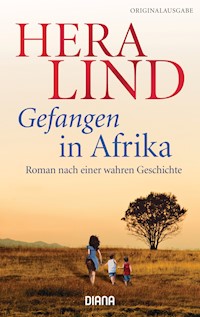11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine starke Mutter. Ein ungewolltes Mutterkreuz. Ein Schicksal in Zeiten des Krieges.
Runau, 1905: Die junge Helene wird gezwungen, den gewalttätigen Großbauern Otto zu heiraten. Ihre Ehe ist vom Patriarchat geprägt. Auch ihre Söhne müssen für den Vater schuften wie Arbeitssklaven. Als Otto im Ersten Weltkrieg fällt, versorgt die sechsfache Mutter den Bauernhof allein. Mit ihrer großen Liebe, dem Grenzsoldaten Ewald, bekommt sie sechs weitere Kinder. Bald aber stellt der erstarkende Nationalsozialismus die Familie vor eine Zerreißprobe. Helene verliert durch Unfälle, den Zweiten Weltkrieg und ein grausames Kriegsverbrechen fünf ihrer zwölf Kinder. Und doch bewahrt sie sich ihr großes Herz, das schließlich auf eine letzte schwere Probe gestellt wird.
Auf mitreißende und zutiefst bewegende Weise erzählt Hera Lind vom Schicksal einer Mutter im Krieg – so wie es wohl unzählige Mütter und Kinder erlebt haben und was viele Familien über Generationen prägte. Zugleich feiert sie mit dieser einzigartigen Familiengeschichte die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
HERA
LIND
Die stille Heldin
Roman nach einer wahren Geschichte
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe 11/2025
Copyright © 2025 by Hera Lind
Copyright © 2025 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Antje Steinhäuser
Umschlaggestaltung: bürosüd, München, unter Verwendung von Arcangel / Mary Wethey,
Krasimira Petrova Shishkova / Trevillion Images, Mark Owen / Trevillion Images und © www.buerosued.de
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-32351-6V002
www.heyne.de
Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch. Es basiert zwar zum Teil auf wahren Begebenheiten und behandelt typisierte Personen, die es so oder so ähnlich gegeben haben könnte. Diese Urbilder wurden jedoch durch künstlerische Gestaltung des Stoffs und dessen Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus dieses Kunstwerks gegenüber den im Text beschriebenen Abbildern so stark verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert ist.
Für alle Leser erkennbar erschöpft sich der Text nicht in einer reportagehaften Schilderung von realen Personen und Ereignissen, sondern besitzt eine zweite Ebene hinter der realistischen Ebene. Es findet ein Spiel der Autorin mit der Verschränkung von Wahrheit und Fiktion statt. Sie lässt bewusst Grenzen verschwimmen.
Achtung: Im Text kommen in Zeitungszitaten, Dialogen und Gedanken Formulierungen und Parolen der Nationalsozialisten vor, die heute als hochgradig diskriminierend gelten bzw. für das unmenschliche nationalsozialistische Regime stehen und nicht mehr verwendet werden. Im Buchtext werden sie jedoch wiedergegeben und weder umschrieben noch vermieden oder nur angedeutet, da es gerade das Anliegen der Autorin ist, durch die ausdrückliche Benennung und Wiedergabe die Zeit und die Zustände im NS-Staat und auch danach darzustellen.
Die ohne Wurzeln wird der Wind davontragen.
unbekannt
Runau, September 1905
»Nebenan sitzt der Großbauer!« Mutter zog mich wispernd zur Seite, als ich mit den zwei Eimern voller abgeernteter Kohlrüben verschwitzt unsere dunkle Kate betrat, und wies mit dem Kopf in die winzige Küche, aus der verhaltenes Gemurmel zu hören war. Die leisere Stimme gehörte meinem Vater, die andere kannte ich nicht. Es roch so fremd, nach Tabak und Pferd und … Macht.
»Der Großbauer?« Überrumpelt stellte ich die beiden schweren Eimer auf die Schwelle und rieb mir die schwieligen Hände. »Was will er denn von Vater? Er wird ihn hoffentlich nicht zum Teufel jagen?« Vater verdingte sich als Tagelöhner bei dem jungen Gutsbesitzer, und wir waren auf seine kargen Einkünfte angewiesen. Obwohl Vater erst fünfzig war, sah er aus wie ein alter Mann, ausgemergelt, abgemagert, grau im Gesicht und weitgehend zahnlos.
»Pscht, du musst dich unbedingt erst waschen!« Mutter zerrte mich an meinen weiten Röcken zum Brunnen auf dem Hof und begann eilig, den Pumpenschwengel zu malträtieren. Ich streifte mir die Blusenärmel hoch und hielt meine vor Schmerz pulsierenden Hände mit den schmutzigen Fingernägeln unter das eiskalte Wasser.
»Aber was habe ich damit zu tun? Vorsicht, Mutter, du spritzt mein Kleid ganz nass!«
Erst jetzt bemerkte ich das rassige schwarze Reitpferd, das leise wiehernd und scharrend an der seitlichen Stallwand angebunden war und erwartungsvoll mit dem Kopf nickte.
»Helene, ich habe ihn deinen Namen sagen hören!« Angstvoll blickte Mutter zu dem winzigen Küchenfenster hinüber, hinter dem »Männergespräche« geführt wurden. »Selbst deine Tante Luise hat die Küche verlassen müssen!«
Tante Luise war Mutters unverheiratete Schwester, die ganz selbstverständlich mit uns dreien in der ärmlichen Bauernkate lebte. Sie ging uns allen schweigend zur Hand, ihr Platz war meistens in der Küche, wo sie Kartoffeln schälte, Bohnen schnippelte, Holunderbeeren zu Marmelade verarbeitete, Brot buk, strickte, nähte, stopfte oder den Boden schrubbte. Noch nie hatte ich Tante Luise in ihren schwarzen langen Kleidern und dem unvermeidlichen Kopftuch untätig gesehen. So wie keinen von uns. Wir waren zum Arbeiten geboren. Nach einem vierzehnstündigen Arbeitstag auf den Feldern des Großbauern gab es abends meistens Wrucken, mal mit Möhren, mal mit Sellerie, in den seltensten Fällen mit einem Stückchen Fleisch. Ich kannte es nicht anders und arbeitete seit meinem Schulabschluss an der Dorfschule seit zwei Jahren feste mit. »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!«, lautete der Spruch, der sich in meinen Kopf eingebrannt hatte.
»So, und nun ordne deine Haare und steck sie zu einem anständigen Dutt zusammen.« Mutter friemelte schon mit ein paar Haarnadeln im Mund an meinem Kopf herum. »Wie siehst du nur aus, Kind.«
»Es war so windig auf dem Feld! Au, das ziept!« Ich versuchte mich aus der Umklammerung meiner Mutter zu winden, aber sie packte mich und raffte mein langes dunkelblondes Haar zu einem strengen Dutt zusammen. Ihr schien es ebenso zu gehen wie mir: In der Gegenwart des Großbauern fühlte ich mich grundsätzlich unwohl. Er hatte die Macht über uns Tagelöhner; wenn er uns keine Arbeit mehr gab, mussten wir verhungern.
»Kind, steh ruhig und hample nicht herum. Ein Otto Öllermann hat nicht alle Zeit der Welt.«
Schließlich spuckte Mutter noch in ein Taschentuch und wischte mir damit über das Kinn. »Hast du etwa von den Holunderbeeren genascht?«
»Wirklich nur ein paar, Mutter. Mir war schon ganz schlecht vor Hunger!« Seit Kurzem hatte ich zudem das, was Mutter und Tante Luise hinter vorgehaltener Hand »Besuch von Tante Rosa« nannten. Das war mit Bauchkrämpfen und äußerst peinlichen Dingen behaftet, die man absolut diskret und beschämt mit sich selbst ausmachte. Erstaunt hatte ich in letzter Zeit festgestellt, dass meine Blusen anfingen zu spannen und der Rockgummi an der Hüfte zwickte. Erst neulich hatte Tante Luise mir wieder den Saum rauslassen müssen, wobei sie mir dann auch die Sache mit den ausrangierten Lumpenfetzen erklärt hatte, die ich jetzt regelmäßig benutzte und diskret unter dem Bett aufbewahrte.
»Hoffentlich hat es keiner gesehen, das mit den Holunderbeeren. Auf Diebstahl von den Feldern des Großbauern stehen harte Strafen.«
Mutter kniff mich beherzt in beide Wangen: »Ein bisschen Farbe steht dir gut zu Gesicht.«
Wieder wieherte und nickte das Pferd, als wollte es seine Zustimmung äußern.
»So, und nun drück das Kreuz durch und geh rein. Sieh ihm nicht in die Augen, halte den Blick gesenkt und rede nur, wenn du gefragt wirst.«
Mutter schob mich liebevoll, aber bestimmt zur Küchentür hinein, nachdem sie leise angeklopft hatte. Sie klopfte an unsere eigene Küchentür!
Aus dem Augenwinkel sah ich Tante Luise mit wehenden Röcken die Holztreppe hinaufhuschen, die Gebetskette in den Händen.
»So. Da ist sie ja endlich.« Otto Öllermann, den wir alle im Dorf nur ebenso respekt- wie angstvoll den »Großbauer« nannten, saß breitbeinig auf der Bank, auf der sonst immer Tante Luise hockte, und nahm den gesamten Raum an der Breitseite des Küchentisches ein. Er war ungefähr dreißig Jahre alt, stämmig und mit vernarbtem Gesicht. Den Korb mit den Näharbeiten hatte er achtlos mit dem Ellbogen beiseitegeschoben, sodass er vom Tisch gekippt war. Vater hatte ihm ein Glas Schnaps eingeschenkt, das bereits leer war. »Wie alt ist sie jetzt?« Er griff erneut nach der Flasche.
Die Frage ging an meinen Vater, nicht etwa an mich.
»Vor Kurzem sechzehn geworden.« Vaters Stimme klang verzagt und kläglich. Sein grauer Schnurrbart zitterte. Er hockte in seinem zerschlissenen Hemd auf dem lehnenlosen Schemel, der sonst immer für mich vorgesehen war. Ich stand schüchtern im Türrahmen, meine grauhaarige Mutter ängstlich hinter mir.
»So, na, dann passt es.« Otto Öllermann ließ seinen Blick über mich schweifen wie über ein Stück Vieh. »Die Rundungen sind schon an der richtigen Stelle.« Mit den Zähnen zog er den Korken aus der Flasche und spuckte ihn auf den Tisch.
Augenblicklich schoss mir die Röte ins Gesicht, und die Peinlichkeit zog wie eine Schlange über meinen Hals hinauf. Ich fühlte meine wund gearbeiteten Finger zittern und wusste nicht, wo ich meine Hände lassen sollte. So versteckte ich sie in den Falten meines langen Rockes unter der Schürze.
»Komm mal näher, Kleine. Bei der Funzel hier drinnen sieht man dich gar nicht richtig.«
Otto Öllermann, feist und rotgesichtig unter kurz geschorenen Borstenhaaren, zog mich mit seiner Pranke eng an sich heran und schnupperte an mir. »Riechen tut sie auch gut.« Er leckte sich über die Lippen und taxierte mich mit gierigen Blicken.
Mein Herz zog sich zusammen, als hätte jemand eine eiserne Schlinge darumgeworfen.
»Sie ist kräftig und gut gebaut, nicht eine von den mageren Hennen, die beim ersten Windhauch umfallen. Ich hab dich beobachtet, Kleine. Du kannst anpacken, kennst dich in der Landwirtschaft aus und bist genau richtig jung, um viele Kinder auf die Welt zu bringen.«
Mein Herz raste und polterte dumpf wie eine Dampfmaschine, meine Brust hob und senkte sich und ich starrte auf den frisch gebohnerten Küchenfußboden, auf dem ich tausend kleine Punkte tanzen sah.
»Sehr schön, alles drum und dran.« Die Pranke von Otto Öllermann glitt von meinem Scheitel über die Schultern bis auf meinen Po, in den er beherzt und kräftig zwickte.
»Dann ist das also abgemacht.« Er schenkte sich das Schnapsglas erneut voll und knallte die Flasche auf den Tisch, mit einem flachen Hieb pappte er den Korken wieder drauf.
Die Panik drückte mir die Kehle zu und ließ das Blut in meinen Adern stocken wie erkaltendes Blei. Mutter, schrie ich stumm, Vater! So helft mir doch! Ihr könnt mich doch nicht …
»Nun ja, Herr Öllermann, wir freuen uns natürlich sehr über die große Ehre, dass Sie ausgerechnet unsere einzige Tochter, ja, sogar unser einziges Kind, als Braut ausgewählt haben …« Mutter räusperte sich tapfer, um ihre Stimmbänder frei zu bekommen und schob sich vollends in die Küche. »Aber sie ist doch wirklich erst vor Kurzem sechzehn geworden. Vielleicht mögen Sie noch etwas warten, wenn’s genehm ist.«
»Es ist nicht genehm!«, polterte der Großbauer und hieb mit der Faust auf den Tisch, dass Flasche und Glas wackelten. »Was fällt euch ein, Tagelöhner? Ihr könnt froh sein, dass ich eurer Tochter so ein Leben biete, an meiner Seite, auf dem Gut, für das ihr arbeiten dürft!« Er zog sich eine Prise Schnupftabak in die Nase und wischte sie brüsk mit dem Handrücken ab. »Wenn ihr mir eure Tochter nicht noch diesen Monat zur Frau gebt, gebe ich euch keine Arbeit mehr! Dann könnt ihr hier in eurer jämmerlichen Mausefalle verrecken!«
Aus dem Augenwinkel nahm ich wahr, dass Tante Luise verschreckt durch den Türspalt lugte. Auch sie traute sich nicht, dem grobschlächtigen Kerl Einhalt zu gebieten. Ununterbrochen glitten die Perlen ihrer Gebetskette leise klappernd durch ihre Finger.
Noch immer schwieg Vater verstört. Schweiß trat auf seine Stirn, seine mageren Hände zitterten, und er starrte auf die Schnapsschlieren auf der Tischplatte.
Ich war doch sein einziger Sonnenschein! Es würde ihm das Herz brechen, mich wegzugeben. Sie lebten doch nur für mich!
»Mann, hör schon auf zu überlegen!« Der Großbauer schüttete den Inhalt des Glases in seinen Schlund. »Es ist nicht so, als ob du eine Wahl hättest! Du weißt so gut wie ich, dass ich dir dein ohnehin schon armseliges Leben noch schwerer machen kann.«
»Ja, Herr.« Vaters Finger verknoteten sich ineinander. Flehentlich blickte er mich an, seine Mundwinkel zitterten.
»Na also. Ja, Herr. Das wollte ich hören.« Öllermann stand auf. »Dann gehe ich jetzt aufs Standesamt und bestelle das Aufgebot. Und ihr sorgt dafür, dass ich eine anständig gekleidete Braut habe, ist das klar?«
Er zog den Rotz hoch, kniff mich besitzergreifend in den Hintern und schob meine Mutter beiseite. »Ich gebe euch Bescheid, wann die Hochzeit ist. Kirche muss natürlich auch sein.«
Drei Wochen später, Oktober 1905
»Komm in die Hufe, Kleine!« Mein frisch angetrauter Ehemann, fast doppelt so alt wie ich, klatschte mir auf den Hintern, dass später alle seine fünf Finger darauf zu sehen sein würden. »Die Gäste haben nichts mehr im Glas!«
Es war mein eigener Hochzeitstag, und Vater hatte mich schweigend und mit Tränen in den Augen zum Traualtar geführt, wo mein Bräutigam Otto stand und mich endgültig aus seiner Obhut gerissen hatte. Mutter stand hinten in der Kirche und weinte. Tante Luise hatte aus der Küchengardine einen Brautschleier für mich genäht, und ich trug mein einziges Sonntagskleid und mein einziges Paar Schuhe, die beide gerade noch so passten. Öllermann hatte seinen Blick stolz über die brechend volle Kirche schweifen lassen, bevor er das Jawort herausblökte, was sämtliche Töchter und Mütter, die darauf spekuliert hatten, vor Ärger und Enttäuschung erröten ließ, und unter seinem fordernden Blick hatte ich mit leiser Stimme ebenfalls »Ja« gesagt. Das war es, was man von mir erwartete. Ich hatte keine andere Wahl. Und jetzt, kaum eine halbe Stunde später, schickte er mich wie eine Dienstmagd in die Küche, um die Gäste zu bedienen.
»Den brauchst du ab sofort nicht mehr!« Unter dem Gelächter seiner Großbauern-Kollegen riss er mir den Schleier ab und warf ihn auf die Erde. »Du bist zum Arbeiten hier, das ist dir ja wohl klar.«
Tapfer biss ich die Zähne zusammen und blinzelte die aufsteigenden Tränen weg. Während ich in der fremden, großen Küche mit Töpfen und Pfannen hantierte, sehnte ich mich mit jeder Faser meines Herzens in die kleine, dunkle Kate meiner Eltern zurück. Auch wenn wir sehr arm waren, so hatte doch immer Liebe, Respekt und Wärme zwischen uns geherrscht. Meine Eltern, Johann und Ottilie, kannten sich seit Kindertagen, waren zusammen zur Schule gegangen und hatten tatsächlich aus Liebe geheiratet. Auch wenn unser aller Leben aus Kargheit, Armut und harter Arbeit bestand, so waren wir doch eine Einheit, teilten Kummer und Sorgen und hielten zusammen. Meine Eltern hatten sich das Schulgeld für mich vom Munde abgespart und mich bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr die Dorfschule besuchen lassen. Sie wollten einmal ein besseres Leben für mich, unser aller Traum war, dass ich Lehrerin werden würde.
Und nun war ich das Eigentum von Otto Öllermann.
»Was ist, wo bleibt der Wein? Hast du denn keine Augen im Kopf?« Er knallte sein leeres Glas auf den Tisch, riss mir wütend die Teller mit dem dampfenden Festtagsbraten aus den Händen und versetzte mir einen Stoß. »Wieso hast du so lange zum Kochen gebraucht, du dummes Trampel? Die Gäste verhungern mir noch!«
Hastig stapfte ich hinunter in den dunklen Keller, tastete mich durch modrige kalte Räume und kniete verstört vor dem Weinregal, wo ich versuchte, die verstaubten Etiketten der Weinflaschen zu lesen, als ich plötzlich von hinten einen harten Schlag auf Schulter und Nacken verspürte. »Na, dir werd ich Beine machen, du faules Luder!«
Mit einer brutalen Bewegung griff Otto Öllermann mir zwischen die Beine, drückte mich mit dem Gesicht gegen das hölzerne Regal, riss meinen Rock hoch und den Strumpfhalter herunter und schob etwas Dickes, Grobes, Schreckliches in mich hinein, dass mir Hören und Sehen verging. In Sekundenschnelle reagierte er sich schwitzend und nach Alkohol stinkend an mir ab, mit groben, brutalen Stößen, die mich immer wieder mit der Brust und dem Kopf gegen das Regal schleuderten, dass es klirrte.
Mit einer Hand hatte er meinen Hals umklammert, mit der anderen hielt er mir den Mund zu. Der Schmerz durchschnitt mir förmlich die Eingeweide. Trotz aller bisherigen Verletzungen, des Tritts einer Kuh gegen meine Stirn, als ich zum ersten Mal versuchte zu melken, blutiger Hände vom Pflügen der eingefrorenen Feldfurchen und fast erfrorener Füße in dünnen Holzpantinen bei der Stall- oder Feldarbeit, noch kein Schmerz hatte mich annähernd so brutal von innen zerrissen wie dieser.
»So, und jetzt scher dich rauf zu den Gästen und serviere ihnen diesen Wein!« Mein Gatte knöpfte sich seinen Hosenlatz wieder zu, brachte sein Hemd und seine Weste wieder in Ordnung und scheuchte mich vor sich her die Treppe hinauf.
Bei lauter Schrammelmusik der Dorfmusikanten und übermütigem Tanz in der großen Diele des Gutshauses war sein grausiger Übergriff gänzlich unbemerkt geblieben. Hastig richtete ich mir das Kleid, befestigte noch im Hinaufstolpern den Hüfthalter am Mieder und schenkte zitternd die Gläser voll, die mir mit übermütigem Gesang und lautem Gelächter entgegengehalten wurden.
Ich blendete mich selbst völlig aus. Automatisch räumte ich leere Teller ab und trug sie in die Küche, und alle zehn Minuten schritt ich mit vollen Weinflaschen die Tische ab und füllte sämtliche Gläser, derer ich habhaft werden konnte. Während Öllermann mit seinen Gästen bis weit nach Mitternacht soff und feierte und sich die eine oder andere Bauernmaid schnappte, um sie im Tanze zu drehen, schrubbte ich die Teller und Töpfe mit kaltem Wasser, rannte mit weiteren belegten Schnittchen und Wurstplatten aus eigener Schlachterei hin und her, bediente den Bierzapfhahn und umrundete die inzwischen stockbetrunkenen Gäste, die mich nicht weiter beachteten. Mutter und Tante Luise hatten mir helfen wollen, aber er hatte sie davongescheucht wie streunende Hündinnen.
Ich träumte von zu Hause, von meiner unbeschwerten Kindheit, die so abrupt geendet hatte. Noch vor Schulbeginn hatte ich als kleines Mädchen jeden Morgen die Hühner gefüttert und die Schweinebox ausgemistet, war dann bei aufgehender Sonne im warmen Morgenlicht in meinen Holzpantinen ins Dorf gelaufen und gehüpft, und nach der Schule hatte ich willig und freundlich Tante Luise im Gemüsegarten geholfen. Wenn es nach den Hausaufgaben noch hell war, hatte ich die Einkäufe im einzigen Kolonialwarengeschäft im Dorf übernommen. Ich sah mich glücklich summend durch Wiesen und Kiefernwälder meiner Heimat streifen, eingebettet zwischen sanften Hügeln und erfrischenden Seen. Die Böden galten als fruchtbar, sodass hier viel Getreide, aber auch Gemüse angebaut wurde. Mithilfe eines Korbes, den Tante Luise aus Weidenzweigen geflochten hatte, sammelte ich alles, was der Wald- und Feldboden hergab, sodass Mutter am Abend etwas Schmackhaftes kochen konnte. Dann saßen wir alle vier zwar eng, aber gemütlich in der dunklen Küche, sangen Lieder, während im Ofen ein Feuer prasselte, und ich kuschelte mich wohlig an meine Eltern.
War das alles erst wenige Wochen her? So brutal war wohl selten ein Mädchen gezwungen worden, erwachsen zu werden.
»Hast du alles aufgeräumt? Die Gäste sind weg.« Öllermann stand plötzlich in der Küchentür, eine Öllampe in der Hand. »Komm in die Schlafstube.«
Wie eine Marionette folgte ich ihm, willenlos, innerlich tot. Er warf sich aufs Bett, riss sich Hemd und Hose auf und streifte die Schuhe von den Füßen. »Lösch die Lampe, zieh dich aus und leg dich zu mir.« Otto Öllermann klopfte neben sich auf das Bett.
Ich tat, was er mir befohlen hatte. Innerlich völlig versteift, in der grässlichen Vorahnung auf erneuten Schmerz biss ich die Zähne zusammen und starrte an die Decke.
»Stell dich nicht so an, du bist jetzt meine Frau!« Öllermann fackelte auch diesmal nicht lange, wälzte sich mit alkoholgeschwängertem, säuerlich riechendem Atem auf mich, packte brutal meine Brüste und saugte sich daran fest. Der Schmerz schoss mir so harsch in die Brustwarzen, dass ich entsetzt nach Luft schnappte. Wieder hielt er mir den Mund zu, drang in mich ein und verschaffte sich gewaltsam sein Recht. Der Schmerz auf der frischen Wunde war unbeschreiblich.
»Selber schuld, wenn du nicht lockerlässt!« Er spuckte auf die vermeintlich zu trockene Stelle, die ihm nicht durchlässig genug war, und rammelte wie ein riesiges Karnickel auf mich ein. Schließlich stöhnte er auf, verdrehte die Augen und wälzte sich von mir herunter.
Keine zwei Sekunden später schnarchte er wie ein Holzfäller, und sein alkoholgeschwängerter Atem streifte mein Gesicht. Die Schlafkemenate roch nach diesem Süßlich-Widerlichen, was ich heute Mittag im Weinkeller schon gerochen hatte, kaltem Rauch und Schweiß. Ich lag da in blanker Panik, und der Gedanke, er könnte dieses Grauenvolle, Scheußliche, jetzt öfter tun, lähmte mir die Sinne.
Runau, Juli 1906
»Na los, Helene, beweg dich! Schwanger sein heißt nicht krank sein! Ich brauche frisches Wasser vom Brunnen für die Pferde!« Mein Mann sprang aus dem Einspänner, mit dem er mal wieder tagelang unterwegs gewesen war, und hielt mir zwei Eimer unter die Nase. »Und bring gleich die Futtersäcke mit, meine Lieblinge haben Hunger!«
Meine Ehe hatte sich eingespielt: Ich arbeitete doppelt so hart wie früher zu Hause. Inzwischen ging ich auf die siebzehn zu. Zu dem Gutshof gehörte der angrenzende Bauerngarten mit verschiedenen Obstbäumen und allerlei Gemüsepflanzen sowie ein Hof mit Stall und Scheune. Anzupacken war ich gewohnt, so hatte ich umgehend begonnen, den viel größeren Haushalt zu führen. Ich kochte, wusch Wäsche, schrubbte auf Knien das Haus, kümmerte mich um den Garten, versorgte die Tiere im Stall und half sogar auf den Feldern.
»Was ist los, wieso eierst du so schwerfällig durch die Gegend? Stell dich nicht so an, sonst kriegst du es mit der Mistgabel, du faules Stück Dreck!« Otto Öllermann packte mich an den Haaren und schleifte mich mitsamt meinen vollen Wassereimern über den Hof. »Hier. Du tränkst jetzt die Pferde und hängst ihnen die Futtersäcke um, ich nehme inzwischen im Haus ein Bad. Ich kann nur für dich hoffen, dass du die Blechwanne bereits mit warmem Wasser gefüllt hast!«
Das hatte ich, zum Glück. Mein Vater, nach wie vor Tagelöhner bei seinem Schwiegersohn, hatte einen Burschen geschickt und die Ankunft unseres gemeinsamen Herrn angekündigt. Er hätte mich grün und blau geschlagen, wäre das Badewasser nicht pünktlich und in der richtigen Temperatur in die Zinkwanne gefüllt gewesen.
Während der tagelangen Abwesenheiten meines Mannes wagte ich es, entgegen seinem ausdrücklichen Verbot, frühmorgens über die Dorfstraße an das andere Ende des Dorfes zu huschen und nach meinen Liebsten zu sehen. Meistens traf ich nur Mutter und Tante Luise an, denn Vater arbeitete bereits seit Morgengrauen auf den Feldern des Großbauern.
Wenn sie mich dann ganz zerschlagen, mit blauem Auge und Schrammen auf dem ganzen Körper, und inzwischen hochschwanger, auf sie zulaufen sahen, kamen Mutter und Tante mir schon entgegen: »Ach du armes Kind, ach, was dauerst du uns, kannst du hereinkommen, ist er auch nicht in der Nähe, ach Gott, was hat er dir wieder angetan …«
Dann verarzteten sie meine Wunden und strichen selbst gemachte Kräutersalben auf geplatzte Augenbrauen, blau geschlagene Rippen oder die deutlich sichtbaren Striemen auf meinem Allerwertesten. »Ach Gott, Kind, was hat ihn denn jetzt wieder derart in Rage gebracht …«
»Mutter, Tante Luise, könnt ihr mir schnell das Kochen beibringen?« Zitternd und wimmernd stand ich vor ihnen.
»Aber du kannst doch kochen, Lenchen!«
»Ja, aber doch nur Eintopf und Wrucken! Er will aber knusprigen Schweinebraten mit Klößen und gebratene Ente mit Rotkohl und gebratene Taube mit Kartoffelpüree! Er sagt, das servieren sie ihm in der Stadt im Freudenhaus, und er will es genau so!«
Mutter und Tante Luise warfen einander bedeutungsvolle Blicke zu. »Tja, Kind … ein so üppiges Fleischgericht haben wir natürlich noch nie zubereitet …«
»Außerdem will er seine Hemden gestärkt und geplättet haben und die Bettwäsche auch!«
So versuchten Mutter und Tante Luise mit all ihren kärglichen Mitteln, mir zu helfen, während Vater immer ein Auge auf den Horizont hatte, und sobald der Öllermann hoch zu Ross und Staub aufwirbelnd am Horizont erschien, schickte er einen Dorfburschen, um mich zu warnen.
So stand ich nun im Gutshof, tränkte die Pferde und wuchtete die Futtersäcke herbei, als plötzlich heftige Rückenschmerzen einsetzten. Otto lag derweil in der Zinkwanne. Mutter hatte mich schon auf die sogenannten »Wehen« vorbereitet und mir erklärt, dass ich dann schnell Hilfe holen sollte.
»Otto, ich glaube mein Kind will auf die Welt …«
»Erst machst du deine Arbeit zu Ende. Los, nimm den Spaten und grabe die Frühkartoffeln aus. Ich will heute ein vernünftiges Abendessen.«
Ich krümmte mich vor Schmerzen, die inzwischen höllisch auf mich eindroschen, hielt immer wieder die Luft an, um nicht loszuschreien, grub aber tapfer weiter in den eingetrockneten Ackerfurchen herum.
Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich mein Vater auf, schob die Kappe in den Nacken und führte mich mit sich fort.
»Papa! Mein Kind kommt!«
»Ich weiß, Liebes. Wir haben dich alle im Blick.« Sanft stützte er mich, an der anderen Seite war plötzlich Mutter, und so brachten meine Eltern mich zu sich nach Hause, wo ich kurz darauf auf einem vorbereiteten Lager aus Stroh mit meinem ersten Sohn niederkam.
Tante Luise half wie immer umsichtig, flink und schweigend. »Da ist er. Ein gesunder kleiner Junge. Das hast du gut gemacht, Lenchen.« Sie legte mir das winzige wimmernde Bündel in die Arme.
»O mein Gott, ist das jetzt mein Kind? Meines ganz allein?«
»Das ist er. Wie soll er denn heißen?«
»Alfred.« Versonnen strich ich auf dem zarten Köpfchen herum und küsste das weiche Wänglein des knarzenden Wesens. »Ottos Vater heißt Alfred, und er hat es so bestimmt. Wäre es ein Mädchen gewesen, hätte es nach seiner Mutter Gertrud geheißen.«
»Natürlich.« Mutter und Tante Luise wechselten einen kurzen Blick. »Alfred ist ein sehr schöner Name. Da wird Otto sicher sehr stolz sein.«
Noch während ich erschöpft auf dem Strohlager mein neugeborenes Baby stillte, hörte ich bedrohliches Hufgetrappel und wusste genau, mein Herr und Gebieter kam wie ein bedrohliches Gewitter näher. »Brrrr!«
Otto zog die Zügel an, und wiehernd und scharrend blieb der glänzende Rappe in unserem kleinen Hof stehen.
»Ist sie hier?« Mit einem massigen Rutsch glitt er vom Kutschbock.
»Ja, Otto, sie hat gerade euren ersten Sohn geboren!« Mutter eilte ihm entgegen, sich die Hände an einem Tuch abwischend. »Lass dir von Herzen zu eurem Stammhalter gratulieren!« Währenddessen stand Vater schon mit einem Schnaps bereit. »Prost, Otto. Ihr habt uns soeben zu glücklichen Großeltern gemacht.«
»Sie hat gefälligst sofort nach Hause zu kommen!« Otto polterte auf groben Stiefeln herein, das Gesicht noch rot vom heißen Bad in der Zinkwanne, auf seinem Hals schlängelte sich ein blutiger Schnitt. Er hatte sich vor lauter Wut über meine Abwesenheit beim Rasieren geschnitten. »Das nächste Kind kriegt sie bei uns zu Hause!« Er riss mir den Knaben von der Brust und schaute ihn kaum an: »Das reißt mir hier gar nicht erst ein, dass du wegen jeder Geburt zu deinen Eltern läufst!«
Er warf das fest eingewickelte Bündel Menschlein in den Einspänner und riss mich vom Strohlager hoch: »Du hast noch zu tun, Madame!« Und als ich taumelnd vor Schmerz und Schwindel nicht sofort in das holprige Gefährt stieg, sondern mich noch einmal nach meinen Eltern und der Tante umdrehte, knallte er mir eine Ohrfeige ins Gesicht, dass mir Hören und Sehen verging: »Dir werd ich Beine machen!«
Schon gleich am nächsten Abend verlangte Otto Öllermann wieder, dass ich ihm zu Willen war, und beklommen stellte ich im Frühjahr 1907 fest, dass ich wieder schwanger war.
Ich gab mir alle Mühe, den Haushalt zu führen, Hofarbeiten zu erledigen, Alfred zu stillen, Windeln zu waschen und Ottos achtlos auf den Boden geworfene Kleidung zu reinigen, auszubürsten und seine Hemden zu bügeln und natürlich seine Leibgerichte zu kochen, ihn zu bedienen und den richtigen Wein zu servieren, bevor er wieder »ins Freudenhaus« in die Stadt fuhr – eine willkommene Abwechslung von Schlägen, Demütigungen und täglichen Vergewaltigungen, denn auch wenn es damals als »eheliches Recht« galt, so war es doch nichts anderes.
Anfang 1908 wurde mein zweiter Sohn geboren; diesmal auf Befehl im eigenen ehelichen Bett und mithilfe der Dorfhebamme. »Er heißt Paul«, befahl Otto, nachdem diese ihm seinen zweiten Sohn in die Arme gelegt hatte. »Und ihr macht das hier wieder sauber, bevor ich zurück bin!«
Exakt zwei Jahre später kam unser dritter Sohn, Bruno, auf die Welt. Ich war inzwischen zwanzig Jahre alt und hatte mich an mein sogenanntes eheliches Dasein gewöhnt.
Während ich die zwei Kleinen am Rockzipfel und Baby Bruno an der Brust hatte, versuchte ich weiterhin, Ottos Bedürfnisse zu befriedigen und bemühte mich um Haushalt, Wäsche, Hof und Feld. An einem bitterkalten Wintertag schürte ich gerade das Feuer in der Küche, als der junge Bursche schüchtern eintrat, den Vater immer schickte.
»Hallo, Hannes, nett, dass du vorbeischaust, magst du eine heiße Milch trinken?« Ich wuchtete die zwei Kleinen auf die Holzbank und legte Bruno in seine Wiege. »Du siehst ja ganz verfroren aus. Hier, halt mal den Schürhaken, dann koche ich dir schnell eine.«
Doch Hannes starrte mich noch bleich und zitternd an. Eisbröckchen hingen ihm in den Augenbrauen und in der Mütze.
»Setz dich doch, Kleiner. Was hast du denn? Hat Vater dich geschickt? Am besten, du nimmst gleich noch einen Becher heiße Milch für ihn mit zurück aufs Feld.« Unsicher sah ich mich um. »Der Herr ist doch noch nicht aus der Stadt zurück?!« Es war mir streng verboten, meine Eltern »mit durchzufüttern«, die »hatten gefälligst zu arbeiten, wenn sie was fressen wollten«.
»Dein Vater ist tot zusammengebrochen«, stammelte Hannes verstört, und dann fing er an zu weinen, dass ihm der Rotz aus der Nase lief.
»Pass auf die Kinder auf, und geh vom Feuer weg!« Ich riss meinen Wetterumhang vom Haken und rannte auf meinen Holzpantinen hinaus in den eisigen grauen Tag. Der Wind pfiff über das vereiste Feld, Krähen schrien unheilvoll und flatterten in den kahlen Bäumen herum, am Horizont sah ich die Tagelöhner mit Äxten und Spaten Eis aufhacken. Und da lag ein grauer, schon fast zugeschneiter Leichnam am Wegesrand. Sie hatten einfach eine Pferdedecke über ihn geworfen und weitergearbeitet.
»Vater!« Verzweifelt warf ich mich auf meinen geliebten Vater, dessen graues Gesicht spitz und leblos auf die Ackerfurchen starrte. »Was ist passiert?«, schrie ich die Arbeiter an.
»Er ist einfach umgefallen und war tot.« Das scherte hier keinen, das passierte einfach so. Vor Erschöpfung, Hunger und Kälte brachen die Tagelöhner regelmäßig unter der Last ihrer schweren Arbeit zusammen und hauchten ihr Leben aus.
»O Gott, da kommt Mutter, bitte erspart ihr diesen Anblick!« Ich rannte meiner armen Mutter entgegen, wohl ahnend, dass Hannes nicht bei meinen drei Jungs geblieben war, sondern die Kunde bereits im Dorf herumposaunt hatte.
Mutter schrie wild und laut wie die Krähen, die über unseren Köpfen flogen. Verzweifelt hielten wir uns aneinander fest. »Ich muss zu den Kindern …«
»Tante Luise ist bei ihnen – oh Gott, Kind, was soll denn jetzt werden?« Laut jammernd klammerte sich meine kleine, ausgemergelte Mutter an mir fest. »Vater hat doch noch wenigstens ein bisschen was Essbares, eine Rinde Brot, eine Rübe oder ein Stück Brennholz am Abend mit heimgebracht! Jetzt will ich auch nicht mehr leben!«
»O bitte, Mutter, du musst dich zusammenreißen!« Ich versuchte sie aufzurichten und zu stützen, und noch während das arme Häuflein Vater, das schon ganz zugeschneit war, mit vereinten Kräften auf einen Ochsenkarren gehievt wurde und in Richtung Friedhof von dannen rumpelte, schrie Mutter mit zum Himmel gereckter Faust: »Es gibt keinen Gott! Erst nimmt er mir meine einzige Tochter, und jetzt noch meinen Mann!«
»Mutter! Versündige dich nicht!«
»Lieber will ich in der Hölle schmoren wegen Gotteslästerung, als dieses jämmerliche Leben weiterleben!«
Und so wurde im Jahr 1910 nicht nur mein Vater, sondern auch kurz darauf meine Mutter auf dem Dorffriedhof von Runau begraben.
Doch das Leben ging weiter. Im Februar 1912 kam unser vierter Sohn, Erich, auf die Welt, und fast genau auf den Tag zwei Jahre später unser fünfter Sohn, Ernst.
Mit so vielen Kindern hatte ich alle Hände voll zu tun, denn kaum war eines aus den Windeln, kündigte sich schon der nächste Nachwuchs an. Immer wenn Otto Öllermann auf Reisen war, schlich ich mich heimlich zu Tante Luise, die nun ganz alleine in unserer Kate hauste, und brachte ihr, was ich auf die Schnelle erübrigen konnte: Brot, Butter und Milch, und zur Schlachtzeit auch mal einen Zipfel Wurst, eine Speckschwarte oder ein Stückchen Fleisch.
Bekam Otto davon Wind, hagelte es für mich Schläge. Als Alfred und Paul etwas größer waren, schmuggelte ich ihnen die notwendigen Lebensmittel für ihre Großtante Luise in den Saum ihrer Spielhöschen, die ich selber genäht hatte, und schickte sie ans andere Ende des Dorfes. Schon der siebenjährige Alfred und der sechsjährige Paul begriffen ganz genau, dass es um Leben und Tod ging, und hielten sich mit feinen Instinkten an die Schweigeregel.
Ihr Vater beachtete die Kinder nicht weiter, außer, um sie zu maßregeln, anzubrüllen und zu schlagen, wenn sie nicht auf der Stelle zu Diensten waren, etwa, um ihm die Stiefel auszuziehen, sie mit Spucke auf Hochglanz zu wichsen, ihm ein Bier zu bringen, das Essen zu servieren oder im Stall mitzuarbeiten. Morgens um fünf wurden sie »rausgehauen«, wie Otto sich auszudrücken pflegte, und hatten ihm beim Melken zur Hand zu gehen, die schweren Milcheimer zu schleppen, den Kuhmist wegzuschaufeln, die Pferde zu striegeln und den Karren für seine Ausfahrten zu säubern.
Otto zog sich mit jedem Sohn, den ich ihm gebar, weitere willige Arbeitssklaven heran. Im Dorf gab er damit an, dass er »nur Söhne konnte, aber dafür richtig«!
Die Kinder wagten nicht aufzumucken oder gar zu weinen, denn wenn eine Träne floss, brüllte Otto: »Ein Preußenjunge weint nicht!« und prügelte die Jungen windelweich. Schon bald hatten sie gelernt, sich in seiner Anwesenheit möglichst unsichtbar zu machen.
Und doch stellte ich mich mit dem Mut einer Löwin vor ihn, als Alfred sieben und Paul sechs Jahre alt waren: »Ich möchte, dass unsere Kinder zur Schule gehen.«
»Papperlapapp, für so einen Unsinn habe ich kein Geld! Außerdem bringt das Leben den Kindern bei, was sie wissen müssen! Und das ist Disziplin, Gehorsam und Fleiß!« Er ließ seine Peitsche knallen, die wir oft genug am eigenen Leib zu spüren bekamen. Wir luden gerade seinen Karren ab und verstauten die Arbeitsgeräte und leeren Kisten im Schuppen.
»Otto, schau, ich mache dir doch seit Jahren die Buchhaltung.«
»Na und?« Böse stierte er mich an.
»Das kann ich nur, weil meine Eltern mich in die Schule geschickt haben!«
Immer wenn Markttag war, fuhr Otto mit unseren landwirtschaftlichen Erzeugnissen in die Stadt zum Markt, und wenn er abends mehrere Kühe, Schweine oder zentnerweise Getreide verkauft hatte, war ich es, die die Rechnungen ausstellte, das Geld zählte und die Steuern ausrechnete. Er pflegte nach solch erfolgreichen Tagen mit seinesgleichen in der Dorfkneipe oder im »Freudenhaus« zu verschwinden. Inzwischen war ich regelrecht dankbar dafür, denn dann konnte ich trotz meiner fünf Jungs mit einem friedlichen Abend rechnen.
»Was soll das, Weib, willst du mich provozieren?« Otto knallte eine schwere Kiste direkt vor meine Füße, sodass ich erschrocken zurücksprang.
»Nein, Otto, ich möchte nur darauf hinweisen, wie nützlich es sein kann, wenn jemand lesen, rechnen und schreiben kann. Und deine Söhne sind klug. Das haben sie von dir geerbt.« Im Stillen sandte ich einen dankbaren Gruß an meine Eltern, die mir auf wundersame Weise immer noch beistanden. Meine innere Gelassenheit und weibliche Taktik konnten nur von ihnen aus dem Himmel gesendet worden sein. Einmal mehr stellte ich fest, welch glückliche Kindheit ich trotz aller Armut und Entbehrungen hatte erleben dürfen, und mir wurde bewusst, wie liebevoll und respektvoll meine Eltern und die Tante mit mir als Kind umgegangen waren.
»Und ich soll auch noch die Schulbücher und Stifte bezahlen?« Ärgerlich schob Otto sich die Mütze in den Nacken und spuckte auf den Boden. »Oder wie hast du dir das gedacht?«
»Ich könnte sie gebraucht erwerben. Oder wir tauschen einfach Kartoffeln und Zuckerrüben dagegen ein. Du weißt doch, die Städter hungern, und ihre Bücher und Stifte können sie nicht essen.«
Dies konnte ich als kleinen Teilsieg für mich und die Jungs verbuchen, denn schließlich genehmigte Otto großzügig, dass Alfred und Paul zur Schule gehen durften.
Otto war mit viel weltbewegenderen Dingen beschäftigt: Das Attentat auf den österreichisch- ungarischen Thronfolger 1914 in Sarajevo hatte die Welt in eine neue Zeitrechnung gestürzt. Es folgte daraufhin die Zuspitzung der Konflikte zwischen fünf europäischen Großmächten sowie Serbien, denn untereinander standen die Länder vertraglich in der Verpflichtung, sich zu unterstützen. Keine der Mächte wollte auf eine frühe Mobilmachung verzichten, dadurch eskalierte die Situation. Österreich erklärte Serbien den Krieg, Russland aber verbündete sich mit Serbien und machte mobil. Am 1. August 1914 erklärte Deutschland Russland den Krieg. Deutschland befand sich in einem regelrechten Kriegstaumel und fühlte sich unschlagbar, genau wie Otto, geblendet von eigener Machtüberschätzung, Aggression und narzisstischem Größenwahn.
»Ihr Kinder haltet jetzt den Mund und hört mir zu! Ich werde eurer Mutter die Weltlage erklären.« Otto saß an der Breitseite des Tisches, während die vier Jungs sich auf der Holzbank zusammendrückten und der kleine Ernst mit großen staunenden Augen daneben in der Wiege lag, und schaufelte mit aufgestützten Ellbogen Fleischbrocken in sich hinein. Er hielt die Gabel wie eine Mistforke in der Faust und verschlang seine Riesenportion, ohne auf die Jungen zu achten, die wie Spatzen auf der Bank hockten und auf einen Brocken vom väterlichen Teller hofften.
»Das deutsche Heer zählt zur stärksten Armee der Welt!« Er rülpste, spülte seinen letzten Bissen mit Bier herunter und knallte Alfred auffordernd den leeren Krug hin. Ohne dass es eines Wortes bedurft hätte, huschte der Achtjährige mit dem Krug in den Keller und füllte ihn bis zum Rand wieder auf. Als ein bisschen Schaum überlief, fing er sich direkt eine Kopfnuss ein.
»Hervorgegangen als Sieger, und das verdammt schnell, des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 vergrößerte Deutschland seitdem seine Armee, und jetzt sind wir die Größten! Na? Lernt ihr das in der Schule?«
»Noch nicht, Vater.«
»Da seht ihr, dass ihr zu nichts nütze seid! Starr nicht so futterneidisch auf meinen Teller, du Pimpf! Du hast deinen Grützefraß gehabt, mehr gibt es erst wieder, wenn du morgen früh gearbeitet hast!« Schon hatte auch Paul einen Nackenschlag eingeheimst. »Das ist es, was ihr zu lernen habt: Wer nicht arbeitet, kriegt auch nix zu fressen!«
»Otto. Du wolltest mir doch die politische Weltlage erklären.« Inzwischen war ich fast fünfundzwanzig Jahre alt und hatte eines gelernt, mit weiblicher Intuition das Ego meines Mannes zu stärken. Dann ließ er sich wie ein zorniger Bulle von seinen Aggressionen ablenken und spiegelte sich im roten Tuch seiner unbefriedigten Eitelkeit.
Mit gebeugten Rücken saßen meine vier kleinen Kerlchen auf der Holzbank und zogen die Köpfe ein, während Ernst in seinen Windeln erschrocken an die Decke starrte.
»Ich, Otto Öllermann, habe natürlich meinen Militärdienst abgeleistet und wurde vor Jahren in die Reserve versetzt.« Otto hob seinen Krug und soff ihn in einem Zuge aus. »Im Zuge der Mobilmachung hat man mich aber nun mit als Ersten für Kaiser und Vaterland verpflichtet, in den Krieg zu ziehen.«
Täuschte ich mich, oder richteten sich unsere Kleinen unauffällig ein wenig auf?
»Ach«, entfuhr es mir beeindruckt. »Da bin ich aber stolz auf dich. Nicht wahr, Jungs?«
»Ja, Vater.«
»Das könnt ihr auch!« Otto schob den Teller von sich und lehnte sich selbstgefällig auf seiner Bank zurück. »Der Krieg wird schnell vorbei sein, der wird höchstens ein paar Monate dauern. Wir Deutschen sind unschlagbar, und ein Otto Öllermann allemal.«
»Ja, Vater.«
»Ich fühle mich geehrt, meinem Vaterland treu und ergeben zu dienen.«
»Aber Otto, bei allem Stolz und aller Vaterlandstreue, wie soll ich ohne dich Haus und Hof überblicken, die Ein- und Verkäufe tätigen, die Buchhaltung und Bestellungen verwalten …?«
»Ich denke, du warst in der Schule?!« Otto warf mir einen spöttischen Blick zu. »Dann beweise mal, was du kannst. Oder bin ich etwa unentbehrlich? Was, Jungs?«
»Nein, Vater.«
»Was hast du gesagt? Wie wagst du es, mit deinem Vater zu sprechen?!«
»Nein, Otto.« Ich warf den Jungs beschwörende Blicke zu. »Wir werden alle ganz doll zusammenhalten, und die Jungs werden helfen, wo sie nur können, und ich denke, für die kurze Zeit, die der Krieg dauern wird, werden wir es schaffen.«
»Was?!«, blökte Otto und schlug Alfred, der wegen der Orgelpfeifen-Ordnung leider das Los gezogen hatte, neben ihm zu sitzen, während die Kleinen sich in meine Nähe drängten, heftig auf die schmale Schulter. »Ist das ein Wort? Hä? Ein Mann ein Wort?«
»Ja, Vater.«
»Dann will ich mich auf euch verlassen. Und wehe, mir kommen Klagen zu Ohren. Dann sollt ihr mich erst richtig kennenlernen.«
Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.
Als Otto einige Tage später in den Zug stieg, stand ich mit den drei Kleinen am Bahnsteig und winkte. Die beiden Großen waren in der Schule. Keines der Kinder hatte er mehr eines Blickes gewürdigt, geschweige denn, sie zum Abschied in den Arm genommen.
Andere Väter gingen vor ihren Kindern in die Knie, wischten sich und ihnen die Tränen ab, nahmen sie in den Arm und trösteten sie. Wir standen hingegen wie versteinert. Vor den Augen der anderen Soldatenfrauen mimte ich die liebende Ehefrau und winkte mit meinem Taschentuch, bis der Zug schnaufend am Horizont verschwunden war.
Dann nahm ich die Kinder rechts und links an die Hand, und aus dem hastigen Nachhauseweg wurde ein unbeschwertes Hüpfen.
Runau, Ende August 1914
»Bruno und Erich, spielt ihr auch schön einvernehmlich?« Es war kurz vor sieben am frühen Morgen, aber unser bäuerliches Leben pulsierte schon seit Stunden. Die Sonne wärmte bereits und tauchte Haus und Hof in sattes, goldenes Licht. Ich hatte die Kühe gemolken, Frühstück gemacht, die Kleinen angezogen und gefüttert, das Baby gestillt und frische Windeln angelegt.
»Ja, Mutti.« Der Vierjährige baute artig Sandkuchen im erst kürzlich angelegten Sandkasten, die der Zweijährige mit seinen Patschhändchen begeistert wieder zusammenhaute.
»Und weint und streitet ihr auch nicht?« Ich stützte die Hände in die Hüften. »Der Tag ist noch lang!«
»Nein, Mutti. Ganz bestimmt nicht.« Demonstrativ streichelte Bruno Erich über sein Blondhaar und reichte ihm großzügig sein kleines Holzauto. »Wir sind ganz lieb.«
»Dann kann ich jetzt Wäsche waschen.« Mit einem Blick auf den sechs Monate alten Ernst, der im Schatten der Kastanie in seinem Kinderwagen schlief, schleppte ich Trog und Waschbrett aus dem Schuppen zum alten Ziehbrunnen im Hof. Alfred und Paul, meine knapp acht- und sechsjährigen Söhne, sah ich gerade noch im Stall verschwinden, bevor sie zur Schule loslaufen würden. Wie von Geisterhand arbeiteten und schufteten sie, ohne dass ich sie je um einen Handgriff bitten musste, in der unbewussten Hoffnung, dass unser Friede auf diese Weise so schnell nicht wieder gestört werden würde.
Mit einem kritischen Blick auf den strahlend blauen Himmel begann ich, den Pumpenschwengel zu bedienen und Wasser aus dem Brunnen in den Trog zu geben.
»Das Wetter hält, der Wind bläst genau richtig, das Leben kann so schön sein …«
»Wiedersehen, Mutti, wir haben den Stall ausgemistet, wir gehen jetzt zur Schule.« Alfred und Paul tauchten aus der Stalltür auf, stellten ordentlich die Eimer und Forken an die Wand, zogen Holzpantinen an und wuschen sich die Hände am Brunnenwasser.
»Freut ihr euch?« Ich wischte Paul noch einmal über das Gesicht und fuhr Alfred durch die borstigen Haare.
»Ja! Danke, Mutti, dass wir gehen dürfen.«
»Ich hab euch lieb, ihr zwei.« Ich steckte ihnen noch ihr Butterbrot und je einen Apfel zu.
»Wir dich auch! Bis später!« Beide schulterten ihren Ranzen, der kurz darauf munter auf ihren Rücken hüpfte, das Schwämmchen für die Schiefertafel hüpfte fröhlich mit.
Zufrieden machte ich mich daran, die Wäsche meiner fünf kleinen Bengels über dem Waschbrett zu schrubben, und ertappte mich dabei, wie ich zufrieden von mich hin summte.
»Zum Tanze, da geht ein Mädel mit güldenem Wams …«
Dabei war ich im Leben noch nicht tanzen gewesen. Wenn im Dorf ein Fest war, ging Otto immer alleine hin und tanzte mit anderen, nie mit mir. »Heißa Kathreinerle, schnür dir die Schuh …« Vielleicht war seine Abwesenheit der Grund, warum ich mich trotz der vielen Arbeit so unglaublich wohl in meiner Haut fühlte. Singend und kleine Tanzschritte vollführend ging ich der grob verdreckten Wäsche an den Kragen, schrubbte und rubbelte, wrang und drückte, dass meine Hände schon ganz rot und schwielig waren, und nachdem ich Bruno und Erich zwischendurch mit Grießbrei gefüttert und sie zum Mittagsschlaf hingelegt hatte, begann ich, die Wäschestücke über die Leine zu werfen und mit hölzernen Wäscheklammern zu befestigen. Immerhin waren keine Otto-Unterhosen und Otto-Hemden mehr dabei, und ich fühlte mich erleichtert und beschwingt. Schließlich wehten alle meine Jungs in Form ihrer mir so vertrauten Hemden und Hosen im Wind, und ich setzte mich auf die Bank unter der Kastanie und stillte Ernst, der schon seit einer Weile vor sich hin gejammert hatte.
»Ja, Kleiner, ich bin schon da. Du musst ja schon halb verhungert sein …« Zärtlich legte ich das Baby an die Brust, und sofort klammerte sich der Kleine mit seinen Fäustchen gierig an mich und zappelte vor Gier und Hunger mit den Beinchen. »Ruhig, nur ruhig, das ist jetzt unsere Viertelstunde, nur du und ich …« Leise begann ich wieder zu summen. Die Bienen umsummten uns, der Haushund Hasso trottete durch die Hitze und legte sich hechelnd mir zu Füßen, und eine Amsel flog zeternd auf. Sonst umgab uns nichts als friedliche Stille.
»Was meinst du, Kleiner? Solange dein Papa im Krieg ist, könnte ich vielleicht Tante Luise zu uns holen? Au, nicht so fest. Ja, du kriegst noch die zweite, so gedulde dich doch …« Mit routinierten Griffen legte ich den Kleinen an die zweite Brust, wo er sich sofort wieder gierig ins Zeug legte. »Wie die Kälbchen und die kleinen Ferkel im Stall«, lächelte ich auf ihn herunter. »Dabei musst du dich doch gar nicht mit einem Dutzend Konkurrenten um die Zitze streiten …«
Hasso begann plötzlich zu knurren, erhob sich und trabte bellend und schwanzwedelnd dem Postboten entgegen, der sich am Hoftor zu schaffen machte. Er kramte in seiner schwarzen Umhängetasche und winkte mit einem Schriftstück.
»Gustav! Warte, ich komme!« Ich runzelte die Stirn, legte den protestierenden Ernst in seinen Kinderwagen zurück, knöpfte mir die Bluse zu und eilte dem alten Postboten entgegen.
»Heiß heute, was Gustav? Magst du ein Glas Wasser?«
»Nee, lass man, Helene. Hab leider keine guten Nachrichten, fürchte ich.« Er tippte zum Gruß an die Mütze.
»Aber Gustav, nun mach doch nicht so ’n Gesicht! Ist doch ein viel zu schöner Tag heute!«
»Telegramm, Helene. Du musst hier unterschreiben.« Schwitzend schob der alte Mann sich die Mütze aus der Stirn und kramte einen Bleistiftstummel hervor. »Amtliches Poststück.«
»Ja, mach dir mal keinen Kopp, Gustav.« Ich kritzelte meine Unterschrift hin und nahm das verschlossene Telegramm entgegen. »Wirklich kein Wasser, Gustav?«
»Nee. Lass man, Helene. Und wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen.«
Er schlurfte davon. Ich packte Hasso am Halsband und zog ihn wieder herein. Die Wäsche flatterte munter im Wind und jeder einzelne Hemdsärmel der Jungs schien mir freudig zu winken.
Ernst brüllte beleidigt im Kinderwagen, dass er wackelte. »Ja, ist ja gut, die Mutti ist schon wieder zur Stelle …« Lächelnd legte ich das Telegramm auf die Bank und mein Söhnchen wieder an die Brust.
Ich wusste ja, was drinstand. »Otto Öllermann starb den Heldentod für Kaiser und Vaterland, während des Angriffs auf Frankreich tödlich verwundet …«
Gedankenverloren saß ich in inniger Umarmung mit meinem Jüngsten auf der Bank und fühlte plötzlich ein nie gekanntes Glücksgefühl. Ich war fünfundzwanzig, hatte fünf Söhne und war Witwe. Und ich war endlich frei.
Als Erstes holte ich Tante Luise auf den Hof. Die treue liebe Seele verkaufte das Häuschen meiner Eltern, und da Otto Öllermann kein Testament hinterlassen hatte, war ich automatisch die Alleinerbin des Gutshofes samt den Ländereien geworden und es ging uns, trotz des andauernden Krieges, im Vergleich zu anderen Menschen einigermaßen gut. Nicht, dass die Arbeit leichter wurde, aber durch Luises liebevolle, fürsorgliche Anwesenheit konnte ich hin und wieder verschnaufen.
Zu gern verließ ich ab und zu den Hof, um durch die angrenzenden Wälder zu streifen. Dabei sammelte ich Wildkräuter, die ich später in der Küche zum Trocknen aufhängte, um sie bei Gelegenheit als Würze unseres spärlichen Essens zu nutzen und sie mit in die Wurst zu geben, die ich an Schlachttagen herstellte. Oft kam ich mit einem Strauß wilder Blumen – Lupinen, Flieder, Maiglöckchen oder Butterblumen zurück, um unsere Wohnstube damit zu verschönern. Daraus schöpfte ich Kraft, die ich brauchte! Um die fünf Jungs zu erziehen, das Haus sauber zu halten, den Hof zu führen, den Garten zu pflegen, mich um die Tiere zu kümmern und die Felder zu bestellen. Oft sattelte ich mir Otto Öllermanns schwarzglänzendes Reitpferd und ritt hinaus, um die dortige Arbeit zu kontrollieren. Wie schon zu seinen Lebzeiten, stellte ich für die Feldarbeit Tagelöhner ein, die Tante Luise und ich abwechselnd mit Essen und Trinken versorgten. Nach getaner Arbeit schliefen die Männer in der Scheune, und jeden Abend ritt ich hinüber und zahlte sie nach Heller und Pfennig aus.
Säuberlich schrieb ich, wenn die Kinder im Bett waren, abends am Küchentisch die Buchhaltung über jede Aus- und Einnahme. Waren die Jungs am nächsten Morgen in der Schule und die Kleinen in der Obhut von Tante Luise, stieg ich auf den Pferdewagen und übernahm den Großverkauf der Kartoffeln, der Rüben und des Getreides auf dem Markt im nächsten größeren Ort. Je nach Saison bot ich Möhren, Sellerie, Kohlrabi, Bohnen oder Kohl feil, alles, was mein Bauerngarten hergab. Auch eingekochte Marmelade oder Tomatensoßen, frische Eier und Butter, ja, sogar selbst gebackenes Brot verkaufte ich mit großem Erfolg. Durch den Krieg herrschte in den Städten enormer Hunger. Schon seit Juni 1915 gab es Brot nur noch auf Lebensmittelkarten. Seit der Seeblockade der Briten kamen kaum noch Lebensmittel ins Hinterland. Wenn ich mit meiner Ware frühmorgens auf dem Markt eintraf, war mein Pferdewagen schnell von einer hungrigen Menschentraube umringt.
»Brauchen Sie Hilfe?« Ein junger, kräftiger Mann, groß, rötlich blond und mit leuchtend blauen Augen, stand plötzlich wie aus dem Nichts vor meinem Pferd, das Sekunden zuvor unwillig zu tänzeln begonnen hatte, und fasste es am Halfter. »Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig.«
Ich blieb abrupt stehen, und er lächelte beiläufig. Am Himmel dahinter glühte ein rosiger Sonnenuntergang. Ich stand vor einem niedrigen Gebäude aus Stein mit einer hölzernen, von der Zeit geschwärzten Stalltür. Die Farbe war größtenteils abgeblättert und darunter zeigte sich das graue, alternde Holz. Die Torflügel hingen ein wenig schief in den Angeln und versanken zur Mitte hin im hohen Gras.
»Was meinen Sie?« Ich hatte gerade die letzten Gemüsereste verkauft und verstaute die leeren Kisten wieder auf meiner Ladefläche.
»Nun, ich beobachte Sie schon eine ganze Weile und kann keine männliche Unterstützung entdecken.« Er strich dem wiehernden Gaul beruhigend über die Nüstern.
»Ich komm alleine zurecht, danke.« Energisch wuchtete ich mich mit meinen langen Röcken auf den Kutschbock und ergriff die Peitsche. »Hü, auf geht’s, nach Hause.«
Das Pferd scheute noch immer, der Karren geriet ins Schwanken. Und ehe ich michs versehen hatte, war der Fremde aufgestiegen und griff mir in die Zügel:
»Hohoooo, ruhig Blut, Brauner.« Und obwohl ich mich ärgerte, war ich auch erleichtert, dass dieser Mann buchstäblich an meiner Seite war. Unauffällig musterte ich ihn mit einem ruhigen, abschätzenden Blick. Er sah gut aus. Stark. Jung. Kräftig.
Als könne es kein Wässerchen trüben, trabte das Pferd kurz darauf in die richtige Richtung.
»Sie können jetzt wieder absteigen.« Freundlich, aber bestimmt schaute ich den jungen Mann an. »Ich komme allein zurecht.« Abgesehen von dem Geräusch des Windes, herrschte plötzlich eine merkwürdige Stille zwischen uns. Wir standen vor einem hohen Stapel mit Heuballen und uraltem, verrostetem landwirtschaftlichen Gerät. Insgeheim sehnte ich mich nach männlicher Hilfe, wollte es aber keinesfalls zugeben.
»Dabei wollte ich Sie fragen, ob Sie Arbeit für mich haben.« Er lächelte mich von der Seite an. »Ich bin auf der Durchreise vom Kriegseinsatz und habe weder einen Kanten Brot noch ein Dach über dem Kopf.«
»Sie können als Tagelöhner bei mir arbeiten, wie alle anderen auch.« Mit einem kühlen Seitenblick ließ ich ihn spüren, dass ich hier die Arbeitgeberin war. »Ich lasse Sie an der Scheune raus, am Brunnen können Sie sich waschen.«
Was der junge Mann kurz darauf auch tat. Mit einem Seitenblick auf mich, die ich gerade Wäsche aufhängte, entledigte er sich seiner abgewetzten Kleidung und seifte sich pfeifend den muskulösen Oberkörper ein.
»Lenchen, Lenchen, wo schaust du bloß hin?« Tante Luise bückte sich nach der nassen Wäsche, um mir die Teile einzeln anzureichen. »Da hast du aber mal einen feschen Kerl aufgegabelt.«
»Ach was.« Ärgerlich strich ich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht, die sich im Eifer des Gefechts aus meinem Dutt gelöst hatte. »Der hat mir nur heute mit dem Gaul geholfen, als der scheute – reich mir mal die Socken. Die Roggenernte steht an. Und der hier sieht mir kräftig aus.«
»Weißt du, wie der heißt?« Tante Luise schaute unauffällig zwischen den Hemden der Jungs hindurch. »Und wie lange der bleibt?«
»Keine Ahnung«, murmelte ich so teilnahmslos wie möglich, die nächste Wäscheklammer zwischen die Zähne geklemmt. »Wenn der sich geschickt anstellt, kann er meinetwegen den Sommer über bleiben.«
Was er auch tat, der fesche Hans. Er erwies sich als ausgesprochen hilfsbereit, freundlich und zuvorkommend. Zugegeben, das hatte ich bei einem Mann noch nicht erlebt. Während die drei Kleinen zu Hause bei Tante Luise gut behütet auf dem Hof spielten, schlugen wir zu viert im Takt mit dem Dreschflegel; Alfred und Paul, meine beiden Großen auf der einen Seite, Hans und ich auf der anderen. Der Schweiß floss dabei in Strömen.
»Zum Glück hält das Wetter, das scheint eine gute Ernte zu werden!« Hans ließ seine Muskeln spielen. »Habt ihr Lust, etwas zu singen? Dann geht es schneller von der Hand!«
»Ja, was kannst du für Lieder?« Die beiden Jungs schienen die schwere Arbeit weniger als Last, denn als unterhaltsame Abwechslung von der Schule zu empfinden. Denn auch dort herrschte natürlich Zucht und Ordnung, der Lehrer schlug sie unbarmherzig auf die Finger, wenn sie etwas nicht auf Anhieb aufsagen oder ausrechnen konnten, das war damals ganz normal. Und so ein lustiger Geselle wie der Hans, der stets zu Scherzen aufgelegt war, erfreute den Neun- und Siebenjährigen genauso wie mich, ihre sechsundzwanzigjährige Mutter.
»Hört ihr die Drescher, sie dreschen im Takt«, sang Hans im Gleichklang zu seinen rhythmischen Bewegungen. »Eins, zwei, drei … – jetzt du, Alfred … jetzt du, Paul, ja genau, immer feste druff … und jetzt die Mutti …«
Alfred und Paul ließen sich sofort hinreißen zu dem musikalischen Reigen, und selbst mir machte es Spaß. Auf einen Fremden hätten wir wirken können wie eine harmonische Familie. »Eins-zwei-drei, eins-zwei-drei … halt, jetzt sind wir aus dem Takt. Noch mal von vorn. Diesmal fängt eure Mutti an!« Hans ließ seine Augen blitzen, und die Jungs hingen an seinen Lippen.
Die Körner flogen nur so aus den Ähren, und als wir uns zum Zwölf-Uhr-Läuten vom Kirchturm auf der mitgebrachten Picknickdecke niederließen, durchströmte mich ein Gefühl von Zufriedenheit und Glück. So hätte es immer sein können, schoss es mir durch den Kopf.
»Hier, für jeden gibt es eine schöne dicke Scheibe Brot.« Ich reichte das Messer und das Butterfass herum. Genüsslich kauten wir mit vollen Backen. Die Blicke der Jungs glitten abwechselnd zu Hans und zu mir, und ihre Augen strahlten. Selber mit einem Lächeln im Gesicht, schüttete ich aus der mitgebrachten Kanne rot schimmernden Hagebuttentee in die Becher.
»Oh, lassen Sie mich das machen, Großbäuerin.« Schon hatte Hans mir die Kanne aus der Hand genommen, wobei sein Arm mit den blonden Härchen darauf mein Handgelenk wie zufällig streifte.
In der Ferne hantierten die anderen Tagelöhner mit Hacken und Beil, mit Harken und Mistgabeln, und der eine oder andere spähte sicher argwöhnisch zu uns herüber: Was hatte der fröhliche Hans, was die anderen nicht hatten? Ich wusste es ja selber nicht.
Mein Ehemann Otto Öllermann hatte in den neun Jahren unserer Ehe kein einziges Mal ein liebes Wort für mich gehabt, geschweige denn mit den Jungs gesungen oder gelacht. Jeder Einzelne von uns war nur mit knappen Befehlen angeschrien worden, und wenn dem Herrn etwas nicht passte, hatte es sofort Schläge gehagelt. Aber dieser hier war ein anderes Exemplar von Mann.
Am Abend dieses warmen Spätsommertages klopfte es an die Tür. Luise und ich saßen gerade mit den Kindern am Tisch, und beide wechselten wir einen bedeutungsvollen Blick. Es musste schon fast acht sein, so tief stand vor dem Küchenfenster die buttergelbe Sonne.
»Machst du auf?« Luise schnitt für die Kleinen mundgerechte Brotstücke und tunkte sie in warme Milch.
»Nee, Tante Luise, das schickt sich nicht. Geh du man.« Unwillkürlich wischte ich mir die Hände an der Küchenschürze ab.
»Guten Abend, Sie wünschen …?«
»Guten Abend, gnädige Frau. Ich würde gern Frau Öllermann sprechen.«
»Die ist beschäftigt.« Tante Luise öffnete die Tür zur Küche einen Spaltbreit. »Sie können gerne einen Blick auf ihre Kinderschar werfen.«
»Oh, ich bin bereits im Bilde.« Jetzt lachte er, und ich konnte nicht umhin, mir schnell vor dem milchigen Küchenspiegel die Haare zu richten. Alfred und Paul winkten ihm verschämt, und die drei Kleinen starrten ihn neugierig an.
»Hallo Kinder, lasst euch beim Essen nicht stören. Ich wollte eure Mutti nur ganz kurz zum See entführen.« In stiller Faszination ließ sich der junge Mann auf dem Stuhl mir gegenüber nieder. »Heute wird gewiss ein wunderschöner Mond scheinen, und wie ich euch kenne, schafft ihr es, alleine ins Bett zu gehen?!«
»Also, Hans …« Ich kaute einen Moment lang auf der Innenseite meiner Wange herum, dann beugte ich mich zu ihm vor und spürte, dass ich rot wurde. »Warte bitte draußen, wir sind gleich mit dem Essen fertig.«
Wenn das jeder machen wollte! Ich verschränkte die Arme. Meine gespielt aggressive Pose wurde von einem plötzlichen Sonnenstrahl untermalt, der durchs Fenster hereinfiel und die rötliche Lockenpracht des Tagelöhners plötzlich schimmern ließ wie flüssiges Gold.
»Kind, geh nur, ich bringe die Jungs schon ins Bett.« Tante Luise drückte mir den Arm. »Pass auf dich auf, mein Mädchen. Aber der junge Mann macht mir einen guten Eindruck, und nachher sieht man bestimmt einen schönen Sternenhimmel.« Sie reckte leicht das Kinn, und ein Lächeln huschte in ihre feinen Fältchen um ihre Augenwinkel und Lippen.
Einige Zeit später huschte ich mit klopfendem Herzen hinaus auf den Hof. Schon bald hüllte der milchige Mond den Abend in silbriges Licht, die Zikaden zirpten, und in den Bäumen und Büschen raschelte es. Warmer Wind brachte die silbrigen Blätter zum Klingen. »Ich finde, dass dieser Tag plötzlich eine sehr erfreuliche Wendung genommen hat!«
Ich fühlte mich leicht und frei, als ich mit Hans Hand in Hand zum See hinunterlief. Kichernd streiften wir unsere Kleider ab und glitten in das warme, dunkle, geheimnisvolle Wasser.
Mein Herz klopfte so wild, dass mir die Knie zitterten, als ich mit ein paar ungelenken Schwimmstößen versuchte, nicht unterzugehen.
»Schau doch nur, eine Sternschnuppe!« Hans legte seinen kräftigen Arm um meinen schlanken nackten Körper und zog mich zu sich heran. Er lächelte mich an und beobachtete aufmerksam meine Reaktion. Eigentlich sollte ich ihm eine Ohrfeige verpassen. Doch ich spürte, wie sich