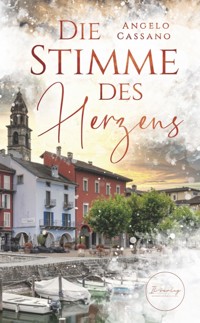
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beniamino ist ein Junge aus dem Oberen Irpinien. Er sieht sich in ein Schicksal verwickelt, das er nicht als sein eigenes empfindet. Der erwachsene Erzähler blickt mit Wohlwollen auf diesen Jungen, auf seine eigene Vergangenheit, die in der Rückschau in all ihren Widersprüchen vor ihm auftaucht. Der Erwachsene sieht, wie das Kind wächst und leidet, Auswege sucht: Der Erzähler führt sich selbst und den Leser auf eine Reise, geografisch und metaphysisch, die ihn zu sich selbst, seiner Freiheit und seiner Berufung führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Angelo Cassano
Die Stimme des Herzens
Roman
Originalausgabe 2025
Copyright © 2025 by IL-Verlag, Basel
Copyright © 2025 by Angelo Cassano
Umschlagfoto: Florin Sayer Gabor Cover: © IL-Verlag Cover: Florin Sayer Gabor Umschlagentwurf: © IL-Verlag Korrektorat/Lektorat: © IL-Verlag Buchsatz©: IL-Verlag Buchsatz: Frei & Fantastisch
Druck: Booksfaktory
Printed in Austria
ISBN: 978-3-907237-75-5 (Print Version)
Bei einigen verwendeten Grafiken wurde künstliche Intelligenz als Hilfsmittel eingesetzt. Diese KI-Grafiken wurden für das Coverdesign weiter verändert und bearbeitet. Das Cover ist KEIN reines Erzeugnis Künstlicher Intelligenz.
Teil 1
DIE ZEIT DES NEBELS
Terra mia
Ein leichter Wind weht von Osten her über die ewige Stadt. Beniamino läuft mit kurzen, leisen Schritten durch den Rione Monti, das Viertel der drei Hügel, mitten in Rom. Es ist früher Abend, die Lichter gehen an und die Schatten werden länger. Aus den verzweigten Gassen wehen die Gerüche der Tavernen herüber. Die Fontana dei Catechumeni, der Brunnen der Taufanwärter auf der Piazza della Madonna dei Monti, beherrscht, so scheint es ihm, wie eine Königin die Piazza.
Beniamino läuft weiter in die Via dei Serpenti, den Schlangenweg, und betritt eine Taverne. Das Lied „Terra mia“ von Pino Daniele weckt seine Aufmerksamkeit. Eine zierliche junge Frau mit braunen Haaren und einer kleinen Brille auf der spitzen Nase spielt am Klavier. Trotz des Lärms der Gäste bahnt sich die warme, samtene Stimme des Mädchens den Weg in seine Seele.
„Terra mia, terra mia, commˋè bello a la penzà. Terra mia, terra mia, commˋè bello a la guardà. Meine Heimat, mein Land, wie schön, an dich zu denken. Meine Heimat, mein Land, wie schön ist es, dich zu sehen.”
An diesem kühlen Frühlingstag im Herzen von Rom, nur wenige Schritte vom Kolosseum entfernt, rufen diese Worte verwirrende Gefühle hervor, Erinnerungen an Kindheit und Jugend werden wach. Er ist es gewohnt, mit vielen Herausforderungen im Alltag umzugehen, aber es gelingt ihm nicht, das zu beherrschen, was jetzt aus seinem Inneren strömt. Es wird stärker und mächtiger, reißt ihn mit, reißt seine Sicherheiten nieder, als habe ein längst vergessener Schmerz sich wieder gemeldet.
Mit einem tiefen Atemzug verlässt Beniamino die Taverne in Richtung Kaiserforen. Oft war er hier mit Freunden aus dem Ausland unterwegs gewesen, hatte auf die alten Steine geblickt und stolz vom Ruhm Roms erzählt. Jetzt aber weckt der Anblick der steinernen Vergangenheit unruhige Erinnerungen. Aus den Tiefen seiner Seele tauchen längst verlorene Gesichter auf.
„Terra mia, terra mia“ klingt in seiner Seele wider wie ein Donner im Tal. Kalte Schauer laufen ihm über den Rücken, doch dann macht sich ein wohliges Gefühl der Wärme in der Tiefe seiner Seele breit.
Die letzten Sonnenstrahlen beleuchten die Säulen des Cäsarforums. Sein Blick bleibt daran hängen. Am Kapitol setzt er sich auf eine Felskante, betrachtet den Venustempel und gibt sich seinen verwirrten Gefühlen hin. Begleitet von einem süßsauren Geschmack im Mund melden sich die Fragen: Wie viel echtes Leben haftet an diesen antiken Schätzen? Welcher Sog zieht mich in die Vergangenheit, die ich so viele Jahre aus meinem Herzen verbannt hatte?
Wie im Traum verschmelzen die Bilder der Kaiserforen mit denen seiner Heimat und funkeln immer bedrängender vor seinen tränenverschleierten Augen. Gedanken und Gefühle jagen einander wie viele von einem Gewitter überwältigte Ameisenherden. Gerne liefe Beniamino jetzt davon, aber seine Füße rühren sich nicht. Das Gewicht, das sich ihm um die Seele wickelt, lässt ihn straucheln und verhärtet sich zu einem Felsen, der zu zerbersten droht.
Die im Leben offen gebliebenen Verbindungen lassen sich nicht schließen. Im fein verworrenen Geflecht seines Inneren ist die Stimme des Herzens neu erwacht, die ihn als Kind in den unheimlichsten Momenten begleitet hat: „Mach dich auf, gehe die staubige Straße noch einmal entlang! Vielleicht gelingt es dir, zwischen den Sandbänken deiner Existenz und in den bunten Schichten der Vergangenheit herauszufinden, warum du hier und nicht anderswo geboren bist!”
Sein Widerstand ist gebrochen.
„Es ist Zeit, dass ich in meine Heimat, in mein Land zurückkehre.“
Wurzeln der Zukunft
Der Zug ist langsam unterwegs. Durch das Fenster schaut Beniamino auf den klaren Frühjahrshimmel und die Hügellandschaft der Irpinia. Weizenfelder wechseln sich ab mit Gemüsegärten, Weingärten, Olivenhainen und Kartoffelfeldern. Die an seinem Auge vorbeiziehenden Bilder wecken einen Zauber aus längst vergangenen Tagen.
Starke Empfindungen und wirre Gedanken wabern in seinem Kopf. Ihm misslingt der Versuch, die Geographie der Gefühle in seiner Seele zu ordnen. Wie Schilfrohr im Wind fühlt sich an, was jahrelang geschlummert hatte. Noch weiß Beniamino nicht, was auf seinen Schultern gelastet und seinen Rücken gekrümmt hatte.
Nur wenige Male war er in seine Heimat zurückgekehrt, immer in Eile, immer in Hast, damit er das Unbehagen nicht wahrnehmen musste, das ihn heimlich begleitete. Geheimnis volle Fäden des Leidens und Strebens waren in seine Seele eingewoben, tiefe Wurzeln einer schrillen und doch fruchtbaren Melancholie. Er würde sie hier wiederfinden.
Wie Sternschnuppen rasen die Bäume am Fenster vorbei. Der Zug lässt die Bergkette des Kampanischen Apennins hinter sich, majestätisch beherrscht von der Hochebene um den ehemals von den Samniten bewohnten Lago Laceno. Nusco taucht auf, wie an den Berg geklebt mit der Kathedrale Sant’Amato. Dann sieht Beniamino in der Ferne Sant’Angelo dei Lombardi, seine Geburtsstadt, mit der Festung aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, die sich wie ein Juwel an die Anhöhe schmiegt, von der aus man einen Gutteil der bunten Landschaft der Irpinia erblicken kann.
Sein Herz schlägt unbändig. Hier wurde er geboren, hier war er aufgewachsen. Im Alter von neunzehn Jahren hatte er diese Stadt verlassen. Seitdem glich sein Leben einer Pilgerreise, körperlich und geistig, ein unaufhörlicher Kampf um das Vergessen.
Er hatte diese Gabe des Vergessens und die Fähigkeit, das Wesentliche zur Nebensache zu machen. So glaubte er auch dieses Mal, es könne genügen, die Brücken hinter sich zu sprengen und mit Entschlossenheit zu verdrängen, was er wie die Büchse der Pandora vermeintlich für immer verschlossen gehalten hatte.
Nun muss seine Kraft des Vergessens sich dem Ansturm unauslöschlicher Erinnerung geschlagen geben, in der eine noch ganz offene Zukunft ihre Wurzeln finden mag. Sein Herz wird, kaum angekommen, von Gefühlen und Erinnerungen jener eigentlich vergessenen Kindheit und Jugend bevölkert werden.
Beniamino steigt aus dem Zug in den verlassenen Bahnhof. Er geht mit großen Schritten zum Hof seiner Familie. Seine Mutter und sein Vater sind in der Schweiz. Niemand vor Ort weiß von seiner Ankunft. Bei der Begegnung mit sich selbst möchte er keine Zuschauer.
Er geht über das taunasse Gras und betrachtet die Landschaft, die sich seinen von bitteren Tränen gefüllten Augen darbietet. Er fährt sich über die Stirn, wie um die letzten Reste einer Zögerlichkeit wegzuwischen.
Er blickt in die Ferne und bemerkt deutlich sichtbare Veränderungen. Neue Gebäude bedrängen seine einst vom Weizen umhüllte Heimat. Asphalt hat die alten schlammigen, von den Spuren der Wagen gezeichneten Pfade ausgelöscht. Eine große Industrieanlage ist hier entstanden. In nur wenigen Jahren hat sich vieles verändert. Das Grün leistet stoischen Widerstand, wenn auch der Zement versucht, dem Tal seine ursprüngliche Schönheit zu rauben.
Am Hof seiner Familie angekommen, öffnet er das Tor aus verzinktem Eisen. Er bemerkt ein Gefühl anziehender Vertrautheit. Erkann hier Motive und Urgrund seines Lebens sehen – ja, gar mit Händen fassen.
Es ist, als sei es gestern gewesen, dass er ein Kind war. Sein Blick fällt auf den alten Backofen, aus dem die Mutter das knusprig goldene Brot herausholte. Er hebt seine von einem fieberhaften Schimmer geblendeten Augen und sieht auf die Terrasse. Hier entkörnte die Großmutter die Maiskolben und unterhielt ihn mit ihren intriganten Geschichten voller Rivalität und Eifersucht.
Mit andachtsvollen Bewegungen setzt er sich auf den Stamm eines vom Blitz enthaupteten Baumes. Zwei große Eichen gewähren dem Bauernhof Sonnenschutz und Kühle. Aus dem Boden treten ihre Wurzeln hervor. Sie erscheinen Beniamino wie eine natürliche Spur, der es zu folgen gilt. Etwas Wunderliches zeigt sich in diesen jahrhundertealten Wurzeln. Sie sind Hinweis und Symbol dessen, was über viele Jahre in den Windungen seines Gedächtnisses versteckt geblieben war.
Liebe kennt kein Alter
Durch die kräftigen Äste der Eichen erhellen und wärmen die morgendlichen Sonnenstrahlen die Erde. Beniamino lässt die Zeit verstreichen und beobachtet ein Rotkehlchen, das von Zweig zu Zweig hüpft.
Wie durch einen Zauber ziehen dann auf dieser Naturbühne die Bilder der Vergangenheit vorbei, stürmisch und faszinierend. Unwiderstehlich wird für ihn der Wunsch, diese Bilder zu lesen und ihnen einen Sinn zu entlocken.
Es ist die zweite Hälfte der 1960er Jahre, als in Amerika die von Martin Luther King angeführten Kämpfe um Bürgerrechte Leidenschaften und Hoffnungen entfachen. Vor Beniaminos Augen tauchen aber keine Friedensmärsche auf, sondern Pfade, auf denen es von Schlaglöchern und Steinen nur so wimmelte. Er gibt sich seinen Erinnerungen hin, reist in eine längst vergangene Zeit, die doch so nah ist; auf ewig mit ihm verbunden.
Der Regen bildete Pfützen, in denen sich die Mauern der weit abgelegenen Häuser spiegelten. Man musste sie unbedingt meiden, sonst bekam man nasse Füße. Auf dem Schulweg ging er mit den Freunden aus seinem Viertel im Gänsemarsch und jeder setzte darauf, dass der Vordermann den trockensten Weg wählte.
Sieben Jahre war er alt, als er, der Angst vor der Nacht und den Geistern trotzend, zum benachbarten Bauernhof lief. Onkel Camillo und seine Familie unterhielten sich angeregt am Feuer des großen Kamins, der diesen schmucklosen, von der rauchgeschwärzten Decke verdunkelten Raum beherrschte. Sie tranken Wein und knabberten Kastanien. Auf einer kolossalen, rauen Bank saß Beniamino im Halbschatten und betrachtete aus der Froschperspektive ihre geflickten Hosen, die einen erdigen Geruch verströmten. Sie arbeiteten den ganzen Tag auf den Feldern und am Abend gelang es ihnen kaum mehr, ihre Unzufriedenheit zurückzuhalten.
Onkel Camillo hatte dichte Augenbrauen, über denen sich eine breite, gekräuselte, von der Hitze und von der Anstrengung gezeichnete Stirn abzeichnete. Beim Widerschein der Öllampe auf dem Kaminsims erschien sein Gesicht rot wie ein brennendes Holzscheit. Mit zornigen, erfahrenen Bewegungen drehte er eine Zigarette und richtete seinen Blick durch das wackelige Fenster in eine unbekannte Ferne.
Eines Abends, nachdem er ein paar Gläser Wein getrunken und einen tiefen Zug aus seiner Zigarette genommen hatte, schlug Onkel Camillo die Faust auf den Tisch. Der Rauch drang aus seinen Nasenlöchern und bahnte sich den Weg durch seinen ungepflegten Bart. Mit der Hand strich er sich über die Stirn, als wolle er sich den Schweiß abtrocknen, der in jenem Moment nicht da war. Er hub an mit Worten voll Bitterkeit. „So geht es nicht weiter! Wir müssen nach New York gehen: Dort ist die Arbeit gewiss hart, aber wenigstens haben wir genug Geld zum Leben. Hier dagegen erpresst uns Don Leone – der Teufel möge ihn holen – immer weiter und beutet uns aus.”
Er hielt abrupt inne, drehte sich zum Kamin und legte, ohne aufzustehen, Holz nach. Das Feuer loderte auf, knisterte und warf groteske Schatten auf die rußbedeckten Wände. Eine Grimasse verunstaltete seinen Mund, begleitet von einem grimmigen Blick. Er griff nach dem schlanken Kerzenhalter, der in der Mitte des Tisches stand, und umklammerte ihn so fest, dass er zerbrach. Die ganze Familie verstummte. Niemand wagte, dieses Crescendo seiner Wut zu unterbrechen. Nur das Summen einer einsamen Fliege, die der Kälte entkommen war, schwebte in der Luft.
„Ich will nichts mehr mit den Herren hier zu tun haben! Sie bauen ihr Glück auf unsere Kosten. Wir gehen fort und kommen nie wieder zurück.”
Während Onkel Camillo, die Füße unter den Tisch gestreckt, weiter über sein Unbehagen und seine Zukunftspläne plauderte, fuhr sich Beniamino gedankenversunken mit der Hand durch die zerzausten Locken und schaute in die Augen vonMaria, der Tochter von Onkel Camillo. Sie begegnete seinem Blick, lächelte liebenswert, auch wenn ihre Augen ein instinktives Unbehagen verrieten. Er versuchte, das Lächeln zu erwidern, aber seine angespannte Unterlippe verriet seine Untröstlichkeit, ausgelöst durch die grauen-haften Worte, dieOnkel Camillomit solcher Entschlossenheit ausgesprochen hatte.
Auch Marias Gesicht verdunkelte sich. In ihren von Tränen verschleierten Augen lag eine unendliche Traurigkeit. Sie waren verliebt, aber auch einem Schicksal ausgeliefert, das sie nicht beeinflussen konnten. Beniamino suchte sie ständig. Maria war nur ein Jahr älter als er. Ihre smaragdgrünen Augen waren durchzogen von feinen grauen Äderchen und ihre hellen Wangen wurden umhüllt von schwarzen, luftigen Locken, die ihr um den Hals tanzten. Sie war sein Idol, seine Fee, seine Komplizin. Die kleinen Freiräume, die sich die Kinder in dieser von den Düften der Gemüsegärten und herbstlichen Nebeln durchzogenen Landschaft geschaffen hatten, waren erhaben und von einer seltenen, zarten und tiefen Stille begleitet. Sie verstanden sich auch ohne Worte.
Beide liebten sie die bunten Farben der Jahreszeiten. Besonders im Herbst, wenn frühmorgens die Sonne in ihrer Herrlichkeit leuchtete und die Blätter der Bäume sich gelb und rot färbten, liefen sie die Hügel neben Onkel Francescos Hof entlang. Sie wippten mit den Füßen, um sich zu wärmen, und blickten, Hand in Hand, umschmeichelt von einer sanften Brise, ins Tal hinab. Eingerahmt von bewaldeten Bergrücken war das Tal in ein Meer aus dichtem Nebel gehüllt, den die Sonnenstrahlen nur mit Mühen durchdringen konnten. Jede Träne, jede schlechte Laune, jede Traurigkeit verschwand beim Anblick dieses Naturschauspiels, das über den ganzen Himmel reichte und ihren Atem stocken ließ.
Beide litten unter den Gemütszuständen der Erwachsenen. Oft wurden sie unter irgendeinem Vorwand geschlagen. An ihnen entlud sich ihre Wut. Die vielen Spannungen, die sich in ihren Seelen gesammelt hatten, fanden ein natürliches Ventil bei den Schwächeren, die gerade zufällig greifbar waren. Und dennoch, in diesen Nebelzeiten erreichten auch kleine Fetzen von Glück ihre Herzen.
Einige Monate später zog Mariamit ihrer Familie nach New York. Beniamino empfand ihre Abwesenheit als einen unüberbrückbar tiefen Abgrund. Die Stimme der Freundschaft, die seine Tage erhellt hatte, war nicht mehr zu hören. Sein Herz schlug schnell, als würde es in den Wahnsinn getrieben. Es gelang ihm nicht, diesen Verlust zu akzeptieren. Seine vernebelten Gedanken irrten in der Leere. Die Traurigkeit stach in sein Herz wie ein Messer in das Fruchtfleisch eines reifen Apfels. Er gab nicht auf und rannte im Kreis umher wie ein Wolf im Käfig über jene von Hecken und Ginster eingefassten Wiesen, wo sie noch bis vor wenigen Tagen gespielt hatten. Er rannte bis ihm der Atem stockte und rief seine Fee mit lauter Stimme in der Hoffnung, dass sie wie von Zauberhand erscheinen möge.
Seine Seele war untröstlich und voller Fragen, die antwortlos verpufften. Er wandte sich an seinen Schutzengel und gab seinem Schmerz eine Stimme.
„Warum gerade ich? Warum ist meine Fee nicht mehr hier?”
„Sieh zum Himmel hinauf, Kleiner, sie ist unter den Sternen.”
Er empfand diese Stimme als Liebkosung, aber auch als Todesurteil. Eine Art Beziehungstod, den alle Wandernden dieser Erde gut kennen. Im Schoß der Nacht erschienen ihm selbst die Sterne blasser als sonst.
Als die Zeit verging, versuchte er vergeblich, den vergessenen Klang ihres schallenden Lachens zu hören. Sie würden sich nie wiedersehen. Die Zeit heilt keine Wunden; sie zwingt uns nur, die Verwundungen als unausweichliches Schicksal anzunehmen. Es kommt vor, dass das, wonach wir uns sehnen, zu spät kommt oder zu früh.
Rauchschwaden
Mindestens drei Monate im Jahr war das Bergland von Schnee bedeckt. Der Wind erfüllte die Luft mit Heulen und Brausen. Beniamino besuchte Onkel Francesco. Der alte Mann wohnte nicht weit von seinem eigenen Hof. Das kleine Haus aus großen, grauen Natursteinen lag in einem sorgfältig angelegten und gut gepflegten Weinberg.
Er hob den Blick: Lange Eiszapfen hingen vom Dach herunter. Aus der Küche kam ein kräftiger Geruch nach Speck und Tabak. Beniamino rieb sich die Hände vor Kälte und trat in einen von Rauchwolken vernebelten dunklen Raum. Er grüßte Onkel Francesco, die Zähne aufeinandergepresst. Das Kaminfeuer erzeugte ein rötliches Licht auf dessen von tiefen Falten durchfurchten Gesicht. Der Putz an den Wänden war teilweise abgeblättert und hatte Feuchtigkeitsflecken. Zwischen Spinnweben hingen dort ein altes Jagdgewehr und ein verblichenes Foto, das den Onkel als jungen Mann in Soldatenuniform zeigte.
Ohne seine Arbeit zu unterbrechen, erwiderte Onkel Francesco den Gruß und deutete ein Lächeln an. Wie üblich hockte er neben dem Kamin und flocht Körbe aus gut getrocknetem Ginster oder hantierte sorgfältig mit Tabak und Pfeife, die immer in greifbarer Nähe war. Er trug ein vielfarbiges, kariertes Hemd und braune Hosen. Hier hatten die in den Fugen im Boden eingenisteten Kohlestücke und der häufige Kontakt mit Asche schwarze Spuren hinterlassen.
Der alte Mann hatte etwas Wildes und gleichwohl Liebenswertes an sich. Er besaß den wachen Blick eines Menschen, der die Widrigkeiten des Lebens kannte. Er reichte dem Jungen Brot und Käse und kommentierte geheimnisvoll: „A casa re pezzienti non mancheno mai tozzere. - Auch in einem armen Haus ist immer ein Stück Brot übrig.”
Ein chronischer Husten nahm dem Alten den Atem, aber er trübte nicht seine klaren Erinnerungen. Er zeigte dem Jungen die Verwundung aus dem Ersten Weltkrieg am Fuß. Er tauchte in Erinnerungen ab und holte dann in die gemeinsame Gegenwart herauf die hungrig erklommenen Bergpfade, das schier unerträgliche Gewicht der Waffenrüstung und die allgegenwärtige Angst vor dem Feindkontakt. Seine Augen waren tränenverschleiert, wenn er von den Kameraden in den Schützengräben sprach und von den vielen Nächten, die sie gemeinsam im Dreck und unter freiem Himmel verbracht hatten. Eine Mischung aus Stolz und Schwermut zeichnete sich in seinem Gesicht ab, wenn er sich an die Nahkämpfe mit aufgepflanztem Bajonett mit den Österreichern und die erfolgreichen Bodengewinne im Namen des Vaterlandes erinnerte.
Große Tränensäcke unter den Augen zeigten, dass er das Leiden gewohnt war. Aber er wurde wütend und fluchte, wenn er an die Zeit nach dem Großen Krieg erinnerte, an die Überfälle, die Fehler, den Missbrauch. Manche dramatischen Ereignisse ließen ihn nicht los, auch wenn sie mehr als ein halbes Jahrhundert zurücklagen.
„Wir Soldaten wurden von General Cadorna getäuscht und verraten. Als der Kampf im Schützengraben tobte, gab der General den Befehl, die Gewehrschützen hinter uns aufzustellen. Wir waren in der Klemme. Wir konnten weder vor noch zurück, sonst hätten sie uns getötet. Am schlimmsten war es bei der vernichtenden Niederlage von Caporetto. General Cadorna ließ Tausende zurückweichende Soldaten töten, weil er sie für Feiglinge und Deserteure hielt. Aber das ist noch nicht alles! Auch General Diaz hat uns betrogen. Um das Letzte aus uns Bauern herauszuholen, versprach er uns Land, das er nach Kriegsende verteilen würde.
Dem alten Mann stockte der Atem. Er machte eine Pause. Mit vertrauten Bewegungen hielt Onkel Francesco seine Pfeife in den Händen, putzte sie, stopfte Tabak hinein und hielt sie zwischen den Zähnen fest. Er zündete den Tabak mehrmals an und nahm kurze Züge, während er ihn mit dem Pfeifenstopfer zusammendrückte. Den Rauch atmete er nicht ein, er genoss ihn.
Mit der üblichen Traurigkeit und Ergebenheit nahm er dann seine Erzählung wieder auf und zog die Augenbrauen hoch. „Von wegen, mein Sohn! Das Versprechen hielt er nicht! Bei unserer Rückkehr hatte sich die Situation verschlimmert. Ich war ohne Land und ohne Essen. Gegen ein Stück Brot arbeitete ich von früh bis spät auf den Feldern von Don Luigi. Als ob das nicht schon gereicht hätte: Viele steckten sich an der Spanischen Grippe an. Wir dachten damals, das Ende der Welt sei gekommen”.
Die Gesichtszüge zeugten von der Anstrengung, die Onkel Francescodas Atmen bereitete. Dennoch stockte sein Redefluss nicht. Die Aufmerksamkeit des Jungen galt ganz den tiefen Furchen in den großen schwieligen Handflächen. Noch mehr als die Worte erzählten sie von der Erschöpfung. Gerne hätte Beniaminosie aus größerer Nähe betrachtet, dann hätte er die Geschichte vielleicht besser verstehen können. Aber er traute sich nicht. So wanderten die Gedanken des Jungen, trotz allen Bemühens, konzentriert zuzuhören, immer wieder zu den Rauchschwaden, die vom Kamin aus schlangengleich waberten und sich schließlich im ganzen Raum ausgebreitet hatten.
Unbekannte Eigenschaften
Nach einer schlimmen Lungenentzündung starb Onkel Francesco. Es war das erste Mal, dass Beniamino an einer Beerdigung teilnahm. Seine Mutter wollte ihn daran hindern, musste angesichts seiner Beharrlichkeit aber schließlich nachgeben.
Ein langer Trauerzug folgte seinem Sarg. Von den Kartoffelfeldern, die die lange gewundene Straße zum Friedhof säumten, blies ein eisiger Wind. Die Menschen, denen sie begegneten, nahmen ihre Hüte ab und schlugen das Kreuzzeichen. Momente der Stille wurden von Schluchzen und Klagen unterbrochen. Mehr als andere erreichten die Worte von Marisa La Mancina die Ohren des Jungen. „Nur Gott ist imstande, die Stunde und den Tag zu wählen, an dem ein Mensch sterben muss.” Mit von der Kälte gepeitschten roten Wangen und aufeinandergepressten Lippen gelang es Beniamino nicht, einen Gedanken zurückzuhalten, der ihn wie ein brennender Blitz durchfahren hatte: „Wenn das so ist, warum hat Gott dann keinen wärmeren Tag gewählt?”
Er wollte nicht glauben, dass Onkel Francesco wirklich tot war. Als sie am Friedhof ankamen und bevor der Sarg endgültig verschlossen wurde, betrachtete Beniaminomit konzentriertem Blick, forschender Miene und beinahe morbider Neugierde das faltige und wegen des Leidens angespannte Gesicht des Toten. Er küsste ihn auf die Stirn. Der Geruch war unangenehm. Ein Gefühl unerträglicher Unruhe überkam ihn. Der Sinn des Todes kam ihm undurchschaubar vor und eine Frage quälte sein Herz: „Wie kann es sein, dass der Tod das Gesicht eines geliebten Menschen in Abfall verwandeln muss?“
Die schwarz gekleideten Frauen standen um den Sarg herum, seufzten laut und klagten mit Worten der Verzweiflung, während sie sich immer wieder die Nase schnäuzten. Der Anschein trog nicht. Sie zählten laut all die guten Eigenschaften auf, die angeblich zu Onkel Francescos Charakter gehört hatten. Einige davon waren dem Jungen unbekannt und fremd. Beniaminotrat zur Seite und vertraute seine Gedanken seinem Schutzengel an. „Schade, dass Onkel Francesco nicht all das Gute hören kann, das sie über ihn sagen. Noch gestern haben sich dieselben Frauen über seine mürrische Art beklagt.“
Auf dem Weg zurück ins Tal fiel leichter Schnee auf die Blätter. Unbeeindruckt davon zog Beniaminoseinen kurzen Mantel aus, als wolle er sich so von einem Verwesungsgeruch befreien, der an ihm hängen geblieben sein könnte. Die in dicke Kleider eingepackten Leute sprachen weiter über Francesco wie über die liebenswerteste Person der Welt. Im Geist des Jungen blitzte die Versuchung auf, sich den Abhang hinunterzustürzen. In jenen flüchtigen Augenblicken war der Todeswunsch unwiderstehlich. Gerne hätte er Gott das Geschenk des Lebens zurückgegeben, das zu verlieren andere sich wohl fürchteten.
Es war ein nicht nur vom Schmerz diktierter Wunsch. Tief im Inneren wusste er, dass er log. Es war nur angenehm, sich vorzustellen, wie die Leute über ihn gesprochen hätten, ihre ganze Liebe ausgedrückt hätten, auf die er als Lebender fast immer hatte verzichten müssen. Vielleicht gab er sich dem Gefühl des Unglücklichseins auch hin aus dem intimen Bedürfnis heraus, getröstet zu werden. Aber niemand beachtete ihn.
In jenen einsam gelegenen Ortschaften zwischen den Bergen und den Tälern, in denen das Leben täglich hin- und herzupendeln schien zwischen Mühe und Streitsucht und in denen beinahe jeder schlecht sprach über jeden, da schien der Tod, ein Meister der Verstellung und Täuschung, eine kurze Pause zu machen: Er wurde Beniaminofür kurze Zeit zu einem Vertrauten.
Geschrei
Im Jahreslauf gab es Ereignisse, auf die sich Beniamino ungeduldig freute. Es bereitete ihm großes Vergnügen, den Leuten bei diesen Gelegenheiten zuzuschauen und ihr Verhalten zu erforschen.
Die Feste zu Ehren der Schutzpatrone erzeugten Hektik und Aufregung bei Klein und Groß. Buden und Stände wurden auf den Dorfplätzen aufgebaut, Prozessionen und Blaskapellen zogen von Ort zu Ort vorüber: Sant‘Angelo dei Lombardi, Calitri, Lioni, Morra de Sanctis. An den Abenden nach den rituellen Prozessionen ließen die Bauern Erschöpfung und Groll hinter sich: beim Takt der Tarantella und dem Gesang der Volkslieder, bei Wein und bei schwindelerregenden Tänzen bis spät in die Nacht hinein. Alle waren verzaubert und voll guter Gefühle.





























