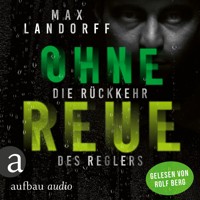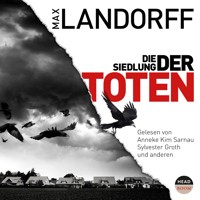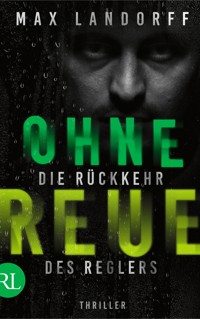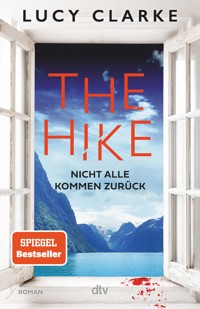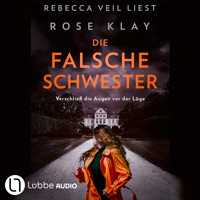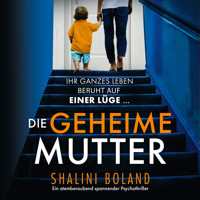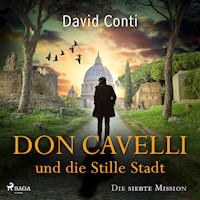8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Regler
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
DIE REGLER-THRILLER: SPITZENSPANNUNG MADE IN GERMANY Er ist der REGLER. Für andere regelt er Leben, Geld, Macht, Sex. Nur die Zeit hat er nicht unter Kontrolle. Denn da draußen ist jemand, der tötet. Und die Opfer tragen alle den gleichen Namen: seinen. Gabriel Tretjak hat sich in die Berge über dem Lago Maggiore zurückgezogen. Als die Quantenphysikerin Sophia Welterlin ihn aufsucht, ahnt er nicht, dass eine eiskalte Jagd im Gang ist: Wenn die Zeit in mehr als eine Richtung läuft, gegen wen arbeitet sie? »Ein filmreifer, rasanter und raffinierter Thriller, der für Blitzlichtgewitter sorgt!« MDR »Ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Mein Tipp: Die REGLER-Thriller hintereinander lesen!« Anouk Schollähn, NDR 2 »Alles, was ein intelligenter Thriller braucht.« Bücher »Story und Spannung vom feinsten.« Stuttgarter Zeitung »Rasant, subtil, vielschichtig: Dieser Regler ist wirklich ein spannender Typ.« Für Sie »Äußerst gekonnt und spannend.« Südwest Presse
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Ähnliche
Max Landorff
Die Stunde des Reglers
FISCHER E-Books
Wie kann man sagen, dass Vergangenheit und Zukunft existieren? Wenn doch die Vergangenheit schon nicht mehr ist und die Zukunft noch nicht ist?
Augustinus
Prolog
Teil 1Vertrauen
Mittwoch, 4. Oktober
(t0 minus 58)
Er hörte dieses schlagende Geräusch. Wieder und wieder. Etwas aus Holz schlug auf etwas aus … Stein? Gabriel Tretjak versuchte, die Augen zu öffnen, aber es gelang ihm nicht, sosehr er sich auch anstrengte. Seine Lider fühlten sich an, als wären sie zugeklebt. In der Nase hatte er den Geruch von nassen Badeanzügen, vielen nassen Badeanzügen, die allesamt Frauen gehörten. Und wieder schlug etwas aus Holz auf etwas aus Stein.
Das menschliche Gehirn ist ein Spieler. Beim Übergang vom Schlaf zum Bewusstsein lässt es sich besonders viele Varianten einfallen. Manche Tage werden angeknipst wie Lichtschalter. Man öffnet die Augen, und die Nacht ist vorbei. Aber manchmal muss man noch eine Weile im Casino des Gehirns bleiben, wo Neurotransmitter mit unserem gesamten Leben spielen, ganz neue Wetten abschließen. Gabriel Tretjak hatte das Gehirn immer als eigenes Wesen betrachtet, bei sich selbst und bei anderen, ein Wesen, das im Kopf wohnte, das man sich zunutze machen konnte, meistens, nicht immer. Es dauerte eine ganze Weile, bis Tretjak an diesem Morgen sein Gehirn dazu brachte, die Karten auf den Tisch zu legen.
Seine Augen waren nicht verklebt, sie waren schon offen. Aber der Raum, in dem er sich befand, war stockfinster. Es war das Schlafzimmer im Haus seines Vaters. Und er lag im Bett seines Vaters, der seit einem Jahr tot war. Oben in der Küche schlug der Fensterladen, den man nicht festmachen konnte, gegen die Mauer. Es war Wind aufgekommen in der Nacht.
Er schloss die Augen wieder. Einen Moment wollte er bei den nassen Badeanzügen bleiben. Es kam nicht oft vor, dass ihn etwas aus seiner Kindheit nachts überfiel, und schon gar nicht aus der kurzen glücklichen Zeit dieser Kindheit – bevor die Katastrophen gekommen waren. Die Badeanzüge in der Umkleidekabine am Pool. Sein Bruder Luca hatte ihn immer wieder dort hingeschleppt. Ein kleines Holzhäuschen, reserviert für Hotelgäste, die schwimmen wollten. Es konnte immer nur von einer Person benutzt werden, man nahm seine Kleider nach dem Umziehen wieder mit. Doch mittags oder auch abends hängten die Gäste ihre nasse Badebekleidung an den Haken in der Kabine auf. Männer rechts, Frauen links. Luca und er lauerten kichernd hinter der Buchenhecke auf den richtigen Moment, dann schlichen sie hinein. Wie alt waren sie damals? Luca 15, er selbst sieben? Luca fasste die Anzüge an, fast ehrfürchtig, und er flüsterte ihm zu, welchen Frauen welches Teil gehörte: der großen Blonden mit dem Riesenbusen zum Beispiel, oder der Tochter der dicken Deutschen, der Frau des Millionärs mit dem Porsche … Der Geruch in dem Häuschen war eine Mischung aus Chlorwasser, von der Sonne aufgeheiztem Holz und dem Duft der Frauen, ihren Parfums und Cremes. Für die beiden Jungs das aufregendste Gemisch, das man sich vorstellen konnte. Gabriel Tretjak versuchte sich zu erinnern, was sein Bruder ihm im Traum gesagt hatte. Aber er sah immer nur das Bild vor sich: Luca, der sich in der Kabine zu ihm umdrehte, seine dunklen Augen und dass er plötzlich fast erschrocken aussah, bevor er sprach.
Tretjak richtete sich im Bett auf, stellte die Füße auf den Holzboden, schlüpfte in die Lederpantoffeln seines Vaters, des toten, des ermordeten Vaters. Er durchquerte den finsteren Raum, öffnete das Fester und stieß den dunkelgrünen Holzladen auf. Es war schon hell draußen. Er blickte auf die Uhr. 20 Minuten vor neun. In den ersten Wochen hier war er oft morgens einfach liegen geblieben. Eingemummelt in eine Decke und in ein Gespinst aus Gedanken und Gefühlen. In letzter Zeit zwang er sich dazu, aufzustehen und eine Art Tagwerk zu beginnen, eine Hecke zu schneiden zum Beispiel oder Brennholz zu hacken. Auch eine kleine Steinmauer hatte er hochgezogen und einen toten Baum gefällt. Solche Dinge kosteten an diesem Ort viel Kraft und Zeit.
Das kleine Bauernhaus, in dem sein Vater die letzten Jahre seines Lebens verbracht hatte, befand sich in den italienischen Alpen. Es stand seit etwa hundert Jahren wie ein kleiner Turm im steilen Berg, direkt über dem Ort Maccagno am Lago Maggiore, dem großen Gletschersee. An seinen Ufern war es so warm, dass Palmen wuchsen, aber auf den Spitzen der Berge, die ihn umgaben, war es so kalt, dass der Schnee auch im Sommer liegen blieb. Das Haus bestand aus lediglich vier Räumen, Schlafzimmer und Bad im unteren Teil, darüber Wohnzimmer und Küche. Eine Steintreppe verband die beiden Ebenen. Von jedem Raum aus konnte man ins Freie treten, auf kleine Terrassen. Von der Küche aus blickte Tretjak jetzt direkt über den Herd auf den See. Es war ein warmer, klarer Herbsttag, Mittwoch, glaubte er zu wissen. Mittwoch, der 4. Oktober, so sollte es auch später in den Polizeiprotokollen festgehalten werden. Unten in dem kleinen Hafen fuhr ein Segelboot auf den See hinaus, ein weißes Segel auf dem weißlich glitzernden Wasser.
Die kleine Espressokanne aus Metall, die auf dem Herd stand, zischte jetzt und brodelte. Tretjak öffnete den Kühlschrank, holte eine Packung Milch heraus, goss sie in eine Tasse und schenkte darauf den heißen Kaffee. Dann setzte er die kleine Geschirrspülmaschine in Gang, in der ein paar benutzte Teller und Gläser der letzten Tage standen. Er zog die Jeans an, die über dem Stuhl hing, und ging hinaus auf die Veranda.
Zum ersten Mal hatte Tretjak diese Veranda am Tag der Beerdigung seines Vaters betreten. Das war schon über ein Jahr her. Von hier aus war er ins Haus gelangt, mit den Schlüsseln, die ihm die Polizei ausgehändigt hatte. Sprachlos und wie in Trance hatte er in den kargen Überresten des Lebens seines Vaters herumgestanden, im letzten Zuhause des Mannes, den er so gehasst hatte. Damals hatte er gedacht, nun sei alles vorbei, nun könne er neu beginnen. Wie froh er gewesen war, dass er nicht allein hatte herkommen müssen. Dass Fiona ihn begleitet hatte. Fiona …
Vor Weihnachten war er dann noch einmal von München aus hierher an den Lago Maggiore gefahren. Eigentlich nur, um den Makler zu treffen, der das Haus für ihn verkaufen sollte. Und vielleicht noch, um den ein oder anderen Gegenstand mit zurückzunehmen. Vielleicht. Vergangenheit aufzuheben war noch nie seine Sache gewesen. Und diese hier schon gar nicht.
Das Besondere an dem Haus war, dass es an einem alten Eselsweg lag und nur zu Fuß zu erreichen war. Den winzigen alten Geländewagen seines Vaters entdeckte Tretjak erst später unter einer Plane. Als er damals vor Weihnachten oben angekommen war, hatte er drei Fehler gemacht. Zuerst hatte er sich auf die Veranda gesetzt, um zu Atem zu kommen. Er hatte über den See geblickt und den Geruch des winterlichen Waldes eingeatmet, der Erde, des Laubes auf dem Boden, den Duft des großen Rosmarinstrauches in dem Steintopf neben sich. Dann hatte er, als er im Haus war, in allen Kaminen Feuer angezündet. Und als alle drei brannten, das Holz krachte und es draußen dunkel wurde, da hatte er beschlossen, ein paar Tage zu bleiben. Niemand wartete auf ihn in München. Sein Leben dort war in die Luft gesprengt worden, die neue Wohnung bedeutete ihm nichts. Plötzlich schien ihm das Haus der richtige Ort für Weihnachten. Zwei Wochen später war der Makler des Auftrags enthoben, das Haus zu verkaufen. Und Ende Januar schleppte Tretjak insgesamt fünf schwere Rucksäcke den Berg hinauf, Kleidung, Bücher, Computer, ein kleines Teleskop. Das große stand noch immer in seiner Sternwarte auf einem Bauernhof bei München. Wahrscheinlich hatte es inzwischen Spinnweben angesetzt.
Graue Mauern durchzogen den Berg und das Grundstück, auf dem Tretjaks Haus stand. Aus Natursteinen errichtet, viele inzwischen halb eingestürzt und von Pflanzen überwuchert, erinnerten sie an die Zeit, als die Menschen an den steilen Hängen Landwirtschaft betrieben hatten. Auch der Eselsweg wurde zum Berg hin von einer solchen Steinmauer beschützt, die von der Gemeinde in Schuss gehalten wurde. Den Weg selbst konnte man deshalb von Tretjaks Veranda aus nicht sehen, doch wenn ein Mensch darauf nach oben gelaufen kam, tauchte sein Kopf immer wieder zwischen den Büschen und Bäumen auf.
Der Hut, den Tretjak jetzt von der Veranda aus sah, war ein billiger Strohhut, von der Art, wie sie unten am See und an allen Stränden der Welt verkauft wurden. Er wippte auf und ab und bewegte sich ziemlich schnell vorwärts. Tretjaks Blick war inzwischen geübt, und er erkannte sofort, dass die Person unter dem Hut körperlich fit war. Er war ein wenig überrascht, als er schließlich sah, dass es eine Frau war, die sich da zügig näherte und schon die letzte Biegung vor seinem Haus erreicht hatte. Jetzt konnte er die ganze Gestalt sehen. Die Frau hatte eine kräftige, beinahe bullige Statur. Sie trug eine helle Leinenhose, eine weiße Bluse und eine Sonnenbrille. Ihre langen braunen Haare hatte sie im Nacken zu einem schweren Zopf geflochten, die Füße steckten in leichten Wanderschuhen. Tretjak schätzte ihr Alter auf etwa vierzig.
Der Weg war inzwischen ein markierter Wanderweg, man gelangte an Tretjaks Haus vorbei in etwa anderthalb Stunden Fußweg zu einem höher gelegenen Bauerndorf. Touristen gingen den Weg gelegentlich, um den Blick auf den See zu genießen, Einheimische benutzten ihn manchmal, um im Wald Pilze und Heidelbeeren zu sammeln. Unlängst hatte eine Pfadfindergruppe irgendwo dort oben ihr Camp aufgeschlagen. Wer Tretjaks Grundstück betreten wollte, musste unten beim Haus ein grüngestrichenes Holztor aufstoßen. Er wusste nicht, ob es sein Vater gewesen war oder der Vorbesitzer, der an diesem Tor eine Vorrichtung angebracht hatte, wie es sie früher in kleinen Lebensmittelläden gegeben hatte. Wenn man die Tür öffnete, ertönte ein kurzes, etwas abgedämpftes Klingelgeräusch, ein angenehm tiefer Ton, der aber doch so laut war, dass man ihn überall gut hören konnte. Der Ton überraschte Tretjak in dem kleinen Schuppen, wo er seine Motorsäge aufbewahrte.
Als er zurück zur Veranda kam, stand die Frau mit dem Strohhut bereits dort. Sie hatte ihre Sonnenbrille abgenommen und schaute ihn aus auffallend dunkelblauen Augen an.
»Sie sind Gabriel Tretjak, nicht wahr?«, sagte sie mit dem unverkennbaren Akzent der Schweizer. Und fügte ein freundliches »Guten Morgen« hinzu. Ihr Blick schwenkte einmal über den Garten zum See. »Schön haben Sie es hier.«
Tretjak fiel auf, dass sie keine einzige Schweißperle auf der Stirn hatte und ihr Atem völlig normal war.
»Sind Sie Hochleistungssportlerin?«, fragte er.
»Nein«, sagte sie, »aber ich bin in Zermatt geboren und aufgewachsen, am Fuß des Matterhorns, 16oo Meter hoch.« Sie lachte, und Tretjak sah, dass sie eher fünfzig war, vielleicht sogar älter. »Ich heiße Sophia Welterlin«, sagte sie und schaute zu der Bank und dem Tisch. »Ich muss mit Ihnen reden, Herr Tretjak. Darf ich mich setzen?«
Tretjak nickte nur, stellte seine Motorsäge auf den Boden. Früher hätte er dieser Frau ein paar klare Fragen gestellt und sie entweder schnell abgewiesen oder höflicher empfangen. An seinem fast schon unbeholfenen Benehmen erkannte er, dass sein Eremitenleben nun schon eine ganze Weile andauerte.
Als sie sich am Tisch gegenübersaßen, sagte Sophia Welterlin: »Ich komme aus der Nähe von Genf, und ich bin hier, weil ich Ihre Hilfe brauche. Die Hilfe des Reglers.«
Hätte ihn vorher jemand gefragt, wie er darauf reagieren würde, auf die Erwähnung seines früheren Lebens, auf die Bezeichnung für seinen Job, die nur wenige überhaupt kannten, er hätte etwas anderes vorhergesagt. Dass er sich freuen würde vielleicht, weil wieder irgendjemand irgendetwas von ihm wollte. Oder das Gegenteil, dass mit diesem einen Wort alles wieder hochkäme, der Hass, die Angst, die Verletzung, der ganze Wahnsinn, der abgelaufen war. Stattdessen empfand Gabriel Tretjak gar nichts. Er sah die Sommersprossen auf den Wangen dieser Frau, den blauen Himmel hinter ihr, den noch blaueren See unter ihr. Und er sagte: »Den Regler gibt es nicht mehr, Frau …«
»Welterlin.«
»Frau Welterlin.«
Es entstand eine kurze Pause, dann sagte sie: »Wäre es zu viel verlangt, wenn Sie mir einen Kaffee anbieten würden?«
Tretjak lächelte und stand auf. In der Tür zur Küche drehte er sich um. »Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass ich noch nie in meinem Leben einen fremden Menschen zu mir nach Hause zu einem Kaffee eingeladen habe?«
»Das glaube ich Ihnen aufs Wort«, sagte sie ernst. »Ich weiß, dass Sie nicht der Typ dafür sind. Ich weiß ziemlich viel über Sie.« Und ohne dass er sie darum gebeten hatte, begann sie zu reden.
Er stand am Herd, mit dem Rücken zur offenen Tür, hantierte wieder mit der Espressokanne und hörte ihr zu, wie sie sagte, was sie sagte. Dass er viele Jahre sehr viel Geld damit verdient habe, das Leben anderer Menschen zu regeln. Dass er mit diesem Geschäft in einer Grauzone unterwegs gewesen sei, rechtlich und moralisch. Und dass schließlich alles ein Ende gefunden habe mit einer Serie von Morden. Verübt, um Rache zu nehmen – an ihm.
»Ich habe das damals nicht verfolgt«, hörte er sie sagen. »Wissen Sie, ich interessiere mich nicht sehr für Verbrechen, und wir in der Schweiz sind sowieso immer etwas ab vom Schuss. Aber jetzt habe ich es alles noch mal nachgelesen. Sowohl die Münchner Kriminalpolizei als auch Sie selbst gingen eine Weile davon aus, dass Ihr Vater der Täter war, bis dann die Wahrheit ans Licht kam, die für Sie vielleicht noch schlimmer war.« Sie sagte noch etwas von dem Verständnis, das sie dafür habe, dass er sich so zurückgezogen hatte.
Der Kaffee war fertig, Gabriel Tretjak drehte das Gas am Herd ab. Immer wenn er das tat, jedes Mal, ohne Ausnahme, auch jetzt, dachte er wieder an das erste Mal damals im Haus. Wie Fiona beschlossen hatte, Kaffee zu kochen, und den kleinen gelben Gashahn unter der Spüle aufdrehte. Wie er das aus den Augenwinkeln bemerkt hatte. Dass sie diesen Hahn gefunden hatte, so schnell, so sicher. Zu schnell, zu sicher. Er wusste noch genau, dass sein Gehirn in diesem Moment gezögert hatte, wie ein Läufer an einer Weggabelung. Habe ich das gerade bemerkt? Oder habe ich es nicht bemerkt? Hier in dieser Küche hatte sie den Gashahn geöffnet und danach das Fenster. Und dann hatte sie etwas zu bewusst und deutlich so getan, als hielte sie nach Tassen Ausschau. Sie hatte ihren eigenen Fehler bemerkt. Es war dieser Moment gewesen, der ihm das Leben gerettet hatte. Weil sein Gehirn damals die richtige Entscheidung getroffen hatte. Nein, nicht die bequeme Abzweigung in Richtung der warmen Gefühle, der Begriffe wie Liebe und Geborgenheit. Nein, nicht so tun, als hätte man das eben nicht bemerkt. Sein Gehirn hatte den anderen Weg genommen, und der hieß: Adrenalin, Herzrasen, Misstrauen, eine sofortige Kehrtwende all seiner Gedanken und Pläne.
Tretjak stellte die beiden Tassen Kaffee, den Zucker und die Milch auf ein kleines silbernes Tablett und trat wieder auf die Veranda. »Wenn Sie schon so viel wissen«, sagte er, »dann wissen Sie sicher auch, dass ich damals nur auf Empfehlung gearbeitet habe, auf persönliche Empfehlung. Und trotzdem die meisten Anfragen abgelehnt habe.«
»Oh, das weiß ich«, entgegnete Sophia Welterlin, als er sich setzte. »Ich habe eine Empfehlung.«
»Von wem?«
»Ich habe versprochen, es nicht zu sagen.«
Tretjak sah sie an. »Sehen Sie, Frau Welterlin«, sagte er, »selbst mit dem Regler von früher wären Sie so nicht zusammengekommen. Der hatte ein paar Prinzipien. Mit das wichtigste dabei war: keine Geheimnisse. Der Klient hat keine Geheimnisse vor mir. Ich kann in sein Leben nur eingreifen, wenn ich alles weiß. Entdecke ich ein Geheimnis, wird die Angelegenheit sofort beendet.«
Sie führte die Tasse zum Mund und trank langsam ein paar Schlucke.
»Was sind Sie von Beruf?«, fragte Tretjak, um das Thema zu beenden.
»Die meisten, die mich das fragen, bereuen es hinterher bitter«, antwortete sie. »Bei Ihnen könnte es anders sein. Ich bin Physikerin, theoretische Physik, Quantenphysik.«
»Frau Doktor Welterlin also«, sagte Tretjak.
»Frau Professor Doktor Doktor, wenn Sie es ganz genau wissen wollen«, sagte sie.
Unten an dem kleinen Hafen in Maccagno legte eine Passagierfähre ab. Die elegante »Alpino« mit ihren weißblauen Streifen auf ihrer nimmermüden Fahrt quer über den See. Oben auf der Veranda legte die Physikerin Sophia Welterlin ihr iPhone auf den Tisch. »Ich möchte, dass Sie sich etwas ansehen, Herr Tretjak, bitte.«
Tretjak würdigte das Telefon mit keinem Blick, sondern sah ihr in die Augen. »Von wem haben Sie die Empfehlung?«
Er spürte, dass sie überlegte.
Schließlich sagte sie: »Wenn ich es Ihnen sage … Würden Sie es für sich behalten, unter allen Umständen?«
»Sie können sich bei mir vielleicht nicht auf vieles verlassen, aber auf meine Diskretion schon«, antwortete er. »Von wem haben Sie die Empfehlung?«
Diese Frau in der weißen Bluse, die hier hochgekommen war, ungebeten, unerwünscht, blickte ihn an und sagte mit fester Stimme: »Von Luca. Von Ihrem Bruder.«
Gabriel Tretjak dachte nicht an den Geruch der nassen Badeanzüge, an seinen Traum aus der Zeit, als sein Bruder für ihn noch sein Bruder gewesen war. Gabriel Tretjak dachte daran, dass er es früher genauso gemacht hätte wie Sophia Welterlin. Sie hatte ihn ohne Vorwarnung in seinem Leben überrumpelt, und sie hatte ihn jetzt mit einer Information schockiert, abgefeuert aus der Hüfte, bei einer Tasse Kaffee. So ging man vor, wenn man schnell Wirkung erzeugen wollte. Vielleicht machte sie es instinktiv richtig. Er, Tretjak, hatte sich solche Taktiken früher erarbeitet, bei Verhörspezialisten, Verhaltenspsychologen, Gehirnforschern.
Er überlegte, ob er ihr den Gegner zeigen sollte, der er sein konnte. ›Ich danke Ihnen für die Information, Frau Welterlin‹, hätte er sagen können. ›In diesem Moment ist unser Gespräch beendet. Trinken Sie in Ruhe den Kaffee aus und genießen Sie gern noch ein wenig die Aussicht. Sie verzeihen, wenn ich mich schon mal an die Arbeit mache. Es ist viel zu tun hier oben.‹ Stattdessen sah er sie schweigend an. Er spürte, dass sie genau diese Reaktion befürchtete: dass er abbrach, dass er sie wegschickte. Sophia Welterlin war keine Schönheit, jedenfalls nicht auf die Art, für die man diesen Begriff verwendete. Ihre Gesichtszüge waren ein wenig zu grob, bäuerlich konnte man sagen. Männer waren sicher kein besonderer Joker in ihrem Leben gewesen. Vieles, vielleicht alles von dem, was sie hatte, hatte sie sich erarbeitet, hatte sie sich selbst geschaffen. So sah sie aus. Aber sie sah auch so aus, als hätte sie dabei nie ihre Laune verloren. Sie strahlte etwas Zuversichtliches aus.
»Mir wurde gesagt, wenn man mal gar nicht mehr weiterweiß, dann sollte man mit Ihnen sprechen. Bitte, Herr Tretjak, sehen Sie sich das an und hören Sie mir zu.«
»Ihnen wurde gesagt … Das heißt, Luca hat das zu Ihnen gesagt?«
Sie nickte stumm.
Zweimal pro Woche sprach Tretjak mit seinem Therapeuten, schon seit über einem Jahr. Der Therapeut war ein Freund, Treysa hieß er, wie der Ort in Hessen, aus dem er auch stammte. Stefan Treysa. Er wohnte und arbeitete in München. Seit Tretjak sich hier oben verkrochen hatte, fanden die Sitzungen via Skype vorm Computerbildschirm statt. Mittwochs und freitags. Für heute Abend um 19 Uhr waren sie wieder verabredet. Immer wieder, wie ein Mantra, hatte Stefan Treysa wiederholt, dass Tretjak sich seiner Vergangenheit stellen müsse. Dass er mit seiner Methode, nach hinten immer alles abzuschneiden, nicht mehr weiterkomme, weil all die Dinge, die hinter ihm lägen, inzwischen wie Schlingpflanzen nach ihm griffen und ihn zu Fall bringen würden. Heute Abend um 19 Uhr würde Tretjak gelobt werden, weil er nicht die Flucht ergriffen hatte vor dem bloßen Namen seines Bruders. Ein Fortschritt, würde Stefan sagen. Aber war es das wirklich, ein Fortschritt?
In diesem Augenblick vibrierte Tretjaks Telefon in seiner Hosentasche. Es kam selten vor, dass er dranging. Meistens erkannte er schon an den Namen auf dem Display, dass es sich bloß um Echos aus seinem früheren Leben handelte, auf die er nicht die geringste Lust hatte. Der Name, der jetzt angezeigt wurde, gehörte zwar auch in die Vergangenheit, war aber eine Überraschung: Rainer Gritz, der Kriminalbeamte aus München, einer, der damals mit Tretjaks Fall befasst gewesen war. Nicht der Boss, aber der zweite Mann. Tretjak erinnerte sich an einen langen, relativ jungen Kerl, der für die Details zuständig gewesen war. Tagelange umständliche Ermittlungen in den Niederungen der Polizeiarbeit, das war seine Sache gewesen.
»Wollen Sie nicht rangehen?«, fragte Frau Welterlin, sichtlich froh über die Unterbrechung. Aber da hörte das Handy schon auf zu vibrieren. Tretjak steckte es zurück in die Hosentasche. Seine Motorsäge, die immer noch auf dem Terrassenboden lag, war ein schwedisches Fabrikat. Eine leuchtend rote Husqvarna mit 65 Zentimeter langem Sägeblatt. Tretjak stand von der Bank auf, nahm die Säge und durchquerte den Garten Richtung Schuppen, um sie dort zu verstauen. Er spürte, dass ihm die Blicke seiner Besucherin folgten. Als er zurückkam, setzte er sich wieder, lehnte sich zurück und sagte: »Schießen Sie los, Frau Professor.«
Drei Stunden später beobachtete Tretjak vom Küchenfenster aus, wie sich der wippende Strohhut wieder nach unten bewegte. Nach ein paar Minuten war er zwischen den Robinienbüschen verschwunden. Tretjak hatte sich Bedenkzeit ausgebeten, wie lange, darauf hatte er sich nicht festlegen wollen. Er hatte ihre Telefonnummern und all ihre Adressen, im Netz und im wirklichen Dasein.
Sophia Welterlin arbeitete am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf. Sie leitete dort ein Projekt mit dem charmanten Namen »Casimir«, da ihr Forschungsgegenstand in Zusammenhang stand mit dem sogenannten Casimir-Effekt, benannt nach seinem Entdecker, einem holländischen Physiker. Welterlins Team arbeitete an einer Frage, die schon lange durch die Köpfe, Rechner und Labore der Wissenschaftler geisterte: Musste die Zeit eigentlich immer nur in eine Richtung laufen? Immer nur von der Vergangenheit in die Gegenwart und von der Gegenwart in die Zukunft? Die Einstein’schen Gleichungen, die so oft recht hatten, ergaben auch eine andere Möglichkeit: die gegensätzliche Laufrichtung. Was bedeuten würde, dass man sich von der Gegenwart in die Vergangenheit bewegen konnte oder von der Zukunft in die Gegenwart. Die meisten Physiker hielten diese Möglichkeit nur für eine theoretische, die sich aus der Mathematik ergab, in der Praxis aber unsinnig war. Sie beriefen sich dabei auf die Paradoxien, die mit Zeitreisen verbunden waren: Was geschähe, wenn jemand in der Zeit zurückreiste und seine Eltern ermordete, bevor er selbst geboren wurde? Es gab aber auch eine Reihe von Physikern, die der Theorie und der mathematischen Präzision die größere Bedeutung zumaßen auf der Suche nach der Wahrheit.
»Und Sie?«, hatte Tretjak gefragt. »Auf welcher Seite stehen Sie?«
»Ich will herausfinden, wie es wirklich ist«, hatte Sophia Welterlin geantwortet. »Wenn die Zeit auch eine andere Richtung einnehmen kann, dann tut sie das vielleicht in einem anderen als unserem Universum. Aber dann muss es auch in unserem Universum Spuren dieser Möglichkeit geben.«
Sie hatte ihm erklärt, dass das Projekt »Casimir« es sich zur Aufgabe gemacht hatte, bei bestimmten großen Experimenten am LHC, dem weltgrößten Teilchenbeschleuniger, gewissermaßen als Trittbrettfahrer nach besonderen Spuren zu suchen – Spuren eines Teilchens, das Higgs Singlet genannt wurde und das theoretisch in der Lage war, in eine neue Raumzeitdimension zu springen. Mit Hilfe solcher Teilchen wäre es möglich, Botschaften in die Vergangenheit zu senden. Ein australischer Physiker hatte den Start des Projekts »Casimir« mit den Worten kommentiert, jetzt sei man endlich dabei, die Firewall der Erkenntnis zu durchbrechen.
»Wir arbeiten im Bereich einer Pikosekunde, also einer Billionstelsekunde« hatte Frau Welterlin gesagt. »Aber die Medien machen daraus Zeitreisen und rufen allerlei Radikale auf den Plan, die entweder glauben, wir wollten die göttliche Schöpfung verändern oder in der Vergangenheit verlorene Kriege nachträglich gewinnen.«
Auf ihrem iPhone hatte sie eine Reihe von Dokumenten gespeichert, die alle ähnlich aussahen, dasselbe Layout hatten: Man sah ein großes Foto, darunter stand ein Satz geschrieben. Verschiedene Bilder, doch immer der gleiche Satz. »So etwas bekomme ich seit Monaten zugeschickt«, hatte sie gesagt, während Tretjak auf dem Display durch die Dokumente blätterte, »als E-Mail, im Kuvert im Briefkasten, ins Büro, nach Hause, sogar in den Ferien kriege ich von Kurierdiensten solches Zeug gebracht.«
Die Fotos zeigten schreckliche Dinge: die Leichenberge im Konzentrationslager Auschwitz, die brennenden Türme des 11. September, die Verwüstungen des großen Tsunami in Asien, den Reaktorblock von Tschernobyl, einen verkohlten Soldaten in der Wüste von Kuwait … Und darunter stand immer nur ein Satz: Don’t touch the past, you won’t survive. Fass die Vergangenheit nicht an, Du wirst es nicht überleben.
Der Regler hatte die Menschen, die seine Dienste in Anspruch nehmen wollten, immer in einem bestimmten Lokal zum Abendessen getroffen. Aus seiner Sicht war es bei den Treffen immer nur um zwei Fragen gegangen: Warum ist diese Person hier? Und was genau will sie von mir? Manchmal war es den Leuten selbst nicht klar gewesen, und man hatte sie darauf bringen müssen. Tretjak hatte sich auf der Veranda immer wieder daran erinnert. Diese Physikerin schien eine Frau mit guten Nerven zu sein, nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, schon gar nicht durch ein paar anonyme Sendungen dieser Art.
»Das ist alles nur der Rahmen, Frau Welterlin, nicht wahr?«, hatte er gesagt. »Sie waren damit sicher schon beim Werkschutz des Forschungszentrums und bei der Polizei. Worum geht es wirklich?«
»Darum«, hatte sie geantwortet und weitere Bilder auf dem kleinen Display aufgerufen. Diesmal waren es Privatfotos, alle aus ihrem Leben, sie als Baby auf dem Schoß ihrer Mutter, als Schülerin bei einem Sportfest, als Rucksacktouristin in Griechenland, als Studentin auf einer Kokainparty, ziemlich desolat. 20, 30 Bilder. Darunter wieder der gleiche Satz: Fass die Vergangenheit nicht an, Du wirst es nicht überleben. »Ich habe keine Ahnung, wo jemand diese Bilder herhaben könnte. Manche kenne ich nicht einmal selbst«, hatte sie gesagt. Und ihm dann das letzte Bild gezeigt. Eine andere Frau, viel jünger, lachend vor dem Eingang zu einem Club.
»Es gibt zwei Punkte in meiner Vergangenheit, auf die ich nicht stolz bin und von denen niemand etwas weiß. Der eine ist auf diesem Bild. Ich habe keine Kinder, aber ich habe mal ein Kind geboren und es zur Adoption gegeben. Dies ist meine Tochter. Die das nicht weiß, die das auch nicht erfahren soll. Wer immer hinter diesen Drohungen steckt, er kommt mir sehr nahe. Ich habe Angst.«
»Und der zweite Punkt?«
»Darf unter gar keinen Umständen bekannt werden. Wenn Sie sich entscheiden mir zu helfen, werde ich es Ihnen erzählen.«
»Und an diesem Punkt kommt mein Bruder ins Spiel?«
»Nein. Ihr Bruder hat nichts damit zu tun.«
Mittwoch, 4. Oktober. Es war noch einmal richtig warm geworden, beinahe 25 Grad. Unten am See herrschte noch Badebetrieb mit Gummibooten und Beachballschlägern. Man hörte das Gelächter als sanftes Rauschen bis in Tretjaks Küche. In den kommenden 58 Tagen sollte er sich noch mehrfach fragen, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, den Ereignissen zu entkommen. Aber hier und jetzt fragte er sich nur, was der Münchner Kripomann Gritz von ihm gewollt hatte.
Mittwoch, 4. Oktober
(t0 minus 58)
Rainer Gritz überlegte schon den ganzen Tag, ob er dem Fußballverein Bayern München nun endgültig seine Treue aufkündigen sollte. Die Saison hatte gerade erst angefangen, zwei Siege, vier Unentschieden, und schon wurde wieder die Trainerfrage gestellt. Heute Abend war das erste Spiel in der Champions League, auswärts in Mailand. Gritz würde natürlich vorm Fernseher sitzen, aber ihm graute schon vor dem Anblick der Vorstandsherren, wie sie selbstgerecht auf der Tribüne saßen, die Gesichter versteinert, weil ein Verteidiger zu spät in eine Flanke gegrätscht war. Alte Recken allesamt, Legenden auf dem Spielfeld, aber inzwischen tumbe Sturköpfe, die nicht abtreten konnten. Gritz war es ernst mit seinen Überlegungen, er war überhaupt ein ernsthafter Mensch, mochte es, wenn die Dinge eine Ordnung hatten, auch in seinem Kopf. Sein früherer Chef August Maler hatte mal gesagt, »Gritz, Sie sind ein Entweder-oder-Mann, für Sie gibt’s nur ja oder nein, 0 oder 1 wie beim Computer.« Er hatte es kopfschüttelnd gesagt, aber dennoch fast wie ein Kompliment. Wahrscheinlich, weil Gritz’ hartnäckige Suche nach dem Entweder-oder zu einigen guten Ermittlungsergebnissen geführt hatte.
In München regnete es seit drei Tagen praktisch ununterbrochen. Von wegen herrlicher Herbst. Die Menschen waren genervt, der Blick auf den Wetterbericht ließ den Eindruck entstehen, es sei überall schönes Wetter, nur in der Münchner Gegend nicht. Umgekehrt kannte man das, aber so? Am Abend zuvor, schon nach 22 Uhr, war am Flughafen Franz Josef Strauß ein sonderbarer Unfall passiert, der schließlich auch Rainer Gritz aus dem Bett geholt hatte. Eine kleine Privatmaschine, eine Cessna 172, war vollständig ausgebrannt, auf ihrem Stellplatz, wo sie schon seit 14 Tagen geparkt war. Der Regen hatte das Feuer nicht verhindern können. Das Ganze war zunächst nur ein technisches Rätsel: War etwas an der Elektrik defekt gewesen? Sabotage? Doch dann entdeckten die Feuerwehrleute zu ihrer Überraschung zwei stark verkohlte Leichen in den Resten des Cockpits, und die Nachtruhe des Rainer Gritz endete. Die Toten waren ein Mann und eine Frau, das war schnell klar, und offensichtlich handelte es sich bei dem Mann um den Besitzer der Maschine. Als Gritz den Namen erfuhr, stutzte er und nahm sich vor, der Sache gleich am nächsten Morgen mit einem Anruf auf den Grund zu gehen: Entweder – oder.
Am Morgen hatte das Handy am anderen Ende noch vergeblich geklingelt, aber jetzt, am Nachmittag, nahm jemand ab.
»Ja.«
»Herr Tretjak?« Gritz saß in seinem Wagen, ein weiteres Mal auf dem Weg zum Flughafen. Wie immer um diese Uhrzeit: Stau.
»Ja. Herr Gritz, Sie haben heute schon mal angerufen. Wie geht es Ihnen?«
Die Frage überraschte Gritz. Schon damals hatte er gefunden, dass Gespräche mit Tretjak immer irgendwie merkwürdig verliefen. »Mir geht’s gut«, antwortete er. »Wie geht es Ihnen?«
»Ich freue mich über die Sonne. Ich mache gerade Ferien am Lago Maggiore. Sie erinnern sich, das Häuschen meines Vaters.«
»O ja. Schön dort«, sagte Gritz. »Sagen Sie, Herr Tretjak, besitzen Sie ein kleines Flugzeug? Haben Sie den Pilotenschein?«
»Weder noch«, antwortete Tretjak. »Warum fragen Sie mich das?«
»Gestern ist hier jemand umgekommen, in seiner Cessna, verbrannt. Die Umstände sind noch ungeklärt. Der Mann hat denselben Namen wie Sie.«
»Tretjak?«
»Er hat sogar Ihren Vornamen: Gabriel. Und denselben Geburtstag, 13. August.«
»Aber ich bin es ja nicht. Offensichtlich«, sagte Gabriel Tretjak. Der Gabriel Tretjak, den Gritz kannte.
»Ja. Offensichtlich«, wiederholte er.
»War es das schon, Herr Kommissar?«
»Eigentlich ja«, sagte Gritz. »Es gibt ja solche Zufälle.«
»Allerdings«, sagte Tretjak. »So besonders selten ist der Name auch wieder nicht.«
»Auf Wiedersehen, Herr Tretjak. Alles Gute.«
»Auf Wiedersehen«, sagte Tretjak, und beinahe hatte Gritz schon aufgelegt, als er noch etwas hinzufügte »Übrigens habe ich nicht am 13. August Geburtstag, sondern am 12. August.«
Gritz hatte die Faxen jetzt dicke mit dem Stau, holte sein Blaulicht aus dem Handschuhfach, setzte es durchs Fenster aufs Dach und wechselte auf den Standstreifen der Autobahn, wo er zügig beschleunigte. Warum hatte er bei diesem Tretjak immer das Gefühl, dass der mehr wusste, als er sagte? Und mehr als er, Gritz?
Freitag, 6. Oktober
(t0 minus 56)
Das Städtchen Penzance lag inmitten einer hügeligen Landschaft in Cornwall, direkt am Meer. Graue Steinhäuser mit weißen Gartenzäunen, ein Leuchtturm hoch über den Klippen, eine südenglische Idylle. Aber Penzance hatte auch einiges zu bieten, das so gar nichts mit den gängigen britischen Klischees zu tun hatte. Hier wuchsen Palmen, da der Golfstrom direkt an der Küste Cornwalls vorbeifloss und für ein außergewöhnlich warmes Klima sorgte. Oder das Essen: Es gab wunderbare Lokale, in denen nicht nur italienisch, pakistanisch, marokkanisch, chinesisch oder französisch gekocht wurde, sondern die auch von echten Italienern, Pakistanis, Marokkanern, Chinesen oder Franzosen geführt wurden, welche alle irgendwann ins friedliche Penzance gekommen – und geblieben waren.
Es gab auch eine eigene kleine Zeitung, »The Penzance«, eine Wochenzeitung, die jeden Montag erschien. Der Kontrast zwischen »The Penzance« und den üblichen englischen Boulevardzeitungen, die nichts mehr liebten als den blutigen Krawall, hätte nicht größer sein können. Nein, »The Penzance« war ein freundliches Blatt. Das hatte mit seinem Verleger zu tun, John Pendelburg, der gleichzeitig auch Chefredakteur war. Als er die Zeitung vor 21 Jahren gegründet hatte, stand seine Philosophie fest: Eine Zeitung war dann erfolgreich, wenn sie schrieb, was die Menschen lesen wollten. Jeder Mensch hatte eine Version von seinem Leben, »und genau diese Version schreiben wir auf«, pflegte Pendelburg zu sagen. »Unsere Leser sind unsere Freunde.«
John Pendelburg legte großen Wert auf ein ruhiges Leben voller vertrauter Gewohnheiten. Schlafen bis neun Uhr, erstes Frühstück, dann im Büro eine Tasse Tee mit etwas Gebäck. Nach dem Mittag ein kurzes Schläfchen auf seiner Bürocouch. Später wieder Tee, mit den wunderbaren Scones, Clotted Cream und selbstgemachter Aprikosenmarmelade. Kurz vor 18 Uhr noch ein kleiner Whiskey, ein irischer, mit der Sekretärin. So vergingen die Tage, je ähnlicher, desto lieber war es Pendelburg. Wenn unvorhergesehene Arbeit kam, überließ er sie seinen zwei Redakteuren. Es gab nur wenige Dinge, um die er sich noch persönlich kümmerte.
Doch an diesem kühlen, klaren Freitagmorgen, Anfang Oktober, war Pendelburg früh ins Büro gekommen, früher als alle Kollegen. Er hatte einen Nachruf zu schreiben, und Nachrufe waren immer Chefsache. Hier die richtigen Worte zu finden, das Leben eines Verstorbenen so zu beschreiben, dass jedermann zufrieden war, hielt Pendelburg für eine besondere Kunst. Er setzte sich an seinen Computer, und wie immer fiel ihm als Erstes auf, dass sein gewaltiger Bauch an die Schreibtischkante stieß. Pendelburg machte dafür aber nicht seinen Bauch verantwortlich, sondern den Schreibtisch. Oder war es der Stuhl? Er nahm sich jedenfalls wie schon so oft vor, mit seiner Sekretärin über neue Möbel zu sprechen.
Bei dem Nachruf gab es ein Problem. Nein, es war nicht das Leben des Toten. »Mister Big«, wie sie ihn alle in Penzance genannt hatten, war ein tadelloser Gentleman gewesen. »Big« – weil er zwei Meter und vier Zentimeter groß gewesen war. Und »Mister« – weil er ein eleganter Mann gewesen war, immer gut gekleidet, immer freundlich und zuvorkommend. Zusammen mit seiner Frau hatte er ein kleines Hotel betrieben. Und auch sonst hatte er sich im Ort engagiert, war etwa einer der großzügigsten Sponsoren der lokalen Kunstszene gewesen. Nur 54 Jahre war er alt geworden. Vor etwa zehn Jahren war er nach Penzance gekommen, von einem Tag auf den anderen, und hatte das Hotel gekauft. Mister Big stammte aus Riga, er war zur See gefahren. Und einmal mit einem Schiff im Hafen von Penzance gelandet. Von da an hatte er gewusst, dass er hier irgendwann einmal leben wollte. ›Eine Liebe auf den ersten Blick‹, formulierte Pendelburg. Das gefiel ihm.