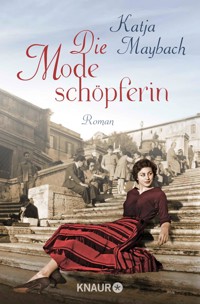9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mütter und Töchter
- Sprache: Deutsch
In ihrem neuen und zugleich persönlichsten Roman "Die Stunde unserer Mütter" erzählt Katja Maybach, inspiriert durch ihre eigene Familiengeschichte, von zwei unterschiedlichen Frauen in den Kriegs- und Schicksalsjahren 1940 bis 1945. Kraftvoll, gefühlsstark und authentisch zeigt dieser Roman den immer schwerer zu bewältigen Alltag, die Bedrohung durch die Gestapo und selbst durch Nachbarn und vermeintliche Freunde, die Hilflosigkeit aber auch den Widerstand gegen den Hass, der sich immer weiter ausbreitet. Doch zugleich erzählt Katja Maybach in "Die Stunde unserer Mütter" auch vom Bewahren der eigenen Menschlichkeit und von der Liebe, die verloren geglaubt ist und dennoch zum Moment der Hoffnung wird. Durch die eingeflochtenen Feldpostbriefe und Tagebuchauszüge von Katja Maybachs eigenem Vater erhält dieser Roman seine besondere Kraft und Wahrhaftigkeit. Im Mittelpunkt stehen Maria und Vivien, die einander nie besonders sympathisch waren – und jetzt eine Schicksalsgemeinschaft bilden, aus der nach und nach tiefe Freundschaft entsteht. Dabei sind die beiden Frauen denkbar unterschiedlich: Während Maria, die ihren Mann, den Forstbeamten Werner, gegen den Willen ihrer Familie heiratete, mittlerweile an ihrer Ehe zweifelt, schmerzt die Engländerin Vivien jede Minute der erzwungenen Trennung von ihrem Mann Philipp. Maria ringt bei jedem Feldpostbrief Werners mit sich, die Distanz, die zwischen ihnen entstanden ist, zu durchbrechen und ihm ein paar liebevolle Worte zu schreiben. Vivien dagegen, die nur deshalb in der Kleinstadt vor den Toren Münchens Zuflucht gesucht hat, um ihren Mann, der im Widerstand tätig ist, nicht zu gefährden, wartet nur auf ein Zeichen, um zu ihm zurückzukehren. Während Maria zu ihrer verträumten Tochter Anna nur schwer Zugang findet, sind Vivien und ihre Tochter Antonia einander sehr ähnlich. Doch je schmerzhafter die täglichen Einschränkungen werden, je näher der Krieg ihnen kommt und je größer die Gefahren von Denunziation und Anfeindungen werden, desto enger rücken die beiden Frauen zusammen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Katja Maybach
Die Stunde unserer Mütter
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kraftvoll, gefühlsstark und authentisch
Deutschland 1940: Maria und Vivien könnten unterschiedlicher nicht sein. Maria zweifelt mittlerweile an ihrer Ehe mit Werner, ihre britische Schwägerin Vivien schmerzt hingegen jede Minute der erzwungenen Trennung von ihrem Mann Philip, der sein Leben riskiert, indem er Juden bei sich versteckt. Während Maria bei jedem Feldpostbrief Werners mit sich ringt, ein paar liebevolle Worte zu schreiben, wartet Vivien nur darauf, zu Philip zurückkehren zu können. Doch je schmerzhafter die täglichen Einschränkungen und je größer die Gefahren von Denunziation und Anfeindungen werden, desto enger rücken Maria und Vivien zusammen.
Emotional und mitreißend erzählt Katja Maybach in Die Stunde unserer Mütter eine dramatische Geschichte, die eng an ihre eigene Familiengeschichte angelehnt ist und Feldpostbriefe ihres Vaters enthält.
Inhaltsübersicht
Widmung
Teil I
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Teil II
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Quellen
Danksagung
Für meinen Vater
Teil I
Mai 1940 – April 1941
Eins
Die kühle Frühlingsluft ließ Maria frösteln, so stand sie auf und zog in der Küche das Fenster zu. Es klemmte und ließ sich nicht richtig schließen. Vieles war defekt in dem alten Haus, in dem sie seit sechzehn Jahren lebte.
Mit einem Seufzer zog sie einen Stuhl an den Tisch heran und strich über den zerknitterten Brief ihres Mannes Werner. Heute Morgen war er mit der Post gekommen, nachdem er monatelang unterwegs gewesen war.
Geschrieben im Felde
Von Offizier Dr. Werner Richter
30. März 1940
Doch als es von der nahe gelegenen Kirche zwei Mal schlug, sprang sie auf. Die Uhr in der Küche war stehengeblieben, so war sie spät dran. Rasch nahm sie den Brief vom Tisch, lief in die Diele, denn sie durfte auf keinen Fall den Bus nach München verpassen, und während sie in ihren schwarz-weiß karierten Mantel schlüpfte, steckte sie den Brief in ihre Handtasche.
»Nadja?«, rief sie nach oben. Ein leichtes Rumoren im Dachgeschoss war die Antwort, dann erschien die junge Russin auf dem Treppenabsatz im ersten Stock. Sie sah zu Maria herunter.
»Ich gehe jetzt, Nadja. Kannst du bitte dafür sorgen, dass Anna nicht wieder die Turnstunde schwänzt? Und wo ist Hella? Hoffentlich ist sie nicht wieder zu Frau Hofer über den Zaun gesprungen.«
Nadja lachte und kam die Treppe herunter. »Keine Sorge, Maria, ich kümmere mich um alles. Ich war gerade oben auf dem Dachboden, der Sand reicht nicht, du musst nachbestellen.«
Jeder Haushalt war angewiesen worden, den Speicher leer zu räumen und im gesamten Dachgeschoss Sand auf den Boden zu streuen, für den Fall eines Brandbombenangriffs.
»Ja, ja, ist schon gut, das mache ich.« Da war sie wieder, diese Müdigkeit, der Überdruss, das Sich-so-fremd-Fühlen im eigenen Leben »Du siehst blass aus.« Nadjas Sorge tat Maria gut, und sie hängte sich bei der jungen Frau ein. Zusammen verließen sie das Haus. Am Gartentor angekommen, warf Maria einen schnellen Blick auf das Nachbargrundstück. Frau Hofer hatte sie vor einer Woche auf der Straße angesprochen.
»Ihr Dienstmädchen ist keine Deutsche, nicht wahr, Frau Doktor?«
»Doch, das ist sie, und sie lebt bereits seit acht Jahren in unserer Familie«, hatte Maria ruhig geantwortet. »Und bitte nennen Sie mich einfach nur Frau Richter. Ich habe keinen Doktortitel, sondern mein Mann.« Als sie das aussprach, hatte Maria mit dem Gedanken gespielt, wie schön es doch wäre, wieder Maria Kroll zu sein.
»Da hinter dem Haus, siehst du?« Nadja riss Maria aus ihren Gedanken. »Hella buddelt schon wieder die Radieschen aus.«
Lächelnd sahen die beiden Frauen sich an.
»Ich glaube, sie ist der einzige Hund, der Radieschen frisst«, meinte Maria kopfschüttelnd. »Naja, Hauptsache, sie ist nicht zu Frau Hofer über den Zaun gesprungen. Also, bis heute Abend.«
Als Maria das Gartentor hinter sich schloss, sah sie ihre Tochter Anna am Ende der Straße auf dem Bürgersteig sitzen.
»Anna! Hallo!«, rief sie laut, doch ihre Tochter rührte sich nicht und schien auch nichts zu hören.
Maria versuchte, durch auffälliges Winken die Aufmerksamkeit ihrer Tochter zu erregen. Anna jedoch reagierte nicht.
»Das macht sie absichtlich.« Maria wurde ungehalten.
»Nein, sicher nicht. Sie ist in Gedanken vertieft und hört dich nicht«, beschwichtigte Nadja. »Außerdem ist sie einfach zu weit weg.«
Doch Marias Verärgerung blieb. Sie war der Überzeugung, Anna habe sie mit voller Absicht überhört. Ihre Tochter entzog sich ihr auf jede nur erdenkliche Art. Es hatte auch keinen Sinn zu fragen, was Anna dachte, denn sie verweigerte sich beharrlich und blieb selbst während der Mahlzeiten verstockt und abweisend. Zu Marias Leidwesen trieb sie sich oft in den Hopfenfeldern und bei den Bauern herum. Ein dreizehnjähriges Mädchen, zwischen Kind-Sein und Veränderung. »Ich glaube, sie starrt das Rad da vorn an, du weißt, wie sehr sie sich eines wünscht.«
»Das weiß ich, aber mit einem eigenen Rad wäre sie gar nicht mehr zu Hause, sondern nur noch unterwegs. Deswegen schenken wir ihr keines«, betonte Maria, blieb noch einen Moment stehen und beobachtete ihre Tochter. Anna saß zusammengekauert auf dem Bordstein und umfasste mit beiden Händen ihre Knie.
Nach einem kurzen Zögern wandte sich Maria zum Gehen. »Also, bis heute Abend!« Sie nickte Nadja zu und lief die Straße in die andere Richtung entlang bis vor zur Biegung. Früher war dies die Friedensallee gewesen, vor einiger Zeit aber war daraus die Adolf-Hitler-Straße geworden.
Kurz bevor Maria abbog, drehte sie sich um. Anna saß immer noch am Straßenrand, wirkte teilnahmslos und gab weiterhin vor, ihre Mutter nicht zu sehen.
Seit sechs Tagen stand es da und hob sich in leuchtendem Rot von der grauen, abgebröckelten Mauer des Gasthofs Grieser ab.
Niemals hatte Anna ein so wundervolles Rad gesehen. Langsam erhob sie sich, nahm ihre Schultasche auf und schlenderte über die Straße. Heute war Ruhetag, keiner begegnete ihr. Sie spürte ihren Herzschlag und das Kribbeln im ganzen Körper. Niemand zeigte sich auf der Straße, niemandem schien es zu gehören. Die Klingel war zu verführerisch: Anna ließ sie scheppern. Doch auch der Klang blieb ungehört, die Fenster des Gasthofs wurden nicht aufgestoßen.
Langsam fuhr Anna mit der Hand über den glänzenden neuen Ledersattel, glitt weiter über den Gepäckträger bis zu dem Hinterrad. Das Schloss blockierte es, aber wenn sie es hinten hochhob, während sie mit der anderen Hand vorne lenkte, könnte sie das Fahrrad nach Hause bringen und es im Geräteschuppen verstecken und das Schloss mit einer Zange knacken.
Ihr Herzschlag wurde immer schneller, das Kribbeln immer stärker. Mit einer Hand umschloss sie fest das Lenkrad, und mit der anderen hob sie das Hinterrad leicht hoch.
»Gehört das Rad dir?« Erschrocken ließ Anna das Fahrrad fallen. Ein Polizist stand neben ihr.
Stumm schüttelte Anna den Kopf und lehnte es vorsichtig wieder gegen die Wand.
»Ich habe es mir nur angesehen«, murmelte sie. Dann drehte sie sich auf dem Absatz um und lief weg, so schnell sie nur konnte. Erst am Gartentor machte sie halt, presste die Hand auf ihre Brust, in der das Herz immer noch wie verrückt klopfte. Nur wenig später, und der Polizist hätte sie auf frischer Tat ertappt, während sie das abgeschlossene Rad nach Hause schob.
Sie riskierte noch einen Blick über ihre Schulter und seufzte erleichtert auf. Der Polizist ging die Straße entlang in die andere Richtung.
Anna stieß die angelehnte Haustür auf und rannte die Treppe hoch in ihr Zimmer, die Zimmertür warf sie hinter sich zu.
»Hallo?«, rief Nadja ihr nach. »Anna? Bist du das? Das Essen ist fertig, und deine Turnstunde fängt bald an. Du weißt doch, dass deine Mutter es nicht mag, wenn du so kurz vor dem Turnen noch etwas isst.«
»Ja, gleich«, rief Anna durch die geschlossene Zimmertür.
Langsam beruhigte sich ihr Atem, sie warf die Schultasche auf den Boden und ging ins Bad, um sich die Hände zu waschen. Danach ging sie in die Küche hinunter und aß langsam die Kartoffelsuppe, die für sie bereits auf dem Tisch stand. Die Wurststückchen darin steckte sie unter dem Tisch heimlich Hella zu, die schwanzwedelnd danach schnappte. Sie aß wenig, wie immer hatte sie keinen Hunger, und dann gab es da noch diese Geschichte, die ihre Mutter ihr einschärfte, nämlich dass einem, wenn man so kurz vor dem Turnen viel aß, eine Darmverschlingung drohe. Als Anna nachhakte, was das sei, war Maria ungeduldig geworden. »Der Volksmund sagt das eben so. Irgendwas wird schon dran sein. Also lieber zwei Stunden vor dem Turnen nichts mehr essen.« Nadja war bereits in der Bügelkammer. »Ich esse später, ich habe noch keinen Hunger, aber du musst dich beeilen«, rief sie durch die angelehnte Tür. »Du darfst nicht immer zu spät kommen.«
Anna gab keine Antwort, aß dafür noch langsamer, um Zeit zu schinden. Sie hasste Turnen. Anna war unsportlich und ungeschickt. Sie hatte lange, dünne Beine und stolperte ständig über ihre eigenen Füße, wenn sie Völkerball spielten oder laufen mussten. Sie konnte keinen Kopfstand, nicht einmal gegen die Wand, und beim Barrenturnen knickte sie ein, da sie in den Armen keine Kraft hatte. Sie war schmal und dünn, an den Ringen hing sie wie ein Mehlsack, wie die Turnlehrerin Fräulein Eberth jedes Mal ironisch bemerkte, was Annas Mitschülerinnen regelmäßig zum Lachen brachte. Fräulein Eberth, die in Annas tatsächlichem Unvermögen ein boshaftes Verweigern sah und es als Affront gegen sich persönlich wertete, ließ keine Gelegenheit aus, um Anna lächerlich zu machen.
Einmal im Monat bekam Anna von ihrer Mutter eine Entschuldigung wegen »Unwohlseins«. Das reichte aber nicht, um Anna vor den Demütigungen zu bewahren und ihr die Angst vor dem Turnunterricht zu nehmen. Irgendwann hatte sie geübt, die Handschrift ihrer Mutter zu fälschen. Eigentlich wollte sie heute ausnahmsweise zum Turnen gehen, doch jetzt entschied sie sich dagegen. Magenverstimmung würde sie auf die Entschuldigung schreiben. Bis jetzt war alles gutgegangen. Erleichtert über ihre Entscheidung löffelte sie rasch die Suppe aus. Dann rannte sie hoch, um ihren Turnbeutel zu holen, damit Nadja nicht misstrauisch wurde. Die Entschuldigung würde sie heute Abend schreiben und morgen vor dem Unterricht im Sekretariat abgeben.
Anna verließ das Haus und wurde am Gartentor von der Hündin Hella erwartet; sie war durch die Haustür geschlüpft, als Anna nach oben sauste.
»Komm«, flüsterte Anna und warf einen raschen Blick über die Schulter zurück. »Ich nehme dich mit. Nadja wird’s nicht merken, und Mama ist weggefahren.«
Es würde nicht auffallen, denn Hella sprang oft über den niedrigen Gartenzaun. Daher kannte jeder der Nachbarn die freundliche Spanielhündin mit den langen seidigen Ohren und dem schwarz-weißen Fell. Oft lief sie die Straße hoch bis zur Metzgerei von Andreas Bärmann. Dort wartete sie geduldig, bis die nette Verkäuferin herauskam und ihr ein Stück Wurst zuwarf.
»Komm, Hella, komm!« Rasch öffnete Anna das Gartentor und rannte die Straße hoch, bog ab und lief am Stadtwall entlang bis zu den Hopfenfeldern.
Es war ein leuchtender Frühlingstag. Ein leichter Wind ging, weiße Wolken formierten sich am Himmel, zogen wieder auseinander, und die Wiesen, über die Anna lief, waren übersät mit gelbem Löwenzahn. Es war herrlich, und so lief Anna weiter und weiter. Hella sprang hinter ihr her. Die Hopfenfelder lagen bereits hinter ihr, jetzt rannte Anna einfach drauflos, das machte ungeheuren Spaß, und wenn sie so lief, dann stolperte sie auch nicht, denn das Gefühl von Freiheit gab ihr eine ungewohnte Kraft und ließ sie laufen und immer weiterlaufen. Erst als ihr Atem immer keuchender wurde, verlangsamte sie ihre Schritte. Inzwischen bewegte sie sich zwischen Bäumen hindurch und heftete ihre Blicke konzentriert auf den Waldboden. Jetzt entdeckte sie die ersten blühenden Anemonen. Auf dem Rückweg würde sie einen Strauß der weißen zarten Blumen für Nadja pflücken. Als ihr Vater noch nicht an der Front war, hatte sie auch ihm oft Blumen mitgebracht, und er hatte sich darüber sehr gefreut, dann die Schublade seines Schreibtisches geöffnet und ein kleines Stück Schokolade herausgezogen. »Sag es nicht deiner Mama«, hatte er ihr augenzwinkernd erklärt. Und Anna schwieg. Es war ein so schönes Gefühl gewesen, mit ihrem Vater ein kleines Geheimnis zu teilen.
Den Blick immer noch auf den Boden gerichtet, merkte sie nicht, dass sie tief in den kleinen Wald geraten war.
Irgendwann blieb sie stehen.
Stille umfing sie. Hier war sie noch nie gewesen, denn ihre Mutter hatte ihr verboten, weiter als bis zu den Hopfenfeldern zu gehen. Es wäre besser umzukehren, doch nach einem kurzen Zögern lief sie weiter, Hella an ihrer Seite. Jetzt lichteten sich die Bäume, und nur ein paar Schritte entfernt erhob sich ein hoher Stacheldraht. Sie sollte stehen bleiben, und doch ging sie weiter, angezogen von einer hohen Stimme, die ein Lied sang.
In geduckter Haltung schlich Anna näher. Ganz vorsichtig, Schritt für Schritt. Dann blieb sie abrupt stehen. Nur lauschen, lauschen, sich nicht bewegen, nicht stolpern. Wieder Stille … Dann erklang erneut diese Frauenstimme, sie klang traurig lang gezogen, sehnsüchtig.
Maikäfer flieg.
Dein Vater ist im Krieg.
Die Mutter ist in Pommerland
Pommerland ist abgebrannt.
Jetzt stand Anna direkt vor dem hohen Stacheldraht. Weit hinter der Abgrenzung sah sie flache Baracken, die in einer langen Reihe standen, davor erhob sich ein hoher Wachturm.
Unbehagen beschlich Anna. Doch ihre Neugierde siegte. Sie schlich sich noch näher an den Zaun heran. Jetzt sah sie die Frau, die reglos hinter der Absperrung stand und in die Luft starrte, während sie mit erhobenem Kopf sang. Gekleidet war sie in einer Art Hemd, das ihr um den mageren Körper schlotterte. Die Haare hingen ihr wirr auf die Schultern. Ein Schauer lief Anna über den Rücken.
Maikäfer flieg.
Dein Vater ist im Krieg.
Engeland ist abgebrannt.
Maikäfer flieg.
Plötzlich ertönte eine Sirene, Tumult entstand an den Baracken. Männer, mit Gewehren bewaffnet, schwärmten aus, und die Hunde, die sie mit sich führten, bellten und zerrten an ihrer Leine. Die Männer kamen schnell näher, griffen nach der mageren Frau, die in die Knie brach, doch sie wurde hochgezerrt und weggeschleift.
Anna war zwischen die Bäume zurückgewichen, ihr Herz klopfte zum Zerspringen, sie konnte kaum atmen, sich nicht bewegen. Sie spürte, wie sich die Härchen auf ihren Armen aufstellten, und doch konnte sie nicht weglaufen.
Da fiel ein Schuss, der die Stille zerriss, und dann ein zweiter. Anna erstarrte, dann drehte sie sich nach Hella um, doch die Hündin war nicht da. »Hella?«, flüsterte sie leise, nichts bewegte sich, kein Bellen, kein Lebenszeichen der Hündin. Sie hatte Hella einfach vergessen, als sie der Stimme der Frau gefolgt war. Da lief Anna in Panik durch die Bäume zurück, sah sich ängstlich um, lief immer weiter über die Wiesen mit dem blühenden Löwenzahn und noch weiter, bis die Hopfenfelder mit ihren hohen Stangen vor ihr auftauchten.
Keuchend blieb sie stehen und beugte ihren Oberkörper nach unten, um auszuatmen.
»Hella?«, rief sie jetzt leise und verzweifelt. »Wo steckst du?« Langsam kehrte sie wieder um, ging voller Furcht ein paar Schritte zurück. Zwei Schüsse waren gefallen, auf wen hatte man geschossen, etwa auf die Frau? Oder waren es nur Warnschüsse gewesen, und die Männer hatten auf etwas gezielt, das sich hinter dem Zaun bewegte? Voller Angst ging sie leise weiter.
»Hella? Hella?«, rief sie, sah sich dabei immer wieder furchtsam um.
Jetzt war sie wieder am Wald und fand schließlich die Hündin. Hella lag im hohen Gras, hob ihren Kopf, hechelte, und da sah Anna, dass das Tier am Bauch blutete.
»Hella«, flüsterte sie, »meine Hella.«
Ruhig bleiben, ganz ruhig, Hella darf deine Angst nicht spüren, ermahnte sie sich. Ruhig bleiben. Schließlich hatte niemand sie verfolgt. »Hella, alles ist gut, wir sind bald wieder zu Hause.« Anna kniete sich neben der Hündin ins Gras, zog die breiten Haarschleifen von ihren Zöpfen ab und umwickelte mit den Bändern die Wunde des Tieres am Bauch. Blut tränkte den weißen Taft sofort.
Behutsam nahm Anna das verletzte Tier hoch, flüsterte Koseworte in sein Ohr, bat Hella durchzuhalten, sie seien doch gleich daheim. Hella sah sie mit ihren treuen dunklen Augen an, und vorsichtig trug Anna sie nach Hause und übergab Nadja das blutende Tier.
Dann ließ sie sich auf einen Stuhl in der Diele fallen.
»Ich habe meinen Turnbeutel verloren«, schluchzte sie los.
Nach dem Gespräch mit ihrem Bruder hatte Maria keine Lust mehr, durch München zu flanieren, wie sie es sonst so gern tat. Heute ging sie direkt zur Haltestelle am Justizpalast und stieg bereits eine halbe Stunde vor Abfahrt in den Bus ein.
Sie hatte ihrem Bruder ein Versprechen gegeben, etwas zugesagt, das sie eigentlich nicht wollte. Aber sie hatte es getan, weil sie Philip liebte. Genauso wie sie wusste, dass sie sich ab heute große Sorgen um ihn machen würde. Er hatte nicht alles preisgegeben, aber es reichte aus, um sie mit großer Unruhe nach Hause fahren zu lassen.
Sie hatten sich im Café Tambosi getroffen, ein Vorschlag von Philip. Er war schon da gewesen, als Maria das Café betrat. Er saß am Fenster und stopfte gerade seine Pfeife, doch als seine Schwester an den Tisch trat, legte er sie auf dem Aschenbecher ab und erhob sich. Nach einer kurzen Umarmung nahm Maria ihm gegenüber Platz.
Philip wirkte nervös, er bestellte einen Kaffee für sie und einen Mokka für sich selbst, dann erkundigte er sich nach ihrem Mann. Maria erzählte, dass Werner in Krakau stationiert sei und beim deutschen Generalgouverneur Hans Frank ein und aus gehe.
»Frank residiert in der Burg oberhalb Krakaus«, erzählte sie weiter, erkannte dann aber, dass Philip ihr nicht wirklich zuhörte.
»Werner hatte mit seiner Einheit einen Einsatz bei Lublin gegen polnische Ulanen. Das muss schlimm gewesen sein. Er schrieb, es ginge hart her«, betonte sie. Jetzt war Philips ganze Aufmerksamkeit auf seine Schwester gerichtet.
»Höre ich da einen ironischen Unterton heraus?«
Maria zuckte die Schultern. »Es klingt so prahlerisch, findest du nicht?«
»Nein«, war Philips Antwort. »Im Gegenteil, er versucht, es ein wenig herunterzuspielen.«
»Meinst du?«
»Natürlich. Es muss furchtbar sein, tage- oder wochenlang zu warten, und plötzlich wirst du zu einem Einsatz abkommandiert, bei dem du erschossen oder in die Luft gesprengt werden kannst.«
»So habe ich es noch nicht gesehen«, gab sie leise zu.
»Hast du denn keine Angst um deinen Mann?« Philip sah sie mit seinem durchdringenden Blick an, dem »Familie-Kroll-Blick«, wie ihre Mutter Elsa ihn nannte. »Doch, doch natürlich«, erwiderte sie rasch, »aber der Krieg dauert ja nicht mehr lange.« Philip schüttelte ungläubig den Kopf. »Wie kommst du denn darauf?«
»Werner hat es geschrieben.«
Philip lachte auf. »Glaubt dein Mann das wirklich?«
Maria antwortete nicht, da die Kellnerin den Kaffee und den Mokka in einer kleinen silbernen Kanne brachte.
Schweigend tranken beide den ersten Schluck.
»Heiß«, bemerkte Philip, als er die winzige Mokkatasse auf den Unterteller zurückstellte. Maria nickte und beobachtete ihn nachdenklich. Warum war er so nervös, was wollte er mit ihr besprechen? Philip steckte die Pfeife zurück in seine Jackentasche, ohne geraucht zu haben.
Marias Bruder war drei Jahre älter als sie, etwas kleiner, fast zierlich. Er trug einen eleganten zweireihigen Nadelstreifenanzug, und seine Haare waren sorgfältig nach hinten gekämmt. Die beiden sahen sich ähnlich, die gleichen grauen Augen, der prüfende Blick, dem nichts verborgen blieb. Aber Philips Nase sprang aus dem schmalen Gesicht stärker hervor, der Mund war für einen Mann zu voll, zu weich. Er war nicht wirklich attraktiv, aber Maria wusste, dass er eine starke Anziehung auf Frauen ausübte und Leute für sich einnehmen konnte.
Philip war Anwalt, er hatte in München und Oxford studiert und auf der Universität in England seine Frau Vivien kennengelernt.
»Nun«, Maria hatte ihren Kaffee ausgetrunken und beugte sich über den Tisch zu ihrem Bruder, »warum wolltest du mich hier treffen? Warum diese Geheimniskrämerei?«
Philip beantwortete die Frage nicht, sondern wies mit dem Kinn durchs Fenster auf die Feldherrnhalle.
»Hast du es bemerkt?«
»Was meinst du?« Maria drehte sich um.
»Hast du gesehen, wie wenig Leute dort vorbeigehen?« Philip lachte kurz auf. »Sie drücken sich davor, zu salutieren, und machen einen Umweg durch die Viscardigasse.«
»Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe nicht so viel Zeit, Philip, also, warum wolltest du mich sprechen?«
Und da hatte Philip die Katze aus dem Sack gelassen. Maria fand keinen besseren Ausdruck für seine Bitte: Sie sollte seine Frau Vivien und die Tochter Antonia bei sich aufnehmen. »Zunächst nur bis Ende des Schuljahres, dann sehen wir weiter«, hatte er hastig hinzugefügt, als er ihre Ablehnung erkannte.
»Aber warum, Philip?« Maria war entsetzt gewesen, alles, nur nicht das! »Du weißt doch, dass viele Städter jetzt aufs Land ziehen, es herrscht geradezu eine Landflucht.«
Das entsprach der Wahrheit. Auch in ihrer Kreisstadt tauchten neue Gesichter auf. Freunde oder Verwandte der Einwohner, Leute, die aus Angst vor feindlichen Bombenangriffen bei ihren Verwandten unterkamen, da sie sich auf dem Land sicherer fühlten. Maria senkte den Kopf und starrte auf ihre Hände, die sie nervös faltete und wieder öffnete. Ein Film spulte sich in ihrem Kopf ab. Vivien, die kühle selbstsichere Schwägerin, die Fünf-Uhr-Tees veranstaltete, als lebe sie im viktorianischen England, die mit Philip in einer eleganten großen Wohnung in der Widenmayerstraße wohnte. Sie sah Vivien geradezu vor sich, wie sie ihre Teetasse hob, ihre seidenbestrumpften Beine übereinanderschlug und sich mit ihrem kühlen englischen Lächeln den Gästen zuwandte. Und der Film lief weiter, ihr eigenes kleines Haus in der Kreisstadt mit einer Küche, hinter dessen weißem Schrank die Badewanne installiert war, dann ihr Wohnzimmer gegenüber. Die Biedermeiermöbel, ein Geschenk ihres Vaters zur Hochzeit, gedacht für einen großen Raum, waren eng gestellt, so dass man sich am Sofa vorbeiquetschen musste, wenn man am großen Tisch Platz nehmen wollte. Dadurch hatten die Möbel jeden Charme und jeden Stil verloren, vor allem, da Maria ihren geliebten Flügel mit nach Bayern gebracht hatte, der nun in der Ecke des Biedermeierzimmers stand, so dass man die Tür nur einen Spalt breit öffnen konnte. Und dann noch die Hirschgeweihe im Arbeitszimmer von Werner, der leidenschaftlicher Jäger war. Die spöttische Reaktion ihrer Schwägerin konnte sie jetzt schon ahnen. »Und was sagt Vivien zu deinem Plan?«, fragte sie.
»Sie ist einverstanden, sonst hätte ich dich nicht gefragt.« »Und Antonia?«, hatte Maria noch dagegengehalten. »Das Schuljahr endet am 30. Juli, und jetzt ist bereits Mai, das wird für sie sehr schwierig werden.«
»Sie schafft das schon, glaube mir. Bitte Maria, es muss einfach sein.«
»Es muss einfach sein?«, wiederholte Maria argwöhnisch. »Wieso?«
Philip sah sich vorsichtig um, als habe er Zuhörer, und sprach dann weiter: »Neulich waren ein paar Herren von der Gestapo bei uns und haben Fragen gestellt, da Vivien doch Engländerin ist. Vielleicht hatten sie den Verdacht, sie sei eine feindliche Spionin.« Philip hatte gelacht, es sollte leicht, ein wenig ironisch klingen, doch Maria hörte große Sorge aus seiner Stimme heraus.
»Aber Vivien ist doch deutsche Staatsbürgerin und hat auch keinen Kontakt zu ihrer Familie in England.«
»Das schon, aber es ist einfach besser, wenn sie nicht mehr hier ist. Offiziell trennen wir uns«, hatte Philip noch hinzugefügt.
»Und wenn die örtliche Gestapo bei mir auftaucht?«, war Marias große Sorge.
Philip ließ sich mit der Antwort Zeit, goss den Rest des Mokkas in seine Tasse und nahm einen weiteren Schluck. »Ich denke nicht«, hatte er erklärt, »dein Mann ist Offizier der Wehrmacht, ist mit eurem Grafen von Zell befreundet und hat viele Bekannte bei euch in der Stadt, viele, die meisten sind in der Partei.«
»Und Nadja? Sie ist Russin«, vergebens suchte Maria ein Argument, um Philip von seinem Plan abzubringen.
»Sie gilt als euer Dienstmädchen und ist doch schon seit Jahren bei euch.«
»Sie ist mehr als mein Dienstmädchen«, hatte Maria heftig protestiert. »Irgendwie gehört sie doch längst zu uns.«
Philip hatte nichts gelten lassen. Jedes Argument konnte er entkräften. Das Einzige, was er ihr einschärfte, war, vorsichtig zu sein. Auch wenn Vivien und Antonia einwandfrei deutsch sprachen, sollte niemand erfahren, dass Vivien Engländerin war. »Bevor sie bei euch eintreffen, musst du noch mit Anna sprechen, aber sie ist ja ein vernünftiges Mädchen.«
»Findest du?« Philips Bemerkung hatte Maria überrascht. Sie hatte ihre Tochter noch nie als vernünftig eingestuft, alles, nur nicht das. Rebellisch, eigensinnig, nachlässig, was ihr Äußeres betraf, stets in eigenen Gedanken versunken. Aber vernünftig?
Philip war ungeduldig geworden. »Maria! Lass mich nicht so lange betteln. Ich weiß, du und Vivien, ihr habt keinen Draht zueinander, aber ich brauche dich, Maria. Es geht nicht nur um meine Familie, ich brauche deine Hilfe.«
Philip hatte die richtigen Worte gefunden.
Er sah sich vorsichtig um, dann beugte er sich zu seiner Schwester vor und sprach im Flüsterton weiter.
»Es ist eine politische Geschichte, mehr brauchst du nicht zu wissen. Ich bitte dich nur um diese eine Sache.«
Maria erschrak. Philip war nicht nur Anwalt und Reserveoffizier, sondern gehörte auch zum Wehrkreis VII. Er war dort als Dolmetscher im Einsatz. Befand er sich in Schwierigkeiten? »Gibt es etwas, das ich wissen sollte?«
Als er schwieg, stieg der Verdacht in ihr auf, er wolle seine Familie nur aus dem Haus haben, um frei zu sein.
»Hast du eine Geliebte?«, fragte sie ihn misstrauisch.
Lächelnd hatte Philip den Kopf geschüttelt.
»Nein, nein, wirklich nicht. Ich liebe Vivien. Aber lass mich nicht so lange betteln.«
Da erwiderte Maria heftig: »Nein, entweder du sagst mir die Wahrheit, oder ich mache gar nichts. Ich muss wissen, um was es geht.«
Philip schwieg und schien mit sich zu kämpfen.
»Also«, wieder sah er sich um, während er sprach, »in der nächsten Zeit werde ich Leute bei mir aufnehmen, die auf der Fahndungsliste der NSDAP stehen, vor allem Juden. Und zwar so lange, bis Freunde von mir ihnen Papiere beschafft haben und sie heimlich über die Grenze bringen. Verstehst du jetzt? Alle, die daran beteiligt sind, müssen sich unauffällig bewegen können, dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Und aus diesem Grund ist es besser, dass ich mich von meiner englischen Ehefrau trenne.«
»Und Vivien ist damit wirklich einverstanden?« Maria hatte es kaum glauben können.
»Ja, das ist sie. Sie steht zu mir, und auch sie will helfen. Wie gesagt«, hatte er noch rasch ergänzt, »das alles gilt erst einmal bis Ende des Schuljahrs. Dann werden wir weitersehen.« Zusammen hatten sie das Café verlassen, und als sie sich verabschiedeten, hatte Philip Maria fest umarmt, als wolle er sie nicht loslassen.
»Du weißt, dass du über alles, was ich dir gerade erzählt habe, mit niemandem sprechen darfst. Auch nicht mit deinem Mann.«
Und Maria hatte es versprochen, in tiefer Unruhe und Angst um ihren Bruder.
Und jetzt also saß sie im Bus und beobachtete durch das Fenster, wie die letzten Fahrgäste einstiegen, bevor sich der Bus langsam in Bewegung setzte. Wo sollte Vivien überhaupt schlafen? Und Antonia? Niemals hätte sie sich träumen lassen, einmal mit Philips Frau und seiner Tochter unter einem Dach zu leben. Sie hatte sich der selbstsicheren kühlen Vivien immer schon unterlegen gefühlt.
Dazu kam noch eine gewisse Sorge, tägliche Gefahr sogar, ständige Vorsicht.
Der Bus bog jetzt in die Landstraße ein, und da erst griff sie in die Tasche und holte Werners Brief heraus.
Liebes Mariele,
was das Wetter betrifft, haben wir immer noch keinen Frühling.
Wir hatten vorige Woche zwei Tage über null Grad, Sonnenschein und daher auch Tauwetter. Die Folgen waren verheerend. Überschwemmungen, die Weichselbrücken wurden vom Eis mitgenommen, Bahndämme fortgespült, Straßen und Gehöfte standen unter Wasser. Unsere Einheit war im Dauereinsatz. Was es hier für Pioniere zu tun gibt, kannst Du Dir vorstellen.
Und plötzlich kam die Kälte zurück. Über dem Wasser lag durch den nächtlichen Frost eine dünne Eisschicht, vor mir brach einer meiner Leute ein, der trotz Rettungsversuchen nur noch tot geborgen werden konnte.
Ein Sturm hatte sich erhoben, man sah kaum drei Meter weit, jeden Augenblick brach einer meiner Männer auf seinem Pferd ein, und stand dann bis zur Brust im Wasser. Die Pferde wieherten, wurden unruhig, sie schreien, bekommen einen Koller, machen sich los, und rennen querfeldein. An den Fahrzeugen reißen die Stränge, brechen Deichseln. Aber man muss durch. Dann kommt das Schlimmste, die Müdigkeit, die Apathie. Und dann sinkst du ein, du spürst das kalte Wasser, es steigt hoch, und dann wurde ich aus dem Wasser gezogen, in eine Decke geschlagen, auf eine Trage gelegt.
Irgendwo tauchten dann einige der Pferde auf, von einer Eisschicht überzogen, sie sahen aus wie Eisbären …
Die Erlebnisse der letzten Tage, wie auch der Einsatz in Lublin waren voller Schrecken, doch es erscheint seltsam, wie schnell man vergessen kann.
Aber wie ich Dir schon im letzten Brief schrieb, dauert der Krieg nicht mehr lange, und ich komme für immer nach Hause.
In großer Liebe
Werner
Langsam faltete Maria den zerknitterten Brief zusammen und steckte ihn in die Tasche zurück. Wieso glaubte Werner, der Krieg sei bald vorbei? Und was war dann? Wie ging es weiter? Wie ging es mit ihnen beiden weiter? Zu viele Spannungen hatten schon vor Beginn des Krieges zwischen ihnen gestanden.
Mit neunzehn Jahren, direkt nach ihrer Hochzeit, hatte sie noch an die Beständigkeit ihrer Liebe geglaubt, aber dem Alltag in der bayrischen Kleinstadt nicht standhalten können. Werner war als Forstrat der Regierung hierher versetzt worden, und sie ging mit. Aus Liebe zu ihm. Werner fühlte sich wohl, tagelang ging er mit dem Grafen von Zell und anderen Männern auf die Jagd, während sie sich mit dem alten Haus und dem verwilderten Garten herumplagen musste.
Philip hatte sie heute gefragt, ob sie keine Angst um ihren Mann habe. Sie hatte sich herausgeredet. Wieso konnte sie nicht einfach sagen: Doch, ich habe Angst um ihn, auch wenn ich oft an ihm, an unserer Liebe zweifle? Maria legte den Kopf an die Fensterscheibe und sah hinaus in den Himmel, der sich langsam verfärbte. Das Blau wich der Dämmerung, die sich friedlich über die Hopfenfelder senkte. So weit ab von Krieg, Tod und Verfolgung.
Philip Kroll ließ seiner Schwester kaum Zeit, um Vorbereitungen für den langen Besuch seiner Familie zu treffen. Bis zum Ende des Schuljahres hatte er gesagt, das waren noch fast drei Monate. Bereits vier Tage nach ihrem Gespräch hielt ein alter Mercedes in der Adolf-Hitler-Straße 9. Peter Lessing, Philips bester Freund, hatte sich bereit erklärt, Vivien und ihre Tochter mit dem Auto hierherzubringen.
Maria und Anna standen am Gartentor und warteten, bis die drei ausgestiegen waren. Anna griff unsicher nach der Hand ihrer Mutter, und Maria drückte sie fest. Sie signalisierte ihrer Tochter eine Sicherheit, die sie selbst nicht empfand.
Philip hatte sie am Tag zuvor angerufen und seine Familie angekündigt. Maria war sehr enttäuscht gewesen, dass er selbst nicht mitkam.
»Es tut mir leid, ich kann hier nicht weg«, hatte er bedauert.
Peter Lessing holte das Gepäck aus dem Kofferraum und verabschiedete sich von Vivien mit einem raschen Kuss auf die Wange, Antonia reichte ihm mit einem Knicks die Hand. Sie sah entzückend aus in ihrem karierten Faltenrock und der hellen Bluse. Ihre langen blonden Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. An den Füßen trug sie weiße Söckchen und schwarze Lackschuhe. Maria wünschte sich, dass ihre Tochter nur ein einziges Mal so artig und hübsch aussehen würde wie ihre Cousine. Sie warf einen raschen Blick auf Anna, an deren Kleid bereits wieder der Saum heruntergerissen war und deren Zöpfe sich auflösten. Eine Schleife fehlte. Annas schmales Gesicht mit dem spitzen Kinn war ihrer Cousine zugewandt, und ihre leicht schrägen Augen schienen jede Bewegung von Antonia zu verfolgen. Peter Lessing kam noch kurz ans Gartentor und begrüßte Maria. Ihre Einladung, mit ihnen Kaffee zu trinken, lehnte er mit Bedauern ab, er müsse leider zurück. Gehörte auch er dem Wehrkreis VII an?
Er winkte noch einmal und fuhr dann ab.
Vivien hob ihren Koffer hoch und ging die paar Schritte auf Maria zu. Sie trug ein hellgraues Kostüm, dazu eine gestreifte Bluse und einen Hut, der schräg auf dem Kopf saß. War das modern oder war er nur verrutscht? Maria interessierte sich nicht für Mode, musste aber zugeben, dass ihre Schwägerin faszinierend aussah. Aber warum kam Vivien so elegant gekleidet aufs Land?
Vivien sei apart, so hatte Philip seine Verlobte vor vielen Jahren beschrieben. Interessant dazu, intelligent und sehr gebildet. Schon beim ersten Kennenlernen der kühlen Engländerin hatte Maria sich ihr unterlegen gefühlt, und bei jedem Treffen schaffte es ihre Schwägerin, dieses Gefühl aufs Neue bei Maria hervorzurufen.
Und immer wieder beneidete Maria Vivien, sie war eine der ersten Frauen gewesen, die in England auf einer Eliteuniversität studierten, während sie, Maria, sich nach dem Abitur für ein Leben als Hausfrau und Mutter entschieden hatte. War es das, was sie so sehr bereute? Nahm sie es Werner übel, dass sie ihn geheiratet hatte?
Auch Maria hatte sich heute gut angezogen, doch ihr wurde jetzt bewusst, dass sie mit Vivien nicht mithalten konnte. Ihr blaues Kleid erschien ihr hoffnungslos altmodisch. Außerdem hatten ihre Haare sich am Morgen ganz besonders schlecht frisieren lassen und lösten sich bereits wieder aus dem Knoten. Aber als Vivien sich höflich bedankte, dass sie hier wohnen dürfe, schoss Maria der Gedanke durch den Kopf, dass sie vielleicht nicht die Einzige war, die heute einen guten Eindruck machen wollte. Konnte es sein, dass sich hinter Viviens kühler Fassade Unsicherheit verbarg? Wollte auch sie sich bei Maria von ihrer besten Seite zeigen?
Dieser Gedanke beschäftigte Maria noch, während sie ihre Nichte begrüßte und die beiden ins Haus bat. Vivien kannte das Haus der Richters von ein paar kurzen Besuchen, die bereits Jahre zurücklagen. Danach war es stets Maria gewesen, die nach München kam. Jetzt blieb Vivien auf der obersten der halb zerfallenen Steinstufen stehen. Staunend sah sie sich um.
»Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie malerisch dieses Haus ist, und dann noch der verwunschene Garten!«, rief sie aus.
»Eher verwahrlost«, stellte Maria in nüchternem Ton richtig. Sie warf noch einen raschen Blick auf das Nachbarhaus. Frau Hofer stand am Zaun und zeigte ungeniert ihr Interesse am Geschehen.
Drinnen an der offenen Küchentür wartete Nadja auf die neuen Mitbewohner. Auch sie hatte sich für den Besuch besonders schön gemacht. Sie trug ein geblümtes Kleid, das ihr Maria im vergangenen Sommer im Textilhaus Bohnenberger gekauft hatte. Es stand ihr sehr gut zu ihren dunklen Haaren, die sie zu Zöpfen geflochten und wie eine Krone aufgesteckt trug. Am Tag zuvor hatte sie einen russischen Zupfkuchen gebacken, den sie Vivien und Antonia präsentierte.
»Dobro pozhalovat, herzlich willkommen«, sagte sie und machte einen tiefen Knicks. Maria lächelte ihr dankbar zu. Nadja verstand es, auf eine herzliche und außergewöhnliche Art die neuen Mitbewohner zu überraschen und ihnen das Gefühl zu geben, wirklich willkommen zu sein.
»Oh, der sieht ja herrlich aus«, rief Vivien etwas zu laut. »Da kommt man sich vor wie in einem Roman von Leo Tolstoi. Dieses wunderbare Haus mit der bewachsenen Veranda davor, der verwunschene Garten, Nadja, der Kuchen, die alte Küche … hinreißend.« Maria warf ihrer Schwägerin, die sich einmal um sich selbst drehte, einen misstrauischen Blick zu. War das ehrlich gemeint, oder glaubte Vivien, hier alles gut finden zu müssen?
Anna stand ein wenig abseits, bis Maria sie bat, Antonia ihr Zimmer zu zeigen.
»Die beiden wohnen zusammen, und du bekommst das Gästezimmer im Erdgeschoss«, wandte sie sich an ihre Schwägerin. Jetzt erst kam Hella verschlafen aus ihrem Korb in der Küche angetrabt. Als Antonia sie sah, stieß sie einen kleinen Entzückensschrei aus, beugte sich zu der Hündin hinunter und streichelte sie. »Der ist ja süß und so lieb. Aber warum hat er einen Verband um den Bauch?«
»Nun …«, Anna brach ab und sah zu ihrer Mutter. Durfte sie erzählen, was passiert war?
»Hella hat sich verletzt, nicht schlimm«, erklärte Maria rasch. »Eine kleine Wunde, die genäht werden musste, aber es geht ihr gut.«
»Ich habe mir immer einen Hund gewünscht.« Antonia sah zu Anna hoch und kraulte die willige Hella hinter den Ohren. Anna lächelte, sie freute sich. Es gab also etwas, das sie besaß und Antonia nicht, das vermittelte Anna ein gutes Gefühl. »Es ist eine sie«, erklärte sie in leicht überlegenem Ton.
»Wenn ihr ausgepackt habt, trinken wir Kaffee. Komm Vivien, ich zeige dir dein Zimmer«, erklärte Maria jetzt. Während sie ihre Schwägerin den Gang nach hinten führte und Hella hinter ihnen her trottete, stieg Anna mit ihrer Cousine die Treppe hoch. Sie führte Antonia in ihr Zimmer, das sie sich ab sofort teilen mussten.
»Das ist deins«, erklärte sie Antonia und wies auf das Bett, das an der Wand neben der Tür stand. »Und die rechte Hälfte des Schranks habe ich für dich ausgeräumt.«
Antonia sah sich um. »Ein nettes Zimmer, wirklich«, betonte sie höflich. Sie nahm ihren Koffer und legte ihn auf ihr Bett. Sie konnte nicht ahnen, wie Maria, Nadja und auch Anna in den drei vergangenen Tagen geschuftet hatten. Die Möbel und Kisten aus dem leergeräumten Speicher hatten im Gästezimmer gestanden, jetzt türmten sie sich in Werners Arbeitszimmer. Maria und Nadja hatten bis in die Nacht hinein gearbeitet, um das Gästezimmer für Vivien wohnlich zu machen. Das Bett für Antonia hatten sie in Einzelteile zerlegt und in Annas Zimmer zusammengesetzt, was erst nach vielen Mühen gelungen war.
»Du darfst dich im Bett nicht zu sehr bewegen«, erklärte Anna, »beim Zusammensetzen ist es einmal zusammengekracht. Nicht, dass dir das passiert, wenn du drinliegst.«
»Ich bin eine ruhige Schläferin«, erklärte Antonia und öffnete ihren Koffer.
Anna setzte sich auf ihr Bett und beobachtete Antonia beim Auspacken.
»Ich habe Kleiderbügel mitgebracht«, erklärte Antonia und drehte sich zu Anna um. »Mummy meinte, das sei besser so.«
»Du sollst deine Mutter nicht so nennen«, ermahnte Anna sie ernsthaft. »Niemand darf wissen, dass ihr Engländer seid, das weißt du doch, das ist sehr gefährlich. Auch wenn ihr beide perfekt deutsch sprecht«, fügte sie noch hinzu.
»Ja, ja, ich passe schon auf.« Antonia reagierte ein wenig ungeduldig, packte schweigend weiter aus und kam dann jedoch zu Anna und setzte sich neben sie. »Du hast ja recht«, lenkte sie ein. »In meiner alten Schule war das bekannt, und ich wurde deswegen angefeindet. Es ist schön, jetzt hier zu sein«, fügte sie leise hinzu. »Und euer Haus gefällt mir, es ist ein so besonderes Haus.«
Anna wusste zuerst nicht, ob Antonia sich lustig machte, doch dann erkannte sie, dass ihre Cousine es ernst meinte. Da atmete sie erleichtert auf. Sie hatte alles erwartet, vor allem jene gewisse Hochnäsigkeit, die Antonia ihr gegenüber jedes Mal an den Tag gelegt hatte, wenn Anna ihre Cousine in München in ihr großes Zimmer führte. Aber Antonia gefiel offenbar dieses Haus. Noch kannte sie allerdings nicht alle Räume, noch wusste sie nicht, dass sich die Badewanne in der Küche hinter dem Schrank befand.
Antonia erhob sich wieder, ging zu ihrem Bett, und während sie weiterauspackte, erzählte sie, dass ihre Mutter sie bereits auf dem Mädchengymnasium angemeldet habe.
»Aber du gehst in die Klasse über mir«, erklärte Anna.
»Das weiß ich, und das ist sehr schade«, meinte Antonia bedauernd, und wieder fragte sich Anna, ob das jetzt alles echt war oder ob ihre Cousine ihr nur Theater vorspielte.
Sie beobachtete Antonia misstrauisch, die als Letztes ihre BDM-Uniform auf einen Bügel hängte.
»Wie ist es hier so beim BDM?«, fragte sie dabei.
»Ich gehöre nicht dazu«, erklärte Anna mürrisch.
»Ach ja, du bist ja erst dreizehn.«
»Ich bin froh, dass ich noch nicht zum BDM muss. Die machen dauernd Gymnastik, spielen Völkerball und lauter solches Zeug, und dann wird auch noch ständig gesungen.«
»Das mussten wir in München auch machen, aber vieles macht doch Spaß.«
»Wenn du meinst.« Anna blieb einsilbig.
»Aber im Sommer bist du dann auch vierzehn.«
»Ja, schon. Da macht der BDM immer Ausflüge ins Gebirge. Sie steigen auf eine Alm, auf der übernachtet wird. Abends wird gesungen und Fahnen geschwungen. Das sieht dann so aus.« Anna sprang auf, stellte sich in Positur, schwenkte ihre Arme über ihren Kopf hin und her. Ihre Darstellung einer Fahnenträgerin war so gut, dass Antonia lachen musste.
»Weißt du«, erzählte sie dann, »einmal haben wir einen Ausflug an den Starnberger See gemacht, da mussten wir in unserer Uniform durch die Gegend marschieren und das Lied ›Unsere Fahne flattert uns voraus‹ singen. Das war so peinlich.«
»Schrecklich«, antwortete Anna, aus tiefstem Herzen schockiert.
»Manches ist aber auch ganz interessant, wir lernen kochen und wie man als verheiratete Frau den Haushalt führt.«
»Das klingt ja noch schrecklicher.« Anna war entsetzt. »Ich will sowieso nicht heiraten«, erklärte sie dann.
»Wirklich nicht?«, Antonias Verwunderung war echt, wie ihre Cousine erkannte.
Anna zuckte mit den Schultern. »Mal sehen«, erklärte sie dann spröde. »Aber weißt du«, erzählte sie weiter, »hier auf dem Land helfen viele BDM-Mädchen bei der Ernte. Ich durfte auch schon mitmachen, da ich die Bauern kenne. Und das macht Spaß. Weißt du, wie man Spargel sticht?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Siehst du, ihr in der Stadt wisst auch nicht alles, auch wenn ihr in die Oper geht und dauernd eingeladen werdet.« Antonia überging diese Anspielungen auf ihre früheren Prahlereien über das Stadtleben.
»Und wo hast du das schon gemacht?«
»Ich arbeite in der Saison beim Spargelbauern Hoffelder«, erklärte Anna. »Schon seit drei Jahren.«
»Und machst du das umsonst?«
Anna wurde unsicher. Was war jetzt die beste Antwort, um die Achtung ihrer Cousine zu gewinnen?
Dann aber blieb sie bei der Wahrheit. »Wir bekommen abends Spargel mit nach Hause, so viel wir wollen. Aber dieses Jahr«, hier zögerte Anna, »darf ich nicht, weil so viele Jungen aus der HJ dazu abkommandiert wurden.«
»Und was tragen die Mädchen, wenn sie auf die Alm gehen?« Antonia kam auf die Gebirgswanderungen im Sommer zurück.
Typisch, schoss es Anna durch den Kopf, genauso eitel wie ihre Mutter. Viviens Eleganz, ihre lackierten Fingernägel hatten Maria schon oft zu abfälligen Bemerkungen verleitet, die Anna aufnahm und so ihr Bild von der Tante prägten.
»Natürlich Dirndl«, erklärte sie dann. »Hast du eines?«
»Ja, aber nicht hier. Und in den großen Ferien fahre ich vielleicht zu Oma, sie hat mich eingeladen.«
»Mich auch, aber ich will nicht hinfahren.«
»Warum nicht?«
»Opa ist so streng. Man muss sich ständig gut benehmen, sogar einen Knicks machen, als ob ich noch klein wäre«, empörte sich Anna. »Und man kann nie aus dem Haus gehen, ohne zu sagen, wohin man will. Außerdem ist es in der Stadt langweilig.«
»Vielleicht hast du recht. Aber ich mag Oma so gern«, antwortete Antonia. »Und jetzt sind wir ja erst einmal hier und bleiben eine Weile.«
»Wirst du deinen Vater vermissen?«, fragte Anna neugierig.
»Ja«, antwortete Antonia leise, während sie sich neben ihren Koffer aufs Bett setzte. »Ja, sehr, und ich habe auch Angst um ihn.«
»Wieso, er ist doch nur Reserveoffizier und nicht an der Front wie mein Papa.«
»Ja, schon, aber trotzdem, meine Eltern reden viel, und wenn ich dann ins Zimmer komme, verstummen sie, aber neulich habe ich sie belauscht.«
»Und?«
»Ich habe gehört, dass morgen Abend die Schlesingers zu uns kommen. Daddy versteckt sie bis zu ihrer Flucht aus Deutschland.«
»Und deswegen hast du Angst?«
»Ja, es ist gefährlich, das hat Daddy gesagt. Aber du darfst es nicht weitersagen, versprich es mir.«
»Ich verspreche es. Und weil das so gefährlich ist, wohnt ihr jetzt bei uns?«, fragte Anna erstaunt.
Antonia nickte. »Ich denke, ja.«
»Das wusste ich gar nicht«, wunderte sich Anna. »Meine Mutter hat mir erzählt, ihr kommt für eine Weile hierher, weil es auf dem Land sicherer ist als in der Stadt.«
»Siehst du, da weiß ich mehr als du«, erklärte Antonia ein wenig überheblich.
»Ja, weil du deine Eltern belauschst.«
»Machst du das nie?« Antonia war erstaunt.
»Weißt du«, antwortete Anna nachdenklich, »meine Eltern sprechen manchmal Französisch miteinander. Dann weiß ich, dass sie über Dinge reden, die ich nicht wissen darf.«
Die beiden Mädchen verstummten und saßen sich reglos gegenüber, jede auf ihrem Bett.
Da wurde die Tür geöffnet, und Maria steckte den Kopf herein, noch mehr Haare hatten sich aus ihrem Knoten gelöst, und ihre Wangen waren stark gerötet.
»Ich habe gerufen, habt ihr es nicht gehört? Antonia, deine Mutter hat frischen Bohnenkaffee aus München mitgebracht, und Nadja mahlt ihn gerade, kommt ihr? Wir wollen Kuchen essen.«
»Ja, wir kommen.«
Schon hastete Maria nervös die Treppe hinunter, und die Mädchen folgten ihr. Unten vor dem Biedermeierzimmer blieb Anna stehen und sah ihre Cousine eindringlich an.
»Sag nie wieder Daddy oder Mummy, hörst du?«
Antonia nickte ernst. »Du hast recht, ich muss aufpassen.«
»Ich werde auch auf dich aufpassen«, antwortete Anna ernsthaft. »Ich verspreche es.«
Und Antonia glaubte, wenn Anna etwas versprach, dann hielt sie es auch.
Maria beobachtete Vivien mit großer Sympathie. Die Frau ihres Bruders hatte sich die Haare gewaschen, fuhr sich jetzt mit dem Kamm durchs nasse Haar. Sie lächelten sich an, beide erstaunt, wie gut sie sich vertrugen, wie gut sich auch Vivien den gegebenen, den primitiven – wie Maria sie nannte – Lebensumständen angepasst hatte.
Was sie früher nie gedacht hatten, ein Zusammenleben funktionierte. Aber das kam nur zustande, weil sie beide von Anfang an bereit waren, Kompromisse zu machen. Beide aus Liebe zu Philip. Und dieses Gefühl verband Maria und Vivien, schuf eine Nähe zwischen ihnen, von der sie niemals geglaubt hätten, dass sie entstehen könnte. Sie waren sehr verschieden, aber vielleicht vertrugen sie sich gerade deswegen gut, überlegte Maria. Sie ergänzten sich. Maria, die vor jedem neuen Tag eine gewisse Angst verspürte, den täglichen Anforderungen nicht gewachsen zu sein, und Vivien, lebhaft, voll Energie, die sich in die ungewohnte Arbeit stürzte. Ob das anhielt?, überlegte Maria weiter. Nun, man musste es abwarten. Jedenfalls war es schön, sie hier zu haben.