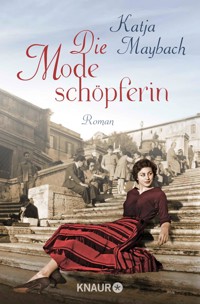9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mütter und Töchter
- Sprache: Deutsch
Der Mut der Frauen: Liebe und Leid in den Nachkriegsjahren In ihrem neuen Roman "Die Zeit der Töchter" erzählt Katja Maybach die dramatische Familiengeschichte ihres Bestsellers "Die Stunde unserer Mütter" weiter. Maria und Vivien haben den Krieg überstanden, ihre Töchter entdecken im München der 50er-Jahre das Leben. Doch während Anna und Antonia heimlich ein Wiedersehen ihrer Mütter mit den Frauen vorbereiten, die sie bei Kriegsende aus dem Lager retten konnten, sehen Maria und Vivien sich erneut Anfeindungen ausgesetzt: Ihr Einsatz für Flüchtlinge aus dem Osten sowie die sogenannten »Besatzungs-Kinder« führt immer wieder zu teils handgreiflichen Auseinandersetzungen. Als dann auch noch eine junge Ostpreußin auftaucht, deren Kind offensichtlich einen dunkelhäutigen Vater hat, bahnt sich eine Katastrophe an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Katja Maybach
Die Zeit der Töchter
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Mut der Frauen: Liebe und Leid in den Nachkriegsjahren
In ihrem neuen Roman »Die Zeit der Töchter« erzählt Katja Maybach die dramatische Familiengeschichte ihres Bestsellers »Die Stunde unserer Mütter« weiter.
Maria und Vivien haben den Krieg überstanden, ihre Töchter entdecken im München der 50er-Jahre das Leben. Doch während Anna und Antonia heimlich ein Wiedersehen ihrer Mütter mit den Frauen vorbereiten, die sie bei Kriegsende aus dem Lager retten konnten, sehen Maria und Vivien sich erneut Anfeindungen ausgesetzt: Ihr Einsatz für Flüchtlinge aus dem Osten sowie die sogenannten »Besatzungs-Kinder« führt immer wieder zu teils handgreiflichen Auseinandersetzungen. Als dann auch noch eine junge Ostpreußin auftaucht, deren Kind offensichtlich einen dunkelhäutigen Vater hat, bahnt sich eine Katastrophe an.
Inhaltsübersicht
Widmung
München 1957
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Kapitel einundvierzig
Kapitel zweiundvierzig
Kapitel dreiundvierzig
Kapitel vierundvierzig
Kapitel fünfundvierzig
Kapitel sechsundvierzig
Kapitel siebenundvierzig
Kapitel achtundvierzig
Kapitel neunundvierzig
Danksagung
Für meine Mutter
München 1957
Kapitel eins
Der Zug aus Wien fuhr mit quietschenden Bremsen im Münchner Hauptbahnhof ein. Die Türen öffneten sich, die Reisenden stiegen aus und umarmten ihre Freunde oder Verwandten, lachten oder weinten, Blumen wurden von den Wartenden überreicht. Langsam zerstreuten sie sich. Der Schaffner lief an den Waggons entlang und warf die Türen zu.
Anna stand noch auf dem Bahnsteig, der sich immer mehr leerte. Jetzt erst nahm sie ihren Koffer hoch, verließ den Bahnsteig, blieb in der Bahnhofshalle stehen und sah sich um. Weitere Züge kamen an, Leute liefen aufeinander zu, drängelten sich an ihr vorbei.
Eine Stimme im Lautsprecher kündigte die Verspätung des Zuges aus Hamburg an.
Anna ging langsam an den Gleisen entlang. Sie hatte vergessen, wo damals genau ihr Vater abgefahren war. Vor diesem Moment ihrer Ankunft hier hatte sie sich gefürchtet, hatte geglaubt, dass die Erinnerungen sie überwältigen könnten. Aber nichts passierte. Sie brach nicht in Tränen aus, denn der Bahnhof heute erinnerte nicht an die gespenstische Stille, die am 13. Juni 1942 über der Halle gelegen hatte. Damals hatte Anna mit ihrer Mutter an dem blumengeschmückten Zug gestanden, der die vielen Soldaten nach Russland brachte.
Dieser Moment hatte über die Jahre an Schärfe verloren, wirkte jetzt verschwommen. Einer der wichtigsten Augenblicke ihres Lebens war im Laufe der Zeit verblasst, so sehr, dass sie sogar jetzt, da sie hier stand, nichts mehr empfand.
Anna fröstelte. Es war ein regnerischer Sonntagnachmittag, und sie musste an die Gegenwart denken, die kompliziert genug war. Gleich würde sie ihrer Cousine Antonia gegenüberstehen und sich noch einmal dafür bedanken, während ihres Engagements am Residenztheater bei ihr wohnen zu dürfen. »Ich bin so stolz auf dich«, hatte Antonia ihr am Telefon erklärt. »Meine Cousine, eine berühmte Schauspielerin aus Wien, wohnt bei mir.«
Antonia hatte angeboten, Anna am Bahnhof abzuholen, doch die lehnte ab. Ein Wiedersehen nach so vielen Jahren auf einem kalten, zugigen Bahnsteig erschien ihr besonders schwierig, und Antonia hatte offenbar das Gleiche empfunden.
Anna spürte ihre eiskalten Füße. Im Zug war die Heizung ausgefallen, und an ihren Schuhen waren die Sohlen durchgelaufen. Sie sah sich um. Sie könnte noch schnell irgendwo einen heißen Tee trinken, den Moment der Wahrheit hinauszögern. So betrat sie kurz entschlossen einen der Wartebereiche, über dem der Name stand: Europasaal. Sie setzte sich an einen der Tische zwischen jeweils zwei hohen Sofas aus rotem Kunstleder. Hier warteten Reisende auf die Abfahrt ihres Zuges oder Angehörige, die zu früh am Bahnhof waren, um Freunde oder Familie abzuholen. Manche trafen sich auch einfach nur hier.
Als die Kellnerin an den Tisch kam, bestellte Anna keinen Tee, sondern einen Kognak.
»Einen französischen oder einen deutschen, Fräulein?«
Anna lächelte. Sie war dreißig, und die Anrede Fräulein bewies, dass sie vielleicht doch jünger wirkte. »Einen deutschen, bitte.«
Er war nicht so teuer wie der französische, doch er würde sie wärmen und ihr ein wenig Mut machen, bevor sie gleich Antonia gegenüberstand. Vor elf Jahren hatten sie sich tränenreich in den Armen gelegen und ewige Freundschaft geschworen.
Sie hatten sich gegenseitig besuchen wollen, einander schreiben, die Verbindung halten. In den schwierigen Kriegsjahren waren sie miteinander aufgewachsen, hatten sich ein Zimmer geteilt: zwei junge Mädchen zwischen Kindheit und Erwachsenwerden. Was war davon geblieben? Ein Briefwechsel, zuerst ellenlange Erzählungen, Austausch ihrer Erlebnisse, ihrer Wünsche und Träume. Doch die Briefe wurden seltener, Besuche fanden nicht statt, die Zeit fehlte. Vielleicht auch der Antrieb, die durchlebten Enttäuschungen, die Anna davon abhielten, ihre Cousine einzuladen. Wohin auch? Es hätte bedeutet, ihre Situation preiszugeben: dass sie in einer schäbigen Künstlerpension lebte.
Aber auch Antonia blieb in ihren Einladungen nach München vage und halbherzig. Bis vor zwei Wochen, als Anna sie angerufen hatte. Anna hatte all ihren Mut zusammennehmen müssen, weil sie wusste, dass in dem noch teilweise zerstörten München große Wohnungsnot herrschte. Aber Antonia hatte sofort zugesagt. Sie schien sich zu freuen, dass Anna kam.
Gleich würde sie also in der Wohnung in der Widenmayerstraße ankommen, in der sie als Kind bereits mit ihrer Mutter zu Besuch gewesen war. Unwillkürlich blickte Anna an sich hinunter. Sie trug einen grauen, taillierten Mantel mit einem großen Persianerkragen, den sie in einem Laden gekauft hatte, in den auch bekannte Schauspielerinnen ihre Garderobe brachten. Der Mantel habe einmal Paula Wessely gehört, hatte der Inhaber mit großem Respekt erklärt. Er kostete kaum etwas, also nahm Anna ihn. Vielleicht verlieh der Mantel des Wiener Theaterstars auch ihr ein wenig Glanz.
Anna sah auf die Uhr. Antonia wusste, wann der Zug ankam, sie konnte sie nicht länger warten lassen. So erhob sie sich, zahlte, nahm den Koffer und ihre große Tasche und verließ den Europasaal, der sich jetzt immer mehr füllte. Sie durchquerte die zugige Halle und ging an den Gleisen entlang und in den Flügelbahnhof, den Starnberger Bahnhof, hinüber, vor dem die Straßenbahnen abfuhren.
Antonia stand vor dem Spiegel und beugte sich ihm entgegen. Sie hatte sich das Gesicht gepudert, um die Narbe zu verdecken, die sich von der Oberlippe bis zur Nase zog. Seufzend sah sie sich an. Dann aber schüttelte sie den Kopf. Letztendlich kannte Anna doch die Narbe, das Zeichen einer durchgestandenen Qual, eines Ereignisses, das sie verändert hatte. Manchmal kehrte der Albtraum zurück. Dann sah sie das Messer aufblitzen, spürte den furchtbaren Schmerz, der vom Gesicht durch den ganzen Körper jagte. Eine dreckige Engländerin war sie genannt worden, die im Land des geliebten Führers nichts zu suchen habe.
Es war Anna, die sie gerettet hatte, und das schweißte die beiden Cousinen zusammen, hatte sie Freundinnen fürs Leben werden lassen, wie sie sich damals schworen. Aber erst heute, nach elf Jahren, sahen sie einander wieder. Zum Begräbnis des Großvaters in Speyer war Anna nicht gekommen, und bei der von ihnen so geliebten Großmutter Elsa hatten sie sich nur kurz gesehen; Anna hatte es eilig gehabt, nach Wien zurückzukommen. Sicher wegen einer großen Rolle am Wiener Burgtheater. Langsam strich sich Antonia durch die blonden Haare, die ihr glatt auf die Schultern fielen. Sie trug einen weiten grauen Rock, einen hellblauen Angorapulli mit einem schmeichelnden Rollkragen und kurzen angeschnittenen Ärmeln. So war sie chic, aber nicht zu aufgeputzt. Konnte sie gegen eine berühmte, sicher sehr elegante Schauspielerin bestehen?
Als Annas Anruf kam, war sie so überrascht gewesen, dass sie ihr sofort anbot, bei ihr zu wohnen. Aber dadurch kam jetzt auch die Wahrheit ans Licht. Die Realität, beschönigt in den wenigen Briefen, die sie im Laufe der Zeit an Anna geschrieben hatte. Wie viele waren es in elf Jahren gewesen? Drei? Mehr sicher nicht.
Und gleich war es so weit: Anna, die berühmte Schauspielerin vom Wiener Burgtheater, kam her, um die nächste Zeit bei ihr zu wohnen.
»Endlich, ich dachte schon, du hast den Zug verpasst, oder er hatte Verspätung.«
Antonia öffnete und bat Anna herein. »Ich hätte dich abholen können, schließlich hast du Gepäck.«
»Es sind doch nur ein Koffer und eine Tasche, alles ist gut gegangen«, lächelte Anna. Sie stellte ihr Gepäck ab, sah Antonia nur an.
Antonia ging auf Anna zu, umarmte sie hastig, doch bevor Anna die Umarmung erwidern konnte, war ihre Cousine bereits zurückgetreten. Annas Arme fielen herab.
Antonias Blick glitt rasch über ihre Cousine, von den kurz geschnittenen braunen Haaren zu dem ausdrucksvollen Mund und weiter über den tellergroßen grauen Persianerkragen bis zu ihrer überschlanken Taille, um die der Mantel schlotterte. Der Saum war an einer Seite heruntergerissen, hatte Anna es nicht bemerkt? Antonia lächelte unwillkürlich – es war wie damals.
Vor siebzehn Jahren war Anna mit ihrer Mutter Vivien zu ihnen aufs Land gekommen. Anna stand neben dem russischen Dienstmädchen Nadja Pimarova vor der Gartentür, aufgelöste Zöpfe, eine Schleife fehlte, und der Saum ihres Kleides war lose.
Antonias Unsicherheit verflog. Dieses kleine Detail zeigte ihr, dass Anna sich vielleicht nicht so sehr verändert hatte, dass in der berühmten Burgschauspielerin noch immer das kleine achtlose Mädchen steckte. »Ich freue mich so, dass du da bist. Du hast mir schrecklich gefehlt.«
Der nächste Umarmungsversuch gelang den beiden Frauen und trieb ihnen die Tränen in die Augen. Plötzlich wollten sie sich gar nicht mehr loslassen.
Nachdem sie sich voneinander gelöst hatten, zeigte Antonia ihrer Cousine das Zimmer, in dem sie wohnen würde, das ehemalige Gästezimmer mit dem großen Barockschrank, hinter dem sich eine fast unsichtbare Tapetentür verbarg. Hier hatten während des Kriegs jüdische Ehepaare gelebt, sogar Familien, die Philip Kroll, Antonias Vater, versteckte, bis sie mit falschen Papieren aus Deutschland fliehen konnten.
»Daddy hat ein Haus am Staffelsee, dort wohnt er mit Jette. Er ist nur selten hier. Ich habe uns eine Gemüsesuppe gekocht, sicher bist du noch Vegetarierin, oder?«
Anna nickte, und Antonia redete nervös weiter: »Mach dich frisch, und lass dir Zeit. Komm dann einfach in die Küche.«
Anna stellte den Koffer ab und strich mit der Hand über die altrosa Seidensteppdecke, dann wanderte ihr Blick weiter zum Tisch mit der Jugendstillampe, die ihr als Kind so imponiert hatte. Eine Frau aus Porzellan, halb nackt, die in einer Drehung den Lampenschirm aus buntem Glas hielt. Unwillkürlich dachte sie an ihre Pension in Wien.
»Ich hoffe, du fühlst dich wohl hier«, hörte sie Antonia sagen, die sich bereits zum Gehen wandte.
Anna konnte nur stumm nicken.
»Daddy ist übrigens ein erfolgreicher Anwalt, er vertritt jetzt Filmfirmen und ihre Rechte. Er wird hochgeachtet, auch wegen damals, weißt du.«
Anna nickte abermals stumm.
Die Vergangenheit, immer wieder war sie präsent.
Doch da redete Antonia bereits weiter, ein wenig überdreht. »Daddy und Jette freuen sich, dass du einziehst, da ich dann nicht so allein bin, wie sie meinen.«
»Wieso allein?«
»Sie bleiben meist im Haus am See. Nur selten ist einer von ihnen in der Stadt, und am Wochenende sind sie sowieso draußen.«
Ihre Blicke trafen sich. Philip hatte seine Frau Vivien, Antonias Mutter, mit ihrer besten Freundin Jette betrogen und sie dann geheiratet.
»Also bis gleich.«
Die Tür schloss sich, und Anna setzte sich kerzengerade auf die seidene Steppdecke, sah sich einfach nur um. Erst als Antonia klopfte und fragte, ob sie nicht kommen wolle, erhob sie sich und ging hinaus zu ihrer Cousine, die ganz offensichtlich ein gutes, ein privilegiertes Leben führte. Während sie …
»Nun erzähl«, bat Antonia, kaum dass sie saßen.
»Ach …« Anna stopfte sich rasch ein Stück Brot in den Mund, um nicht sofort antworten zu müssen. Sie wollte vorsichtig sein, Wien und das Burgtheater nicht gleich heute erwähnen. »Übermorgen fange ich mit den Proben im Residenztheater an. Ich werde die Viola in Shakespeares Was ihr wollt spielen.«
»Ist das eine gute Rolle?«
»Eine sogenannte Hosenrolle, ich bin im Stück eine junge Frau, die sich als Mann verkleidet. Es ist eine leichte Komödie. Ein Herzog mit Namen Orsino liebt eine bildschöne Frau, Olivia. Die aber verliebt sich in Viola, erkennt aber nicht, dass Viola eine verkleidete Frau ist, und Viola verliebt sich in den Herzog, der sie aber für einen Mann hält.«
Antonia lachte. »Ganz schön kompliziert.«
»Ja, wie das richtige Leben!« Jetzt lachte auch Anna. »Jemand verliebt sich, es ist der Falsche, denn der wiederum liebt eine andere und so weiter. Aber in dem Stück findet alles ein gutes Ende, denn Viola hat einen Zwillingsbruder, der sich dann in Olivia verliebt.«
»Ja, das ist schön. Ich mag keine Liebesgeschichten, die schlecht ausgehen«, erklärte Antonia. »Aber du hast bei unserem Telefonat gesagt, ein sehr berühmter Regisseur inszeniere das Stück?« Antonia war begierig, alles über die Theaterwelt zu erfahren.
»Ja, Julian Winter hat mich engagiert. Als Ersatz«, fügte sie hinzu. »Die Schauspielerin, die für die Rolle vorgesehen war, hat ihm nicht gefallen.«
»Und bist du gern vom Burgtheater weggegangen?« Antonias Fragen kamen schnell, hastig.
Nachdenklich sah Anna sie an. Wollte Antonia durch ihre Fragen von sich ablenken? Ohne darauf zu antworten, erklärte sie, wie gut die Suppe sei, und auch das dunkle Bauernbrot.
Antonia fragte weiter: »Hast du in Wien die Julia gespielt? Ich erinnere mich, das war doch deine Traumrolle.«
Anna schüttelte den Kopf, und Antonia begriff, dass ihre Cousine nicht darüber reden wollte, also wechselte sie rasch das Thema. »Ich sitze gern hier am Fenster«, erzählte sie. »Wenn ich morgens frühstücke, beobachte ich von hier oben die Leute, die ihre Hunde spazieren führen, das macht Spaß.«
Schweigend löffelten sie weiter die Suppe, bis Anna die gefürchtete Frage stellte. »Über was hast du deine Doktorarbeit geschrieben?«, wollte sie wissen, während Antonia bereits aufgestanden war und die Teller im Spülbecken abstellte.
Antonia drehte jetzt Anna den Rücken zu. »Das erzähl ich dir demnächst«, erklärte sie in leichtem Ton über die Schulter. »Ich muss morgen sehr früh aufstehen.«
Auch Anna erhob sich sofort. »Ich denke, ich sollte auch ins Bett gehen. Sollen wir das Geschirr noch spülen?«
Antonia schüttelte den Kopf. »Das ist nicht nötig, es ja schon so spät. Morgen früh kommt Frau Mayr, unsere Putzfrau, die macht das schon.«
Sie wünschten sich Gute Nacht, und jede ging in ihr Zimmer.
Die Stunden vergingen zäh. Immer wieder sah Anna auf ihren kleinen Reisewecker, der auf dem Nachttisch stand. Der Zeiger schob sich unlustig und langsam weiter. Und morgen, wäre da alles besser?
Als sie draußen auf dem Gang ein Geräusch hörte, hob sie den Kopf und horchte angespannt. Kein Zweifel, die Tür von Antonias Zimmer hatte sich geschlossen, und der Parkettboden im Gang knarzte unter ihren Schritten.
Anna schwang ihre Beine über die hohe Bettkante und öffnete leise die Tür. Sie hatte sich nicht geirrt, in der Küche brannte Licht. Sie atmete durch, warf sich ihre Wolljacke über den Flanellschlafanzug und ging zur Küche. Sie öffnete die Tür, verharrte dort und lehnte sich an den Türpfosten. Antonia saß am Tisch und strickte.
»Das mache ich noch immer«, erklärte sie fast entschuldigend. »Stricken entspannt mich.«
Sie wechselten einen Blick und lächelten sich zu. Beide erinnerten sich, dass Antonia in der Schule für Anna, die Linkshänderin war, immer die Wollsocken gestrickt hatte. Sie mussten sie für die Soldaten an der Front anfertigen.
Dafür hatte Anna ihr dann ein »Geheimnis« aus ihrer Kindheit anvertraut. Diese Erinnerung an eine Gemeinsamkeit ließ Anna plötzlich sagen: »Antonia, ich denke, wir müssen reden.«
Ein trüber Morgen dämmerte bereits herauf, und die beiden Cousinen saßen immer noch an dem kleinen Tisch am Fenster, tranken längst kalt gewordenen Tee, warfen manchmal Blicke hinunter auf das Isarufer und den Weg, wo schon die ersten Spaziergänger ihre Hunde ausführten.
Und Anna erzählte. Wie sie in der Schauspielschule als besonderes Talent hochgelobt wurde. Wie sie ihre Abschlussprüfung mit Bravour bestand und im Gefühl, etwas Besonderes zu sein, Angebote kleiner Bühnen ablehnte. Sie wollte hoch hinaus, sie wollte ans Burgtheater.
Und das kam sie auch. Doch dort ging es nicht weiter. »Ich war das ewige Talent«, erklärte sie mit Bitterkeit in der Stimme. »Aber ich bekam nur kleine Rollen, meist fand man mich unter den Statisten.«
»Aber dieser … Julian Winter, der hat dich jetzt nach München geholt.«
Anna, die den Kopf gesenkt hielt und mit beiden Händen den Becher mit Tee umklammerte, sah hoch. »Ja, dieses Wunder ist geschehen. Ich weiß nicht, warum. Er war in einer Vorstellung von Dantons Tod, in der ich eine kleine Rolle spielte, die Grisette. Hinterher lud er mich zu einem Vorsprechen ein. Zuerst dachte ich, er verwechselt mich.« Hier lachte Anna kurz auf. »Und nach dem Vorsprechen war ich sofort engagiert. Ich kann das Wunder noch gar nicht fassen.«
»Weißt du«, Antonia begann leise, lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, suchte Abstand. »Ich hatte solche Angst vor unserem Wiedersehen, aber jetzt, da du so offen über deine Vergangenheit gesprochen hast, will ich es auch versuchen. Die Wahrheit ist, ich habe mein Studium geschmissen und natürlich dann auch nicht promoviert. Also nichts mit dem großen Traum der erfolgreichen Frau Doktor.«
Ihre Blicke begegneten sich.
»Und warum nicht, warum hast du aufgegeben?«
Antonia zuckte seufzend die Schultern. »Ich habe das Physikum nicht bestanden, und da gab ich auf. Fing an, fürs Rote Kreuz zu arbeiten, ich habe ja damals im Lazarett eine Schwesternausbildung gemacht. Ich betreue Frauen und Kinder im Lager Frauenholz. Sie leben dort in Baracken außerhalb der Stadt.«
Antonias Stimme wurde lebhafter, und Anna spürte ihr starkes Engagement.
»Dann kümmere ich mich noch um die sogenannten Suchkinder, die im Krieg zwischen Trümmern gefunden wurden und für die wir ihre Verwandten suchen. Auch Kinder, die aus Ostpreußen vor der Roten Armee geflüchtet sind und verloren gingen. Wir haben hier viele, die stark traumatisiert sind. Inzwischen sind sie bereits zwischen vierzehn und siebzehn Jahre alt.«
Anna hörte fasziniert zu.
»Diese Jugendlichen leben teilweise in Heimen oder Pflegefamilien, verteilt auf ganz Deutschland, und manchmal, wenn uns eine Familienzusammenführung gelingt, ist das ein sehr starker emotionaler Moment.«
»Das ist bewundernswert, Antonia. Du kannst helfen, ist das nicht das Wichtigste? Und ist es letztendlich nicht egal, ob du einen Doktortitel hast?«
Annas Antwort war ein stummes Schulterzucken. Sie schwiegen, sahen sich im aufkommenden Tageslicht an, lächelten einander zu.
»Weißt du«, erklärte Anna, »vielleicht wollten wir unser Scheitern nicht zugeben, weil unsere Mütter so außergewöhnlich sind. Nach dem Krieg wurden sie mit einem Orden für ihre Tapferkeit ausgezeichnet, in den Zeitungen schrieb man über sie. Da fühlten wir beide uns als Versagerinnen, als es bei uns nicht so recht klappen wollte, und hatten nicht den Mut, uns gegenseitig die Wahrheit zu sagen.«
»Das kann schon sein«, überlegte Antonia. »Vielleicht waren wir einfach nur feige, zu sehr am Erfolg orientiert.«
Wieder lächelten sie einander zu, müde, blass und sehr erleichtert, dass sie sich zur Wahrheit bekannt hatten.
Spontan erhob Antonia sich und umarmte ihre Cousine, und beide fühlten sich angenommen und unterstützt, was auch kommen würde.
Wenn die Musik der Liebe Nahrung gibt, spielt weiter.
Der erste Satz, der Beginn der Komödie von Shakespeare. Erster Akt, erste Szene.
Anna stand in der Bühnengasse und hörte angespannt der Probe zu. »Nein, nein«, rief Julian Winter, der unten am Regiepult im Zuschauerraum saß, jetzt aufsprang, die paar Stufen auf die Bühne sprintete. »Du musst in der Haltung bereits deinen Schmerz ausdrücken, mehr Gefühl, bitte, nicht so routiniert.«
Hans Dunker, der Darsteller des Herzogs, erhob sich und versuchte, dem Regisseur seine Interpretation der Szene klarzumachen. Seiner Meinung nach sei das Ganze ein wenig ironisch gemeint, der Herzog nehme seinen Liebeskummer nicht so ernst.
Anna faszinierte der Widerspruch des Schauspielers, es war bekannt, dass sich niemand gegen die Anweisungen des berühmten Julian Winter stellte. Schließlich war es eine große Ehre, dass er hier in München eine Regiearbeit übernommen hatte. Aber Hans Dunker konnte es sich erlauben, er war der Star des Theaters, umschwärmt und umjubelt.
Am Tag zuvor hatte Anna ihre erste Einzelprobe mit Julian gehabt, heute war sie nur Zuschauerin, morgen aber, kurz vor zehn Uhr, wurde sie offiziell dem Ensemble vorgestellt und sollte an der ersten Probe teilnehmen.
»Schläfst du mit ihm?«
Unwillig drehte sich Anna um. Ein zierlicher kleiner Mann stand vor ihr und streckte ihr die Hand entgegen. »Martin, ich spiele den Malvolio.« Links hielt er einen Apfel, in den er hineinbiss, während er sie neugierig anstarrte.
Sie übersah seine Hand, nickte ihm nur zu und machte einen kleinen Schritt zur Seite. Er folgte ihr, wieder stand er ganz nahe.
»Das ganze Ensemble fragt sich das.« Er kaute an dem Apfel, sprach aber weiter: »Es ist schon ungewöhnlich, Thekla Wirth hatte bereits mit den Proben für die Viola angefangen, da lehnte Julian sie ab. Sie ist eine bekannte Schauspielerin, und dann kommst du. Niemand kennt dich, das ist schon seltsam, gib es zu.« Wieder biss er in den Apfel. »Oder bist du Jüdin?«
Anna wusste, dass Julian Winter, selbst Jude, Deutschland 1931 verlassen hatte, im Alter von zwanzig Jahren. Aber sonst gab es keine Informationen über ihn, keine Interviews. Niemand kannte seine Vergangenheit. Auch nicht sein Privatleben, das er streng geheim hielt.
Anna hatte keine Lust zu antworten, sie sah fasziniert Hans Dunker zu. Martin war ihr lästig, und so machte sie einen weiteren Schritt von ihm weg, doch der Schauspieler folgte ihr.
»Wenn du mit ihm schläfst, darfst du nicht zu besitzergreifend sein, er entzieht sich den Frauen, die verrückt nach ihm sind.«
Anna wurde wütend, aber bevor sie antworten konnte, klatschte Julian Winter in die Hände. »Kurze Pause«, rief er den Schauspielern zu, schlug Hans noch kurz auf die Schulter, wandte sich ab und ging die Stufen in den Zuschauerraum hinunter.
Hans Dunker aber hatte Anna gesehen, lächelte, kam jetzt auf sie zu und hielt ihr strahlend die Hand entgegen, die sie ergriff.
»Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns persönlich kennenzulernen.«
Anna wusste, dass er für seine Affären mit Kolleginnen bekannt war. Er hatte eine schöne Stimme, wache blaue Augen, einen Mund, der sie anlächelte. Er fesselte sofort ihre Aufmerksamkeit, sie konnte sich gegen seine Ausstrahlung kaum wehren. Anna wurde sich ihrer achtlosen Kleidung bewusst, sie trug ihren alten weißen Pullover, der ihr zu ihrem blassen Teint nicht besonders schmeichelte. Auch ein wenig Lippenstift hätte nicht geschadet.
In dem Moment tippte ihr der Inspizient auf die Schulter. »Herr Winter möchte Sie sprechen, er wartet in der Kantine auf Sie.«
Achtlos warf Anna ihren Mantel auf den Stuhl am Eingang, ging zum Telefon, das auf der Konsole stand, zögerte, hob die Hand, ging dann aber weiter in die Küche. Vom Fenster aus sah sie in einen tiefblauen Himmel, an dem der starke Föhnsturm die Wolken auseinanderriss. Ein Tag, an dem man von der Stadt aus bis ins Gebirge sehen konnte, so als sei man nur ein paar Momente von den Bergen entfernt.
Das Gespräch mit Julian war anders verlaufen, als sie gedacht hatte. Er wartete in der Kantine auf sie, hatte ihr an der Theke einen Tee geholt, sie habe so verfroren in der Bühnengasse gestanden. Die Kantine war ein fensterloser Raum im Keller, ausgestattet mit einfachen Holztischen, über denen die Lampen tief hingen. Sie hatte ihren Tee getrunken, angespannt gewartet. Vielleicht sogar den Satz erwartet, sie erfülle die Rolle nicht, er habe sich in ihr getäuscht.
Ihre kalten Hände zitterten leicht, als sie Julian betrachtete. Er sah nicht im eigentlichen Sinne gut aus, aber seine hohe Stirn brachte die dunklen, lebhaften Augen zur Geltung und bewirkte, dass man sich diesem Blick nicht entziehen konnte.
Er hatte Charisma, war auf eine spezielle Art sehr attraktiv. Er strahlte Energie und Willenskraft aus, und das machte ihn zu einem außergewöhnlichen Mann. Er mag keine Frauen, die verrückt nach ihm sind … Martins Satz schoss ihr durch den Kopf.
So saß sie da und wartete auf ihr Urteil, wie sie es innerlich nannte. War ihre Zeit in München bereits beendet, bevor sie überhaupt anfing?
Doch es war anders gekommen. Er erzählte, dass er ihren Onkel, Philip Kroll, bei einer Veranstaltung des Bayerischen Rundfunks getroffen habe. Er hatte nicht gewusst, dass er Annas Onkel sei. Julian sprach über seine große Hochachtung und Bewunderung für Philip Kroll, der während des Kriegs unter Einsatz seines Lebens Juden versteckte und dem Wehrkreis VII angehörte, der als Mittelpunkt des intellektuellen Widerstands in München galt. Und vor allem, dass er sich der Widerstandsgruppe Freiheitsaktion Bayern angeschlossen hatte und damit sein Leben riskierte.
Vielleicht war das der Auslöser für Anna gewesen, um Julian auch von ihrer Mutter und ihrer Tante zu erzählen. Sie holte aus, da sie Julians starkes Interesse spürte, und erzählte von dem russischen Dienstmädchen Nadja Pimarova, das nach kurzer Zeit bereits zur Familie gehört hatte und von der Gestapo abgeholt worden war.
»Sie kam in ein nahes Lager. Meine Mutter wollte zuerst nur etwas für Nadja tun, aber dann ging es weiter. Bäcker Fesl, der im Widerstand war, stellte meiner Mutter die vorsichtige Frage, ob sie bereit sei, die Brotlieferungen ins Lager zu übernehmen. Und meine Mutter sagte zu, meine Tante Vivien auch. Sie müssen wissen«, erklärte Anna, »in den Broten waren Botschaften für die Insassen des Lagers eingebacken. Dort waren Jüdinnen inhaftiert, Zigeunerinnen, aber die meisten Frauen waren Russinnen, Frauen aus Osteuropa.«
»Da haben Ihre Mutter und Ihre Tante ihr Leben riskiert.« Bewunderung sprach aus Julian, und so erzählte Anna weiter.
»Ja, das haben sie. Fesl aber wurde entdeckt und eines Tages ermordet in den Hopfenfeldern gefunden.«
Julian beugte sich ihr über den Tisch entgegen, er vergaß seinen Wein, hörte angespannt zu.
Und als sie weitersprach, erzählte, was sie so lange zurückgehalten hatte, war die Erinnerung so stark, so lebendig, dass ihr die Tränen kamen. »In den letzten Kriegstagen rückten die amerikanischen Panzer an, sie rollten auf die Stadt zu. Da zeigten meine Mutter und meine Tante wirklich Mut, sie radelten den Panzern entgegen und brachten sie dazu, ihre Route zu ändern und zum Lager zu fahren. Sie befreiten die Frauen in letzter Minute, denn Soldaten der Wehrmacht waren bereits im Anmarsch, um die inhaftierten Frauen zu erschießen.« Anna schwieg. In diesem Moment stand ihr die Szene ganz klar vor Augen: Sie war aus der Jagdhütte ihres Vaters gekommen, es war bereits später Abend gewesen. Sie war gerannt, als sie in der Straße ankam. Im diffusen Licht der Straßenlaternen hatte sie die Gestalten gesehen, nur noch in Fetzen gekleidet, abgemagert bis aufs Skelett, viele hatten keine Haare mehr. Schweigend kamen sie, gruppierten sich, bis endlich ein leises Weinen, ein Aufschluchzen zu hören war.
Ein Schauer hatte Anna damals erfasst. Sie hatte nicht glauben können, was sie sah. Wie Gespenster sahen sie aus, eine apokalyptische Szene.
Und da hatte Anna erkannt, es waren die Frauen aus dem Lager, die vor Vivien und Maria auf die Knie fielen, nach ihren Händen griffen, kaum fähig, etwas zu sagen.
In Erinnerung daran, an die große Stunde ihrer Mütter, schwieg sie.
Es war Julian Winter, der wieder das Wort ergriff. Er erzählte von seiner Tante Sarah Wertheim, die in London lebte und berichtet hatte, sie sei vom Lager Buchenwald in ein anderes, kleines nach Bayern gekommen. In den letzten Kriegstagen wurden die Insassinnen von den Amerikanern befreit, doch letztendlich waren es zwei mutige Frauen, denen sie ihr Leben zu verdanken hätten.
Als Anna mit einem überraschten Laut hochfuhr, bat er: »Sagen Sie Ihrer Mutter lieber noch nichts, warten Sie ab, bis ich Näheres weiß. Ich werde es herausfinden. Ich bin demnächst bei Sarah und sage Ihnen dann Bescheid.«
Als er sich bereits erhoben hatte, legte er ihr noch ganz kurz die Hand auf die Schulter, dann verließ er die Kantine.
Anna lief unruhig durch die Wohnung. Vor einer Stunde hatte sie über etwas gesprochen, worüber sie jahrelang geschwiegen hatte. Konnte es wirklich sein, dass Julian Winters Tante eine dieser geretteten Frauen gewesen war?
In der Küche blieb sie am Fenster stehen und beobachtete einen Mann, der fürsorglich seinen Pudel hochnahm, da ihn sonst der starke Föhnwind erfasst hätte. Sie legte die Stirn an die Scheibe und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Zu viele Erinnerungen kamen zurück. An die junge, schöne Nadja, die im Lager an den Folterungen gestorben war. An die kalten Winter, die Entbehrungen. Endlich löste sie sich vom Fenster und griff in der Diele nach dem Telefonhörer. Es läutete lange, bis abgehoben wurde.
»Hallo Mama, ich bin’s.«
Kapitel zwei
Maria saß in der Küche und wartete, bis sie ihren Marmorkuchen aus dem Ofen holen konnte. Sie horchte auf das Klavierspiel, das aus dem Wohnzimmer zu ihr herüberklang. Dort saß Walter von Heimhausen an ihrem Flügel, ein höflicher älterer Mann, der vor fünf Jahren vom Wohnungsamt als Flüchtling aus Ostpreußen bei ihr einquartiert worden war. Er sei aus der Nähe von Insterburg, habe aber auch viel in Berlin gelebt, mehr wollte er nicht erzählen. Vivien und sie hatten Glück mit ihrem Untermieter. Er war ein ehemaliger Pianist, der sich mit Klavierstunden durchschlug.
Während Maria auf sein Spiel horchte, zog sie ihr altes Kochbuch aus der Schublade des Küchentischs. Zwischen den Seiten lagen Annas Kinderzeichnungen und der letzte Brief ihres Ehemannes Werner, den er geschrieben hatte, bevor er nach Stalingrad fuhr. Er war nicht mehr zurückgekommen, gestorben dann in einem Lazarett in Mähren, wohin man ihn ausgeflogen hatte.
Dann gab es noch Briefe ihrer Mutter Elsa Kroll, der Streitbaren, der Unangepassten, die sich nach dem Krieg für die Rechte von Flüchtlingsfrauen einsetzte. Auch für die Frauen, die von der Gesellschaft verachtet wurden, da sie gegen das Fraternisierungsgesetz verstießen, als sie sich mit den Männern der amerikanischen Besatzung einließen, wie man es nannte. Bis zu ihrem Tod vor drei Jahren hatte sie in der Zeitung Anders leben Artikel veröffentlicht, unter ihrem Pseudonym H.S.: Hanna Schwertlein.
Ach, Mutter, seufzte Maria stumm. Wie sehr fehlst du mir.
In Gedanken versunken, überhörte sie das Läuten des Telefons. Sie schreckte erst hoch, als Walter von Heimhausen in der offenen Tür stand, seine Schuhe in der Hand. Er spielte immer nur in Socken, da könne er das Pedal besser bedienen. »Das Telefon«, betonte er höflich, »haben Sie es nicht gehört?«
Jetzt sprang Maria auf, lief hinaus in den Gang und hob ab.
Es war Anna, ihre Tochter.
Erst zögernd, dann ein wenig mitteilsamer erzählte Anna von ihrem Engagement am Residenztheater, und dass sie jetzt bei Onkel Philip und ihrer Cousine Antonia wohne.
»Willst du zur Premiere kommen? Ich freu mich, wenn du kannst.«
Ein Zögern, ein Abwarten, doch Maria überlegte nicht lang, sie sagte sofort zu, erleichtert, lachend, ja natürlich, natürlich komme ich. Dann redeten sie noch ein wenig über das Wetter in München, und Anna fragte, wie es ihr denn so gehe.
»Ich backe gerade einen Marmorkuchen.«
»Ich kann dich ja mal besuchen«, schlug Anna spröde vor, »aber erst im neuen Jahr, vorher ist im Theater ziemlich viel los.«
»Du wirst erstaunt sein, wenn du kommst.« Maria wurde lebhaft. »Es gibt keine Badewanne mehr hinter dem Küchenschrank, Vivien hat zwei Badezimmer einbauen lassen, eine große Modernisierung vorgenommen, alles renovieren lassen.«
Sie verabschiedeten sich, und bevor Maria zurück in die Küche ging, wischte sie sich rasch die Tränen ab. Walter sollte nicht sehen, dass sie geweint hatte. Sie wollte seine diskrete Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen, denn die war oft schwerer erträglich als offene Neugier.
»Ich habe mir erlaubt, den Kuchen aus dem Ofen zu holen«, erklärte er und sprang sofort wieder vom Stuhl hoch, auf den er sich gesetzt hatte.
»Danke.« Maria reagierte fast euphorisch, so groß war ihre Freude über den Anruf ihrer Tochter. Plötzlich schien alles vergessen, die Auseinandersetzungen, die Jahre der Stille zwischen ihnen, da Maria die Berufswahl ihrer Tochter nicht akzeptieren konnte. Eine brotlose Kunst, aber jetzt schien sich das Blatt gewendet zu haben.
Vorsichtig stürzte sie den Kuchen auf das Kuchengitter, während Walter sich in die Zeitung vertiefte, die aufgeschlagen auf dem Tisch lag.
»Ich habe inzwischen diesen Artikel gelesen. Entschuldigen Sie.«
»Ja, macht doch nichts.« Maria reagierte ungeduldig, da sich Walter fast immer für alles und jedes entschuldigte.
»Er ist sehr interessant. Dieser Redakteur geht rigoros gegen die neue Partei, Freunde der Heimat, vor.«
»Ja, ja«, nickte Maria, »das ist richtig. Die Menschen lehnen die Flüchtlinge immer noch ab, auch jetzt noch, nach Jahren. Man hat ihnen die Eingliederung in unsere Stadt nicht leicht gemacht.«
»Ja, genau so beschreibt es dieser Journalist auch.« Walter reagierte lebhaft. Ganz offensichtlich wollte er Maria in eine längere Diskussion verwickeln, doch sie brach das Gespräch ab. Sie müsse jetzt noch ein wenig Schreibkram erledigen und würde dann auf Vivien warten.
Sofort schwieg Walter, verbeugte sich leicht, nahm seine Schuhe hoch und verließ auf Socken die Küche.
Maria sah ihm nach, wandte sich dann der aufgeschlagenen Zeitung zu und strich mit einem Lächeln darüber, bis zum Ende des Artikels und den Initialen, die darunter standen: H.S.
Das Vermächtnis ihrer Mutter, Marias kleines Geheimnis.
Wie hatte sie glauben können, alles ginge immer so weiter? Tassilo war zwölf Jahre jünger als sie. Und war sie letztendlich nicht selbst schuld, wenn er sie jetzt nach elf Jahren verließ, da sie das Wort Beziehung immer vermieden hatte und betonte, es sei eine Affäre?
Sie hatte ihm seine Freiheit lassen, ihn nicht an sich, die ältere Frau, binden wollen. Vivien liebte seine Zärtlichkeiten, er gab ihr das Gefühl, mit einundfünfzig Jahren schön und begehrenswert zu sein. Das war so kostbar für sie mit jedem Jahr, das sie älter wurde. Und nun?
Mit zittriger Hand zündete sich Vivien eine Zigarette an. Vor einer halben Stunde war sie aus Augsburg zurückgekommen, und jetzt saß sie in dem verlassenen Wartesaal des Bahnhofs, dessen einziger Schalter noch geöffnet war. Im trüben Licht starrte sie auf das alte Filmplakat an der Wand: 12 Uhr mittags mit Gary Cooper und Grace Kelly. Daneben hing noch ein altes Poster aus dem Jahr 1942, eine Reklame für Ersatzkaffee, ein anderes warb für Drops für die Reise. Und es gab noch eine Schokoladenreklame mit der Abbildung eines kleinen Mohren in Pumphosen, irgendwas war darüber gekritzelt worden, von Weitem nicht zu entziffern.
Viviens Blick glitt an den teilweise abblätternden Wänden entlang und blieb an Schmierereien hängen: Flüchtlinge raus.
Hier im Wartesaal war das neu. Diese Parolen tauchten plötzlich immer häufiger auf, angeheizt durch Reden und Parolen der neuen Partei Freunde der Heimat, die alte NSDAP-Anhänger, Arbeitslose und Kriegsheimkehrer versammelte. Doch auch beunruhigend viele Jugendliche machten mit.
Vivien lehnte sich auf der Bank zurück, schloss die Augen. In Gedanken ging sie noch einmal den Abend durch.
Tassilo und sie waren nicht wie sonst im Hotel hinauf in ihr Zimmer gegangen. Stattdessen hatte Tassilo sie in die Bar gebeten, um etwas zu trinken, er müsse mit ihr sprechen. Und dort erklärte er der überraschten Vivien, er habe jemanden kennengelernt. Er müsse einfach nachdenken, eine Neuorientierung in seinem Leben suchen. Nach diesem Gespräch waren sie auseinandergegangen wie Fremde, ohne Zärtlichkeit, ohne Abschied, nur ein förmliches Auf Wiedersehen.
Dann war Vivien zum Bahnhof gegangen, ohne etwas zu spüren.
Und nun, zwei Stunden später, saß sie hier in diesem zugigen Wartesaal und zog nervös und zittrig an der Zigarette. Sie sollte nach Hause gehen, nicht den Moment hinauszögern. Maria würde sowieso auf sie warten, egal, wann sie kam. Maria hatte neugierig reagiert, als sie anrief, sie bleibe nicht über Nacht in Augsburg, wie sonst immer, sondern komme noch am Abend nach Hause.
Langsam erhob sie sich und drückte die Zigarette aus, als die Bahnhofstür aufsprang und ein kleiner Junge hereinrannte. Er lief direkt auf den Mann am Schalter zu, stellte sich auf die Zehenspitzen und fragte atemlos: »Ist der letzte Zug schon da?«
Der Beamte legte seine Zeitung ab, schüttelte den Kopf und erklärte, der sei wegen des Sturms ausgefallen, das habe man ihm gerade durchgegeben.
Enttäuscht wandte der Kleine sich ab und ließ sich auf die Bank fallen, auf der Vivien gerade noch gesessen hatte.
»Kennen Sie den kleinen Jungen?« Neugierig ging Vivien zu dem Mann hinter dem Schalter.
Er nickte. »Ja, das ist der Sohn einer Kellnerin, Veronika Freyberg, sie arbeitet drüben im Gasthof Grieser. Und ihr Kleiner hier büxt aus, wenn seine Mutter Spätdienst hat. Am Wochenende kommt er regelmäßig hierher.« Der Mann beugte sich ganz nahe an das kleine Fenster in der Scheibe. »Sein Name ist Daniel, und er wartet auf seinen Vater, glaubt, er kommt irgendwann zurück. Er ist Amerikaner, aber das sieht man ja«, betonte er mit einem vielsagenden Blick.
»Er kommt auch zurück.« Trotzig rief der Kleine es ihnen zu.
Nachdenklich wandte sich Vivien vom Schalter ab.
»Ich muss den Bahnhof jetzt abschließen«, rief ihr der Beamte nach, doch Vivien beachtete ihn nicht, sondern setzte sich neben den kleinen Jungen. Er war hübsch mit seinen krausen Haaren und der dunklen Haut, dazu sehr zierlich, und sie schätzte ihn auf ungefähr sechs Jahre. Sie erinnerte sich, Maria hatte erzählt, dass seit einem Jahr eine junge Frau, Flüchtling aus Ostpreußen, im Gasthof Grieser arbeite. Über sie wurde viel gesprochen, da ihr Kind ein kleiner Neger sei – so hatte sich Frau Hofer, die Nachbarin von Maria, abfällig geäußert.
»Hier«, sie kramte in ihrer Tasche, »willst du ein Stück Schokolade? Ich habe sie mir in Augsburg am Bahnhof gekauft, aber jetzt mag ich sie doch nicht mehr.« Sie zog eine rote Tafel Schokolade heraus, Waldbaur Feinbitter Kernbeißer stand darauf.
Daniel rutschte von ihr ab und sah sie feindselig an.
»Nun, Daniel, ich gehe jetzt, und du musst das auch, der Bahnhof wird abgeschlossen. Soll ich dich nach Hause begleiten?«
Ein Kopfschütteln war die Antwort. »Ich bin doch kein Baby mehr.«
Vivien unterdrückte ein Lächeln. »Ist dir nicht kalt?«
Wieder ein Kopfschütteln. Daniel trug eine Jacke, aber keine Handschuhe und sehr dünne Halbschuhe.
»Nun, ich lasse dir die Schokolade da, ich freue mich, wenn sie dir schmeckt, und dann auf Wiedersehen.«
Sie erhob sich, legte die Schokolade auf die Bank, nickte ihm und auch dem Beamten zu und verließ den Bahnhof. Sie überquerte den kleinen Vorplatz, an dem der Sturm Fahrräder umgeworfen und Äste auf die Straße geschleudert hatte. Doch jetzt war es windstill. Als sie am hell erleuchteten Gasthof Grieser vorbeikam, schallten laute Männerstimmen auf die Straße.
Dort arbeitete Veronika Freyberg. Und während sie Spätschicht hatte, lief ihr kleiner Sohn abends unbeaufsichtigt durch den Ort bis zum verlassenen Bahnhof, um auf seinen Vater zu warten.
Vivien blieb stehen und sah sich um. Hatte sie sich getäuscht oder ein Geräusch gehört? Aber niemand ging oder stand hinter ihr, und so lief sie weiter, drehte sich mehrmals um – nichts zu sehen. In einem plötzlichen Impuls machte sie einen kleinen Umweg bis zu den beiden Gymnasien des Ortes. Es waren zwei graue Gebäude, das Theodor-Storm-Gymnasium für die Jungen und das Maria-Theresia-Gymnasium für die Mädchen.
Hier arbeitete sie seit acht Jahren als Englischlehrerin, und jetzt würde sie ab Februar das Direktorat übernehmen. Sie wusste, dass einige der Lehrer gegen sie gestimmt hatten, sie immer noch als die Engländerin bezeichneten. »Sie leben noch das braune Gedankengut«, wie Maria spöttisch erklärt hatte. »Du wirst es schwer haben«, hatte sie ihre Schwägerin gewarnt, »überleg es dir gut, ob du das Angebot annehmen willst.«
Doch Vivien nahm die Herausforderung an. Die Schülerinnen mochten sie. Vivien Kroll sei modern, unterstütze die Mädchen, die einen Beruf ergreifen und nicht die soziale Passivität einer Ehe wählen wollten.
Und als Vivien die Treppen zu dem dunklen Gebäude hochblickte, lächelte sie. Sie konnte etwas bewirken, sie konnte Toleranz lehren, Pläne ernst nehmen, versuchen, die Mädchen aus pubertärer Unsicherheit ins Erwachsenenleben zu führen. Aber sie gingen weg, und sie selbst? Würde sie in zehn Jahren bis zu ihrer Pensionierung immer noch hier arbeiten?
Unerfreuliche Gedanken, stellte sie fest und wandte sich energisch zum Gehen. Nicht die richtigen Überlegungen gerade heute, wo sie von ihrem Liebhaber verlassen worden war. Und das sicher aus Altersgründen.
Wieder hörte sie ein Geräusch hinter sich, wieder sah sie sich rasch um, und da entdeckte sie den kleinen Daniel, der ihr offenbar gefolgt war. Schnell drückte er sich hinter den Sockel, auf dem sich die imposante Statue von Theodor Storm erhob.
Jetzt lief Vivien langsam weiter, in der Gewissheit, dass Daniel ihr in gebührendem Abstand folgte. Wieder drehte sich Vivien um. »Schmeckt dir die Schokolade?«, rief sie in die Dunkelheit hinein, und ganz zögernd kam der Kleine näher und lief auf sie zu, blieb vor ihr stehen, nickte.
»Weißt du was«, schlug Vivien vor, »ich begleite dich nach Hause, wo wohnst du denn?«
»Am Stadtwall.«
So gingen sie schweigend nebeneinander her, bis er seine kalte Hand in ihre schob. Sie liefen durch die Friedenstraße, vorbei an Marias Haus. Hier blieb Vivien stehen. »Siehst du? In der Nummer sieben, da wohne ich, und wenn du am Wochenende allein bist, kannst du mich jederzeit besuchen. Versprochen?«
Jetzt lächelte Daniel. »Versprochen«, sagte er mit großem Ernst. »Aber in dem Haus daneben«, er zeigte auf das Nachbarhaus, »da wohnt eine böse Frau. Sie mag mich nicht, sie sagt, ich soll verschwinden.«
»Das tut mir leid.« Wut packte Vivien, als sie in sein kleines trauriges Gesicht sah. »Ich spreche mit ihr. Aber komisch, dich habe ich noch nie gesehen.«
»Ich kann mich ja auch unsichtbar machen«, erklärte Daniel mit ernster Miene.
»Ach so, ja, dann ist alles klar.« Vivien unterdrückte ein Lachen, sie wollte ihn nicht kränken. »Und arbeitet deine Mama jeden Abend?«
»Ja, und auch Sonntagvormittags und abends und eigentlich immer. Aber da passt unsere Nachbarin Frau Fischer auf mich auf.«
»Ah ja? Das scheint sie ja nicht besonders gut zu machen«, lächelte Vivien, nicht ohne Besorgnis.
Daniel grinste und sah mit einem Augenzwinkern zu ihr hoch. »Sie ist eingeschlafen, und da habe ich mich rausgeschlichen. Sie schläft sicher noch, wenn ich jetzt heimkomme, ich habe ihr den Schlüssel weggenommen.« Ein kleines kindliches Lachen, voller Freude über den gelungenen Streich.
»Na ja, dann hoffe ich, dass das gut geht.«
»Wird schon«, erklärte Daniel großspurig.
Jetzt bogen sie in den Weg am Stadtwall ein, bis Daniel stehen blieb. »Hier wohnen wir.«
Vivien erschrak. Sie war schon seit einigen Jahren hier nicht mehr entlanggegangen. Sie erinnerte sich, wie im Krieg eines dieser Häuser eingestürzt war, als die Tiefflieger kamen. Heute war es immer noch teilweise zerfallen. Gras und Bäume wuchsen in der Ruine. In den Häusern daneben hatte man einen großen Teil der Flüchtlinge untergebracht. Graue, baufällige niedrige Häuser, auf deren Wänden überall die Parolen standen: Flüchtlinge raus, die Stadt gehört uns. Das Zeichen einer riesigen Blase aus Aggression und Hass, die wuchs und größer wurde, bis sie vielleicht bald in viele Stücke zerplatzte und eine Katastrophe auslöste.
»Siehst du?«, fragte Daniel. »In diesem Haus wohnen wir oben im ersten Stock, und bei Frau Fischer im Erdgeschoss brennt noch Licht.«
»Na, dann beeil dich mal, hoffentlich klappt alles.«
Sie wartete noch und sah zu, wie Daniel den Hausschlüssel aus seiner Tasche zog, aufsperrte und die Tür hinter sich zuzog. Dann erschien sein Kopf am Fenster im Erdgeschoss. Er hob die Hand und machte das Victory-Zeichen.
Vivien schüttelte lachend den Kopf. Daniel hatte es erreicht, dass ihre depressive Stimmung, die Gedanken an die Trennung von Tassilo, die Zweifel über ihre neue Position in den Hintergrund traten. Doch bevor sie sich umwandte, erkannte sie im fahlen Licht der Straßenlaterne noch das Wort, das in roten Buchstaben quer über die Hauswand gemalt war: Flüchtlings-Amihure.
Langsam ging Vivien nach Hause. Einem plötzlichen Impuls folgend, schlenderte sie die paar Schritte weiter bis zum Haus der Frau Hofer. Weder Maria noch sie selbst sprachen auch nur ein Wort mit ihr. Vor vielen Jahren hatte sie Nadja Pimarova, die junge Russin, die Maria bei sich aufgenommen hatte, denunziert. Russen haben in unserem Deutschen Reich nichts verloren … wie gut erinnerte sich Vivien an ihre Worte. Nadja war damals von der Gestapo abgeholt worden.
Und jetzt stand sie vor Frau Hofers Tür, bei der ihr Neffe Roland ein und aus ging. Er war ein Mitglied der Freunde unserer Heimat, ein geduckter Mitläufer dieses Vereins.
Sie würde Frau Hofer warnen: Wenn sie noch ein einziges Mal den kleinen Daniel angriff oder ihn verächtlich Neger nannte, würde das Folgen haben. Wut stieg in Vivien hoch, sie vergaß die Trennung von Tassilo, vergaß, wie deprimiert sie noch vor einer Stunde gewesen war.
Sie erinnerte sich an einen Satz ihres Ex-Ehemannes Philip. Er hatte ihn ausgesprochen, als er sich entschied, Juden vor dem Regime zu retten. Jeder ist für jeden verantwortlich …
Sie läutete und läutete Sturm, und obwohl im ersten Stock Licht brannte, wurde nicht geöffnet. Aber das Fenster stand offen, und so rief Vivien nach oben: »Wenn Sie, Frau Hofer, noch ein einziges Mal den kleinen Daniel oder seine Mutter beleidigen und angreifen, dann zeige ich Sie an.«
In den umliegenden Häusern gingen die Lichter an. Hatte sie wirklich so laut geschrien? Sie wartete. Keine Reaktion, oder hatte sie oben ganz kurz den Neffen am Fenster gesehen, der einen Blick zu ihr herunterwarf?
»Vivien, was machst du, wieso schreist du hier so herum?«
Auch Maria hatte es gehört, sie erschien am Gartentor. Vivien hatte sich inzwischen beruhigt. Es war eigenartig. Vor einigen Stunden hatte ihr jüngerer Geliebter sie verlassen, sie war so niedergeschlagen gewesen, und plötzlich fühlte sie sich gut.
Das Leben ging weiter, und sie würde es nicht mit Traurigkeit vergeuden. Es gab viel zu tun. Vivien fühlte sich von einer Last befreit. Sie hatte ihre Freiheit wieder.
»Und wieso bist du schon zu Hause?« Bei Maria brach die Neugierde durch.
Sie folgte Maria ins Haus. »Tassilo hat sich von mir getrennt«, sagte sie ruhig. »Und bevor ich dir jetzt leidtue, es gibt keinen Grund dazu. Alles ist gut«, erklärte sie ihrer Schwägerin, die sie nur erstaunt ansah. »Und übrigens, ich möchte mich für die Flüchtlingskinder einsetzen. Kennst du eigentlich den kleinen Daniel? Ich möchte erreichen, dass er nicht ausgegrenzt bleibt, und seine Mutter auch nicht.«
»Da hast du dir viel vorgenommen. Aber ich helfe dir.«
Kapitel drei
Das kleine Mädchen rennt, rennt über die Wiesen voller Margeriten, Glockenblumen und Zittergras. Es rennt weiter bis zu dem wogenden Kornfeld mit seinen blauen Blumen und dem roten Mohn dazwischen, weiter zu den Weiden, auf denen die Pferde grasen und die Köpfe heben und mit einem Wiehern auf sie zukommen. Sie freuen sich, das Mädchen zu sehen, wie auch die Bauern auf den Feldern, die ihr lachend zuwinken, wenn sie weiterrennt. Sie rennt immer, sie ist ein Kind, und sie ist glücklich. Ein Mädchen, das an die Liebe der Menschen glaubt, an Zuneigung und die Beständigkeit ihres Lebens. Ihren Eltern gehört das große Gut, das größte in der Gegend, seit Jahrhunderten im Besitz der Familie von Freyberg, umgeben von Wiesen, von Rapsfeldern, von Heckenrosen, die im Mai besonders schön duften, und an jene Maitage wird sich Veronika immer erinnern, auch wenn die Heimat längst untergegangen ist.
Ein paar sorglose Jahre vergehen noch, bis sich drohende Wolken über dem Gutshof des Barons von Freyberg, seiner Frau und seiner Tochter Veronika Vera zusammenziehen. Es passiert langsam, stetig. Die Sorglosigkeit, die Geborgenheit und das Gefühl von Freiheit gibt es nicht mehr. Ein Wort hat alles zerstört: Krieg. Sie ist neun Jahre alt, als im Radio die Meldung kommt: Adolf Hitler ist in Polen einmarschiert.
Die Knechte verlassen das Gut, sie haben einen Einberufungsbefehl, ihr Vater muss an die Front. Die Gesichter der Frauen sind blass, die Augen verweint. Und wo ist der liebe Gott, zu dem sie all die Jahre so vertrauensvoll betete, als das Schlimmste passiert, was sie sich vorstellen kann? Ein Brief trifft ein, ihr Vater ist gefallen. Wo ist Gott, wie kann er es zulassen? Wie kann es passieren, dass ihre Mutter jeden Lebensmut verliert, sich in die Depression zurückzieht, nicht mehr ansprechbar ist?
Stille kehrt auf dem Gutshof ein, die Pferde werden weggebracht, das Vaterland braucht sie.
Sechs Jahre Krieg. Zeit des Frierens, des Hungers, der Angst vor Luftangriffen, vor Dieben, Verbrechern, vor Deserteuren, die sich in der Scheune verstecken. Tagelöhner, die sich herumtreiben. Früher arbeiteten sie für den Vater, heute kommen sie, stellen frech ihre Forderungen, wollen Geld, Lebensmittel, den Schmuck der Mutter. Eine Zeit, in der sie lernt, mit dem Gewehr und der Pistole ihres Vaters umzugehen. Ohne Waffe geht die Zwölfjährige nicht mehr aus dem Haus.
Ist nicht sie jetzt die Starke, die Bewahrerin des Gutshofs, die Bewahrerin der Vergangenheit, die Beschützerin der Mutter? Sie und ein paar weibliche Hausangestellte, etwa die Köchin Emmi, sind noch hier. Die Bauern, die für sie gearbeitet hatten, sind zurückgegangen zu ihren Familien. Sie und Emmi sind es, die das Tafelsilber ganz hinten im Gemüsegarten vergraben, zusammen mit dem Familienschmuck. Doch dann, Anfang 1945, ist es so weit: Sie packen, sie müssen weg, Deutschland ist besiegt, die Rote Armee im Anmarsch. Man sieht ihre Spur der Vernichtung, Feuer am Horizont, die Dörfer brennen, die Alten auf ihren Höfen werden erschossen und die jungen Frauen vergewaltigt.
Sie ist jetzt fünfzehn, sie müssen weg, weg aus dem Haus, in dem sie aufwuchs, weg in eine unsichere Zukunft. Es ist der eiskalte Januar des Jahres 1945, einer der kältesten Winter des Jahrhunderts. Deutschland ist vernichtet. Täglich sehen sie Pferdefuhrwerke, beladen mit Habseligkeiten der Menschen, die flüchten, während die Rote Armee näher rückt, während der Himmel Tag und Nacht rot von Feuer ist. Immer schrecklichere Gerüchte machen die Runde: dass Menschen abgeschlachtet werden und zerstückelt, dass Frauen nach Vergewaltigungen verbluten. Doch ihre Mutter, Emmi und sie bleiben, denn ihre Mutter weigert sich, schreit, schlägt um sich. Wir müssen weg, warnt Emmi, aber sie schafft es nicht, die Mutter allein zu lassen, und sie mitzunehmen geht nicht mehr.
Da sie bleibt, erlebt sie mit fünfzehn Jahren den schrecklichsten Albtraum ihres Lebens.
Kapitel vier
Doch das Stück ist nun aus, und ich wünsch euch viel Heil
Und dass es euch künftig so gefallen mag.
Der letzte gesungene Vers des Narren. Der Schluss der Komödie.
Blass und erschöpft sahen sich die Schauspieler an.
Die erste Durchlaufprobe in Kostüm und Maske war gestern am späten Abend zu Ende gegangen. Mit Pannen, Verzögerungen, Lichtproben, Texthängern. Die Kostümbildnerin, der Bühnenbildner und die Maskenbildnerin saßen in der Reihe vor Julian, der immer wieder die Probe unterbrach, weil ihm das Kostüm oder ein Hut oder eine Perücke nicht gefiel, der das Licht geändert haben wollte, der unzufrieden war.
Es war später Abend gewesen, als Julian endlich die Probe beendet hatte. Er wusste, dass er nicht länger proben durfte, weil die Gewerkschaft es nicht erlaubte.
Da er nicht zufrieden war, hatte er für heute Morgen eine weitere Probe angesetzt und sie jetzt, kurz vor drei, beendet.
»Das war gestern und auch heute nichts.« Julians Stimme klang ruhig. »Oder sagen wir, es war noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Morgen früh möchte ich vor der Probe eine Besprechung mit einigen Damen und Herren des Ensembles ansetzen, die Namen gebe ich noch bekannt.«
Er sah sich um, sah den Schauspielern in die müden, geschminkten Gesichter und wählte einige aus. Anna war nicht dabei, und so verließ sie mit einem kurzen Gruß an die Kollegen die eiskalte Bühne. Sie lief in ihre Garderobe und zog sich um. Als Viola trug sie am Schluss ein schönes helles Kleid, und Julian wollte, dass sie keine Perücke trug, damit ihr kurzes Haar sichtbar blieb.
Als sie das Theater verließ, wartete Hans Dunker am Bühneneingang auf sie. »Gehen wir noch einen Kaffee trinken? Der Tag ist ja noch jung.« Ein charmantes Lächeln, ein Griff nach ihrem Arm.
Sie zögerte, dabei fiel ihr Blick auf Julian, der neben der Portiersloge stand. Fast hatte sie den Eindruck, er warte auf sie.
Einen kurzen Moment blieb sie stehen, ihre Blicke trafen sich, doch da drehte sich Julian um und ging durch die Glastür ins Freie. Sie sah ihn die paar Stufen hinunter in den Innenhof steigen.
Hans hatte in einer vertraulichen Geste ihren Arm genommen, so gingen sie bis zur Maximilianstraße. Es war ein strahlender, warmer Herbsttag, fast zu warm für Ende November. Im Theater hatte man nichts von dem schönen Wetter mitbekommen. »Sei mir nicht böse, Hans, aber verschieben wir’s.«
Sie hatte keine Lust, sich auf Hans einzulassen, außerdem sah sie Antonia, die lässig an einem roten VW Cabriolet lehnte. Die Füße überkreuzt, winkte sie ihrer Cousine zu, die erstaunt auf sie zulief. »Hast du auf mich gewartet?«, fragte Anna.