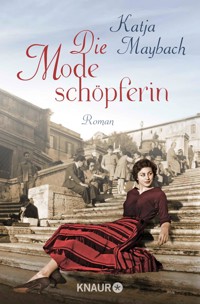5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Chronik der Familie Laverne
- Sprache: Deutsch
Begleiten Sie die Familie Laverne durch die schicksalhaften Jahre ab 1945: Der historische Roman »Schicksalskinder« ist der 3. Teil der großen Familiensaga »Die Chronik der Familie Laverne« um einen eleganten Kurort an der französischen Grenze. Bad Lichtenberg im Mai 1945. Für Luise Laverne ist jeder Tag ein Tanz auf dem Drahtseil: Unter ihrer Leitung hat das mondäne Kurhotel der Familie zu altem Glanz zurückgefunden, nun geht die Polit-Prominenz der NSDAP im »Deutscher Kaiser« ein und aus – während Luise in einem Zimmer ohne Nummer den jüdischen Architekten Simon Roth versteckt, ihre große Liebe. Luises Schwester Victoria fiebert derweil der Premiere in ihrem Showtheater entgegen und übersieht dabei, dass ihre 14-jährige Tochter Natalja sich mit einem Jungen trifft. Und Felix Laverne wartet nach seiner Flucht aus Ostpreußen halb verrückt vor Sorge auf Nachricht von seiner Frau, die ihm mit den beiden Söhnen erst einige Zeit später folgen wollte. Doch noch ist der Krieg nicht vorüber, und eines Nachts heulen schließlich auch in Bad Lichtenberg die Sirenen … Katja Maybach erzählt im 3. und abschließenden Teil ihres historischen Familienromans vom Ende des 2. Weltkriegs, einer dramatischen Flucht aus Ostpreußen und von einem Familiengeheimnis in Paris – und sie lässt die Kinder der Familie Laverne in eine optimistische Zukunft blicken. Die ergreifende Familiengeschichte »Die Chronik der Familie Laverne« ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Schicksalszeit (1914–1920) - Schicksalsstunden (1930–1936) - Schicksalskinder (1945–1948)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Katja Maybach
Schicksalskinder
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Bad Lichtenberg im Mai 1945. Für Luise Laverne ist jeder Tag ein Tanz auf dem Drahtseil: Unter ihrer Leitung hat das mondäne Kurhotel der Familie zu altem Glanz zurückgefunden, nun geht die Polit-Prominenz der NSDAP im »Deutscher Kaiser« ein und aus – während Luise in einem Zimmer ohne Nummer den jüdischen Architekten Simon Roth versteckt, ihre große Liebe.
Luises Schwester Victoria fiebert derweil der Premiere in ihrem Showtheater entgegen und übersieht dabei, dass ihre 14-jährige Tochter Natalja sich mit einem Jungen trifft. Und Felix Laverne wartet nach seiner Flucht aus Ostpreußen halb verrückt vor Sorge auf Nachricht von seiner Frau, die ihm mit den beiden Söhnen erst einige Zeit später folgen wollte.
Doch noch ist der Krieg nicht vorüber, und eines Nachts heulen schließlich auch in Bad Lichtenberg die Sirenen …
Inhaltsübersicht
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Eins
Kurort Bad Lichtenberg Dezember 1944
Nataljas Gesicht hellte sich auf, als sie nach oben sah und die ersten Schneeflocken auf den Wangen spürte. Während sie stehen blieb und in den grauen Himmel starrte, ob der Schnee wohl in Regen überging, wurde sie von hinten leicht angestoßen, und ihr Klavierauszug, fest unter den Arm geklemmt, rutschte heraus und fiel zu Boden.
»Entschuldigung, tut mir leid … ich habe nach oben geblickt … ob es wirklich schneit …«
Natalja drehte sich um und lächelte, nur eine Schneeflocke reichte zu ihrem Glück, und nichts konnte es stören. Sie sah, wie der Junge den Auszug von der Straße aufhob und ihn ihr gab. Er hatte sich also auch über die wenigen Schneeflocken gefreut, wie konnte sie da ungehalten sein? Das Papier wellte sich ein wenig, der Auszug war nass, doch es machte nichts. Es schneite, und dieser blasse hübsche Junge sah sie so forschend an, dass sie ihn strahlend anlächelte. Wie alt mochte er sein? Vielleicht sechzehn, siebzehn? Seine blonden Haare waren etwas zu lang, doch das gab ihm ein romantisches Aussehen.
»Alexander«, stellte er sich vor und hielt ihr höflich die Hand entgegen. Bevor Natalja sie ergriff, deutete er mit dem Kopf auf den Klavierauszug. »Mondscheinsonate, du spielst Beethoven?«
Staunen hörte sie aus seiner Stimme heraus, sie zeigte sich auch in seinem Gesicht.
Natalja zögerte, er duzte sie einfach, hielt er sie noch für ein Kind? »Natalja«, stellte sie sich vor, ohne auf seine Frage einzugehen.
»Ein schöner Name, ein russischer.« Sein Erstaunen wuchs. Sicher würde er sie jetzt fragen, wieso sie einen russischen Namen im nationalsozialistisch geprägten Deutschland trug, in das sie ja hineingeboren worden war.
Sie wusste es selbst nicht so genau. »Ich hatte eine russische Kinderfrau«, erzählte sie bereitwillig.
»Ach ja? Und sprichst du auch Russisch?« Sein Interesse wuchs mit seinem Erstaunen.
»Du bist ganz schön neugierig«, erklärte Natalja, erzählte aber doch weiter. »Ja, in meinen ersten Jahren habe ich nur Russisch gesprochen, und als ich dann aus Berlin hierher zu meinen Großeltern und meiner Tante kam, verstanden sie mich erst gar nicht.« Jetzt lachte sie in Erinnerung daran. »Damals war ich fünf«, fügte sie noch hinzu. War das falsch? Wenn er nachfragte, kam heraus, dass sie erst dreizehn war. Aber sie sah aus wie fünfzehn, das sagte auch ihre Großmutter Irene. Und sie hatte bereits eine musikalische Vergangenheit.
Sie war ein Wunderkind gewesen – schon im Alter von neun Jahren gewann sie in München einen Klavierwettbewerb und ein halbes Jahr später sogar einen internationalen Nachwuchswettbewerb. Mit dieser Vergangenheit war sie doch bereits fast erwachsen. Sie wurde verlegen, als Alexander sie weiterhin interessiert ansah. Natalja war nicht groß, und ihr schmaler Körper nahm ganz zarte weibliche Formen an, sie bewegte sich ein wenig linkisch, das hatte Großmutter Irene beanstandet. Sie müsse lernen, sich graziös zu bewegen. Das hatte zu einem heftigen Streit zwischen ihrer Großmutter und ihrer Mutter Victoria geführt.
»So ein Unsinn«, hatte Victoria erklärt, »setz meiner Tochter nicht diese veralteten Vorstellungen in den Kopf, das war schon zu meiner Zeit nicht mehr aktuell. Meine Tochter hat eine große Begabung, nur das zählt, außerdem ist sie hübsch. Basta.«
Das hatte Natalja zum Nachdenken gebracht. War sie nun einfach nur eine große Begabung oder doch auch hübsch? Schließlich war Victoria ihre Mutter und fand ihre Tochter aus diesem Grund hübsch. Sie selbst mochte ihre helle Haut, die Sommersprossen und die rötlichen Haare der Laverne-Frauen nicht. Die Jungen vom Kurfürstengymnasium, die oft vor der Mädchenschule der englischen Fräulein standen, neckten sie wegen der roten Haare. Rotfuchs, Rotfuchs, schrien sie ihr nach. Aber es waren einfach nur dumme Jungs, sie aber war bereits fast erwachsen und würde eine berühmte Pianistin werden. Sie sah jetzt Alexander an, der sie weiterhin stumm beobachtete. Was sollte sie jetzt sagen, da er schwieg? So standen sie voreinander, verlegen und unsicher. Dann aber antwortete sie. »Ja, ich spiele die Mondscheinsonate«, erklärte sie endlich und hob den Auszug hoch.
»Alexander, komm bitte, ich warte schon auf dich.«
Sie standen vor der Wandelhalle mit ihren Brunnen, und im Eingang erschien jetzt ein Arzt im weißen Kittel, der seine Ungeduld nicht verbergen konnte. Alexander wandte den Kopf, rief: »Ich komme ja«, und drehte sich Natalja wieder zu. »Wie du siehst, wartet man schon auf mich, leider.« Bedauernd hob er die Schultern.
Natalja erschrak. Wer hierherkam, um das Heilwasser der Brunnen zu trinken, war oft krank. Früher, oder ganz früher in der Steinzeit, wie es Natalja in Gedanken formulierte, kamen die Kurgäste hierher, um zu flanieren, sich in eleganter Robe zu zeigen und von Kellnern im Frack das Wasser in kostbaren Gläsern reichen zu lassen, um dabei über die neuesten Gesellschaftsereignisse zu klatschen. Das hatte Luise erzählt, doch wer jetzt kam, erhoffte sich Gesundheit aus der Quelle der Natur.
»Bist du … ich meine …« Sicher war es unhöflich, ihn zu fragen, ob er krank sei, aber …
»Ich war krank, aber jetzt geht es mir gut. Mein Vater glaubt an die Heilkraft dieses Brunnens, darum hat er mich hierhergeschickt. Einfach zur Erholung«, erklärte er leichthin.
Welche Krankheit hast du gehabt? Die Frage lag Natalja auf der Zunge, doch sie sprach es nicht aus. Aber sie wollte mehr wissen. »Bist du Patient in einer der Kliniken hier?«
Er schüttelte den Kopf. Er sei erst vor einer Woche hier eingetroffen und wohne bei seiner Großtante, Marlies Schwarz. »Ich kenne hier noch niemanden«, setzte er nach einem kleinen Zögern hinzu, »vielleicht könnten wir uns einmal treffen?« Seine Stimme klang unsicher.
»Ja, natürlich.« Nataljas Antwort kam, ohne nachzudenken. »Vielleicht Schlittschuhfahren?«, schlug sie mit einem Blick nach oben vor, denn die Schneeflocken verdichteten sich. In ihrer Fantasie sah sie sich bereits Hand in Hand mit Alexander über den zugefrorenen Weiher im Stadtpark gleiten.
Jetzt lachte Alexander. Wie hübsch er dabei aussah. Natalja spürte ihr Herz klopfen.
»Ja, das wäre schön«, stimmte er zu. Dann drehte er sich endgültig um, und mit einem »Wir sehen uns sicher, ich bin jeden Nachmittag um vier Uhr hier …« lief er auf den wartenden Arzt zu.
Natalja blieb noch einen Moment stehen, doch dann erschrak sie – auch sie wurde erwartet. Ihr Lehrer, Professor Geiger, wurde sehr schnell ungehalten, wenn sie sich verspätete. Keine Disziplin, sagte er dann regelmäßig. »Keine Disziplin, das Wichtigste für einen Künstler, hast du das noch nicht begriffen?«
»Ich bin erst dreizehn«, wandte sie dann jedes Mal ein, und jedes Mal erwiderte der Professor, das spiele keine Rolle, sie sei hochbegabt, und das bringe nun einmal Verpflichtungen mit sich.
Und so rannte sie jetzt los, vorbei an den Säulen der prunkvollen Wandelhalle, dann hetzte sie am Grand Hotel Deutscher Kaiser vorbei, bis sie in die kurze Privatstraße Am Anger einbog. Hier wohnte der berühmte Professor, der in Berlin vor drei Jahren ausgebombt wurde und seine Frau in den Trümmern sterben sah. »Durch Musik kannst du Schmerz verarbeiten. Und solange es Musik gibt, ist man nicht einsam.«
Seine Worte prägten sich Natalja ein. Denn war nicht auch sie einsam? Sie wuchs ohne Freundinnen, ohne andere Kinder auf, sie hatte nicht wie andere gespielt oder war durch den Park der Villa ihrer Großeltern getobt. Sie war eine schlechte Schülerin, bekam Nachhilfestunden, doch die meiste Zeit verbrachte sie am Flügel oder bei Professor Geiger. Das war ihr Leben, doch sie hatte nicht den Eindruck, ihre Kindheit verpasst zu haben. Nur die Musik zählte. »Eines Tages aber«, hatte Tante Luise ihr gesagt, »wirst du dich verlieben, und alles wird sich verändern, du wirst dich verändern. Denn die Liebe ist das Schönste und Bedeutendste, was man erleben kann.«
Das hatte ausgerechnet Luise, die Karrierefrau, gesagt, die das international renommierte Grand Hotel Deutscher Kaiser leitete. Als Luise ihr das sagte, hatte ihre Stimme traurig geklungen. Das hatte Natalja beschäftigt. Die Liebe sei das Größte? War das nicht ein Satz aus der Bibel? Es musste ja nicht das ganz große, alles verändernde Gefühl sein, von dem Luise gesprochen hatte, aber war man bereits verliebt, wenn man sich mit einem hübschen Jungen unterhielt und dabei Herzklopfen bekam? Der sich dazu auch noch über Schnee freute, so wie sie? Das war doch bereits eine erste Gemeinsamkeit, oder nicht? Das Anzeichen, verliebt zu sein?
Jetzt stand sie atemlos vor dem Gartentor des Hauses von Professor Geiger. Lang und anhaltend drückte sie auf die Klingel. Sie könnte behaupten, er habe ihr mehrfaches Läuten überhört. Doch schon öffnete sich die Haustür, und der Lehrer stand mit verschränkten Armen kopfschüttelnd dort und sah ihr missbilligend entgegen. Keine Chance einer kleinen Flunkerei.
»Es tut mir leid, der Schnee …«, versuchte sie eine Entschuldigung, bevor sie dem vorwurfsvoll schweigenden Professor ins Haus folgte.
Zwei
Victoria saß im abgedunkelten Zuschauerraum ihres Theater im Palmengarten und beobachtete das Probetraining neuer Tänzerinnen auf der Bühne. Sie trugen schwarze Übungstrikots und bemühten sich, auf die Musik von Jacques Offenbach Temperament und Freude beim Tanzen zu versprühen. Auch der Korrepetitor am Klavier tat sein Bestes.
»Wir machen eine Pause«, rief Victoria hoch, lehnte sich zurück und legte die Beine auf die Rückseite des Vordersitzes. »So wird das nichts. Alles wirkt lahm, wenn die Leute an Silvester zu uns kommen, wollen sie ein paar Stunden mitgerissen, unterhalten werden, den Krieg vergessen.« Die Choreografin Berthe kam die paar Stufen von der Bühne herunter, umlief den kleinen Orchestergraben und setzte sich neben Victoria.
»Du erwartest zu viel, Victoria. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wie soll man da groß Pläne machen? Seit die Wehrmacht in Stalingrad kapituliert hat und in Ostpreußen der Einmarsch der Roten Armee begonnen hat, wie soll man da bei den täglichen Horrormeldungen noch Freude versprühen können.«
»Das ist unser Beruf, auch Berufung, vergiss das nicht. Wir haben die Aufgabe, Menschen zu unterhalten, sie für ein paar Stunden glücklich zu machen.«
»Jaja, Victoria, ich weiß.« Berthe versuchte, locker zu klingen. »Aber keine Vorstellung ist mehr ausverkauft, Zuschauer aus Baden-Baden und den umliegenden Orten bleiben weg.«
»Das ist verständlich«, sagte Victoria. »Wer will schon im Zug sitzen, der aus der Luft bombardiert wird, oder auf der Autobahn durch einen Tiefflieger erschossen werden.«
»Jaja, und für die Tänzer und Schauspieler ist es wenig motivierend, vor fast leerem Haus zu tanzen oder zu spielen.«
»Da darf man nicht eitel oder empfindlich reagieren, Berthe. Letztendlich haben sie oben hier im Haus eine Wohnung, ein gutes Gehalt, und sollte es zu Luftangriffen kommen, ist der Keller unter dem Orchestergraben bombensicher. Sie sind hier also wesentlich geschützter als in Berlin oder München.«
»Toi, toi, toi.« Berthe klopfte auf die Rücklehne eines Stuhls. »Bis jetzt zumindest. Was noch kommt, wissen wir nicht. Aber du hast recht, wir müssen unser Bestes geben, auch wenn wir nur für drei Zuschauer tanzen.«
»Ja, Berthe. Außerdem ist die Silvestervorstellung ausverkauft, die Karten gehen alle an Gäste des Deutschen Kaisers. Das Hotel ist übrigens ausgebucht, wie offenbar auch die anderen Hotels und Pensionen. Ihr werdet alles geben, euch selbst übertreffen, verstanden?«, rief Victoria hoch zu den Tänzern, die frierend auf der Bühne einen Kreis gebildet hatten.
Sie sahen sich an, nickten stumm zu Victoria hinunter.
»Jetzt geht hoch, für heute ist Schluss.« Damit entließ Victoria ihre Gruppe. »Wärmt euch auf, morgen geht es dann weiter.«
Victoria wühlte in ihrer Tasche und zog eine Zigarette heraus. Die Zigaretten, die man auf Lebensmittelkarten bekam, waren sehr knapp bemessen, und diese hier war bereits die letzte. Sie machte einen tiefen Zug, lehnte sich zurück und nahm die Füße vom Vordersitz. Sie sah zu, wie die Tänzer erschöpft von der Bühne schlichen, da sie heute kein Lob von der Chefin bekommen hatten. »Es wird schon werden, wir haben es immer geschafft«, rief Victoria ihnen noch nach. »War ich zu hart zu ihnen?«, wandte sie sich an Berthe.
»Nein, nein«, widersprach die Choreografin schnell, »du machst das schon ganz richtig, Zuckerbrot und Peitsche.«
Victoria überhörte die Ironie in Berthes Stimme. Auch sie war müde, und letztendlich war es ihre Tanztruppe, ihr Theater, das sie hier im Kurort vor sieben Jahren gegründet und den Erfolg hart erarbeitet hatte. Vor acht Jahren war sie aus Berlin gekommen, weil niemand mehr Victoria Laverne als Kostümbildnerin engagiert hatte. Sie sei »weg vom Fenster«, wie ein Agent ihr kühl erklärt hatte. Keiner hatte geglaubt, dass sie, die »Ausgebrannte, die Erfolglose« ein Theater aufbauen und führen könnte.
Aber sie hatte es geschafft, sie hatte an ihren Erfolg geglaubt, hier in Bad Lichtenberg ein kleines Showtheater eröffnen zu können. Und ihre zähe Arbeit, ihr Wille und das Verzichten auf jegliches Privatleben hatten es ermöglicht. Das Provinztheater war schnell bekannt geworden, zu jeder neuen Aufführung kamen Kritiker aus den Großstädten und hatten dieses kleine Theater hochgelobt, es sei ein Schmuckstück der Provinz. Doch ein Kritiker hatte geschrieben, es sei ein Theater für die Reichen und Schönen, die in Bad Lichtenberg in einem der besten Luxushotels Europas wohnten, vor einer Vorstellung Champagner schlürften und anschließend zum Dinner in eines der edlen Restaurants des Hotels gingen. Das sei ein Hohn, ein Schlag ins Gesicht des ganzen Lands, dessen Bevölkerung hungerte, ausgebombt war oder um ihre Männer an der Front trauerte. Von ihnen, die im Dreck und Schlamm ihr Land verteidigten, mal abgesehen. Und die zu Tausenden ihr Leben für das Vaterland opfern mussten.
Das hatte Victoria getroffen, denn genau das war nicht die Vision eines Theaters gewesen, wie sie es geplant hatte, es sollte ein Theater für alle werden. Aber das war es nicht geworden, die meisten Zuschauer kamen aus dem Deutschen Kaiser.
Victoria erhob sich. »Berthe, ich muss gehen, ich treffe jetzt Frank Welser, er hat das Kurfürstentheater hier übernommen.«
»Was? Der kommt in die Provinz?« Berthe staunte. »Er ist doch international berühmt für seine Inszenierungen am Berliner Opernhaus.«
»Das voriges Jahr durch eine Brandbombe vollkommen zerstört wurde. Ich kenne ihn übrigens aus meiner Berliner Zeit.«
»Ach so, ja, und jetzt findet auch er den Weg in die Provinz.«
Victoria gab keine Antwort mehr, sie war in Gedanken bereits bei dem berühmten Opernregisseur, der das kleine Barocktheater am Rathausplatz übernehmen wollte. Sie schlüpfte in ihren Mantel, schlang sich den gestrickten Schal ihrer Mutter um den Hals und zog die Mütze auf. Sie war komplett durchgefroren, dann verabschiedete sie sich kurz von Berthe und verließ das Theater. Vor dem Restaurant Palmengarten blieb sie einen Moment stehen. Am Flügel saß ein Pianist, wie in früheren Zeiten untermalte er mit seinem Spiel die gedämpfte Unterhaltung der Gäste des Lokals. Manchmal, wenn sie hier stand und dem Klavierspiel zuhörte, erinnerte sie sich an den Sommer 1914, an seine Wärme, die Sonne, die Kriegseuphorie, wenn der kleine Zeitungsjunge durch den Palmengarten lief, das Extrablatt hochhielt und neue Nachrichten verkündete. Eine davon war: Russland hat Deutschland den Krieg erklärt …
In diesen Sommertagen hatte hier ein junger russischer Pianist gesessen, Juri Petkov, und den Liebestraum von Liszt gespielt. Nur für sie, Victoria, das sechzehnjährige junge Mädchen, gerade aus dem Internat zurückgekehrt. Juri, der nach den Tagen der ersten Liebe so plötzlich verschwunden war. Erst viel später war ihr klar geworden, er musste als Russe zurück, um für sein Vaterland gegen Deutschland zu kämpfen. Juri, den sie viele Jahre später in Berlin wiedertraf, Juri, ihre große Liebe. Doch gerade die Momente, die Stunden mit ihm im Sommer 1914 blieben unvergessen, vielleicht auch, weil sie so jung und verletzlich war. Und der Schmerz so groß, als er ging.
Sie gab sich einen Ruck, atmete durch und sah sich im Restaurant um. Der Palmengarten war voll besetzt, die Leute kamen nachmittags hierher, weil sie zu Hause froren und der Palmengarten wie auch das Grand Hotel Deutscher Kaiser noch beheizt wurde.
Jetzt sah sie Frank Welser in einer Ecke sitzen, fast verdeckt durch eine Palme. Er beugte sich vor, sah zum Eingang herüber und beobachtete die Hereinkommenden. Er sah sie an, blickte weg. Erkannte er sie nicht? Hatte sie sich so verändert? Auch als sie ihm winkte und auf ihn zuging, sah er ihr immer noch irritiert entgegen. Da nahm sie ihre Mütze ab, fuhr sich schnell durch die kurzen Haare, und erst als sie direkt an seinem Tisch stand, sprang er auf, um sie zu begrüßen. »Entschuldigen Sie, aber ich habe Sie nicht sofort erkannt.«
Das traf sie mehr, als sie dachte – oft hatten sie sich in Berlin auf Premierenfeiern oder Einladungen gesehen, sich zugewinkt, doch nie miteinander gesprochen. Aber letztendlich war das schon zehn Jahre her. Er half ihr aus dem alten dicken Mantel, und sie setzte sich rasch, denn zum ersten Mal seit langer Zeit wurde ihr bewusst, wie sie aussah in dem gestrickten Pullover ihrer Mutter Irene, die das Stricken entdeckt hatte und es für Kriegswaisen und Mütter tat, und auch für ihre verfrorene Tochter Victoria.
»Ja«, sagte sie forsch, nachdem der erstaunte Blick des Regisseurs sie nicht losließ, »ich weiß, ich weiß, hier sehe ich etwas anders aus als in der Hauptstadt.«
Jetzt lachte Frank. »Entschuldigen Sie, aber in Berlin kannte man Sie als extravagante Frau mit dem besonderen Haarstil und den eleganten Hosenanzügen.«
»Die kurzen Haare habe ich immer noch, wie Sie sehen, und ich trage die Kleidung, die für mich hier passend ist.« Ihre Stimme klang schärfer, als sie gewollt hatte.
Sie setzte sich ihm gegenüber, blieb jetzt aber freundlich, und im Laufe der Unterhaltung ließ sie sich doch von ihm einnehmen, von der Intensität, mit der er über seine Pläne hier im Barocktheater sprach. Er wolle aus diesem kleinen Opernhaus ein berühmtes Theater machen, »in der Art, wie Sie es hier mit Ihrem Showtheater erreicht haben. Das ist außergewöhnlich«.
Wollte er wiedergutmachen, dass er sie gekränkt hatte? Hatte er es erkannt? Sie sprach wenig, hörte zu, als er über Berlin sprach, die Stadt, die bereits fast ganz in Trümmern lag. Er erzählte von seinen letzten Inszenierungen an der Deutschen Oper Berlin. »Götterdämmerung«, das war wie ein Zeichen, der Untergang einer Stadt. »Vielleicht sogar des Landes.«
Während er sprach, beobachtete sie ihn. Frank Welser musste so um die fünfundvierzig Jahre alt sein, er sah nicht wirklich gut aus, doch er strahlte Persönlichkeit und Energie aus, und der intensive Blick seiner blauen Augen konnte sein Gegenüber nervös machen.
Während sie Tee tranken, erzählte er von seinen konkreten Plänen für das Opernhaus. Er wolle es am 15. Juni nächsten Jahres mit Verdis La Traviata eröffnen. »Haben Sie Lust, die Kostüme dafür zu entwerfen? Opulent und etwas ›fürs Auge‹.«
»Na ja.« Victoria blieb skeptisch. »Jeder weiß, dass das Theater kein Geld hat, wie wollen Sie das finanzieren?«
»Irgendwie werden wir es schaffen.« Seine Begeisterung war ansteckend, und für sie war das eine neue Herausforderung. Opernkostüme zu entwerfen, das war etwas anderes als Showkostüme mit Glitzer und Perlen und immer nur Revue, Revue – wenn sie ehrlich war, hing es ihr zum Hals heraus.
Voller Euphorie und mit dem Entwurf eines Vertrags in der Tasche verließ sie nach zwei Stunden intensiven Gesprächs den Palmengarten. Sie fühlte sich inspiriert und voll neuer Energie. Bedeutete die Oper einen Neuanfang, nachdem sie nach Jahren im Showbusiness gelangweilt, ausgepowert war? Aber sie musste jetzt doppelt so viel arbeiten, für ihr eigenes Theater und gleichzeitig für das Opernhaus.
Sie sah hoch in die grauen Wolken, denn es schneite in dicken Flocken, und Victoria hielt ihr Gesicht dem Himmel entgegen, aus dem der Schnee lautlos auf die Erde fiel und sogar liegen blieb. Und das war hier in dem warmen Klima, in dem Palmen und Wein gediehen, etwas Besonderes. Etwas weiter weg stand ein junger Mann und ein … war das Natalja? Traf sich ihre Tochter mit einem jungen Mann? Doch dann verwarf sie den Gedanken. Natalja musste um diese Uhrzeit bei ihrem Professor sein, und niemals hätte sie eine Unterrichtsstunde versäumt.
Schnell lief Victoria weiter und bog in die Birkenallee ein, vielleicht war sogar ihr Vater in der Villa, dann konnte sie den Vertrag gleich mit ihm durchgehen.
Noch ganz in dem Gespräch mit Welser verfangen, vergaß sie, dass sie mit ihrer Schwester Luise im Wintergarten des Deutschen Kaisers verabredet war.
Drei
Luise wartete im Wintergarten des Deutschen Kaisers auf ihre Schwester. Hatte sie die Verabredung vergessen? Victoria vergaß vieles in letzter Zeit, sie war überfordert mit der Führung und Erhaltung des Showtheaters, jede Saison zwei Inszenierungen, immer wieder neue Tänzer, neue Shows, wenig Einnahmen.
»Frau Direktor?«
Luise schreckte aus ihren Gedanken hoch.
Der Page Fritz stand vor ihrem Tisch. »Zwei Herren warten in der Halle auf Sie.«
Luise erhob sich und folgte dem Sechzehnjährigen, dessen Uniform ihm ein wenig um den schmalen Körper schlotterte. Er war freigestellt, musste nicht an die Front, wie inzwischen viele Jugendliche seines Alters, die man von der Schulbank wegholte, ein Gewehr in die Hand drückte und an eine der vielen Fronten schickte. Fronten, die nacheinander zusammenbrachen.
In der Halle standen zwei Männer in schwarzen Ledermänteln, und als sie ihnen entgegenging, hoben sie den Arm zum Hitlergruß.
Als Luise endlich in ihre Suite zurückkehrte, wurde es bereits dunkel. Sie öffnete die Terrassentür einen Spalt, um die frische Winterluft hereinzulassen. Tief atmete sie durch. Immer noch in Anspannung, das Falsche gesagt zu haben.
Hatte man sie in eine verbale Falle tappen lassen, ihr etwas entlockt, was die Gestapo hören, sie aber nicht hätte preisgeben dürfen? Als das Telefon läutete, erschrak sie zutiefst, löste sich von der Terrassentür und ging zu ihrem Schreibtisch. Hatten die Beamten von der Gestapo eine Frage vergessen, sollte sie noch einmal zum Verhör nach unten kommen? Und das war es gewesen, sie hatten zwar höflich erklärt, sie hätten nur ein paar Fragen, bedankten sich, dass Frau Luise Laverne, die das Grand Hotel so erfolgreich leite, sich Zeit für sie nahm. Sicher wisse sie, dass das Hotel von führenden Parteimitgliedern hochgeschätzt wurde. Doch am anderen Ende der Leitung war die junge Frau der Telefonzentrale. »Ihr Fräulein Schwester will Sie sprechen.« Victoria erklärte hastig, es täte ihr so leid, sie habe einfach vergessen, dass sie verabredet gewesen waren. »Aber weißt du, ich habe den berühmten Opernregisseur Frank Welser …«
Hörte Luise ein leichtes Klicken in der Leitung, wurde sie bereits abgehört, oder versagten ihre Nerven? »Das macht nichts, Victoria, wir sehen uns ja am Sonntag zum Essen.«
»Ja, stimmt. Onkel Carl übrigens versucht schon seit Wochen, Felix dazu zu überreden, Ostpreußen zu verlassen, auch wenn es doch …«
»Wie geht es Mutter?«, unterbrach Luise sie.
»Gut«, sagte Victoria erstaunt. »Du weißt ja, sie kümmert sich um Kriegswitwen und Waisen, wie sie das schon während des vorigen Kriegs gemacht hat. Und sie strickt … das ist ihre Leidenschaft, bunte Pullis. Heute hatte ich einen an, und da …«
»Entschuldige, Vic, ich bin so furchtbar müde, reden wir doch am Sonntag weiter.«
»Ja, wenn du meinst, ich wollte dir etwas erzählen, aber wenn du nicht willst …«
Victorias Stimme klang eingeschnappt, wie Luise genau heraushörte, aber trotzdem wollte sie das Gespräch beenden, nichts sagen, was gefährlich werden konnte. Und so verabschiedete sie sich von ihrer Schwester und hängte schnell ein.
Sie wollte auch nicht über ihren Cousin Felix sprechen. Carls Sohn, der aus Ostpreußen wegwollte, doch die Regierung hatte entschieden, dass die dortige Bevölkerung nicht evakuiert wurde. Das sei nicht notwendig, obwohl die Rote Armee bedrohlich näher rückte.
Sie hängte ein. Sie musste vorsichtig sein, nachdem sie gerade ein Verhör der Gestapo durchgestanden hatte. Auch wenn die Beamten höflich und freundlich gewesen waren und ihr einfach nur ein paar Fragen nach Simon Roth stellen wollten. »Sie haben ihn doch gekannt, Fräulein Laverne?«
Simon Roth.
Der geniale jüdische Architekt, der nach dem großen Brand im Jahr 1918 den Westflügel des Hotels neu konzipiert hatte und später auch noch den Palmengarten nach seinen Entwürfen renovieren ließ. Simon, mit dem sie eine leidenschaftliche Affäre gehabt hatte, die er so plötzlich beendete. Nur einen Brief hatte sie bekommen, den er einem Freund mitgegeben hatte, nachdem er ohne Abschied übereilt abgereist war.
Und nun jagte ihn die Gestapo. In Paris habe er einen Angehörigen der Wehrmacht niedergeschlagen, sogar tödlich getroffen, er, der Jude, habe sich der Résistance angeschlossen, die nahe Paris Deutsche gefangengenommen und getötet hätte.
Nein, sie wisse nicht, wo er sich aufhalte, und ja, sie habe eine Beziehung mit ihm gehabt, das hatte sie zugegeben, nachdem sie begriff, die Gestapo war darüber informiert. Ja, er sei damals nach Amsterdam gegangen, um ein Museum zu konzipieren, mehr wisse sie nicht. Sie war froh, dass sie damals den Brief zerrissen hatte, so wie er die Beziehung ohne Vorwarnung beendet hatte. Du musst mich vergessen, ich bin Jude …
Die Beamten hatten ihr eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. »Wenn sich Simon Roth bei Ihnen meldet, sollten Sie uns umgehend informieren.«
Luise hörte die Drohung sehr wohl heraus und hatte es versprochen.
Nachdem sie das Gespräch mit ihrer Schwester so abrupt abgebrochen hatte, stand sie lange noch am Schreibtisch. Sie sollte sich beruhigen, sie hatte nicht gelogen, und sie hatte Vic unterbrochen, als sie von Felix erzählen wollte, sie hatte nichts preisgegeben, keinen Fehler gemacht.
Als sie ein Geräusch an der offenen Terrassentür hörte, erschrak sie. Ihr Herz jagte, und der Atem ging sofort wieder heftig. Sicher hatte sie sich getäuscht, eine Reaktion ihrer überreizten Nerven. Reglos blieb sie stehen und sah zur Terrassentür hinüber. Konnte es sein, dass die Tür dort leicht aufgestoßen wurde, der Vorhang sich bewegte? Und dann hob sich eine Silhouette im Halbdunkel dort ab, ein Geräusch, ein paar Schritte, eine männliche Stimme … bitte … Luise, hilf mir … und dann noch ein paar Schritte auf Luise zu, ein Schwanken, dann brach der Mann zusammen.
Luise zögerte nicht, sie beugte sich zu ihm hinunter, dem Mann, der offensichtlich Hilfe brauchte, der sie auch kannte, sah in sein Gesicht, das sich ihr entgegenhob. In seinen Augen las sie den verzweifelten Schrei nach Hilfe.
Es war Simon Roth.
Vier
Ostpreußen 1944
Die Dunkelheit wollte dem Tag nicht weichen und der Schnee nicht aufhören, leise zu fallen. Felix öffnete die Haustür und kehrte mit einem Besen den Schnee von der Schwelle. Es hatte die ganze Nacht durchgeschneit, und vor der Haustür hatte sich ein hoher Berg aufgetürmt. Für einen Moment hielt er inne, atmete die kalte klare Luft ein und lauschte auf die Stille des Winters. Wie sehr liebte er diese Zeit in Ostpreußen, das ihm längst zur Heimat geworden war. Mit einem Lächeln blieb sein Blick am Zaun hängen, auf dem sich Hauben aus Schnee türmten, und er sah zu, wie ein paar Vögel das kleine Holzhäuschen umschwirrten, das seine Tochter Viola aufgestellt hatte und es so ernsthaft betreute. Einmal hatte sein Zwillingsbruder Julian ihn hier besucht, er, der in Rom im Vatikan lebte und an der Päpstlichen Universität lehrte. Es gefiel ihm hier, ich kann verstehen, dass es zu deiner Heimat geworden ist, hatte er gesagt. Doch auch er würde ihm raten, Ostpreußen zu verlassen, da war sich Felix sicher. Geh, solange es noch möglich ist. Fast konnte er seinen Zwillingsbruder hören – ja, er würde ihm raten, zu gehen.
Felix schloss fest die Haustür, musste sich dagegenstemmen, um sie schließen zu können. Er ging ins Wohnzimmer, in dem er bereits das Kaminfeuer angezündet hatte, das eine wohlige Atmosphäre des Friedens schuf, die Atmosphäre einer Beständigkeit, des häuslichen Glücks, das es nicht mehr geben würde. Jette und die Kinder schliefen noch, und Felix bangte vor dem Moment, wenn er ihnen am Frühstückstisch seinen Plan unterbreiten würde. Aber ahnte Jette nicht längst, was er ihr vorschlagen wollte? Jetzt lief er durchs Haus, sein geliebtes Haus, das er vor vielen Jahren gekauft und restauriert hatte. Es war ein Kampf gewesen, eine Förderung der Reichsbank bewilligt zu bekommen, um diese alte Ruine wieder aufbauen zu können. Tag und Nacht hatte er mitgearbeitet, bis zur Erschöpfung, alles eingerichtet und die Möbel nach seiner Vorstellung anfertigen lassen. Mit jedem Stück verband sich eine kleine Erinnerung seines Entstehens, dann die Freude, als das Haus endlich eingerichtet war. Er liebte jedes Möbelstück. Versonnen strich er über die Lehne eines Stuhls, der am langen dunklen Esstisch stand. Wie viele Abende hatten sie hier gesessen, Leute bewirtet, getrunken, gelacht, sich unterhalten, auch Freunde gefunden, doch vor allem hatte ihn eine tiefe Freundschaft mit seinem Nachbarn, einem Reiseschriftsteller, verbunden. Doch er hatte das Dorf vor einem Monat verlassen. »Auch du musst gehen«, hatte er Felix eingeschärft. »Du und deine Familie. Ostpreußen wird fallen, die Russen werden uns überrollen. Seit die Wehrmacht in Stalingrad kapituliert hat, haben wir den Krieg doch längst verloren, und die rote Armee wird sich rächen für die Grausamkeiten der Deutschen. Und ihre Rache wird furchtbar werden.« Es klang wie eine biblische Prophezeiung, und bei den Worten seines Freunds war es Felix kalt den Rücken hinuntergelaufen.
Als Felix in der Küche den Ersatzkaffee kochte und das Frühstück richtete, versuchte er, die Tränen zu unterdrücken. Wusste er denn nicht längst, wie Jette reagieren würde, ahnte er, dass heute die Familie auseinanderbrechen würde? Dieses Leben hier war zu Ende. Felix war Realist genug, um das zu erkennen.
Das letzte gemeinsame Frühstück hier in seinem Haus. Er schnitt das Brot auf, es stammte aus der Backstube des Guts der von Stettens, es gab noch Butter, Marmelade und Käse. Er würde auch Rühreier machen, es würde ein festliches Frühstück werden. Er sah durch das Küchenfenster in den Garten hinaus, in den tief verhangenen Himmel, hinter dem es nur zögernd hell wurde. Er hatte das Dorf mitgeschaffen, Kredite für die Bauern bei der Reichsbank in Insterburg erwirkt, es war ein blühendes Dorf geworden, sogar mit einem Rathaus, in dem er tagtäglich als ihr Bürgermeister saß, sich ihre Sorgen anhörte und ihre Streitereien schlichtete. Er war beliebt, jeder mochte Felix Laverne. Und jetzt würde er sie im Stich lassen. Er hatte erklärt, er fahre über Weihnachten mit Frau und Kindern zu seiner Familie nach Bad Lichtenberg. Er hatte gelogen, denn es war der Bevölkerung Ostpreußens verboten, das Land zu verlassen, eine Evakuierung von der Regierung ausgeschlossen. Er ließ die Dorfbevölkerung, die ihm vertraute, zurück. Und doch ging er.
Belastet mit den Gedanken seines Verrats, starrte er immer noch aus dem Fenster, als er Jette hörte, wie sie die Treppe herunterkam. Hinter ihr polterten die beiden Jungs. Gefolgt von Viola und hübsch angezogen, hüpfte sie die Stufen hinunter.
»Du bist schon auf und hast Frühstück gemacht?« Jette zeigte ihre Freude, indem sie ihn auf die Wange küsste.
Er nickte, der Kloß saß tief in seinem Hals. Während Felix sich dem Herd zuwandte, Butter in die Pfanne gab und das Ei verklepperte, half Jette ihrem vierjährigen Sohn Leopold auf einen Stuhl und strich ihm, ihrem Liebling, zärtlich über den blonden Haarschopf, eifersüchtig beobachtet von dem siebenjährigen Luitpold. Die achtjährige Viola gab ihrem Vater einen Kuss, rückte ihren Stuhl direkt neben den ihres Vaters.
Felix verteilte das Rührei, schenkte Kaffee und den Kindern Kakao ein und nahm neben Viola Platz. Mit großem Appetit verschlangen die drei das Rührei. Felix konnte nichts essen, die Aufregung vor diesem Moment der Entscheidung nahm ihm jeden Appetit. Ahnte Jette, dass er eine Aussprache suchte, Klarheit verlangte? Er beobachtete sie, wie sie in ihr Marmeladenbrot biss, dann mit den Kindern lachte und den Kopf in den Nacken warf, wie sie es immer tat. In diesem Moment erinnerte er sich an den ersten Sommer ihrer Liebe, die Nachmittage im Gras, ihre fordernde Sinnlichkeit, ihr Lachen, sein Erstaunen, dass Jette von Stetten, die junge Frau, die jeden haben konnte, ausgerechnet ihn ausgewählt hatte. Sie habe schon viele Liebhaber gehabt, hatte sie erklärt, aber du bist etwas Besonderes, du hast einen so zarten Körper, und du bist sehr einfühlsam. Warum dachte er gerade an diesem dunklen Morgen daran? Ahnte er, was das Ergebnis des Gesprächs sein würde? Seit diesem ersten Sommer hatte er sich verändert, sein Körper hatte sich verändert. Er war muskulös geworden, die viele Arbeit am Haus, im Garten, beim Obstanbau hatte ihn kräftig werden lassen. Gefiel er ihr eigentlich noch, da sie doch gerade damals seine Zartheit liebte, eine Zartheit, die ihn von den Kerlen unterschied, mit denen sie geschlafen hatte?
Manchmal fragte sich Felix, ob sie ihn während der Ehe betrogen hatte, denn letztendlich pendelte sie zwischen diesem Haus und dem großen Gut ihres Vaters hin und her. Dort blieb sie mit den Kindern oft wochenlang, und er war allein, doch das war in Ordnung. Er fühlte sich frei und ungebunden, half mit bei der Ernte seiner Rapsfelder, der Herstellung des Öls, das er deutschlandweit verkaufte. Sein Blick wanderte von der schweigenden Jette und den stillen Jungs, die tapfer in sich hineinfutterten, weiter und wurde zärtlich, als er seine Tochter Viola betrachtete. Mit ihr war Jette bei der Hochzeit bereits schwanger gewesen. Sie entsprach seinem Bild von Jette als Kind, mit langen blonden Zöpfen, strahlend und gesund durch die Wiesen streifend, auf Bäume kletternd, auch Viola ein glückliches Kind, so wie sicher auch Jette eine wunderbare Kindheit gehabt hatte. Sie wuchs ohne Mutter auf, und dadurch wurde die Beziehung zu ihrem Vater so besonders eng und vertraut. Würde Viola auch ihn, den Vater, sein ganzes Leben lang lieben? Ohne ihn infrage zu stellen, so wie Jette es tat? Unwillkürlich hob er die Hand und strich seiner Tochter zärtlich über die Haare.
»Was ist los?« Jette legte die Gabel auf den Tisch und sah ihn an. Sie kannte ihn zu gut, um nicht zu erkennen, dass ihn etwas Gravierendes beschäftigte.
Er atmete durch, auch er legte die Gabel ab und sah sie an. Bevor er zu sprechen anfing, erklärte Jette in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete: »Wie du weißt, fahren wir morgen zurück aufs Gut. Und wie es scheint«, sie warf einen Blick aus dem Fenster, »hört es langsam auf zu schneien. Vater schickt uns seinen Wagen gegen zwölf. Und wir werden dort Weihnachten verbringen, wie jedes Jahr.«
Jetzt war der Moment gekommen. Jetzt musste er seinen Plan offenlegen. Er hatte vorsichtig beginnen wollen, langsam erzählen, was sie erwarten würde, wenn sie blieben, sich dann steigern, bis Jette einsehen musste, dass es nur den einen Weg gab, um zu überleben.
»Ich möchte, dass wir morgen Ostpreußen verlassen«, platzte er ohne seine wohlüberlegte Vorrede heraus.
Jette lachte auf. Erstaunt, hart. »Ich habe es immer geahnt, dass du wegwillst, du bist ein Feigling. Du hast Angst, die Russen kommen, stimmt’s?«
»Ja, das ist richtig. Die Rote Armee wird Ostpreußen überrennen und nichts als Tod und Verwüstung hinterlassen.«
»So ein Unsinn«, sagte Jette heftig. »Hat die Wehrmacht nicht die Russen zurückgedrängt, mehrere Ortschaften wie … ja, wie … Nemmersdorf zurückerobert?«
Felix suchte verzweifelt nach Argumenten, die Jette überzeugen, sie in Angst versetzen könnten, um mit ihm das Land zu verlassen. Wo waren nur seine Argumente? Doch Jette ließ ihm keine Gelegenheit zu irgendwelchen Ausführungen, sondern sprach weiter: »Die Regierung sagt, wir sollen ausharren, es lohne sich. Wir werden nicht evakuiert, weil es nicht nötig ist.« Jettes Stimme wurde mit jedem Wort lauter.
Felix verlor die Fassung, wütend sprang er auf, und im Grunde ahnte er, dass er verloren hatte. Doch er versuchte es weiter: »Und warum«, seine Stimme bebte, verlor an Festigkeit, »warum evakuiert dann unser Gauleiter seine Familie nach Bayern und hat sich bereits eine Rückzugsmöglichkeit geschaffen?«
Jette antwortete nicht, es war ein Moment der Unsicherheit. Dann aber richtete sie sich kerzengerade in ihrem Stuhl auf und sah ihrem Mann fest in die Augen. »Felix«, erklärte sie ruhig. »Ich werde nicht gehen, ich werde Vater nicht allein lassen. Wenn du willst, dann gehe, ich bleibe, und zwar mit den Kindern auf dem Gut. Es ist auch mein Gutshof, unsere Kinder werden ihn einmal erben. Außerdem«, spielte sie ihren letzten Trumpf aus, »ist es der Bevölkerung verboten, zu flüchten. Und ausgerechnet du, der das Recht verteidigt und sich rühmt, jedes Gesetz zu respektieren – ausgerechnet du willst weg? Heißt es nicht sogar, dass jeder Fluchtversuch mit der Todesstrafe belegt werden kann? Und dieser Gefahr willst du uns aussetzen? Und wie willst du überhaupt von hier wegkommen?«
»Bauer Högle fährt uns morgen mit seinem Fuhrwerk zum Bahnhof. Um ein Uhr geht ein Zug hier ab, er fährt bis Marienburg, dort bekommen wir Anschluss, ich habe die Route genau berechnet.«
Wieder lachte Jette auf und nahm dadurch seinem Plan fast die Möglichkeit einer Durchführung.
»Und was sagst du den Dorfbewohnern? Erklärst du ihnen, dass du flüchten, sie im Stich lassen willst?«
Damit traf sie den wunden Punkt. »Ich habe gesagt, wir fahren über Weihnachten zu meiner Familie. Darum werden wir nur wenig mitnehmen und alles zurücklassen.«
Jette sah ihn an, sie erkannte, wie schwer es ihm fiel, hier wegzugehen. »Züge werden beschossen, es ist unsicher, genauso wie auszuharren. Ich denke, hierzubleiben ist weniger gefährlich, außerdem ist der Gutshof meine Heimat, du weißt, wie sehr ich dort verbunden bin. Ich liebe das Land, unser Land, das wir besitzen, die Pferdekoppel …«
»Die leer steht, weil die Regierung die Pferde abgeholt hat und sie im Krieg niedermetzeln lässt«, warf Felix ein. »Ich erinnere mich, wie du vor fünf Jahren geweint hast, als sie abgeholt wurden.«
»Wir werden neue haben, wenn der Krieg vorbei ist.« Jettes Stimme wurde leidenschaftlich. »Ich kann nicht, Felix, ich kann einfach nicht, und ich kann auch nicht glauben, dass die Russen uns niedermetzeln werden, wie du es nennst. Wenn Vater sie willkommen heißt, dann …«
»Hör auf.« Felix, der wieder Platz genommen hatte, sprang erneut vom Stuhl auf, und zwar so heftig, dass er nach hinten umkippte. Erregt hob Felix ihn auf, hart stellte er ihn zurück. »Wie kannst du so blind, so naiv sein, was geht nur in deinem Kopf vor sich? Du musst doch wissen, was passiert, was in Stalingrad passiert ist, welche Brutalitäten, Grausamkeiten, wie viele Menschen niedergemetzelt wurden … und du glaubst, wenn dein Vater ihnen entgegengeht, dann …«
»Wir sind Zivilisten, sie werden uns nichts tun«, unterbrach Jette ihn.
Felix war weiß im Gesicht, er zitterte am ganzen Körper, Jettes Unvernunft und ihr geradezu kindisches Verweigern der Realität des Kriegs machten ihn fassungslos. Aber so ehrlich wie heute hatten sie noch nie miteinander gesprochen. Er atmete tief durch. »Jette, ich habe dir doch gerade erzählt, dass man Zivilisten nicht verschont, Frauen werden vergewaltigt, getötet, alte Menschen zu Tode gefoltert. Ich kann dich nur noch einmal inständig bitten, komm mit mir. Mit mir und den Kindern. Wie gesagt, wir werden nicht viel mitnehmen können, um es als Reise zu meiner Familie zu tarnen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, wenn die Rote Armee uns erst einkreist, wenn sie bis Insterburg vordringen, und das werden sie, kommen wir nicht mehr weg.«
Jette beugte sich zu Leopold hinunter, der zu weinen anfing, da die Eltern sich anschrien und es für den Kleinen bedrohlich klang. Sein älterer Bruder stimmte ins Weinen mit ein.
»Nein«, rief Jette laut, um das Schluchzen zu übertönen, »nein, Felix, mein letztes Wort ist nein. Ich werde morgen abgeholt, und ich gehe, mit oder auch ohne dich, aber mit den Kindern. Das hat dir wohl Julian eingeredet«, setzte sie noch laut hinzu. »Von allein kannst du doch niemals eine solche Entscheidung getroffen haben, ohne den Rat deines Bruders.«
»Ich habe ihn nicht gefragt«, antwortete Felix ablehnend, »und … ich werde nicht zulassen, dass du mit den Kindern aufs Gut zurückgehst.« Felix versuchte, Ruhe zu bewahren. Die Jungs hatten aufgehört zu weinen und starrten nun verängstigt zwischen Vater und Mutter hin und her. »Ich bin das Oberhaupt der Familie, ich habe das Recht, Entscheidungen für dich und die Kinder zu treffen, und ich entscheide, dass wir morgen das Land verlassen.«
Jette lachte auf, es klang spöttisch und machte Felix klar, dass in vielen Dingen sie das Sagen hatte und er es auch immer zugelassen hatte. Er war ein Ehemann, der seiner Frau jede Freiheit ließ, er wusste, nur dadurch konnte er Jette halten. Doch jetzt ging es um das Leben seiner Kinder. Das Gesetz befugte ihn zu dem Recht, Entscheidungen über die Kinder, die Familie zu treffen.
Plötzlich ließ sich eine Kinderstimme vernehmen, laut und deutlich. »Ich gehe mit Papa.« Viola erhob sich, stellte sich neben Felix und griff nach seiner Hand. »Ich will mit ihm zu den Großeltern Irene und Johannes, mir gefällt es dort, besser als auf dem Gut.«
Die beiden Kleinen, Luitpold und Leopold, fingen wieder an zu weinen.
»Viola, du kommst mit uns, mit mir und deinen Brüdern, was dein Vater macht, das …« Jette machte eine kleine Pause und starrte Felix wütend an. »Das kann er selbst entscheiden. Ihr jedenfalls kommt mit mir.«
»Nein!« Die Stimme der Achtjährigen klang entschlossen. »Ich gehe mit Papa.« Jette und Felix starrten sich an, Feindseligkeit, Hass stand zwischen ihnen, mehr, als Felix es sich ausgemalt hatte. Irgendwie hatte er doch gehofft, er könne Jette überzeugen, ihr klarmachen, was es bedeute, in Ostpreußen zu bleiben.
»Der Tod kommt auf euch zu«, erklärte er mit tonloser Stimme, »bitte, Jette, überwinde deinen Dickkopf und sei vernünftig.«
»Nein, morgen schickt mir Vater den Wagen, dann fahren wir.«
Es war Jettes letztes Wort, und Felix wusste, jetzt konnte er sie nicht mehr überzeugen. Er ergriff die Hand seiner Tochter. »Ich wiederhole, dass ich als Vater die Befugnis habe, über das Wohl meiner Kinder zu bestimmen. Und ich bestimme, ich nehme sie mit.« Er musste laut schreien, um das Schluchzen und Weinen seiner Söhne zu übertönen.
Wieder lachte Jette hart auf. »Wag es nicht, dich an meinen Söhnen zu vergreifen.« Dann sah sie Viola an. Sie war immer das Papakind gewesen, immer in Abwehr gegen die Mutter, schon als sie noch ganz klein gewesen war. »Wenn du mit Papa gehen willst, dann geh. Aber ich denke sowieso, dass wir uns bald wiedersehen, denn ihr werdet zurückkommen.«
An diesem Tag packten beide, Jette die Sachen der Jungs und ihre Kleider, die sie mit zurück auf das Gut nehmen wollte. Felix aber sortierte sehr überlegt, was er auf die lange Fahrt mitnehmen würde. Morgen verließ er seine Heimat, um an den Ort zurückzukehren, an dem er aufgewachsen und der ihm längst fremd geworden war.
Den ganzen Tag schwiegen sie sich an, gingen sich aus dem Weg. Mittags bereitete Jette eine Linsensuppe vor, schweigend setzten sie sich um den Tisch und aßen ein paar Löffel, niemand hatte Hunger. Sogar der kleine Leopold spürte die feindselige Atmosphäre, die zwischen den Eltern herrschte.
Und in dieser letzten Nacht konnte Felix keinen Schlaf finden. Jette hatte ihm den Rücken zugewandt, doch an ihren Atemzügen erkannte er, dass auch sie nicht schlief. Er rückte ganz nah und vorsichtig an sie heran, und sie ließ es zu. Er umschlang sie mit seinen Armen, auch das ließ sie zu. Er spürte ihren weichen Körper, ihre vollen Brüste, die durch die Geburten und das Stillen dreier Kinder an Festigkeit verloren hatten, aber gerade deswegen liebte er diesen Körper, der seine Kinder ausgetragen und geboren hatte.
»Jette«, flüsterte er, »Jette … bitte komm mit …«
Doch da rückte sie ein wenig ab, aber nur so weit, dass er sie immer noch spüren konnte. Beide fanden nicht in den Schlaf, und Felix ahnte, sie wollte von ihm geliebt werden, doch er konnte es nicht, er konnte sie nicht umarmen, sie lieben, denn morgen würde sie ihn verlassen. So umschlang er sie nur vorsichtig mit den Armen und legte den Kopf an ihre Schulter. So verharrten sie schlaflos, bis die Standuhr in der unteren Diele sieben Mal schlug und sie schweigend nacheinander aus dem Bett schlüpften.
Unten in der Küche standen die beiden Brüder ratlos an der Tür und beobachteten ihre Schwester, die sich abmühte, in dem alten Herd ein Feuer zu entfachen. »Steht nicht so herum«, herrschte Viola sie an. »Deckt gefälligst den Tisch und lasst keinen Teller fallen.«
Ungewohnt gehorsam folgten sie der Schwester, schielten aber weiterhin auf sie, als sie die Pfanne auf den Herd stellte und Spiegeleier darin briet. »Ich mag keine Spiegeleier«, maulte Luitpold. »Ich mag nur Rühreier.«
»Du isst, was auf den Tisch kommt«, herrschte Viola ihren Bruder an. »Mama und auch Papa essen gerne Spiegeleier.«
»Sie sind auf der Treppe«, erklärte der kleine Leopold, setzte sich schnell auf seinen Platz und sah den Eltern erwartungsvoll entgegen.
»Wie schön«, lobte Jette, »ihr habt das Frühstück gerichtet.«