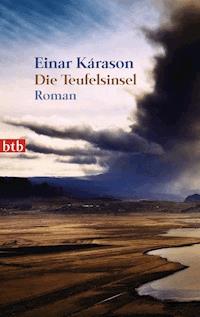9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Zeitalter der Sturlungen – benannt nach dem mächtigsten Wikingerklan – war das blutigste und brutalste Kapitel der isländischen Geschichte. Es läutete gleichzeitig das Ende der Wikingerära ein.
Dieser Epoche setzt Einar Kárason mit seiner imposanten Isländer-Saga ein einzigartiges Denkmal. Erstmals werden die international hochgelobten und vom Autor für diese Ausgabe neu überarbeiteten Romane »Feindesland« und »Versöhnung und Groll« sowie zwei neue, erstmals ins Deutsche übertragene Romane in einem Band erscheinen – übersetzt von Bestseller-Autor Kristof Magnusson. Ein einzigartiges Projekt, dem sich der vielfach ausgezeichnete größte isländische Gegenwartsautor über ein Jahrzehnt gewidmet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1021
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Einar Kárason
DIE STURLUNGEN
INHALT
Vorwort zur deutschen Ausgabe
BUCH EINS – Zeit der Schwerter
BUCH ZWEI – Feindesland
BUCH DREI – Versöhnung und Groll
BUCH VIER – Skalde
WIDMUNG
i migliori fabbri.
William Faulkner, Ásgeir Jakobsson
VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
Dieses Buch spielt im isländischen Mittelalter, genauer gesagt im dreizehnten Jahrhundert. Es mag vielleicht etwas marktschreierisch klingen, aber ich halte diese Zeit in der isländischen Geschichte – und sogar in der Geschichte von ganz Nordeuropa – für absolut einzigartig. Warum das so ist, möchte ich im Folgenden mit einigen Worten begründen.
Im dreizehnten Jahrhundert wurden in Island mehr als dreihundert Bücher geschrieben. Das mag an sich noch nicht so bemerkenswert erscheinen, Bücher wurden schließlich im Mittelalter an vielen Orten geschrieben. Aber die Isländer schrieben schon damals nicht in Latein, sondern in der Sprache, die sie auch sprachen: Altnordisch. Altnordisch wurde damals von allen skandinavischen Völkern gesprochen, es hatte sich im Laufe der Wikingerzeit in großen Teilen von Nordeuropa verbreitet, und doch wurde in dieser Sprache kaum geschrieben. Es gab zwar eine große Tradition der Skaldenlyrik, doch diese Dichtkunst wurde nur mündlich von Generation zu Generation weitergetragen. Es gab nicht einmal eine richtige Schriftsprache, mit der man die Gedichte hätte aufschreiben können, es gab nur die sogenannten Runen, eine primitive Imitation des lateinischen Alphabets, die zu wenig mehr taugte als zur Beschriftung von Grabsteinen. Nachdem die nordischen Länder um das Jahr 1000 christianisiert wurden, verfassten die dortigen Priester und Mönche zwar bald die ersten Bücher, doch sie schrieben nur auf Latein. Außerdem verfassten sie fast nur geistliche Texte. Doch auch die wenigen Bücher weltlichen Inhalts, die überhaupt geschrieben wurden, waren auf Latein verfasst, wie zum Beispiel die bis heute bekannte Gesta Danorum von Saxo Grammaticus über die Geschichte der Dänen. Die Isländer schlugen hier einen Sonderweg ein. Sie entwickelten im zwölften Jahrhundert eine Schrift, in der sie in ihrer altnordischen Muttersprache schreiben konnten, und schufen damit einzigartige Werke der mittelalterlichen Literatur.
Im Island des dreizehnten Jahrhunderts wurden viele Arten von Büchern geschrieben. Eine große Rolle spielten hierbei die Werke der Geschichtsschreibung, in denen es bei Weitem nicht nur um Island ging, sondern auch um Ereignisse in Dänemark und Schweden, in Grönland, auf den Orkney- und den Färöer-Inseln. Auch von dem Land, das die Wikinger noch weiter im Westen entdeckten und Vinland nannten, wird erzählt – heute kennen wir es als Amerika. Doch am berühmtesten sind zweifellos die Isländer-Sagas, die bis heute in der literarischen Welt geschätzt, gelesen und übersetzt werden und zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur gehören.
Allein die Bücher, die in diesem dünn besiedelten, abgelegenen, rückständigen Island des dreizehnten Jahrhunderts entstanden sind, wären also bemerkenswert genug. Was diese Zeit jedoch vollkommen einzigartig macht, ist die Tatsache, dass genau in diesem »goldenen Zeitalter« der mittelalterlichen Literatur in Island ein regelrechter Bürgerkrieg tobte und dass die Autoren, denen wir viele wichtige Bücher aus dieser Zeit verdanken, in diesem Bürgerkrieg ordentlich mitgemischt haben! Es handelt sich bei ihnen um wichtige Oberhäupter der Sturlungen, der damals mächtigsten Familie Islands, nach der diese Epoche auch benannt ist: die Sturlungen-Zeit.
Vor dem Jahr 870 war Island gänzlich unbewohnt gewesen, vielleicht einmal abgesehen von gelegentlichen Schiffbrüchigen, verirrten Seeleuten und einigen irischen Einsiedlermönchen. Dann segelten einige mächtige Wikinger-Anführer mit ihren Schiffen auf den Atlanktik hinaus und entdeckten diese große, damals noch bewaldete Insel, die sie Island nannten und innerhalb weniger Jahrzehnte komplett besiedelten. Viele der ersten Siedler waren nach Konflikten mit den skandinavischen Königen aus ihrer Heimat geflohen und bauten nun in Island ein Gemeinwesen auf, das ohne jegliche Form von adeliger Obrigkeit auskam. Jeder Anführer herrschte in seinem Bezirk. 930 gründeten diese Anführer das Althing, eine Versammlung, zu der die Isländer einmal im Jahr zusammenkamen, Gesetze beschlossen und Gerichtsprozesse führten. Wenn auf diesem Althing ein Urteil gefällt wurde, gab es allerdings keine zentrale Staatsmacht, um dieses durchzusetzen, keinen König, keine Armee oder Polizei. So funktionierte das Land ungefähr 300 Jahre lang, doch in der Zeit der Sturlungen im dreizehnten Jahrhundert löste sich die Ordnung des Wikingerzeitalters auf. Die mächtigsten Familien des Landes lieferten sich immer heftigere Kämpfe um die Vorherrschaft, bis schließlich fast im ganzen Land ein Bürgerkrieg tobte – der einzige (und hoffentlich auch letzte) in der isländischen Geschichte. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass die Familie der Sturlungen hierbei gegen eine Koalition aus zwei anderen mächtigen Großfamilien kämpfte, bevor sich dann auch noch die katholische Kirche und der norwegische König, der Island unter seine Herrschaft bringen wollte, einmischten.
Dabei waren die Isländer in der Sturlungen-Zeit eigentlich vergleichsweise wohlhabend gewesen. Die mächtigsten Familien hatten Reichtümer angesammelt, es gab ein beträchtliches kulturelles Leben und regen Austausch mit dem Ausland. Trotz seiner abgeschiedenen Lage mitten im Meer, war Island nicht vollkommen isoliert. Immerhin hatten die Wikinger auch in Grönland und Vinland gesiedelt, und vieles weist darauf hin, dass die Sturlungen gerade durch den Handel mit Grönland gutes Geld verdient hatten. Jeden Sommer kamen Schiffe mit Walross- und Narwalzähnen, Seehundhäuten, Schneehasen- und Eisbärfellen, und die Sturlungen hatte das Glück gehabt, dass ihr Machtbereich im Westen von Island lag – also dort, wo die Schiffe aus Grönland zuerst anlegten. Die Sturlungen wurden zum wichtigsten Zwischenhändler für den Verkauf dieser Waren nach Europa und stiegen innerhalb kurzer Zeit zur reichsten Familie von ganz Island auf, was sich zum Beispiel daran zeigt, wie viele Sturlungen ins Ausland fuhren, dort weite Reisen unternahmen und viel Geld ausgaben. Dieser Reichtum legte den Grundstein für ihre Macht.
Viele Quellen und Bücher der damaligen Zeit sind glücklicherweise bis heute erhalten: Chroniken, Lebensgeschichten von Heiligen, Bischöfen, Priestern und anderen bedeutenden Persönlichkeiten oder auch die Lebensgeschichten der norwegischen Könige, die sich in den isländischen Bürgerkrieg eingemischt haben. Doch das größte Werk dieser Zeit ist die Saga von den Sturlungen. Streng genommen handelt es sich dabei nicht um eine einzige Saga, sondern um verschiedene mehr oder weniger zusammenhängende Geschichten oder Bücher, die später zu einer großen Saga zusammengesetzt worden sind. Der umfangreichste Teil der Saga von den Sturlungen ist ein Buch des Skalden Sturla Thórdarson, einem bedeutenden Autor aus der Familie der Sturlungen, der in diesem Buch als Skalden-Sturla eine wichtige Rolle spielt. Der Teil der Saga von den Sturlungen, der Skalden-Sturla zugeschrieben wird, erinnert in seiner literarischen Qualität manchmal an die berühmten Sagas, was vielleicht nicht überrascht, denn es gibt viele Hinweise darauf, dass Skalden-Sturla selbst einige der berühmtesten Sagas geschrieben hat. Eine besondere Qualität bekommt die Saga von den Sturlungen dadurch, dass Skalden-Sturla in den Bürgerkriegsereignissen und Kämpfen, von denen er erzählt, selbst tief verstrickt war.
Doch Skalden-Sturlas Beitrag zur Saga von den Sturlungen ist nicht nur gute Literatur, sondern auch Geschichtsschreibung. An vielen Stellen ist ihm das Aufzählen von Fakten offenbar wichtiger gewesen als ein eleganter Erzählfluss. Viele vermuten, dass Skalden-Sturla seinen Teil der Saga von den Sturlungen aus verschiedenen anderen Berichten und Quellen zusammengesetzt hat, ähnlich einer Gerichtsakte. Es finden sich darin endlose Aufzählungen von Namen, wobei sowohl Schlüsselfiguren der Ereignisse in Island genannt werden, als auch Figuren, die kaum mehr als Beobachter oder Statisten waren. Hinzu kommen akribische Aufzählungen und Beschreibungen der Wunden, die die Männer während der Kämpfe damals erlitten hatten, die oft kaum über anatomische Beschreibungen hinausgehen. Mit geradezu dokumentarischer Genauigkeit wird aufgezählt, wer wem in welchem Kampf welchen Schaden zugefügt hatte, egal, wie groß oder klein dieser gewesen sein mag.
Kurz gesagt ist die Saga von den Sturlungen insgesamt eher anstrengend zu lesen, gerade im Vergleich zu den gut geschriebenen Isländer-Sagas. Nur wenige Leute machen sich die Mühe, in dieses lange, schwer lesbare und vielschichtige Werk einzusteigen.
Ich selbst habe mich vor ungefähr fünfundzwanzig Jahren daran gemacht. Ich nahm mir viel Zeit, und je besser ich die Figuren dieser Saga kennenlernte, desto mehr bekam ich das Gefühl, dass sich darin ein wunderbarer Stoff für einen Roman verbarg: Männer und Frauen wie Kakali, seine Schwester Steinvör und sein Bruder Sturla erinnerten mich an Menschen, die ich in meinem eigenen Leben kennengelernt und spannend gefunden hatte. Dennoch wollte ich nie die Saga von den Sturlungen nacherzählen. Ich wollte vielmehr zeitgenössische Romane über die Figuren und Ereignissen dieser unglaublichen Zeit schreiben. In der Saga von den Sturlungen werden zum Beispiel alle Figuren von einem sachlich beobachtenden Erzähler beschrieben. Wir erfahren, welche Ereignisse stattfinden, erfahren aber nichts über das Innenleben der Figuren, wir erleben nicht, was sie denken, was sie fühlen. Um den Leserinnen und Lesern genau diese Perspektive zu zeigen, beschreibe ich in meinen Romanen alles aus der Sicht der handelnden Figuren. Dazu habe ich eine Form gewählt, die mir zum ersten Mal begegnete, als ich den 1930 erschienenen Roman Als ich im Sterben lag des amerikanischen Literaturnobelpreisträgers William Faulkner las – in diesem Buch sieht der Erzähler alles durch die Augen seiner Charaktere, er teilt mit ihnen Leid und Freude und erzählt die ganze Geschichte aus ihrer persönlichen Perspektive.
Die Figuren der Saga von den Sturlungen aus dem dreizehnten Jahrhundert lernen wir nur durch ihre Worte und Taten kennen. Auf dieser Grundlage musste ich versuchen, mir vorzustellen, was das eigentlich für Menschen waren, was sie fühlten, wie sie dachten, was sie antrieb. Dabei bekam ich schnell das Gefühl, dass sie eigentlich genauso waren wie wir. Je länger ich mich mit ihnen beschäftigte, desto mehr erschien es mir als reiner Zufall, dass sie im dreizehnten Jahrhundert geboren waren und nicht, wie ich, ungefähr fünfundzwanzig Generationen später. Und obwohl die Gesellschaft, in die sie hineingeboren wurden, natürlich eine andere war als unsere, war doch im Grundsatz vieles ganz ähnlich. Die Menschen wohnten mit ihren Familien in Häusern, schliefen dort, aßen dort und verließen es, um zur Arbeit zu gehen oder ihre Nachbarn und Freunde zu treffen. Wie wir machten sie sich auf Reisen, nur dass sie eben mit Pferden und Schiffen unterwegs waren, und nicht mit Autos und Flugzeugen. Sie lachten und erzählten sich Geschichten, gaben Verse und Sprichwörter zum Besten, hatten ihre Freuden und Sorgen, liebten und hassten.
Beim Schreiben erinnerten sie mich immer wieder an Menschen aus meiner Gegenwart. So habe ich zum Beispiel bei der Beschreibung der berühmten Skaldendichter aus der damaligen Zeit oft an heutige Autoren gedacht, die ich selber kenne.
Eine andere Figur, die hier eine wichtige Rolle spielt, ist ein großer Manipulierer und Verräter namens Hrafn Oddsson. Skrupellos bricht er sein Wort, wechselt die Seiten, wann immer es ihm passt und wird doch nie dafür zur Verantwortung gezogen. Nach jedem Wortbruch schafft er es irgendwie, dass seine Zeitgenossen ihm doch wieder glauben und vertrauen – und das in einer Zeit, in der viele Männer aus weitaus geringeren Anlässen erschlagen wurden. Als ich mich daran machte, diesen Hrafn Oddsson zu beschreiben, sah ich zuerst einen Mann mit verschlagener Miene vor mir, der mit flüsternder Stimme sprach und immer dem Blick seines Gegenübers auswich. Dann wurde mir jedoch klar, dass das nicht funktionieren konnte. So einem Mann würden schließlich alle misstrauen. Jemand, der über so lange Zeit immer wieder alle hintergehen konnte, musste vielmehr ein besonders gewinnendes Wesen haben, eine Art psychopathischen Charme.
Eine andere Schlüsselfigur namens Eyjólfur Ofsi stellte mich beim Schreiben vor besondere Probleme, weil er sich vollkommen irrational verhielt. Er legte eine solche extreme, grundlose Grausamkeit an den Tag, dass ich seine Handlungen einfach nicht nachvollziehen konnte, denn ich hatte noch nie einen solchen Menschen kennengelernt. Lange Zeit wollte es mir nicht gelingen, mich schreibend in diesen Eyjólfur Ofsi einzufühlen, dann las ich durch Zufall einen langen Artikel über die Tagebücher von Joseph Goebbels, und diese führten mich an die Figur heran.
Das sind nur einige Beispiele von vielen.
Anfangs wollte ich nur ein Buch über die Zeit der Sturlungen im dreizehnten Jahrhundert schreiben: das Buch, das in dieser Gesamtausgabe an zweiter Stelle steht, Feindesland. Nun sind es vier Bücher geworden, eine Tetralogie. So habe ich insgesamt fast fünfzehn Jahre mit den Ereignissen dieser lange vergangenen Zeit gelebt, habe nachgeforscht und mitgefühlt. Es war eine lohnende, ebenso schöne wie erkenntnisreiche Zeit.
Einar Kárason, Reykjavík, im Frühjahr 2017
BUCH EINS –
Zeit der Schwerter
SIGHVATUR
Als mein Sohn Sturla geboren wurde, wussten wir sofort, dass kein gewöhnlicher Mensch auf die Welt gekommen war. Denn genau in der Nacht, als meine Frau Halldóra niederkam, war meiner Mutter, die sich in einem ganz anderen Teil des Landes aufhielt, im Traum ein Bote der höheren Mächte erschienen. Und dieser Bote hatte ihr gesagt, sie habe gerade einen Enkel bekommen, der den Namen Kampfstark tragen würde. Meine Mutter war zu dieser Zeit bei meinem Bruder Snorri im Borgarfjord. Snorri schickte sofort einen Mann los, der uns von ihrem Traum berichtete, und als ich diese Nachricht hörte, besah ich mir noch einmal meinen neugeborenen Sohn. Normalerweise hielt ich mich von kleinen Kindern lieber fern – doch bei ihm war das anders. Ich spürte sofort, dass diesem Jungen eine glanzvolle Zukunft bevorstand. Ich sah es ihm einfach an, sein Gesicht strahlte eine Gelassenheit und innere Ruhe aus, wie ich sie bei einem Neugeborenen noch nie gesehen hatte. Je klarer der Blick seiner himmelblauen Augen in den nächsten Wochen und Monaten wurde, desto mehr verstärkte sich dieser Eindruck, und als er anfing zu sprechen, überraschte mich sofort, wie wortgewandt mein Junge war und wie schnell er lernte.
Meine Frau Halldóra freute sich, dass mir so viel an meinem Sohn lag – schließlich hatte sie sich oft genug darüber beschwert, dass ich mich zu wenig um Tumi kümmerte, unseren Erstgeborenen, der vor einem Jahr zur Welt gekommen war.
In den nächsten Jahren sollten den beiden noch einige Söhne und Töchter folgen. Eine Kinderschar, die vor meinen Augen manchmal zu einer einzigen lärmenden Horde verschwamm – auch wenn ich natürlich genau wusste, wer von ihnen wer war: Da waren Kolbeinn und Kakali, doch vor allem war da meine Tochter Steinvör, aus der bestimmt einmal eine starke, durchsetzungsfähige Frau werden würde – für Steinvör konnte ich mich fast ebenso sehr begeistern wie für Sturla. Meine Frau Halldóra fand das ehrlich gesagt nicht immer gut. Sie warf mir vor, ständig auf Sturlas Seite zu sein, wenn es Streit zwischen den Kindern gab. Sie sagte, für mich gebe es immer nur Sturla, Sturla, Sturla, während ich Tumi, den Erstgeborenen, derart ignorierte, dass er immer verstockter und aufsässiger wurde. Ich hatte Halldóra nicht widersprochen, das hätte sowieso nichts gebracht. Doch im Stillen fragte ich mich, wie man zu einem so unzugänglichen Kind wie Tumi bitte schön eine vernünftige Beziehung aufbauen sollte. Mein lieber Sturla, der war ganz anders, das hatte ich von Anfang an gesehen, und es zeigte sich mit jedem Jahr deutlicher. Er hatte das Zeug dazu, einer der mächtigsten Männer unseres Bezirks zu werden, wenn nicht sogar des ganzen Landes. Er war geboren, um zu führen. Sturla würde wichtige Ämter von meinem Bruder Snorri übernehmen und das Familienoberhaupt aller Sturlungen werden. Mit einem Nachkommen wie Sturla würde ich nicht mehr länger im Schatten von Snorri stehen, obwohl er so ein einflussreicher Mann, so ein berühmter Dichter und Skalde war.
Deswegen kann ich einfach nicht begreifen, warum es einen derartigen Flächenbrand ausgelöst hat, als mein Sohn Sturla schließlich nach dieser Macht gegriffen hat. Warum ausgerechnet auf seine Taten ein solches Blutvergießen gefolgt ist, dass ich heute befürchte, uns droht bald ein Bürgerkrieg, der das ganze Land verwüsten wird.
STURLA SIGHVATSSON
Soweit ich mich erinnern kann, haben mein Vater und ich uns nur einmal gestritten. Das war vor einigen Jahren gewesen, kurz nachdem wir in den Eyjafjord gezogen waren, weil Vater dort Gode werden sollte, also der mächtigste Mann im ganzen Bezirk. Es gab einige einheimische Großbauern, die nicht akzeptieren wollten, dass jetzt ein Zugezogener hier das Sagen haben sollte, und meinem Vater die kalte Schulter zeigten, doch die beruhigten sich bald. Schon kurze Zeit später zweifelte niemand mehr daran, wer der mächtigste Mann des Eyjafjords war.
Ich hatte kurz nach unserem Umzug erfahren, dass in unserer neuen Heimat ein Bauer namens Thorvardur lebte, der ein sehr kostbares Schwert besaß. Es wurde ganz unbescheiden Panzerbeißer genannt. Die Leute erzählten sich, wie oft mit diesem Schwert schon gekämpft und getötet worden sei, es habe ursprünglich einem Söldner gehört, der Teil der berühmten Warägergarde gewesen sei, in Konstantinopel, dieser riesigen Stadt im Süden aller Länder. Wieso sich dieses Schwert jetzt auf einem Bauernhof im Eyjafjord befand, wusste jedoch niemand. Bauer Thorvardur galt nicht gerade als großer Held – er war eher dafür bekannt, auf Schwächeren herumzutrampeln und gegenüber Höhergestellten zu buckeln. Wie dem auch sei, ich brauchte dieses Schwert! Das war eindeutig die Waffe eines Anführers. Also hatte ich Thorvardur gefragt, ob er mir das Schwert nicht verkaufen oder zumindest einmal leihen würde. Ich war gerade mit meinem Vater unterwegs gewesen, und Thorvardur hatte sich während unseres Gesprächs dementsprechend unterwürfig gezeigt, hatte mein Anliegen freundlich aufgenommen und mit sanfter Stimme gesagt, ich solle einfach kommen und das Schwert in Empfang nehmen, wann immer es mir passe.
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Gleich am ersten Sommertag des Jahres ritt ich mit zwei meiner jüngeren Brüder, Kolbeinn und Kakali, zu Thorvardurs Hof. Wir erreichten den Hofplatz, doch als wir an die Tür klopften, machte niemand auf. Also öffnete ich sie vorsichtig. Wir traten über die Schwelle, während ich immer wieder nach Thorvardur rief. Doch obwohl wir im Haus Stimmen hörten, kam niemand, um uns zu empfangen, wir standen da wie bestellt und nicht abgeholt. Langsam wurde mir die Sache vor meinen jüngeren Brüdern peinlich, also ging ich weiter in das Haus hinein und stand bald mitten in der Wohnstube, genau vor dem Schlafplatz des Hausherren. Darüber hing das Schwert. Ich nahm es von der Wand herunter, trug es hinaus auf den Hofplatz und zeigte es meinen Brüdern, die es bewundernd betrachteten. Die Sommersonne glänzte auf der Klinge. Ich nahm das Schwert in beide Hände und tat einige Hiebe gegen einen unsichtbaren Gegner, um das Heulen zu hören, mit dem die Klinge die Luft durchschnitt. Plötzlich hörte ich eilige Schritte hinter mir, lautes Schimpfen und Gebrüll. Ich erkannte die Stimme von Thorvardur, doch bevor ich reagieren konnte, hatte der Hausherr mich auch schon von hinten angesprungen und auf den Hofplatz geworfen. Das Schwert fiel mir aus der Hand, der Hausherr griff es und baute sich mit drohendem Blick über mir auf. Inzwischen waren andere Leute hinzugekommen, sie wollten mich am Aufstehen hindern, schafften es aber nicht. Als ich wieder stand, klopfte ich mir zuerst den Dreck von meiner Kleidung. Meine Brüder, die ja fast noch Kinder waren, standen mit erschrockenen Gesichtern neben mir, und Thorvardur überschüttete uns mit Beschimpfungen, das meiste bekam ich ab: Was mir denn einfiele, einfach in sein Heim einzudringen, nur weil ich der Sohn des Mannes sei, der hier zufällig an die Macht gekommen war, obwohl er nicht einmal aus der Gegend kam? In seinen Augen sei ich nur ein nassforscher Emporkömmling, meine Brüder elende Feiglinge und so weiter und so weiter. Ich versuchte seine Tiraden zu stoppen, um ihm zu erklären, dass ich keinesfalls ungeladen gekommen sei, sondern dass er mich selbst eingeladen hatte. Und dass ich geklopft und gerufen habe, um mich bemerkbar zu machen! Als er keine Ruhe gab, packte ich ihn, damit er mir endlich zuhörte, doch das machte Thorvardur nur noch wütender, er schlug nach mir, erhob das Schwert und schrie: »Willst du mich etwa angreifen?«
Ich bekam Angst, dass er mit dem berüchtigten Schwert nach mir schlagen würde, zog in Windeseile meine Axt und dann war ich wohl einfach schneller gewesen als er, auf jeden Fall traf meine Axt ihn zuerst. Er fiel leblos zu Boden.
Um uns herum brach Geschrei aus. Meine Brüder und ich sprangen so schnell wir konnten auf die Pferde und ritten hastig davon, ritten immer weiter und sprachen kein einziges Wort. Wir waren schon fast zu Hause, da wollte ich plötzlich nicht mehr weiter. Irgendwie traute ich mich nicht auf unseren Hof, also schickte ich meine Brüder voraus – ritt allein auf eine unserer Außenweiden und schaute nach den Pferden. Dort stand eine Stute, die bald gebären würde, doch es war noch nichts geschehen, also machte ich mich nach einer Weile wohl oder übel doch auf den Heimweg.
Schon von Weitem sah ich, dass mein Vater auf unserem Hofplatz stand und umringt war von aufgebrachten Männern, die auf ihn einredeten. Einer von ihnen hatte einen Wundverband um den Kopf – es war Thorvardur! Offenbar hatte ich die Axt so gezogen, dass ich ihn nur mit der stumpfen Rückseite getroffen hatte, nicht mit der scharfen Schneide, die ihm auf jeden Fall den Schädel gespalten hätte.
Als mein Vater mich sah, rief er mich zu sich und fasste die Vorwürfe der Gekommenen kurz zusammen: Ich sei unangekündigt in den Hof eingedrungen, hätte dreist und ohne Erlaubnis das Schwert genommen und dann auch noch einen der besten Bauern des Bezirks bewusstlos geschlagen. Bevor ich auch nur zwei Worte zu meiner Verteidigung sagen konnte, brüllte er, ich sei eine Schande für die ganze Sturlungen-Familie, ein verzogenes Söhnchen, das nichts könne, außer Unruhe zu stiften, doch damit sei es nun aus und vorbei, er würde mir schon Zucht und Ordnung beibringen und das nicht zu knapp. Ich wich erschrocken zurück und bekam kein Wort heraus. Ich hatte Vater noch nie so schlimme Worte über mich sagen hören, und dann auch noch vor all diesen Fremden, die im Laufe seiner Schimpftirade offenbar immer zufriedener geworden waren, sich bald darauf mit höflichsten Grußformeln verabschiedeten und besänftigt davonritten.
Ich blieb zurück, gedemütigt wie ein geprügelter Knecht – sogar meine jüngeren Brüder, die immer zu mir aufgesehen hatten und mir gefolgt waren wie einem echten Anführer, hatten alles mitbekommen. Auch Tumi, mein älterer Bruder, stand draußen auf dem Hof, er hatte zugehört und grinste hämisch. Das alles anzusehen, musste ihm ein reines Vergnügen sein, schließlich hatte er sich oft genug darüber beschwert, dass mein Vater mich immer bevorzugte, nun war ich zu allen anderen in den Dreck gestoßen worden.
Ich dachte, ich könnte nie wieder glücklich werden. Überlegte, meine Sachen zu packen und fortzugehen, um nie wieder ein Wort mit meinem Vater sprechen zu müssen. Zum Abendessen ging ich nicht.
Als ich mich später am Abend auf den Gang schlich, hörte ich auf einmal die Stimme meines Vaters. Er hatte auf mich gewartet: »Komm mal kurz her, mein Lieber. Ich will mit dir reden.«
Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, wortlos an ihm vorbeizugehen, doch seine Stimme klang auf einmal so freundlich, dass mein Zorn von einer Sekunde auf die andere verpuffte, und im nächsten Moment führten wir bereits ein vertrautes Gespräch. Oder besser gesagt, mein Vater sprach: Er bat mich inständig darum, diese ganze Geschichte einfach zu vergessen. Er habe mich beschimpfen müssen, um dieses aufdringliche Pack mit seinen lächerlichen Anschuldigungen so schnell wie möglich loszuwerden. Dabei sei er sich sicher, dass dieser Streit mit Thorvardur nicht meine Schuld gewesen sei.
»Wir lassen uns doch nicht von diesem aufgeblasenen Sackgesicht unsere Freundschaft verderben, oder?! Gut, dass du diesen Kuhfladen umgehauen hast, was anderes hat der gar nicht verdient. Was fällt dem eigentlich ein, meine Söhne Feiglinge zu nennen?!«
Das hatte mein Vater gesagt. Und wir waren wieder Freunde gewesen. So wie wir es immer gewesen waren.
SIGHVATUR
Viele Leute meinen, die Zwietracht, die seit einiger Zeit in unserer großen Familie herrschte, käme daher, dass ich Sturla Zeit seines Lebens gegenüber seinem älteren Bruder Tumi bevorzugt hätte. Doch das glaube ich nicht.
Ich hatte jedenfalls entschieden, dass Sturla das Amt des Goden in den westlichen Tälern übernehmen sollte. Dieses Amt wurde seit langer Zeit von uns Sturlungen besetzt, und als ich einen neuen Goden ernennen musste, ist Sturla bereits ein erwachsener Mann gewesen. Ich hielt das für sinnvoll, für zwingend notwendig sogar – und doch hatte nichts in unserer Familie so viel Zwietracht gesät wie diese von mir für so selbstverständlich gehaltene Entscheidung. Danach lief alles aus dem Ruder. Als mein ältester Sohn davon erfuhr, stürmte er wutentbrannt aus der Tür und sprach kein Wort mehr mit mir. Und nicht nur bei mir zu Hause gab es Ärger, auch meine Brüder schäumten vor Wut. Mein Bruder Snorri stieß die wüstesten Drohungen aus und zog unseren Bruder Thórdur auf seine Seite, den Goden von Snæfellsnes, der eigentlich weithin für seine Friedfertigkeit bekannt war. Wie wir Brüder eigentlich alle.
Ich möchte betonen, dass es mein gutes Recht war, den neuen Goden in den westlichen Tälern zu ernennen. So hatte unser Vater es bestimmt. Thórdur, der älteste von uns Brüdern, hatte die fruchtbaren Ländereien sowie das Godenamt auf Snæfellsnes bekommen und herrschte dort über viele Menschen. Und über die Reichtümer und ehrenvollen Ämter, die mein jüngerer Bruder Snorri, der Dichter und Skalde, bekommen hatte, braucht man gar nicht zu reden. Das Gebiet, das ich hingegen bekommen hatte, tja, das waren die westlichen Täler, über die irgendjemand mal gesagt hat, es seien »darbende Landstriche«. Deshalb konnte ich natürlich nicht Nein sagen, als ich einige Jahre später von den Bauern in Nordisland gebeten wurde, in den Eyjafjord zu ziehen und Oberhaupt ihres reichen Bezirks zu werden. Wir zogen also um. Das hatte allerdings zur Folge, dass ich meinem Godenamt in den westlichen Tälern bald nicht mehr wirklich gerecht werden konnte. Anfangs lief es noch ganz gut, weil meine Stellvertreter vor Ort mir viele Entscheidungen abnahmen, aber letztendlich musste ich doch zu oft zwischen den beiden nicht gerade nahe beieinander liegenden Bezirken hin- und herreisen. Als ich langsam älter wurde, das beschwerliche Reiten nicht mehr gut vertrug und auch der Elan meiner Stellvertreter nachließ, war es mein gutes Recht gewesen, das Godenamt für die westlichen Täler demjenigen meiner Söhne zu übertragen, den ich für den Geeignetsten hielt – das war sogar meine Pflicht gewesen.
Doch nun sprach mein Erstgeborener nicht mehr mit mir, meine Brüder schäumten vor Wut und meine Frau Halldóra las mir ordentlich die Leviten. Ich könne Sturla nicht alles geben und die anderen völlig übergehen, schon gar nicht unseren Erstgeborenen Tumi. Damit, dass ich auch für Tumis Zukunft einen Plan hatte, rechnete offenbar keiner. Ich konnte noch nichts Konkretes dazu sagen, doch schon bald würden alle sehen, dass ich für ihn vielleicht sogar etwas viel Besseres im Sinn hatte als die »darbenden Landstriche«, in denen ich Sturla als Goden eingesetzt hatte.
Und es gab noch etwas anderes, das ich nicht laut sagen durfte. Dass Sturla nämlich wirklich viel besser als Tumi geeignet war, das ehrenvolle Godenamt in den westlichen Tälern, das wir Sturlungen seit der Generation meines Großvaters innehatten, zu besetzen. Sturla war geboren, um zu führen, das konnte niemand bestreiten. Tumi hatte nie Leute für sich gewinnen können, dazu war er zu verschlossen und zu launisch. Sturla hingegen wurde in den westlichen Tälern sofort geliebt, er zog Hilfsbereitschaft und Wohlwollen geradezu an – ganz wie ich es erwartet hatte.
STEINVÖR SIGHVATSDÓTTIR
Seit ich denken kann, hat mein großer Bruder Tumi immer irgendwie armselig und unglücklich ausgesehen. Wir ältesten drei Geschwister, Tumi, Sturla und ich, waren oft zusammen gewesen. Wir hatten gemeinsam gespielt, was manchmal schwierig war, weil Tumi immer so aufbrausend und schnell beleidigt war, ganz im Gegensatz zu dem immer ausgeglichenen Sturla. In dessen freundlichem Gesicht, in seinen blauen Augen, schien ein unendliches Selbstvertrauen zu liegen, die unerschütterliche Gewissheit, dass er in allem der Beste war – eine Gewissheit, die er Tumi manchmal unangenehm deutlich spüren ließ. Dabei war doch Tumi eigentlich der große Bruder.
Sturla konnte sich bei uns zu Hause alles erlauben. Am Esstisch hatte er zum Beispiel als Einziger seinen festen Platz, ganz in der Mitte der langen Bank, die direkt an der Wand stand, sodass eine Menge Leute aufstehen mussten, um ihn rauszulassen. Man könnte vielleicht denken, dass es unbequem war, so eingeklemmt zu sitzen, doch nicht für Sturla. Denn er musste sich keineswegs andauernd raus- und reindrängen – er ließ sich einfach bedienen! Sturla hatte seinen Platz selbst zum Ehrenplatz gemacht; denn es konnte nun wirklich keiner erwarten, dass er etwas holte, das auf dem Tisch fehlte, oder nach dem Essen beim Abräumen half. Er könne nicht mithelfen, er komme hier einfach nicht raus, hatte er immer wieder gesagt und dazu dieses Lächeln aufgesetzt, das uns andere Kinder rasend machte. Tumi trieb das manchmal zur Weißglut – er war schließlich derjenige, der auf diesem Ehrenplatz sitzen sollte, doch es gelang ihm beim besten Willen nicht, Sturla zu vertreiben. Tumi war der Erstgeborene, hatte aber nie gelernt, sich wie einer zu verhalten. Wenn er es doch einmal versuchte, ließ Sturla ihn mit humorvollen Sticheleien auflaufen und die jüngeren Geschwister hielten zu Sturla und lachten, wenn er Witze auf Tumis Kosten machte. Wenn Tumi daraufhin beleidigt war, blickte Sturla ihn nur fragend aus seinen blauen Augen an: Was hatte der nur? Ich unternahm nichts. Mutter wies Sturla manchmal zurecht, sagte, er solle seine Geschwister nicht ärgern, woraufhin dieser uns einen Blick zuwarf, den wir sofort verstanden und ganz verdutzt taten: Sturla hatte doch gar nichts gemacht. Mutter fügte dann meistens hinzu, sie habe gemeint, er solle seinen älteren Bruder nicht ärgern, doch das klang oft nur noch halbherzig mahnend und verlief letztlich im Sande. Manchmal sagte Mutter dann noch, Sturla solle helfen, den Tisch zu decken, wie die anderen Kinder auch. Sie versuchte, dabei möglichst streng zu klingen, doch Sturla half einfach nicht, außer die wenigen Male, als er es selbst beschlossen hatte.
Vater schimpfte nie mit Sturla, er versuchte es höchstens mal mit freundlichen Ermahnungen, die eher wie Witze klangen, sodass sie nicht selten beide darüber lachen mussten. Sturla brachte Vater oft zum Lachen. Vater konnte sich nicht einmal ein Grinsen verkneifen, wenn Sturla Tumi beim Essen ärgerte, und uns Geschwistern ging es ehrlich gesagt ähnlich.
Aber auch wenn Sturla diese unglaubliche Selbstsicherheit – um nicht zu sagen Selbstzufriedenheit – ausstrahlte, hatte er doch seine Schwächen. Er gab zum Beispiel überraschend schnell auf, wenn er in Schwierigkeiten oder Gefahr geriet. Einmal liefen wir Kinder auf der Hochebene in dichten Nebel hinein und wussten plötzlich nicht mehr, wo wir waren. Sturla und ich hatten zwei der kleinen Brüder dabei, Kolbeinn und Kakali, und wir mussten uns bald eingestehen, dass wir im Kreis liefen. Als wir zum dritten Mal an ein und derselben Stelle vorbeikamen, wurde es langsam dunkel, es fing an zu regnen und uns wurde kalt. Wir waren müde und hatten Hunger, wir mussten so schnell wie möglich nach Hause finden, keine Frage. Doch was tat Sturla? Er ließ sich einfach auf den Boden fallen. Setzte sich hin, legte seinen Umhang ab. Als ich fragte, ob wir nicht weitermüssten, sagte er nur: »Das bringt doch nichts. Wir gehen im Kreis. Das bringt doch alles nichts.« Er sah mich an und sprach mit einer Stimme, die ich sonst nur von unserem Vater kannte, wenn er diese Momente durchlebte, in denen ihm alles hoffnungslos erschien, sinnlos und ohne Wert. Ich dachte schon, Sturla würde nie wieder aufstehen, sondern einfach darauf warten, dass … Ja, worauf eigentlich? Dass uns jemand fand? Dass es noch kälter und dunkler wurde? Dass wir erfroren? Ich versuchte mich zu orientieren, irgendeinen Trampelpfad zu finden oder etwas, das mir bekannt vorkam. Schließlich war es Kakali, er konnte damals kaum älter als neun Jahre alt gewesen sein, der einen Bach entdeckte. Wir waren gerettet, schließlich musste dieser Bach ja hinunter ins Tal fließen, wir brauchten ihm also nur zu folgen und fanden auch wirklich bald nach Hause. Ein anderes Mal hatten wir in einem abgelegenen, halb verfallenen Schuppen mit Feuer gespielt und plötzlich stand alles um uns herum in Flammen. Sobald etwas gefährlich erschien, verlor Sturla den Mut. Ich war viel mutiger als er und manche der jüngeren Brüder auch, Kakali zum Beispiel, der hatte vor gar nichts Angst.
Doch auch aus dieser Schwäche Sturlas konnte Tumi keinen Nutzen ziehen. Er kam an seinem kleinen Bruder einfach nicht vorbei. Als Vater dann auch noch erlaubte, dass Sturla die schöne Solveig aus dem südisländischen Oddi heiratete – ich sollte später ihren Bruder Hálfdan zum Mann bekommen – ging endgültig etwas in Tumi kaputt. Er war nämlich selbst in die schöne Solveig verliebt gewesen. Er hatte sie kennengelernt, als Vater ihn und Sturla zum ersten Mal auf eine Thing-Versammlung mitgenommen hatte, und konnte seitdem an kein anderes Mädchen mehr denken.
Dann bekam Sturla von Vater auch noch das Godenamt in den westlichen Tälern zugesprochen. Nicht Tumi. Das Maß war voll.
In letzter Zeit höre ich manchmal, wie Vater zu Mutter sagt, er müsse das Tumi gegenüber irgendwie ausgleichen. Und was ist mit mir? Ich bin auch nirgendwo Gode geworden. Frauen werden so etwas nie. Und es ist auch nie die Rede davon, dass man mir gegenüber etwas ausgleichen müsste.
SKALDEN-STURLA
Ich war damals noch sehr jung gewesen, erst acht Jahre alt. Die Männer hatten über Dinge gesprochen, die nicht für meine Ohren bestimmt waren. Dinge, die ich nicht verstand und die mich eigentlich auch gar nicht interessierten. Und doch werde ich diesen Tag in der Schreibstube von Snorri Sturluson auf Reykholt niemals vergessen. Ich erinnere mich an jeden Gesichtsausdruck und jedes Wort, das gesprochen wurde. Ich weiß noch wie heute, wo wer gesessen oder gestanden hat.
Man hatte mir erlaubt, in der Schreibstube ein wenig vor mich hin zu basteln, solange ich nichts anfasste und die Erwachsenen nicht bei der Arbeit störte. Snorri selbst arbeitete gerade mit zwei Gehilfen an einem Buch, als plötzlich ein Mann hereinkam, der in der Gegend zu tun hatte. Und offenbar wollte er nicht nur die üblichen Neuigkeiten von den Nachbarhöfen weitertratschen, sondern hatte Snorri eine wichtige Mitteilung zu machen. Er drückte sich sehr umständlich aus, und doch stellte sich irgendwann heraus, dass mein Cousin Sturla Sighvatsson sich mit einer Frau verlobt hatte, und zwar mit keiner Geringeren als der schönen Solveig aus dem südisländischen Oddi. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie alle Anwesenden plötzlich erstarrten, als sie das hörten. Niemand traute sich, etwas zu sagen, alle warfen Snorri nervöse Blicke zu, denn sie wussten, dass diese Nachricht dem großen Skalden und Anführer nicht gefallen konnte. Später erfuhr ich, dass außer mir alle im Raum gewusst hatten, dass Snorri selbst ein Auge auf die schöne Solveig geworfen hatte. Er hatte in letzter Zeit immer häufiger und mit immer fadenscheinigeren Begründungen ihren Hof besucht, und es war allen aufgefallen, wie gerne er mit ihr sprach. Und über sie. Doch nun musste er hören, dass Sturla Sighvatsson sie heiraten würde. Sein eigener Neffe! Ich weiß noch genau, wie blass Snorri wurde, wie sonderbar angespannt und hart seine Gesichtszüge auf einmal wirkten, als müsste er alle Kraft aufwenden, um die Fassung nicht zu verlieren.
Als der Besucher dann auch noch erzählte, dass Sighvatur seinem Sohn Sturla das Amt des Goden in den westlichen Tälern übertragen hatte, platzte Snorri vor Wut. Ich hatte ihn noch nie zuvor richtig wütend gesehen, und es war auch danach nie wieder vorgekommen. Deshalb ist mir dieser Tag wahrscheinlich so gut im Gedächtnis geblieben – den geliebten Onkel so dermaßen aus der Haut fahren zu sehen, war für einen achtjährigen Jungen ein ziemliches Ereignis. Ich beobachtete ihn mit einer Mischung aus Spannung und Furcht. Er schlug mit der Hand so kräftig auf sein Pult, dass die Tintenfässchen durcheinanderflogen, fegte Pergamentbögen zu Boden, warf einen Stuhl durch den Raum und schrie, bis er blau wurde. Er brüllte so laut, dass seine Stimme sich in einem schrillen Kreischen überschlug, das ich noch nie von ihm gehört hatte. Von überhaupt niemandem jemals gehört hatte. Er schimpfte über seinen Neffen Sturla, diesen verhätschelten, hochnäsigen Aufschneider und Tunichtgut – eine ganze Flutwelle von Schmähungen brach aus ihm heraus, an die sich nahtlos eine Abrechnung mit seinem Bruder Sighvatur anschloss, diesem alten Trottel, der seine Söhne so vergöttere, dass er sie hoffnungslos überschätze –, diesen Sturla am allermeisten. Schon immer habe Sighvatur, dieser Versager von einem Vater, seinen erstgeborenen Sohn Tumi auf das Schändlichste übergangen – nun habe er ihn sogar um das betrogen, was ihm von Rechts wegen zustehe, und das nur, weil er diesen hochnäsigen Gockel namens Sturla so blind vergöttere. Sicher, Sturla mochte im Vergleich zu seinen verwarzten Hofgenossen hübsch anzusehen sein, aber hatte er jemals irgendwo auch nur einen Funken Männlichkeit gezeigt? Nein. Snorri erinnerte sich noch genau daran, wie Sighvatur diesen Sturla einmal mit auf eine Thing-Versammlung gebracht hatte. Entsetzlich! Die Gesetzesangelegenheiten, die dort besprochen worden waren, hatten Sturla einen Dreck interessiert, nicht ein einziges Mal hatte er das Wort ergriffen, um seinen Vater oder die anderen Sturlungen zu unterstützen, stattdessen sei er die ganze Zeit in bunt gefärbten Kleidern herumstolziert und allem hinterhergestiegen, das weiblichen Geschlechtes war.
Snorris Wutanfall war wie ein Sturm über uns gekommen. Ich war wie gelähmt vor Schreck, und mit diesem Gefühl war ich nicht allein – alle anderen, die in der Schreibstube dabei gewesen waren, waren bald leichenblass. Als das letzte Wort noch nicht verklungen war, stürmte Snorri türenschlagend aus der Stube und ward nicht mehr gesehen. Erst viel später erfuhr ich, dass er offenbar sofort seinem Sohn Óraekja, diesem herzensguten, aber im Suff leider komplett unberechenbaren Kerl, befohlen hatte, in die westlichen Täler zu reiten, um Sturla aufs Übelste zu verleumden und möglichst viel Einfluss zu gewinnen, bevor er dort Fuß fassen konnte.
Wenig später kam Sighvatur zu Besuch. Snorri und er hatten sich eigentlich immer gemocht, aber dieses Mal sah Snorri keinen Anlass, mit seinem Bruder zu reden. Doch Sighvatur ließ sich nicht irritieren. Snorri mochte noch so wortkarg und beleidigt sein, Sighvatur tat einfach so, als ob alles wäre wie immer, er erkundigte sich zum Beispiel nach einem prächtigen Hengst, der ihm auf dem Hofplatz aufgefallen war, denn über Pferde hatten die Brüder immer gerne geredet. Nun wollte Snorri auf der einen Seite seinem Bruder die kalte Schulter zeigen, auf der anderen Seite wollte er aber auf keinen Fall die Gelegenheit versäumen, mit seinen Pferden zu prahlen. Am nächsten Tag bat Sighvatur seinen Bruder dann darum, dass sie gemeinsam in die Schreibstube gingen, und ließ sich dort die Bücher zeigen, die Snorri und seine Gehilfen in letzter Zeit geschrieben hatten. Sighvatur gab einige Verse zum Besten, die er selbst gedichtet hatte und kam damit nicht schlecht an. Er konnte gut dichten, doch die seltene Gabe, mit Tinte auf Kalbshaut Geschichten zu erzählen, die war ihm nicht gegeben.
Dann war es so weit. Snorri las aus einem seiner eigenen Bücher vor. Er las aus seiner Edda die Geschichten über die alten Götter, erzählte von Odin, Thor, Freya, Frigg und Loki, und als Snorri bemerkte, wie gebannt Sighvatur diese Lesung verfolgte und wie begeistert er reagierte – »Haha, das ist mit Geld nicht zu bezahlen, Snorri. Herrlich!« –, konnte Snorri seinem Bruder nicht länger böse sein. Die Gespräche zwischen den beiden nahmen einen zunehmend gelösten und freundlichen Ton an, und so blieb es, bis Sighvatur abreiste.
Doch eine richtige Versöhnung dieser beiden Teile unserer großen Familie war das nicht gewesen. Das sollte sich schon bald auf furchtbare Weise zeigen.
SIGHVATUR
Als der Streit mit meinem Erstgeborenen Tumi gerade seinen Höhepunkt erreicht hatte, erhielt ich die Nachricht, dass mein Schwager Arnór, der Gode des Skagafjords, sich mit mir beraten wolle. Ich machte mich sofort reisefertig, nahm einen Knecht mit, der mich über die Hochebene von Öxnadalur begleiten sollte, und stand bald bei Arnór vor der Tür – ich war ehrlich gesagt ganz froh, für eine Weile von zu Hause fort zu sein. Arnór war zwar nicht so unterhaltsam und wortgewandt wie sein verstorbener Bruder Kolbeinn, doch wer konnte das schon von sich behaupten? Und Kolbeinn war nun einmal tot, erschlagen von einem Stein, den einer der Bettler oder Verrückten aus dem Gefolge Gudmundurs geworfen hatte – diesem Bischof, den die Leute den Guten nannten, weil er das Lumpenpack aus allen Landesteilen bei sich aufnahm, sodass es eine echte Plage geworden war, in der Nähe des Bischofssitzes Hólar zu wohnen. Ich nahm an, dass es das war, worüber mein Schwager Arnór mit mir reden wollte. Ich fand die Vorstellung nicht gerade verlockend, mich schon wieder mit dem Bischof anzulegen, zumal ich meine Brüder nicht noch mehr gegen mich aufbringen wollte – beide, Snorri ebenso wie Thórdur, waren gute Freunde von ihm. Thórdur hielt diesen fußlahmen Stellvertreter Gottes sogar für einen Heiligen, obwohl er sowohl uns Anführern als auch dem einfachen Volk in Nordisland das Leben ziemlich schwer machte.
Wir setzten uns also in Arnórs Wohnstube, und plötzlich kam ein hochgewachsener junger Mann auf mich zu, um mich zu begrüßen, als würden wir uns seit Ewigkeiten kennen. Als Arnór meine Verwirrung bemerkte, lachte er und sagte: »Da siehst du mal, wie lange du nicht hier gewesen bist, wenn du ihn nicht erkennst. Das ist mein Sohn, Kolbeinn der Junge. Ist ganz schön groß und stark geworden, oder?!« Nun erkannte ich ihn natürlich sofort. Er war wirklich groß und stark geworden, hatte breite Schultern und dicke Oberarme bekommen, sein Blick war jetzt erwachsen und sehr wach.
»Ach, du bist das, kleiner Mann«, sagte ich und klopfte ihm auf den Rücken. Arnór lachte, doch der Junge lachte nicht. Er verließ einfach wieder den Raum.
»Ich bin wirklich froh, dass Kolbeinn so prächtig gewachsen ist«, sagte Arnór. »Mich verlassen langsam die Kräfte, und es gibt immer öfter Streit bei uns in der Gegend, ach was, im ganzen Land. Aber darum muss sich jetzt Kolbeinn kümmern. Ist er nicht ein vielversprechender junger Mann?«
»Ja, unsere Söhne übertreffen uns bei Weitem«, sagte ich und bekam etwas zu trinken gereicht.
Dann kam alles wie erwartet: Arnór wollte über Bischof Gudmundur reden und über das Gesindel, das dieser bei sich aufgenommen hatte. Inzwischen kamen fast täglich Leute zu Arnór, die unter der Obhut des Bischofs standen, manchmal sogar mehrere an einem Tag, darunter Tobsüchtige, Leprakranke, Huren mit Kindern und Landstreicher, die nicht selten in anderen Teilen des Landes gesucht wurden, weil sie in irgendwelche Verbrechen verwickelt waren. Diese Leute suchten nun alle Höfe in der Umgebung von Hólar heim, bettelten oder stahlen, wenn auf dem Bischofssitz die Vorräte mal knapp wurden. Keiner von ihnen arbeitete, sie zogen einfach nur dem Bischof hinterher wie die Jünger unserem Herrn Jesus Christus, nur dass sie nicht fasteten und entbehrungsreich ihr Dasein fristeten, sondern in Völlerei und Sünde lebten. Arnór sagte, er habe oft versucht, mit dem Bischof zu reden. Sie seien ja schließlich alte Bekannte aus der Zeit, als der Bischof noch ganz normaler Priester auf Vídimýri gewesen war. Doch der Bischof gebe ihm nichts als ausweichende Antworten. Wenn Arnór sich beschwerte, dass diese Leute nicht arbeiteten, spreche der Bischof von den Lilien auf dem Felde, die auch nicht arbeiteten und doch vom Herrgott ernähret wurden, er sinniere über die Nachfolge Christi, den Heiligen Franz von Assisi oder den Heiligen Thomas von Canterbury.
»Ich sage dir, ich habe es so satt, mit diesem Mann zu reden«, sagte Arnór seufzend. »Ich bin es einfach leid.«
»Was willst du tun?«, fragte ich.
Arnór antwortete mit einem erneuten Seufzer: »Ich weiß, dass wir das schon einmal ohne Erfolg versucht haben, und es uns auch dieses Mal wieder in Schwierigkeiten bringen kann, aber ich finde, wir nordisländischen Anführer sollten unsere Männer bewaffnen und dieses Pack vertreiben. Sollen die doch alle dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind, dann soll jeder Bezirk die eigenen armen Schlucker versorgen. Es geht doch nicht, dass wir die alle an der Backe haben.«
»Aber kommen die nicht sofort wieder hierher zurück?«, fragte ich. »Zurück zu ihrem guten Bischof?«
»Na ja«, sagte Arnór. »Nicht, wenn wir den Bischof auch vertreiben. Wir haben nun wirklich lange genug versucht, uns damit zu arrangieren, dass er hier auf Hólar lebt. Er müsste halt irgendwohin, wo er keine große Landwirtschaft hat und nicht so viele Leute ernähren kann. Am besten auf eine Insel.«
»Das klingt gar nicht so schlecht. Aber dann müssten wir einen fähigen Mann finden, der den Bischofssitz besetzt, oder?«, fragte ich. »Für den Fall, dass das Pack trotzdem zurückkommt …«
»Gewiss«, sagte Arnór, der sichtlich froh war, dass ich die Sache nicht sofort für Schwachsinn erklärt hatte. Wobei er offenbar tatsächlich noch nicht bedacht hatte, dass wir ja an Stelle des Guten Bischofs jemand anderen auf Hólar einsetzen mussten. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass ich vielleicht gerade die Lösung für meinen Streit mit Tumi gefunden hatte. Eine Möglichkeit, meinen Erstgeborenen dafür zu entschädigen, dass ich Sturla die westlichen Täler gegeben hatte, hatte sich aufgetan. Vielleicht hatte ich für Tumi gerade einen Hof und eine Stellung gefunden, die jedem Anführer zur Ehre gereichen würde.
BISCHOF GUDMUNDUR DER GUTE
Was muss ich elender Erdenwurm, ich bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn, nicht alles erleiden. Seit ich lebe, lebe ich in Pein. In Leid und in Schmerz, den mir die ignoranten Menschenkinder ebenso bereiten wie die Gewalten der Natur. Nie werde ich vergessen, wie ich an der westlichen Küste mit meinem Mündel Ingimund einmal in schwere Seenot geraten. Die wütenden Wogen hatten unser Schiff an Land geworfen, wo es derart zerbarst, dass ein zersplittertes Dollbord mir das rechte Bein so zertrümmert, dass der Knochen wie zu Sand zermahlen und die Zehen so verdreht waren, dass sie dorthin wiesen, wo sonst die Ferse war. Und da sich in der Gegend kein heilkundiger Mensch gefunden, ward das Bein mit nur wenig Kunstfertigkeit geschient, und niemand vermochte etwas dagegen zu tun, dass Teile des zersplitterten Knochens aus dem Bein herausgeragt und die Ferse weiterhin nach vorne gestanden. Und doch wuchs alles so gut zusammen, dass meine Pein im nächsten Frühjahr unbeschreiblich ward, als kunstfertigere Männer sich daran gemacht, den Fuß in die richtige Richtung zu drehen, und mir dazu abermals alle Knochen brechen mussten. Seitdem kann ich sie nachfühlen, die Pein, die unser Erlöser unter der Geißel, den Backenstreichen und der Dornenkrone erlitten, unter dem schweren Kreuz, das er selbst getragen, bis er endlich daran geschlagen ward. Die Schläge der Menschen habe ich in all den Jahren, in denen ich meinem Herrgott und Schöpfer als Bischof diene, nur zu gut kennengelernt. Die Unwissenheit und Boshaftigkeit der Menschen ist ein ständiger Begleiter auf meinem steilen, steinigen Weg. Einmal bin ich an einen Hof gekommen, um dort einen Brunnen zu weihen, und als ich Unwürdiger die Zeremonie vorgenommen, haben sich einige Spaßvögel entblößt und ihr Wasser abgeschlagen. In den Brunnen! Dazu riefen sie, die göttlichen Kräfte dieser Weihe würden doch wohl stark genug sein, um den Brunnen vor ihrer frevelhaften Tat zu schützen, sonst hätte man ihn ja nicht weihen müssen. Und als ich ein anderes Mal zur Fastenzeit dem Beispiel unseres Erlösers und vieler Heiliger gefolgt und Hunger und Entbehrungen aller Art auf mich genommen, bewunderten die Leute mich nicht etwa für meinen heiß empfundenen Glauben, nein, sie ergötzten sich daran und flüsterten sich zu, ich habe schon immer zur Übertreibung geneigt.
Die schwerste aller Prüfungen ward mir jedoch von unserem Herrgott auferlegt, als ich die Ausgestoßenen und Aussätzigen bei mir aufgenommen, anstatt sie zu vertreiben. Wir sind doch alle Kinder Gottes, auch die Gefallenen, die in Sünde lebenden Frauen, die Alten, Tobenden, Lahmen, Siechenden. Die Vorhersehung hat es so gewollt, dass diese Menschen mich aufsuchten und mir folgen wollen wie dem Erlöser selbst. Die Anführer dieses Landes sind mit weltlichen Gaben so reich gesegnet, ihre Kinder ergehen sich in Trägheit und Müßiggang, und doch haben sie es für ziemlich gehalten, einen Kriegszug gegen mich anzustrengen. Nur weil die Menschenkinder, die mir folgten, nicht im Schweiße ihres Angesichts gearbeitet, sondern von Almosen gelebt, darunter viele gichtgebeugte Krüppel oder solche, die von schwachem oder rasendem Geiste sind. Wer von euch ohne Sünde ist, sagt die Bibel. Darüber zu sinnieren stünde den Mächtigen dieses Landes gut zu Gesicht.
SOLVEIG
Ich bin nicht gern von zu Hause fortgegangen, weggezogen in die Eintönigkeit der westlichen Täler. Wir haben zu Hause nie besonders gut über die Leute, die dort leben, gesprochen. Seit ich denken kann, habe ich bei uns im Süden immer nur gehört, die Leute in den westlichen Tälern seien ruppig und ungehobelt, ähnlich wie die Leute aus dem Breiten Fjord, ja, eigentlich wie überhaupt alle Westisländer. Egal, ob das nun stimmt oder nicht, die Leute in Südisland haben das immer behauptet, und sie sind nun einmal meine Leute. In den westlichen Tälern, den »darbenden Landstrichen«, wie manche sie nennen, gibt es kein besonderes geistiges Leben, soweit ich weiß. Zumindest nicht so wie bei uns zu Hause auf Oddi. In meiner Familie gibt es viele gelehrte, höfliche Leute, schließlich sind wir eng mit der norwegischen Königsfamilie verwandt. Bei uns in Südisland waren immer alle wohlhabend, alles war weitläufig und hell. Und obwohl wir natürlich wussten, dass die Menschen in den anderen Landesteilen sich gegenseitig überfielen und töteten, hatte bei uns immer Frieden geherrscht, über viele Menschenalter hinweg – ich hatte immer gehofft, ich müsste nie von zu Hause fortgehen.
Dementsprechend schwer war mir ums Herz, als ich dann doch Abschied nehmen musste. Von meinen liebsten Menschen, den Wegen, die ich all die Jahre gegangen war, den Vögeln, die in den Wiesen sangen, den Bergen und dem Meer, das ich in der Ferne sah. Jetzt wohne ich auf Saudafell in den westlichen Tälern. Doch Sturla ist gut zu mir. Wir haben unser erstes Kind bekommen. Und dort, wo mein Kind ist, da bin auch ich zu Hause.
STURLA SIGHVATSSON
Mein Vater Sighvatur kam uns auf Saudafell besuchen. Er traf zwar auch einige seiner Freunde hier in der Gegend, die meiste Zeit jedoch verbrachte er bei uns zu Hause. Er alberte mit seinem Enkelkind herum, plauderte mit Solveig und mir und schien alle Zeit der Welt zu haben. Bald bekam ich das Gefühl, dass ihm etwas auf dem Herzen lag, über das er sich nicht recht zu sprechen traute. Ich kannte doch meinen Vater! Also wartete ich in aller Ruhe ab, bis er mir schließlich eröffnete, dass er zusammen mit Mutters Bruder, Onkel Arnór, einen Kriegszug gegen Bischof Gudmundur den Guten und seine Leute plante. Ich sicherte ihm natürlich sofort meine Unterstützung zu, doch wurde Vater auf einmal sehr zögerlich. Irgendetwas schien ihm daran nicht zu passen.
Aber was sollte das bloß sein? Es war doch selbstverständlich, dass wir zusammenstanden, vor allem dann, wenn es um einen Kriegszug ging, wir waren doch Vater und Sohn! Was gab es da überhaupt zu bereden?
Und dann gestand mein Vater mir, dass er mich nicht dabeihaben wollte.
Ich vergaß mich. Sprang auf. Wurde laut. Ich fragte, ob wir uns fortan gar nicht mehr gegenseitig helfen würden. Ob ich dann auch nicht mehr auf ihn zählen könne, müsste ich eines Tages zu den Waffen greifen. Aber er seufzte nur und begann zu nuscheln und zu stottern und sagte nein, darum gehe es nicht.
Ich fragte, ob denn Kolbeinn der Junge bei dem Kriegszug dabei sein werde und Papa antwortete, ja, doch, gewissermaßen schon, und plötzlich wurde mir schwarz vor Augen vor lauter Wut. Onkel Arnór kämpfte Seite an Seite mit seinem Sohn, und ich sollte meinen Vater nicht unterstützen – wie sah das denn aus?
Vater schnaufte und prustete und sagte dann, mein Bruder Tumi werde mit ihm in den Kampf ziehen. Er werde sogar einer der Anführer sein, denn es sei abgesprochen, dass Tumi sich auf Hólar niederließ, sobald der Bischof vertrieben war.
Nun konnte ich nicht einmal mehr wütend sein – mir kamen fast die Tränen. Ich hatte zwar damit gerechnet, dass auch Tumi irgendwann seinen Teil abbekommen würde, aber dass es so sehr auf meine Kosten gehen würde – das hätte ich nicht gedacht.
In Hólar standen die größten und schönsten Häuser von ganz Nordisland, und auch im Rest des Landes fiel mir kaum ein imposanterer Wohnort ein als dieser. Der Anführer, der sich dort niederließ, wurde zum mächtigsten Mann im ganzen Skagafjord, diesem bedeutenden Bezirk. Wenn mein Bruder Hólar bekam, würde er zwangsläufig die Macht meines Vaters erben, wenn es einmal so weit war. Tumi würde also ganz Nordisland beherrschen und damit der mächtigste Mann im ganzen Land sein. Ich wäre im Vergleich zu ihm nicht mehr als ein gewöhnlicher Bauer, ein Stiefelknecht.
Für mich brach eine Welt zusammen. Meine Welt!
Mein Vater konnte mir nicht einmal in die Augen schauen, während er mit mir sprach. Er strich sich über die Wangen, schnaufte und sah zu Boden, er hatte eindeutig ein schlechtes Gewissen. Zu Recht! Nach langem Schweigen sagte er, ich müsse das doch verstehen, und begann, eine große Rede zu halten, die so konfus war, dass ich mich einfach zurücklehnte und aus dem Fenster sah; das hereinscheinende Tageslicht nahm in meinen Augen alle Farben des Regenbogens an. Vater sagte wieder und wieder, er hoffe, dass alles gut verlaufen würde, er wolle doch nur das Beste für seine Söhne. Meine Sorge, dass Tumi zum mächtigsten Mann im Skagafjord würde, bezeichnete er als grundlos. Schließlich hatten dort Arnór und seine Familie seit Generationen das Sagen, und Kolbeinn der Junge, der bald von seinem Vater Arnór die Macht übernahm, würde es nie erlauben, dass ein Zugezogener sich in seinem Machtbereich breitmachte, auch wenn der zehnmal einen so imposanten Ort wie Hólar bewohnte. So gesehen könnte Tumi sich sogar in eine ziemlich knifflige Situation bringen, wenn er sich in Hólar niederließ, schließlich musste er dann bei jedem Fehltritt die Rachlust der reizbaren Einheimischen fürchten, ganz abgesehen von einem drohenden Kirchenbann für die Vertreibung des Bischofs.
Vater schloss seine Rede mit den Worten: »Aber wir beten natürlich zu Gott, dass alles gut gehen wird.« Dann hatte er aufgehört zu schnaufen und zu prusten und sah mich endlich direkt an, als wollte er herausfinden, ob ich verstand, was er da eben gesagt hatte.
Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. In Wahrheit brachte er Tumi in eine fast aussichtslose Lage. Eine Lage, in die er mich nie hatte bringen wollen. Mein Vater war mir so wohlgesonnen wie immer, jetzt begriff ich es! Ich tat weiterhin etwas beleidigt und so, als fühlte ich mich übergangen, was in dieser Situation vermutlich auch das Richtige war. Dann sprachen wir nicht weiter über die ganze Sache. Mein Vater widmete sich weiter seinem Enkelkind, er war einfach nur zu Gast auf unserem Hof, wie eine Hauskatze, ließ sich umsorgen und redete mit allen über Gott und die Welt, doch nur halbernst, wie im Scherz. Und als er sich drei Tage später auf den Heimweg machte, waren wir vollkommen versöhnt. Wir küssten uns zum Abschied. Wie immer.
Erst nachdem er fort war, bekam ich ein schlechtes Gewissen. Schließlich wusste ich jetzt, in welche Schwierigkeiten Tumi wahrscheinlich geraten würde, so reizbar und rüpelhaft wie er nun einmal war.
SIGHVATUR
Der Morgen brach gerade erst an, als ich schon mit meinen Leuten auf den Hofplatz von Arnór, dem Goden im Skagafjord, ritt. So hatten wir es verabredet. Von meinen Söhnen war nur Tumi dabei. Nach all den Jahren, in denen ich mich mit ihm mehr gestritten hatte als mit jedem anderen meiner Söhne, hatte ich ihm nun eröffnet, dass ich ihn dafür vorgesehen hatte, den großartigen Bischofssitz Hólar zu beziehen. Ich hatte das auch meiner Frau gesagt, damit Tumi mir überhaupt glaubte, dass ich es ernst meinte. Falls diese Leute, die sich dort zusammengerottet hatten, nicht widerstandslos fortzogen, wäre endgültig bewiesen, dass man den Bischof hier nicht mehr dulden konnte. Dann würden wir dieses zwielichtige Gesindel einfach vertreiben und den Bischof gleich mit. Tumi würde den Hof übernehmen, um ihn verteidigen zu können, falls jemand zurückkäme. Tumi war hoffnungsvoll und freute sich, zeigte das mir gegenüber aber nicht. Er war aufsässig und schroff wie eh und je. Er hatte sich nicht einmal bedankt, aber das war in Ordnung. Wir waren insgesamt bestimmt einhundert Mann, meine treuesten Freunde aus dem Eyjafjord waren dabei, und auch Tumi hatte »seine Leute« mitgebracht, seine Freunde und Trinkkumpanen, unter denen nicht wenige in der ganzen Gegend als Unruhestifter und Schläger bekannt waren. Arnórs Männer, die uns ebenfalls begleiteten, waren auch nicht gerade harmlos, allen voran sein Sohn Kolbeinn der Junge, der unser Vorhaben wirklich sehr ernst nahm; er saß groß und aufrecht auf seinem Pferd, mit Streitaxt und Schwert ausgerüstet, den Schild an den Knauf seines Sattels gebunden, und blickte konzentriert und verbissen in die Gegend. Vielleicht war er auch nur wütend – auf jeden Fall war es ein bisschen albern, wie er versuchte, mit seinem Jungengesicht diese Feldherrenmiene aufzusetzen.
Wir ritten in ruhigem Tempo Richtung Hólar. Arnór und ich ganz vorne. Ich bestreite nicht, dass ich ein mulmiges Gefühl hatte, schließlich griffen wir einen heiligen Ort an und geweihte Diener der Kirche. Doch konnte es so nicht weitergehen, das war auch klar. Andererseits wusste ich auch, was ich mir von meinen Brüdern Snorri und Thórdur anhören müsste, falls diese Aktion außer Kontrolle geriet und es Verletzte oder gar Tote gab. Meine Brüder würden sagen, dass Gott mich dafür strafen werde, dachte ich, und sagte Arnór, dass wir auf keinen Fall mehr Gewalt anwenden durften, als unbedingt nötig war. Arnór war derselben Meinung.
»Wir sollten behutsam vorgehen«, sagte er, woraufhin wir unseren Männern einschärften, äußerst vorsichtig zu sein. Danach war ich ein wenig beruhigt. Ich wollte auch meinem Sohn Tumi noch einmal sagen, dass absolute Vorsicht geboten war, doch er ritt weiter hinten, war umgeben von seinen Männern, und der Ausdruck auf seinem Gesicht ließ mich daran zweifeln, dass er offen für Ratschläge oder gar Befehle von seinem Vater war. Schießlich war er doch selbst ein Anführer hier. Oder hielt sich zumindest für einen.
Also blieb mir nichts anderes übrig, als auf das Beste zu hoffen.
Als wir uns dem Bischofssitz näherten, hörten wir immer lauteres Rufen und Geschrei. Fußlahme fuchtelten mit ihren Krücken in der Luft herum und brüllten uns an. Wir machten am Rande des Hofplatzes Halt und hatten alle Hände voll zu tun, uns das Gesindel aus dem Gefolge des Bischofs vom Hals zu halten, unzählige Männer, Frauen und Kinder, die uns drohten und versuchten, uns anzuspucken und mit dem Inhalt ihrer Nachttöpfe zu begießen. Endlich kamen ein paar Männer aus der offiziellen Leibgarde des Bischofs, Aron, Einar und andere, die ich kannte. Ich rief ihnen zu, sie sollen ihre Leute im Zaum halten, wir seien gekommen, um mit dem Bischof zu verhandeln und nicht um Streit anzufangen. Tumi sah mich mit einem Gesichtsausdruck an, der alles andere als Zustimmung signalisierte, er hatte offenbar etwas anderes erwartet. Die bischöflichen Leibwächter hoben die Hände und brachten die Leute endlich zur Ruhe, sodass ich etwas Hoffnung schöpfte, dass die Sache einigermaßen glimpflich ablaufen würde.
Doch ich täuschte mich.
Denn bald darauf wurde der Bischof von seinen Leuten aus dem Hof getragen und als er fast bei uns war, begann er mit hoher, fester Stimme einen liturgischen Gesang auf Latein zu singen. Daraufhin erhob sich um uns herum ein ohrenbetäubendes Heulen und Kreischen und Brüllen. Immer mehr Leute aus dem Gefolge des Bischofs hatten inzwischen ihre Nachttöpfe geholt und bespritzten uns damit, sie spuckten und kamen uns so nah, dass einige unserer Männer mit Peitschen und Waffen nach ihnen schlugen, woraufhin die Menge umso wilder wurde, bis es Pferdemist und Torf auf uns regnete und man nichts mehr hörte außer Geschrei, in das sich jetzt Schlaggeräusche von Waffen mischten. Wenig später hatten viele der Leute des Bischofs blutige Wunden. Man bewarf uns mit Steinen. Sie schienen aus allen Richtungen auf uns niederzuprasseln. Auf einmal bekam ausgerechnet mein Schwager Arnór einen derart riesigen Brocken auf den Brustpanzer, dass er vom Pferd fiel. Ich befürchtete schon, dass ihn dasselbe Schicksal ereilt hatte wie seinen Bruder, der an genau diesem Ort einige Jahre zuvor einen Stein an den Kopf bekommen hatte und daran gestorben war. Als Kolbeinn der Junge sah, wie sein Vater vom Pferd fiel, geriet er so sehr in Rage, dass er sein Schwert in beide Hände nahm und hasserfüllt auf das Bischofspack losging – dass sein Vater sofort nach dem Sturz aufgestanden war und sich nicht einmal verletzt hatte, änderte daran nichts.
Als Kolbeinn der Junge noch ganz klein gewesen war, hatte jemand vorausgesagt, dass aus diesem Kind einmal ein großer Hitzkopf werden würde. Nun wurden wir alle Zeuge davon, wie sich diese Prophezeiung bewahrheitete. Seine Männer taten es ihm gleich. Ich versuchte, sie zurückzuhalten, ermahnte sie durch den Schlachtenlärm hindurch zur Ruhe, doch ohne Erfolg. Keiner hörte auf mich. Nicht einmal Tumi, mein eigener Sohn, der wohl von Anfang an gehofft hatte, er könne hier endlich zeigen, dass er diesem Kolbeinn dem Jungen, über den schon damals alle sprachen, kriegerisch in nichts nachstand. Tumi und seine Leute stürmten mit gezogenen Schwertern in die Menschenmenge, sie schlugen nach Köpfen und Körpern, sodass das Blut nur so spritzte und Hirnmasse aus Ohren quoll.