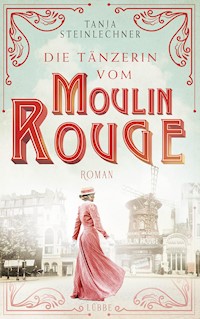
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris 1882. Louise Weber wächst als Tochter einer Wäscherin in bitterer Armut auf. Doch sie brennt für den Tanz. Immer wieder schleicht sie sich heimlich fort, in die Bars und Cafés am Montmartre, und steigt, gefördert von Künstlern wie Renoir oder Toulouse-Lautrec, zum Star des Moulin Rouge auf. Als sie vor dem Schah von Persien tanzt, wird sie zur international gefeierten Königin des Cancan. Doch die Angst, wieder in die Armut abzugleiten, quält sie. Und so setzt sie alles aufs Spiel: Wohlstand, Glück - und die Liebe ihres Lebens ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Paris 1880. Louise Weber wächst als Tochter einer Wäscherin in bitterer Armut auf. Doch sie brennt für den Tanz. Immer wieder schleicht sie sich heimlich fort, in die Bars und Cafés am Montmartre, und steigt, gefördert von Künstlern wie August Renoir oder Toulouse Lautrec, zum Star des Moulin Rouge, zur international gefeierten Königin des Cancan auf. Doch die Angst, wieder in die Armut abzugleiten, quält sie. Und so setzt sie alles aufs Spiel: Wohlstand, Glück - und die Liebe ihres Lebens …
Über die Autorin
Tanja Steinlechner, 1974 in Heilbronn geboren, besuchte die Freiburger Schauspielschule im E-Werk. Sie hat an der Universität Hildesheim Kreatives Schreiben bei Dr. Hanns-Josef Ortheil studiert und war danach als Lektorin und Literaturagentin tätig. In einer Weiterbildung (Master School Berlin) zur Drehbuchautorin entwickelte sie ein Treatment für einen Filmstoff, der im Rahmen des Screenpitch-Wettbewerbes nominiert und im roten Salon der Volksbühne vorgestellt wurde.
TANJASTEINLECHNER
ROMAN
LÜBBE
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anna Hahn, Trier
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Illustrationen von © Trevillion Images: Ildiko Neer: © Bridgeman Images: Look and Learn; © shutterstock: Nimaxs | Mott Jordan
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0404-5
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Merlin Leander und Lucius Valerian,meine beiden wundervollen Söhne, in Liebe
Kein Leben ist vorherbestimmt, und doch weisen nicht nur Herkunft und Stand, Geburtsort und -jahr einem aufgehenden Stern seinen vermeintlichen Platz zu, ein eigenwilliger Charakter, ein herausragendes Talent und allem voran eine mächtige, beinahe unheimliche Sehnsucht, die angestammte Welt hinter sich zu lassen, wirken im Geheimen und weben dort ihre unsichtbaren Schicksalsfäden.
PROLOG
Sie hatte nur kurz ins Zelt spähen und einen Blick auf die Wunder erhaschen wollen, die man sich vom fahrenden Volk erzählte. Im Zirkus sollte es dressierte Äffchen geben, die den Damen unbemerkt ihr Riechsalz und den Herren heimlich Kautabak und Klimpermünzen aus den Westentaschen stahlen. Vielleicht würde sie auch wilde Tiger zu Gesicht bekommen oder gar jene Schlangenmenschen, von denen ihr die Frauen in der Wäscherei erzählt hatten. Die konnten sich angeblich übermenschlich biegen und strecken. Louise würde das Geheimnis der Zirkusleute, der Luftakrobaten, Gaukler und Clowns schon herausfinden. Wenn sie erst einmal wüsste, welches Elixier sie trinken oder mit welchem Zauberöl sie sich einreiben müsste, damit sie im Zirkus auftreten durfte, würde sie es sich schon irgendwie beschaffen.
Louise musste diese Wunder unbedingt mit eigenen Augen sehen. Der Zirkus war so selten in der Stadt, die Chance würde sich so schnell nicht wieder ergeben. Immerhin war heute ihr Geburtstag, und den Eintritt hätte Maman sich niemals leisten können. Das Geld für ihr Geschenk, eine Tarte au Chocolat, hatte sie sich über Monate vom Mund abgespart. Louise war der Schlitz im Zeltstoff gleich aufgefallen. Sie schlich näher heran. Im Schutz der Dunkelheit und fernab der Lichter, die den Eingang erhellten, kauerte sie sich mit klopfendem Herzen auf die Erde. Durch den Riss im Zelt konnte sie die Tänzerinnen in ihren bunt schillernden Kostümen sehen. Zu den leichtfüßigen Rhythmen der Kapelle schwangen sie ihre Beine hoch in die Luft und wedelten dazu mit den Pompons. Wie gebannt verfolgte Louise ihren Auftritt, unfähig, sich von ihrem Anblick zu lösen. Als die Musik verstummte, trat eine ganz in Gold gekleidete Frau herein. Federn schmückten ihren Kopf und glitzernde Ketten wanden sich um ihren Bauch. Diese eine Nummer musste Louise noch sehen! So kniete sie weiter auf der harten Erde und verfolgte mit großen Augen die Vorstellung. Die eigentliche Sensation, das ahnte sie, schlummerte in dem Bastkorb, den der Flötenspieler in Pumphosen soeben ins Zelt schleppte. Er stellte ihn vor der Frau ab und hockte sich in einiger Entfernung von ihr auf ein ausladendes Bodenkissen. Dann begann er zu spielen. Unheimliche und zugleich sirrend leichte Doppeltöne entlockte er seinem Instrument, das eher nach einem verstimmten Schifferklavier als nach einer hellen Flöte klang. Die Frau öffnete den Deckel des Korbes. Der Kopf einer Kobra lugte hervor. Der Zauber der Musik und die Künste ihrer Beschwörerin hatten sie offenbar aufgeweckt. Elegant sah das Tier aus und gleichermaßen gefährlich. Die Frau bewegte ihre Hände zur Musik, und der Kopf der Schlange folgte ihnen.
Da schrak Louise auf einmal zusammen und sprang mit einem Schrei auf. Jemand hatte ihr von hinten auf die Schulter getippt. Sie war so in das Spektakel versunken gewesen, dass sie niemanden hatte kommen hören. Vor ihr standen eine Frau und ein Mann in prachtvollen Kostümen und blickten sie erstaunt an. Merde! Das würde bestimmt ein Donnerwetter geben. Doch der Mann beugte sich zu ihr herunter und fragte: »Gefällt dir die Vorstellung?« Er lächelte nicht, aber etwas Weiches lag in seiner Stimme. Louise nickte, sie brachte keinen Ton heraus.
»Du traust dich ja was, kleine Mademoiselle«, sagte die Frau. Sie hatte feuerrote lange Haare und unzählige Sommersprossen auf dem Nasenrücken.
»Was muss ich tun, wenn ich auch zum Zirkus will?«, wagte Louise zu fragen. Ihr Herz schlug wild. Dass die Zirkusleute sie für ihr Vergehen aber der Polizei übergeben würden, schien ihr inzwischen höchst unwahrscheinlich. »Ich könnte bestimmt lernen, auf einem Seil zu tanzen oder auf dem Rücken eines Elefanten zu reiten.«
Der Mann und die Frau tauschten amüsierte Blicke. »Du willst zum Zirkus?« Die Rothaarige sah sie prüfend an. »Das ist kein leichtes Leben und du bekommst nichts geschenkt. Täglich musst du üben und für die Vorstellungen proben. Abends tun dir oft sämtliche Knochen weh.«
Die Zirkuskünstlerin blickte versonnen in die Baumkronen, die über ihnen sacht im Wind rauschten. Dazu summte sie eine leise Melodie. Louise wartete darauf, dass sie weitersprach.
»Weißt du«, sagte die Frau. »Wir Zirkusleute nehmen all die Mühen und Strapazen nicht auf uns, um reich zu werden. Wir bekommen nur eine kleine Gage. Aber sieh mal!« Sie deutete auf den Riss im Zelt und Louise verstand, wozu sie sie aufforderte. Von drinnen ertönte der Schlussapplaus. Sie ging wieder in die Hocke und erhaschte einen letzten Blick auf die Gesichter der Zirkusleute. Sie machten einen erleichterten und zugleich glückseligen Eindruck. Und so ein himmlisches Glitzern lag in ihren Augen, nicht ganz von dieser Welt. Im Rampenlicht zu stehen, Träume sichtbar zu machen und am Ende der Vorstellung in Beifall zu baden, darum also ging es. Das war ihr eigentlicher Lohn.
Als Louise sich wieder erhob, war das Pärchen verschwunden. Was sie an jenem Abend aber erlebt hatte, hatte von da an in ihr fortgewirkt und eine tief in ihr schlummernde Sehnsucht wachgerufen. Zum ersten Mal hatte sie einen Vorgeschmack auf ein ungezähmtes und freies Leben gekostet.
ERSTER TEIL
KAPITEL 1
Clichy bei Paris, 1882
Louise öffnete das schmiedeeiserne Tor und trat auf den Vorhof der Wäscherei. In der Nacht hatte es kaum abgekühlt, und in die flirrende Sommerluft Clichys mengte sich der Gestank von Geflügelkot und Urin. Beides nutzten die Wäscherinnen, um das Linnen zu bleichen.
Sie rümpfte die Nase und beugte sich zu Minette hinunter, die ihr um die Beine strich und Köpfchen gab. Das waren die wenigen Minuten, die ihr ganz allein gehörten, in denen sie kein Feuer schürte, nicht über das brodelnd heiße Wasser gebeugt im Zober rührte, keine nasse Wäsche auswrang oder sie auf den Trockenboden schleppte, um sie dort auf die Leine zu hängen.
Das langsam anschwellende Schnurren, das den kleinen Katzenkörper ergriff, ließ sie einen Moment aufatmen. Doch dann krampfte sich ihr Magen zusammen. Heute früh hatte sie noch nichts runterbekommen. Am Morgen gab es ohnehin immer nur Brot und verdünnte Milch. Mehr konnten Maman und sie sich von dem spärlichen Lohn nicht leisten. Und gleich würde wieder die endlose Schleife zäh dahinkriechender Stunden beginnen, die sie im Halbdunkeln in der großen grauen Halle zubringen musste. Louise ignorierte das Ziehen in ihrem Bauch, das ihr zuflüsterte, sie möge sich umdrehen und diesen Ort so schnell wie möglich hinter sich lassen. Maman zählte auf sie, und sie hatte ja auch keine Wahl.
Noch einmal streichelte sie sanft Minettes Köpfchen, dann eilte sie über den Hof und schlüpfte durch die angelehnte schwere Tür in die Waschhalle. Von einem der Haken, an denen in Reih und Glied die grauen Schürzen der Arbeiterinnen baumelten, griff sich Louise ihre und band sie sich um. Sie kniete sich neben die Metallwanne, in der sie die Holzscheite sammelten, und schichtete so viele wie möglich in ihrer freien Armbeuge übereinander. Als sie aufstand, geriet sie ins Schwanken, und der Holzberg fiel krachend zu Boden.
Sie seufzte, kniete sich erneut hin, klaubte Scheit um Scheit auf und sammelte sie nun in ihrer Schürze. Abermals erhob sie sich, dieses Mal besonders vorsichtig, und balancierte das Holz bis in die hinterste Reihe mit Zobern, wo sie es absetzte und auf die erkalteten Feuerstellen schichtete.
Da legten sich auf einmal Hände von hinten auf ihre Schultern. Louise zuckte zusammen. Sie hatte die Vorsteherin nicht kommen hören, erkannte Betty aber gleich an den kalten Fingern und dem festen gleichbleibenden Druck, der ihr signalisierte, dass sie unter Beobachtung stand. Jedes Mal tauchte die Vorsteherin wie aus dem Nichts auf, und jedes Mal entlud sich ein Schwall Anschuldigungen und Forderungen. Sie drehte sie zu sich herum und griff schnell nach ihren Fingern, bevor Louise sie hinter dem Rücken verbergen konnte. »Du hast ja ganz schmutzige Nägel!« Betty schüttelte missbilligend den Kopf. »Wir garantieren höchste Sauberkeit. Schreib dir das hinter die Ohren, hörst du? Und wie deine Schürze wieder aussieht! Die wäschst du heute nach Feierabend. Sonst brauchst du gar nicht erst hier auftauchen. Bedauernswert, wer dich einmal zur Ehefrau nimmt.«
Louises Wangen glühten, mehr vor Zorn als vor Scham. Betty genoss es augenscheinlich, sie bloßzustellen.
»Nun steh hier nicht nur herum, Louise, entzünde endlich das Feuer unter den Zobern! Die Wäsche von Madame Dupont muss gefaltet werden, sie hat schon danach gefragt. Und vergiss nicht, die Borten und Spitzen extra zu behandeln. Vite, vite!« Mit diesen Worten verschwand die Vorsteherin Richtung Kasse, wo sie sich auf dem grün gepolsterten Stuhl niederließ. Dort verbrachte sie die meiste Zeit und nahm die Wünsche der Kundinnen entgegen.
Von ihrem angestammten Platz in der hinteren Reihe überblickte Louise gut, was in der Halle vor sich ging – und war vor allem so weit wie möglich von Betty und ihrer zeternden Stimme entfernt. Damit bloß keine der anderen Frauen ihr den Lieblingsplatz wegschnappte, eilte sie stets in aller Früh aus dem Haus und war fast immer als Erste in der Wäscherei. Mit den Streichhölzern, die Louise bei der Feuerstelle am hintersten Zober aufbewahrte, entzündete sie die Scheite. Wie herrlich die Flammen gleich darauf um das Holz züngelten und umeinander tanzten. Das Feuer loderte, ohne zu fragen, ob es dafür geboren war. Sie schloss die Augen und lauschte dem Knistern und Schnalzen. Ein weiterer gestohlener Augenblick, der nur ihr gehörte.
Die Kirchturmuhr schlug die volle Stunde an, und die Wäscherinnen betraten lärmend die Halle, um ihre Plätze einzunehmen. Begrüßungsfloskeln und der neuste Klatsch und Tratsch wurden ausgetauscht. Widerwillig löste sich Louise vom Anblick des Feuers und widmete sich dem großen Wäschekorb, der auf der Ablage hinter ihr stand. Dessen Inhalt zu sortieren hatte sie gestern nicht mehr geschafft. Die Beinkleider und Damenstrümpfe kamen auf einen Extrastapel. Beinahe flüssig fühlte sich die Seide der Strümpfe an, wenn Louise sie sich über die Hand zog, um sie zu wenden. In welchen Farben und Mustern es sie neuerdings gab. Neben den weißen hatten grüne Strümpfe mit roten Zwickeln Einzug gehalten, jede Frau von Welt besaß sie. Es gab auch welche mit Rauten- und Blumenmustern. Einmal hatte Louise roséfarbene Strümpfe mit Schmetterlingen darauf gesehen. Da hatte sie sich vorgestellt, wie es wäre, einmal zu Geld zu kommen und ein rotes Herz auf ihre Wäsche sticken zu lassen, das nur derjenige zu Gesicht bekäme, der …
»Du hast ja ganz rote Wangen, Louise. Bekommst du etwa Fieber?«
Ihre Freundin Lily musste, von ihr unbemerkt, hereingekommen sein. Sie war ausnahmsweise einmal nicht zu spät und hatte einen Platz in der Reihe vor ihr ergattert.
»Bestimmt nicht. Aber weißt du«, nun flüsterte Louise, »manchmal stelle ich mir vor, die feine Wäsche der Damen gehörte mir. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie sich diese Schmetterlinge wohl auf der Haut anfühlen?«
Lily stieg die Röte ins Gesicht.
»Ich würde das zu gern nach Feierabend herausfinden.«
»Das ist verboten, Louise. So eine Idee kann auch nur von dir kommen.«
»Ach, nun sei kein Angsthase. Mach doch mit bei unserem kleinen Abenteuer.«
Die Vorsteherin drehte sich zu ihnen um und brüllte quer durch die Halle: »Lily, du arbeitest heute vorne bei mir. Vite, vite, die Dame. Das ist hier schließlich kein Kaffeeplausch!«
Zu Louise gewandt wisperte Lily im Vorbeigehen: »Ich würde wirklich gern, aber ehrlich, ich traue mich das nicht. Wenn wir erwischt werden, bekommen wir echt Ärger!«
Louise seufzte, beendete die Sortierarbeiten und griff sich die zwei Eimer, die unter der Ablage standen. Damit querte sie die Halle. Sie musste im Vorhof Wasser aus dem Brunnen holen.
Nur ein rascher Blick in den wolkenlosen Sommerhimmel, ein kurzes Durchatmen, dann tauchte sie erst den einen, dann den anderen Eimer ins trübe Nass, lief zurück zum Zober und füllte ihn damit auf. Einen dritten und vierten, einen fünften und sechsten Eimer befüllte Louise, schleppte alle durch die Halle und kippte das Wasser in die Kessel, unter denen bereits die Scheite brannten. Unter dem achten Kessel loderte kein Feuer. Dort weichte sie die Wäsche ein, die stärker verschmutzt war. Zuunterst kamen die Beinkleider und Strümpfe, darauf die Bettwäsche und schließlich die Halstücher, Manschetten und Kragen. Erst dann befüllte Louise diesen Zober mit kaltem Wasser. Einen gesonderten Kessel gab es für das feine Leben: die Damenwäsche mit Spitzenbesatz, die edlen Strumpfbänder, die verschiedenfarbigen Mieder und Unterröcke. Sie würde diese Stoffe später noch einmal extra behandeln müssen, um die Farbe aufzufrischen. Schimmerndes Grün gewann durch eine Lösung aus Essig und Alaun wieder an Glanz, zartes Lila verstärkte sie durch Backpulver, und die roten Pantalons einer gewissen Francine Duboise gab Louise in ein Bad aus Vitriol.
Der Duboise haftete ein zweifelhafter Ruf an. Wenn sie die Halle betrat, verstummten die Gespräche der Wäscherinnen augenblicklich, bis in den hinteren Reihen ein murmelndes Geflüster und Getuschel anhob. Vielleicht lag es an den blonden Locken, die selbst im trüben Licht der Waschhalle glänzten, oder an ihrem eleganten Gang, mit dem sie sich auf den hohen Absätzen über den holprigen Steinboden bewegte. Die anderen mochten bloß neidisch sein, wenn sie hinter vorgehaltener Hand la poule, die Bordsteinschwalbe, oder schlimmer noch la putain, die Hure, zischelten. Für Louise jedoch war dieser Augenblick, wenn die Tür aufschwang und Francine Duboise eintrat, der Höhepunkt des Tages.
Die Duboise trug stets äußerst extravagante Kopfbedeckungen, sodass sie sofort auffiel, wenn sie hereinrauschte, ungerührt von dem Getuschel um sie herum. Jedes Mal stellte sie energisch ihren Wäschekorb auf den Tresen und nahm dann ihren mit prunkvollen Schleifen verzierten Hut ab, eine Unsitte, die keiner Dame in der Öffentlichkeit gebührte. Des Weiteren tat sie nichts Ungehöriges, aber ihre gesamte Erscheinung umgab eine geheimnisumwitterte glanzvolle Aura, die für die spärlichen Minuten ihres Aufenthalts die ganze Wäscherei erfüllte.
Doch mit Francine, wie Louise sie heimlich nannte, war um diese frühe Stunde nicht zu rechnen. Stattdessen tönten die Stimmen der Arbeiterinnen durch die Halle. Ob Witwen mit gekrümmten Rücken oder taufrische Mädchen im heiratsfähigen Alter – sie alle einten die von der Arbeit wunden Hände und der grobe, schwere Stoff der Kleidung. Die Kluft hatte einen einzigen Zweck: Sie musste ihre Funktion erfüllen. In der Anschaffung günstig, bei hoher Temperatur waschbar sein und die weiblichen Reize nicht übermäßig zur Schau stellen. Eine Frau war eine gute Frau, wenn sie tugendhaft war, nicht, wenn sie Aufmerksamkeit auf sich zog, ganz egal, ob sich Louise danach sehnte oder nicht. Ihre Wangen glühten von der Anstrengung und der Hitze, die von dem lodernden Feuer ausging. Sie schüttete aufgelöstes Soda – nur eine Handvoll, keinesfalls mehr – in das heiße, aber nicht kochend heiße Wasser. Auf beides hatte sie achtzugeben, schließlich durfte weder Bekleidung noch Bettwäsche einlaufen und die Bleiche keine braunen Flecken auf dem Stoff hinterlassen. Louise nahm sich der vorbehandelten Halstücher, Manschetten und Kragen an und legte sie in den Zober, der nun genau die richtige Temperatur hatte, während sie einen dritten Kessel für die Kochwäsche anheizte. Ihre Hände waren schon jetzt gerötet, und die wunden Stellen der letzten Tage brannten. Sicher würden sich wieder Blasen bilden. Sie griff nach dem Holzlöffel, um die Waschsuppe umzurühren, ließ ihn aber mit einem schmerzvollen Aufschrei wieder los: Der Stiel war glühend heiß geworden. Sie lüpfte ihre Röcke, fand so endlich ein wenig Abkühlung und gönnte sich eine kurze Pause. Wie hielt Maman diese Schufterei bloß Jahr um Jahr aus? Wie ertrug sie diesen immer gleichen Gestank?
Ihre Mutter war im Elsass zwischen Rosmarin, Thymian und Lavendel aufgewachsen. Auch wenn Louise sich an das Häuschen ihrer Großeltern nur noch schemenhaft erinnerte, so lag ihr beim Gedanken daran augenblicklich der Geschmack weich gebutterten Käses auf der Zunge. Als Kind war sie dort oft zu Besuch gewesen und hatte besonders die grenzenlose Weite geliebt. Wenn sie auf die Äste des knorrigen alten Apfelbaumes kletterte, bot sich ihr eine schier unbegrenzte Aussicht über die Weinberge. Und niemals würde sie den fantastischen Garten vergessen. Inmitten von Apfelbäumen und Gemüsebeeten konnte Louise mit Vic, ihrer Schwester, herrlich toben. Jedes Mal, wenn sie am Gartentisch vorbeiflitzten, reichte ihnen Grandmaman eine süße Erdbeere, ein Stück Käse oder gab ihnen von ihrer selbst gemachten Limonade zu trinken. In jenen glücklichen Tagen überließen die Erwachsenen Louise und Vic sich selbst und ihrer kindlichen Fantasiewelt. Sie konnten tun, wonach immer ihnen der Sinn stand. Grandmaman war mit Kochen, Maman mit Unkrautzupfen beschäftigt, während Papa und Grandpapa sich um den Apfelbaumbeschnitt kümmerten. Häufig saßen sie alle, bis spät in die Nacht und bei Kerzenschein, um den langen Gartentisch herum, es war ein traumhaftes Leben. »Warum bleiben wir nicht für immer hier? Warum müssen wir zurück nach Clichy?«, fragte sie in die Runde. Papa leerte rasch sein Weinglas, seine Hand zitterte dabei leicht. »Wir sind nicht allein auf der Welt und nicht so frei, wie wir erhoffen.«
Damals hatte Louise nicht verstanden, was Papa damit meinte. Sie hatte nicht gewusst, dass er auf den Krieg anspielte, in den er wenig später ziehen würde.
* * * * *
»Wir fahren, wenn die Blätter sich bunt färben«, sagte Papa, als er auf Heimaturlaub in Clichy war und Louise ihn damit bestürmte, wann sie wieder ins Elsass reisen würden. Bis dahin musste sie es also mit Maman und ihrer Schwester Vic in der dunklen Wohnung in Clichy aushalten. Es ging ihnen ja nicht schlecht, sie hatten genug zu essen, und ein eigenes Bett besaß Louise auch. »Dafür musst du dankbar sein.«
Maman hielt sie und Vic stets an, ihr bei der Hausarbeit zu helfen. Sie mussten Geschirr abtrocknen, Wäsche zusammenlegen und zur Nacht beten, dass alles bliebe, wie es war. Einen unsinnigeren Wunsch konnte Louise sich nicht vorstellen. Zwar sprach sie die Gebete, die Maman von ihr verlangte, aber sobald diese das Licht gelöscht und ihr Zimmer verlassen hatte, sprang sie wieder aus dem Bett, kniete sich auf die kalten Fliesen und faltete erneut die Hände zum Gebet. »Lieber Gott, du weißt alles, da weißt du auch, dass ich vorhin lügen musste. Nichts soll bleiben, wie es ist, darum nur bitte ich dich. Mach, dass wir ins Elsass zu Grandmaman und Grandpapa ziehen. Und wenn das nicht geht, lass uns wenigstens in einer hellen Wohnung leben, mit weitem Blick über die Welt. Dann wird es beinahe wieder so sein, als wäre ich auf meinem Apfelbaum.«
Tatsächlich ging Louises Gebet in Erfüllung, nichts blieb, wie es war, aber anders, als sie es sich ausgemalt hatte. Die Blätter färbten sich bunt, doch der Besuch bei den Großeltern wurde verschoben. Papa verbrachte ein paar Tage bei ihnen und vertröstete Louise. »Wenn die ersten Schneeflocken fallen, mein Spatz, dann fahren wir los.«
Der Wind wurde rauer und fegte auch die letzten verbliebenen Blätter von den Ästen, bis sie kahl und gespenstisch in die Lüfte ragten. Die Temperaturen fielen und Papa schickte Geld. Maman erstand einen roten Kindermantel, über den Louise ganz aus dem Häuschen war, so sehr gefiel er ihr. Die Großeltern würden staunen, wenn sie ihr Enkelkind so sähen. Doch der erste Schnee kam und sie brachen immer noch nicht auf. Papa schrieb ihnen von den besonderen Umständen des Krieges und ließ sie wissen, dass er sie alle vermisste. Vermutlich wollte er sie mit seinen Zeilen aufheitern, aber Louise war zum Weinen zumute. Was nützte ein so herrlicher Mantel, wenn sie ihn nicht mit auf Reisen nehmen konnte.
Es brach das neue Jahr an, das sie nicht wie sonst zusammen mit den Großeltern begrüßten. Immerhin war Papa bei ihnen. Gemeinsam sahen sie aus dem Fenster in die Nacht, und als die Kirchturmglocken Mitternacht schlugen, griff Maman nach Papas Hand. »Hoffen wir, dass der Krieg bald ein Ende hat«, sagte sie.
Als die Sonne die ersten Blätter wieder zum Sprießen brachte, wagte Louise schon nicht mehr zu fragen, wann sie denn endlich fahren würden. Sie vermisste die Tage, die sie im Garten des windschiefen Hauses hatte verbringen dürfen, sie vermisste Grandmamans Kochkünste und Grandpapas ruhige Stimme, mit der er so gerne die Welt erklärte.
Nachdem die Kirschblüte vorüber war und der warme Wind die zarten Blätter längst von den Straßen gepustet und übers Land verteilt hatte, als sie abermals nicht ins Elsass aufbrachen, da sagte Maman Vic und ihr endlich die Wahrheit. Sie klang dabei seltsam nüchtern. Louise erfasste dennoch sofort die ungeheure Tragweite ihrer Worte. Es lag nicht in erster Linie an dem, was Maman sagte, sondern daran, wie ihr Körper sich bei jeder wohl gewählten Formulierung wand, als leide er Schmerzen, die keiner bemerken durfte.
»Grandmaman und Grandpapa mussten flüchten.« Maman machte eine Pause, bevor sie weitersprach. »Die boches, die Deutschen, haben das Elsass erobert. Deshalb gehören das Haus und der Garten jetzt nicht mehr den Großeltern, sondern Fremden.«
Für Louise brach eine Welt zusammen. Das Paradies ihrer Kindheit war unwiederbringlich verloren. Nie wieder würde sie dort auf Bäume klettern, nie wieder ihre Ferien dort verbringen. Sie weinte bitterlich.
Als Nächstes starb Papa im Krieg und ließ Maman allein mit ihnen zurück. Was für ein grausamer Gott musste das sein, der ihre Bitte, nichts möge bleiben, wie es war, so gründlich missverstanden hatte? Ins Elsass, zu den Großeltern, konnten sie nicht mehr, und die Wohnung in Clichy, die Papa von seinem Sold bezahlt hatte, mussten sie nach seinem Tod räumen, Maman konnte sie sich schlicht nicht mehr leisten. Also blieb ihnen nur der Umzug. Für Trauer hatte Maman keine Zeit, sie fluchte viel und schimpfte ständig mit Louise und Vic, die im Haushalt nicht mit anpackten und das Wenige, das sie besaßen, nicht ordentlich in den Koffern verstauten.
Louise lag stattdessen auf ihrem Bett und träumte sich fort auf ihren Apfelbaum. Und wenn er nun tatsächlich den boches gehörte und sie niemals mehr dorthin durfte, dann wollte sie wenigstens in ein luftiges Irgendwas ziehen, ein Schloss über den Wolken vielleicht, und wenn das zu viel verlangt war, dann sollte es doch wenigstens eine Wohnung sein, durch die das Licht fiel und die nicht im Erdgeschoss lag, sondern den Blick über die Dächer der Stadt freigab.
Aber sie zogen nicht in eine lichtdurchflutete Wohnung weit über der Stadt. Ganz im Gegenteil. Sie blieben in Clichy und kamen vorerst in einer Notunterkunft unter, die mehr eine Baracke als eine Herberge war. Doch dann fanden Maman und Vic Arbeit in der Wäscherei Noiset, und deren Vorsteherin Betty verschaffte ihnen ein ordentliches Zimmer. Während die beiden arbeiteten, war Louise sich selbst überlassen. In dem dunklen Zimmerchen gab es aber nichts weiter zu tun. Also streifte sie im Viertel umher. Sie drückte sich die Nase am Spielzeugladen platt, malte sich aus, dass Papa ihr sicher den ein oder anderen Wunsch erfüllt hätte und Grandpapa ihr bestimmt ein noch viel lebensechteres Holzpferd gebaut hätte, als es dort zu kaufen gab. Als sie wieder einmal vor dem Laden stand, tippte ihr jemand von hinten auf die Schulter. Sie drehte sich um und stand einem Mädchen gegenüber. Es war mager und hatte einen auffallend hellen Teint, der ihr ein beinahe aristokratisches Aussehen verlieh. Ihre Stimme klang zart, sie heiße Lily, erzählte sie, und fragte schüchtern, ob Louise mit ihr spielen wolle. Louise bejahte. Sie war dankbar, endlich nicht mehr allein zu sein und eine Freundin gefunden zu haben. Am liebsten spielten sie Himmel und Hölle. Das war ein Hüpfspiel, in dem es darum ging, einem Stein über mit Kreide auf den Boden gemalten Feldern hinterherzuspringen und den Himmel zu erreichen, ohne die Hölle zu streifen. Die Hölle lag nur ein Feld vom Himmel entfernt und es bedurfte einiger Konzentration und Geschicklichkeit, sie auf der Zielgeraden zu Gott nicht aus den Augen zu verlieren. Beim Spielen vergaß Louise oft die Zeit, und wenn Maman und Vic nach Hause kamen, verstand sie nicht, weshalb sie ihnen in das Zimmer folgen sollte, in dem nichts stand, außer zwei Betten, in denen sie zu dritt schliefen und wo nichts weiter zu erwarten war, als die Kohlsuppe, die es so oft zu essen gab.
Die Freundschaft mit Lily hatte über die Jahre gehalten und war immer enger geworden. Die Prinzessinnen- und Rittergeschichten hatten sie inzwischen hinter sich gelassen und waren stattdessen auf die jungen Männer zu sprechen gekommen. Häufig schlenderten sie zusammen am Seineufer entlang und beobachteten, wie Arbeiter nach und nach die Pont de Clichy wiederaufbauten, die im Deutsch-Französischen Krieg zerstört worden war. Sie sammelten Beeren und manchmal brachte eine von ihnen Butterbrote mit. Das waren kleine Feste, wenn sie mit Blick auf die Brückenarbeiten picknickten, die jungen Angler in ihren Booten betrachteten und sich darüber berieten, wem sie welche Punktzahl für Attraktivität, Gebaren und gesellschaftlichen Stand verliehen. Louise mochte immer jene Männer, die auf irgendeine Weise aus der Reihe tanzten. Lily zeigte ihr dafür oft einen Vogel. »Du landest noch in der Gosse, bei deinem Geschmack«, sagte sie und Louise antwortete: »Da sind wir längst, falls es dir nicht aufgefallen ist.«
Über solchen Plaudereien zogen sie in der Umgebung immer weitere Kreise. Nachdem die Brücke fertiggestellt worden war, spazierten sie zur Île de Robinson und am Uferweg der Île de Ravageurs entlang. Manchmal ging es auch gleich in Richtung des Parks, in dessen Mitte ein Bach floss und wo im Frühjahr und Sommer die Buchfinken ihre Lieder pfiffen. War es warm genug, zogen sie an seinem Ufer Schuhe und Strümpfe aus und hielten ihre nackten Füße ins Wasser. Zu jeder Jahreszeit nutzten sie ihre kleinen Ausflüge aus dem tristen Alltag, um sich gegenseitig in ihre heimlichen Zukunftspläne und Träume einzuweihen. Louise war besonders gut darin, die Fantasiebilder der Freundin noch weiter auszuschmücken. Wünschte sich Lily einen treusorgenden und liebevollen Ehemann, der regelmäßig genug Geld nach Hause brachte, so erschuf Louise ein eigenes Häuschen ganz allein für Lily, mit einem weitläufigen Garten, duftenden Kräutern und hochstehenden Tannen. Lilys künftigem Ehemann dichtete sie neben der gewünschten Gutmütigkeit noch eine ordentliche Portion Charme und ein attraktives Äußeres an. An einem anderen Tag machte sie sie stattdessen zur Ehefrau eines modernen und jungen Professors, der sich schon während ihrer ersten Begegnung Hals über Kopf in sie verliebte und fortan ihrem Rat folgte. Ihre Erzählungen unterstrich Louise mit Vorliebe durch eine ausladende Gestik und Mimik, die fast schon kleinen Tanzeinlagen glich. Damit entlockte sie ihren Zuschauern immer ein Lächeln und erntete Bewunderung. Sie sprach aus, was Lily sich nicht zu träumen wagte, ja, wahrscheinlich nicht einmal vorstellen konnte. Doch was hatten sie schon anderes als ihre Träume?
Der laute Gong, der die Mittagspause ankündigte, riss sie aus ihren Gedanken. Eilig strömten die Arbeiterinnen aus der Wäscherei in den Hinterhof. Louise wollte ihnen gerade folgen, als plötzlich Francine Duboise hereinrauschte, in Begleitung einer Frau. Rasch schlüpfte Louise hinter den Kessel. Wenn die beiden sich unbeobachtet wähnten, hatte sie vielleicht die Chance, etwas mehr von Francines Welt mitzubekommen.
Die Hitze stand träge im Raum und aus den Zobern stieg der Dampf. Vereinzelt zischte es in den brodelnden Suden. Francine setzte ihren Wäschekorb ab, in dem sich, wie Louise wusste, reich verzierte Mieder, rot eingefärbte Spitzenwäsche und Strumpfbänder befanden. »Wir sind anscheinend ganz allein«, sagte sie zu ihrer Freundin und kicherte.
Louise traute ihren Augen kaum, als Francine ihrer Begleiterin, die sie zärtlich Aurélie nannte, über die Wange strich, ihre Hand einen Augenblick dort ruhen ließ und dann einen Schritt auf sie zu tat. Ihr Dekolleté bedeckte sie mit Küssen, während sie mit ihrer Hand Aurélies rundes Gesäß streichelte.
»Wenn wir heute Nacht zu zweit arbeiten, werden meine Blicke nur dir gelten und keiner der Herren wird ahnen, was uns verbindet. Sie alle werden glauben, ich tue es ihnen zuliebe. Und die Trinkgelder, Liebste, die werden fließen. Wenn wir genug beisammenhaben, hauen wir von hier ab und lassen den ganzen Dreck und Gestank hinter uns.« Francine schlang einen Arm um Aurélies Taille und flüsterte ihr etwas ins Ohr, das Louise nicht hören konnte. Dafür vernahm sie plötzlich Schritte, die langsam näher kamen. Francine küsste Aurélie. Zu lang für eine harmlose Freundschaftsbezeugung. Derart waren sie ineinander versunken, dass Francine ihre Lippen erst von Aurélies löste und den Kopf wandte, als die Vorsteherin laut nach Luft schnappte. »Gütiger Himmel.« Sie bekreuzigte sich und wankte dabei. Einen Moment sah es so aus, als fiele Betty auf die Knie, aber dann fing sie sich wieder und räusperte sich. »Wir sind eine öffentliche Blanchisserie und kein Freudenhaus, meine Damen. Wenn ich Sie also bitten dürfte …«
»Sie dürfen.« Aurélie ließ Francines Hand los, hob den Korb hoch und hielt ihn Betty entgegen.
»Meine Damen, solange ich hier Vorsteherin bin, gilt: Wir sind zwar arm, aber nicht ohne Moral.«
»Das glauben wir wohl, Madame Mouron. Gleiches gilt für uns.«
Die Arme vor der Brust verschränkt, reckte Betty das Kinn in die Höhe. »Sollte ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt haben, wiederhole ich mich ein letztes Mal: Bitte verlassen Sie die Wäscherei. In der Blanchisserie Noiset dulden wir kein obszönes Verhalten, hier arbeiten ehrbare Frauen.«
Aurélie sah verschämt zu Boden.
»Aurélie, es ist auch dein Recht, wie eine anständige Bürgerin behandelt zu werden.« Francine griff in die Tasche ihres Rocks und zog ein ganzes Bündel Scheine hervor. »Vielleicht verstehen Sie jetzt«, sagte sie zu Betty gewandt und blickte sie eindringlich an. »Wir tun unsere Arbeit, wie Sie Ihre Arbeit tun. Und wir nehmen Ihnen, den ehrbaren Frauen …«, sie zog das Wort in die Länge, »… gewisse Unannehmlichkeiten ab.«
In Louises Nase kribbelte es. Oh nein, jetzt bloß nicht auffallen! Betty hatte schon die Lippen zur Gegenrede geöffnet und die Hände in die Hüften gestemmt, bereit, die beiden Störenfriede wenn nötig an den Haaren aus der Halle zu befördern. Dann aber fiel ihr Blick auf die Scheine, die Francine in gemächlicher Manier auf den Tresen blätterte. Just in diesem Moment musste Louise lautstark niesen. Die drei fuhren gleichzeitig zu ihr herum. Ein Grinsen schlich sich in Francines Gesichtszüge, und Betty murmelte: »Schon gut, schon gut, wir werden die Zeit finden, Ihren Sonderauftrag zu erledigen.« Hastig stopfte sie das Bündel Scheine in ihre Rocktasche und schob die beiden Frauen aus der Halle. Louise wusste, dass Betty die zusätzlichen Einnahmen ins Kassenbuch hätte eintragen müssen. Doch als sie einen Moment später zurückkam, schloss sie es mit Nachdruck und verstaute es in einer der vielen Schubladen am Tresen. Dann rief sie Louise zu sich und erklärte ihr, dass in diesem besonderen Fall die Mademoiselles ihrer christlichen Nächstenliebe dringend bedurften, denn nur so seien sie vielleicht noch vor Schlimmerem zu bewahren. Louise dürfe aber keinesfalls irgendwem davon erzählen, schon gar nicht ihrer Maman, Gott bewahre. Es sei ja überdies klar ersichtlich, dass sie durch diese Extraeinnahme auch die Wäscherinnen unterstützte. Als die Vorsteherin Luft holte, weil sie nach einer derart langen Erklärung ja auch einmal atmen musste, steckte sie Louise einen der Scheine zu. Sie handele bloß aus Barmherzigkeit und Mitgefühl, sagte Betty noch, und sicher verstünde Louise das richtig.
An jenem Tag lernte Louise, dass der Begriff der Moral dehnbar war und viele Auslegungsmöglichkeiten in sich trug.
KAPITEL 2
Schweißperlen standen Louise auf der Stirn, als sie den kühlen Hausflur betrat. Von der Wäscherei bis zu ihrer Wohnung waren es nur knapp zwanzig Minuten Fußweg, aber ihre Sohlen brannten vom stundenlangen Stehen am Zober, und ihre Arme schmerzten vom Gewicht der nassen Wäscheberge, die sie heute bestimmt an die fünfzehn Mal von der Halle nach oben auf den Trockenboden geschleppt hatte. Außerdem war ihr übel vom Gestank, dem lauten Stimmengewirr ihrer Kolleginnen und ihren eigenen Ausdünstungen. Louise tastete nach dem knisternden Geldschein in der Tasche ihres Rocks. Obst könnte sie davon kaufen und daraus Marmelade für die Wintermonate einkochen, zwei ordentliche Stücke Fleisch auf dem Markt erstehen, um sie in Rosmarin und Thymian einzulegen, oder das Geld sparen und Maman mit einem Weihnachtsgeschenk überraschen. Eigentlich gehörte der Schein ja gar nicht Louise, sondern Francine. Ob Maman es schätzen würde, wenn sie es sich auf Kosten einer anderen Frau – und gar einer Prostituierten – gut gehen ließen? Louise schob den Gedanken beiseite.
Im Treppenhaus vermengte sich der Geruch von Bratfett mit dem Mief, der aus den Gemeinschaftsklos herwehte. Darüber lag ein säuerlicher Film Potée de chou blanc. Kohlsuppe. Angewidert verzog Louise das Gesicht.
Als sie in die Wohnung trat, stand Maman über den Herd gebeugt, die eine Hand am Rücken, die andere fest um den Kochlöffel. Louise schloss die Tür hinter sich, band die Schnüre ihrer Stiefel auf und befreite die schmerzenden Füße. Auf Strümpfen näherte sie sich ihrer Mutter und umarmte sie von hinten. Deren Leidensmiene, die tiefe Furche auf ihrer Stirn, die von all den Sorgen rührte – sie sah alles vor sich, obwohl Maman ihr den Rücken zuwandte. An Mamans Härte und ihrer Schwermut war der Krieg schuld. Er hatte ihnen nicht nur Papa genommen, sondern auch zu ihrem Leben in Armut geführt.
Als Louise etwa vier Jahre alt gewesen war und der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland ausbrach, hatte Maman auch gerade das Mittagessen gekocht. Papa war an diesem Tag früher nach Hause gekommen. Er hatte Maman den Kochlöffel aus der Hand genommen und die Arme um sie geschlungen. Dann hatte er gesagt: »Frankreich ist im Krieg mit den Deutschen.«
Nur mit Mühe hatte ihr Vater Maman an diesem Abend dazu bewegen können, sich zur Ruhe zu legen. Durch die geschlossene Tür des Elternschlafzimmers konnte Louise noch lange Mamans leises Schluchzen hören. Tagelang ging das so, bis Papa beschloss, in den Krieg zu ziehen. Bei seiner Soldatenehre hatte er ihnen geschworen, für seine Familie und für das Elsass zu kämpfen. Eigentlich hatte er keine Wahl gehabt, er meldete sich bloß freiwillig, bevor er ohnehin eingezogen worden wäre, aber das wusste Louise damals noch nicht.
Früher hatte Papa, mit ihr auf den Schultern und Vic an der Hand, häufig Sonntagsausflüge nach Paris in die Ménagerie du Jardin des Plantes gemacht. Sie lag am linken Seineufer im fünften Arrondissement und niemand musste Eintritt zahlen. Wegen der Forscher und reichen Unterstützer des Zoos gab es längst nicht nur einheimische Tiere zu sehen, sondern auch Elefanten, Bären, ein Affenhaus, Greifvögel und sogar ein nagelneues Reptiliengehege. Am liebsten aber war Louise die Fauverie, das Raubtierhaus. Davor saßen die Tiermaler, die versuchten, die Großkatzen auf ihre Leinwand zu bannen. Louise hätte die Löwen und Tiger Ewigkeiten anschauen können, so herrlich und kraftvoll waren diese wilden Tiere. Und doch wünschte sie sich nichts sehnlicher, als sie aus ihren Käfigen zu befreien. Niemand, schon gar nicht so mächtige und einzigartige Geschöpfe, sollte hinter Gittern sein Dasein fristen müssen. Doch auch wenn es sie betrübte, die Wildkatzen in den Käfigen zu sehen, waren es helle Sonntage. Sie waren bis zum Rand angefüllt mit Glück. Papa nahm Louise an solchen Tagen oft bei den Händen und drehte sich so rasch mit ihr im Kreis, dass sie beinahe meinte, zu fliegen. Für Papa waren Glück und Tanzen ein und dasselbe. Er erzählte oft davon, wie er als junger Mann in Paris gewesen war und es dort gelernt hatte. Mit einem wilden Tanz habe er Maman für sich gewonnen, aber das würde sie natürlich nie zugeben. Seine Töchter lehrte er gegen Mamans Widerstand den Chahut. Wie hoch er seine Beine warf! Das wollte Louise auch können. Kamen sie von ihren Ausflügen nach Hause und spielte gerade einer auf der Straße die Drehorgel, sprang und hüpfte Louise zur Musik, auch wenn längst Schlafenszeit war. Und Papa war immer der Erste, der ihr Beifall klatschte. »Sie hat doch wahrhaftig ein ganz ungeheures Talent, unsere Louise«, sagte er dann zu ihrer Mutter, die das in ihren Augen ungehörige Treiben mit gerunzelter Stirn verfolgte.
Mit Kriegsbeginn hörten die Sonntagsausflüge auf und statt fröhlicher Tänze erfüllte nun eine eigenartige Stille die Wohnung. Dagegen half es, sich an die Vergangenheit zu erinnern und das Lachen, das die Sommertage begleitet hatte, wieder heraufzubeschwören. Louise lachte viel und ohne Anlass und vor allem, weil es sonst niemand tat. Wenn Papa auf Heimaturlaub zu Hause war und niedergeschlagen oder müde wirkte, brachte sie ihn fast immer dazu, vom Sofa aufzustehen, sie an den Händen zu fassen und wie früher mit ihr umherzuwirbeln. Er selbst hatte ihr schließlich gezeigt, wie sich das Glück anfühlte, wie man es wieder heraufbeschwor und an sich band.
Auch jetzt lachte Louise, nahm ihrer Mutter energisch den Kochlöffel aus der Hand und schob sie sacht vom Herd weg.
»Maman, setz dich bitte. Ruh dich aus. Das Kochen übernehme ich.«
Ihre Mutter kam der Aufforderung nach und ließ sich dankbar auf einen Stuhl sinken. Sie wirkte ungewohnt heiter und lächelte. »Ma chérie, es gibt gute Neuigkeiten.«
Louise hörte nicht richtig zu, ihr Blick ruhte auf dem gepökelten Speck, den Maman in die Kohlsuppe gegeben hatte, und den Majoranstängeln, die neben den kleinen Kartoffelschnitzen im heißen Fett schwammen. Sie hatten nicht das Geld, um unter der Woche Majoran und Speck zu kaufen. Überrascht drehte sie sich um und sah ihre Mutter fragend an.
»Speck und Majoran? Woher hast du das?«
Maman antwortete nicht, sie suchte nach einem Zeichen der Zustimmung in Louises Blick, doch der blieb streng. Für heute und morgen war die Mahlzeit zwar gesichert, aber was käme danach? Schnell wandte sich Louise wieder zum Herd und rührte weiter, die Suppe durfte auf keinen Fall anbrennen.
»Stell dir vor«, sagte Maman, »ich habe heute auf dem Markt Rémi getroffen. Er ist Kutscher wie dein Onkel Pierre. Erinnerst du dich an ihn? Er hat dich früher manchmal mit seiner Kutsche mitgenommen. Rémi ist so ein großzügiger und feiner Mensch! Er hat doch tatsächlich unsere Einkäufe bezahlt und verlangt keinerlei Gegenleistung. Und dann hat er am Ende auch noch gefragt, ob du ihn am Samstag auf einen Ausflug begleiten möchtest. Er lädt dich zu einer Kutschfahrt ein!«
»Maman!« Der Löffel fiel Louise in die Suppe. Die heiße Flüssigkeit spritzte hoch, und ein paar Rübenstücke landeten auf dem Holzboden. Ihre Mutter erhob sich schwerfällig vom Stuhl und hielt sich dabei den Rücken. Sie kam auf Louise zu, wohl um sie zu beschwichtigen, wich aber zurück, als Louise abwehrend die Hand hob. »Wie konntest du nur? Was interessiert es mich, ob er denselben Beruf wie Onkel Pierre hat? Ich kenne ihn nicht. Und selbst wenn. Du tauschst mich gegen ein bisschen Speck und ein paar Kartoffeln?« Vor Wut stampfte Louise mit dem Fuß auf. Maman machte noch einen Schritt auf sie zu und übersah dabei die auf dem Boden liegenden Rübenstücke. Sie rutschte aus, strauchelte und fiel mit einem Aufschrei rücklings auf die Dielen. Louise war sofort bei ihr und kniete sich neben sie. »Oh Gott, Maman! Hast du dich verletzt? So sag doch was!«
Ihre Mutter winkte ab, bat aber um einen kühlen Waschlappen. Louise nahm ein Tuch von der Wäscheleine, tauchte es in den Wasserkübel, wrang es aus und brachte es ihr. So hockten sie eine Weile nebeneinander auf dem Boden und schwiegen. Erst als die Suppe überzukochen drohte, sprang Louise auf und eilte zum Topf, der auf dem neuen Sparherd vor sich hin köchelte. Betty hatte dafür gesorgt, dass sie einen dieser Herde mit Backofen und einer Klappe bekamen, die sich schließen ließ. Auf diese Weise konnten sie Kohle sparen. Betty war stets an erster Stelle, wenn Not am Mann war, aber niemals uneigennützig oder ohne Hintergedanken. Sie suhlte sich in der Anerkennung, die ihr wegen ihrer christlichen Hilfbereitschaft in Clichy zuteilwurde.
Maman stand ächzend auf und setzte sich wieder an den Tisch. Louise drehte sich zu ihr um. »Weißt du noch, was Vic einmal gesagt hat? ›Wir dürfen nicht nur buckeln und dienen, Papa hätte das nicht gewollt. Er hat uns das Tanzen und die Freude gelehrt.‹«
Maman ging nicht darauf ein. Sobald die Rede auf ihre Schwester kam, verstummte sie. Als hätte Maman nichts gehört, redete sie einfach weiter. »Dieses Haus, mein Schatz, braucht wieder einen Mann, so viel steht fest, und mich …«, sie rang sich ein heiseres Lachen ab, »… mich will keiner mehr. Rémi hat mir seine Absichten deutlich offengelegt. Er würde dich auf der Stelle ehelichen. Anscheinend bist du ihm aufgefallen, als du mich letztens auf den Markt begleitet hast.« Sie zwinkerte Louise zu.
Louise wurde blass. Dieser Rémi war bestimmt schon ein alter Mann. Und überhaupt hatte sie nicht vor, so bald zu heiraten. »Aber wir haben doch uns«, antwortete Louise rasch und umarmte Maman fest. »Wir haben uns, und wir haben diese vermaledeite Kohlsuppe.«
* * * * *
In der sternenklaren Weite der Nacht war Louise mit sich und ihren Gedanken allein.
Früher waren es die Streitereien zwischen ihrer Schwester und Maman gewesen, deren enormes Gewicht ihr, nachdem die beiden Dickköpfe längst eingeschlafen waren, schwer im Magen gelegen hatte. Die Last fiel immer erst von Louise ab, wenn sie aus dem Bett aufstand und in ihre Schuhe schlüpfte. Sie musste einfach raus ins Freie.
Auch als Vic nicht mehr nach Hause kam und statt dem Gezänk eine traurige Stille bei ihnen einzog, schlich sich Louise nachts vor die Tür. Die kühle Luft tat ihr gut und machte ihr schweres Herz leichter. Sie hatte Maman gefragt, weshalb ihre Schwester nicht wiederkäme, doch die antwortete nur knapp: »Vic hat ein anderes Leben gewählt.« Mehr war aus Maman nicht herauszubekommen.
Aber Louise wusste sehr wohl, wohin Vic gegangen war, der Klatsch und Tratsch im Viertel blieben ihr schließlich nicht verborgen, und ihre Schwester hatte es tatsächlich geschafft, eine Zeit lang das Gesprächsthema Nummer eins zu sein. Ein einziges Mal gelang es Louise, ihre Mutter zu provozieren. »Vielleicht hat Vic recht? Vielleicht stimmt es ja und ein Leben als Tänzerin im Montmartre ist viel besser als unsere Plackerei?« Normalerweise überging Maman Louises Fragen bloß, aber damals fing sie sich eine Ohrfeige ein, und seitdem hatten sie die stille Übereinkunft getroffen, nicht mehr über Vic zu sprechen.
Maman und sie hatten vorhin noch gemeinsam einen Teller Suppe gegessen, die meiste Zeit schweigend. Nach dem Essen war ihre Mutter müde geworden und hatte sich ins Bett gelegt, wo sie sofort eingeschlafen war. Louise hatte noch einen Moment gewartet, war dann in ihre Stiefel geschlüpft und hatte leise die Tür hinter sich ins Schloss gezogen.
Wie herrlich die Nachtigall ihr Lied trällerte. Nur ein leiser Wind pfiff durch die Pappeln, die die Straße säumten. Kein sich sorgender Blick lastete auf Louise, keine Vorsteherin bedrängte sie mit Fragen. Hast du schon die Schärpe von Mademoiselle Cunox gewaschen? Sei vorsichtig mit der Seidengaze und dem Atlasband. Hast du die Mantille schon auf den Trockenboden gebracht?
Ganz ins Gespräch vertieft gingen zwei junge Männer an ihr vorbei, nahmen aber keine Notiz von ihr. Vielleicht lag es daran, dass sie sich im Halbschatten verbarg oder dass schlicht keiner der beiden damit rechnete, im hiesigen Viertel eine junge Frau zu dieser Zeit auf der Straße anzutreffen.
»Wenn sich die Dunkelheit über die Vorstadt legt, erwacht das Reich der Durstigen zum Leben«, hatte die Vorsteherin Louise oft gewarnt. »Bist ja noch so jung, Kind. Aber ich sag’s dir jetzt und in aller Freundschaft, lass dich bloß nicht einlullen von einem dieser Ungehobelten, die hier in Clichy herumlungern und hübsche Mädchen wie dich in die Cafés und Tanzlokale am Montmartre einladen.« Die älteren Arbeiterinnen hatten über Bettys Worte nur gelacht und hinter vorgehaltener Hand von Bordellbetreibern, Schlägern und Huren getuschelt. Aber Louise hatte keine Angst. Sie war mit ihren sechzehn Jahren längst kein Kind mehr – und spätestens seit sie die fliegenden Akrobatinnen im Zirkus gesehen hatte, spürte sie den Sog, der von dieser anderen Welt ausging. Sie würde alles dafür geben, eines Tages Clichy und die Arbeiterwohnungen hinter sich zu lassen. Sie wollte im Rampenlicht stehen und Menschen Träume schenken, die sie beflügelten.
Zwar war Francine keine Artistin und sie dressierte auch keine Raubkatzen, aber wo sie auftauchte, zog sie die Blicke auf sich und schuf so ihre eigene Bühne. Sie scherte sich einen Dreck darum, was die Obrigkeit oder Menschen wie Betty von ihr dachten, und es kümmerte sie auch nicht, was die Leute über sie redeten. Sie tat, wonach ihr der Sinn stand und nahm sich, was sie begehrte – auch Aurélie, die Francine nie hätte begehren dürfen. Für sie zählte nur ihr Streben nach Glück. Wenn Louise nur ein bisschen wie sie werden könnte, böten sich ihr bestimmt bessere Zukunftsaussichten. Und wer sich verändern wollte, musste neue Erfahrungen sammeln, so viel stand fest.
Louise hatte ein paar Gesprächsfetzen der beiden jungen Männer aufgeschnappt, die aus unerfindlichen Gründen ihre Neugier geweckt hatten. So beschloss sie spontan, ihnen zu folgen, um die Unterhaltung weiter zu belauschen. Ihr würde schon nichts geschehen, wenn sie ihnen eine Weile nachging.
Die Herren debattierten angeregt. Offenbar fiel es ihnen nicht auf, dass Louise hinter ihnen herschlich.
Einer von ihnen war klein und untersetzt. Der andere, schlank und hochgewachsen, trug einen Vollbart und in der Hand hielt er einen Spazierstock. Seine warme Baritonstimme rutschte bei jedem Schritt, den er tat, ein wenig nach oben. »Weißt du, Thierry, was mir seit geraumer Zeit durch den Kopf geistert? Viel zu lange haben wir uns mit dem Lichteinfall befasst, weil wir beweisen wollten, dass Momente nur flüchtig sind und unsere Wahrnehmung alles, was wir sehen, kreiert. Dass es nichts gibt, nur das Flüchtige – und nun scheint mir auch das falsch.«
Thierry tat zwei Schritte und schnaufte von der Anstrengung, während sein Freund einen machte. »Ist dir deine Algerienreise etwa nicht bekommen? Erzähl doch, was hast du erlebt? Ich platze vor Neugier.«
»Es schließt sich doch nicht aus, dass sich Licht und Form beide verbinden. Der Tanz mit den Farben trotz erkennbarer Konturen. Es ist an der Zeit, mit den immer gleichen Erwartungen zu brechen, auch mit unseren eigenen.«
Louise presste die Lippen aufeinander. Von was sprach der Schlanke da? Und wo lag dieses Algerien? Es klang orientalisch, wie eine Stadt aus dem Märchen.
Thierry klopfte seinem Freund auf den Rücken. »Gehst du eigentlich absichtlich nicht auf meine Frage ein? Oder beschäftigt dich die Malerei tatsächlich auch mitten in der Nacht?«
Der Hochgewachsene schüttelte den Kopf. »Wie sollte sie mich nicht beschäftigen? Die Malerei und ich sind ohneeinander nichts.«
Der sanfte Nachtwind fuhr über Louises Wangen, streichelte ihre Arme und Beine. Nur vereinzelt beleuchteten Gaslaternen den Weg. In flottem Tempo bogen alle drei um Häuserecken, passierten den Park, der ihr – ganz anders als bei Tage – aus der Finsternis still und unheimlich entgegensah, ein breiter und mächtiger Schatten. Dann wand sich der Weg noch zweimal links- und einmal rechtsherum, und schließlich kamen sie in einer abgelegenen, aber gepflasterten Straße an, die von der Gasglühbeleuchtung einer Brasserie erhellt wurde. Hier war Louise noch nie gewesen.
Die Schritte der beiden Männer verlangsamten sich und Streichhölzer glimmten auf, als sie ihre Zigaretten anzündeten. Sie flanierten vorbei an bunt geschmückten Frauen in Unterröcken und Miedern, die Lippen und Wangen rot bemalt. Die Dirnen lehnten schwatzend an den Häuserwänden und warfen den Vorbeischlendernden aufreizende Blicke zu. Eine trug das rot gelockte Haar hochgesteckt, über dem tiefen Ausschnitt einer anderen baumelte eine Kette mit einem schwarzen Kreuz. Dazu klimperten bei jeder ihrer Bewegungen Münzen in einem grünen Samtbeutel. Der Nächsten quollen die Brüste aus einem viel zu eng geschnürten Mieder hervor. Louises Knie fühlten sich merkwürdig weich an. Ihr Puls raste, und sie hielt den Atem an.
»Was glotzt du denn so?« Die Rothaarige hatte Louise entdeckt, und nun drehten sich auch die beiden Herren zu ihr um.
»Biste neu hier?«, fragte die mit dem großen Busen. »Wer schickt dich?«
Die Gespräche der Frauen waren verstummt. Einige taten es der Rothaarigen gleich, lösten sich aus der Reihe und kamen auf sie zu. Nach und nach bildeten sie einen dichten Halbkreis um sie.
»Sag schon. Hier ist nicht jede willkommen, hörste? Jeder ihr Gebiet, das ist Gesetz, und wehe du verpfeifst uns.«
»Ich, ich meine, das verhält sich alles ganz anders, als es jetzt scheint,« sagte Louise zaghaft.
»Soso«, die Rothaarige kicherte höhnisch. »Das sagen sie doch alle, nur nicht jede tut so fürnehm. Willste uns vergackeiern?«
Die Stimmen wurden immer lauter und aggressiver. Louise, die nicht erkennen konnte, wer von den Frauen gerade sprach, sah ängstlich zu Boden. Am liebsten hätte sie sich unsichtbar gemacht.
»Ham wir gern, so junge Dinger, keine sechzehn, habe ich recht? Nu antworte, oder ich schlag dir ein Veilchen!«
»Aber, aber, meine Damen, so beruhigen Sie sich doch.« Es war eine sanfte Männerstimme, die die aufgeregten Gemüter zu beschwichtigen versuchte.
Louise blickte auf. Die Frauen wichen etwas zurück, um einem Mann Platz zu machen, der ihr nun seine Hand anbot. Er trug ein Jackett mit einer doppelten Knopfreihe, dazu halbhohe Schnürstiefel, und in der Hand hielt er ein offenbar prall gefülltes Portemonnaie.
»Niemandem soll wegen der jungen Dame irgendeine Unannehmlichkeit entstehen. Ganz im Gegenteil, ich lade Sie alle ein, gemeinsam mit uns diese sternenklare Nacht zu feiern.« Zu Louise gewandt flüsterte er: »Nun spielen Sie schon mit und reichen Sie mir Ihre Hand.«
Louise zögerte einen Augenblick, doch etwas an dem Fremden ließ sie Zutrauen fassen. Vielleicht lag es an seinem Blick. Der Mann betrachtete sie nicht anrüchig, sondern wohlwollend. Louise ergriff wortlos seine Hand.
»Na, wenn das so ist«, sagte die Rothaarige. »Mes puces, folgen wir Augustes Einladung. Lasst uns feiern.« Sie zwängte sich zwischen Louise und den Mann, zwinkerte ihm zu und hakte sich dann bei ihnen unter. Ein wenig zog sie sie zur Seite und raunte: »Was Auguste schätzt, werde ich nicht mit Füßen treten, Täubchen. Aber lass bloß die Finger von ihm. Man nennt mich übrigens Belle.«
Louise erwiderte nichts. Verwundert über die unerwartete Wendung des Abends folgte sie mit klopfendem Herzen dem sich in Bewegung setzenden Grüppchen in Richtung der erleuchteten Brasserie am Ende der Straße. Der Kellner schien die Herren und ihr weibliches Gefolge zu kennen. Er nickte ihnen zu und winkte seinem Kollegen, der ihm unverzüglich half, die kleinen Bistrotische aneinanderzurücken und die Kerzen auf den Tischen zu entzünden. Beide trugen lange weiße Schürzen, Handschuhe und schwarze Westen. Jeder Handgriff saß, sie arbeiteten geschwind, aber gleichzeitig unauffällig. Louise gefiel es, so umsorgt zu werden und Teil dieser kleinen Gesellschaft zu sein. Auch wenn sie sich vor Belle, die das Sagen zu haben schien, ein wenig fürchtete.
Der Fremde, der Louise soeben aus der misslichen Lage gerettet hatte, kam auf sie zu und lüpfte seinen Hut. »Mademoiselle, darf ich mich Ihnen vorstellen. Ich bin Auguste Renoir, Porzellanmaler und Künstler. Und Sie sind?«
»Louise Weber – Wäscherin wider Willen.«
Auguste lachte und setzte sich an den Tisch. Louise straffte die Schultern und atmete tief ein. So forsch, wie sie gerade getan hatte, fühlte sie sich nicht. Im Gegenteil, ihr klopfte das Herz immer noch bis zum Hals. Belle setzte sich galant auf Augustes Schoß, wie um ihren Besitzanspruch klarzustellen. Louise ließ sich neben Auguste auf einem der geflochtenen Korbstühle nieder. Die anderen verteilten sich um die beiden Herren herum.
Männliche Servierkräfte in Hemd und Frack rollten auf Anweisung des Oberkellners zwei Beistelltische mit Kübeln darauf herbei, in denen jeweils eine Flasche Champagner auf Eis ruhte. Auf Silberplatten wurden verschiedene Sorten Käse gereicht. Manche davon kannte Louise vom Markt. Maman kaufte sie nie, sie waren zu teuer.
»Ein Camembert de Normandie«, sagte der Kellner, und deutete auf einen weiß ummantelten Laib, »daneben ein Brie de Meaux, sehr mild und cremig auf der Zunge. Und in direkter Nachbarschaft der Brie de Melun, kräftiger und stärker gesalzen. Den Hartkäse haben wir für die Herrschaften bereits gewürfelt.« Er zeigte auf die andere Platte, sprach von einem Beaufort AOP, dem König der Gruyère, einem Tomme d’Abondance aus der Haute-Savoie, den Bleus mit ihrem herrlich würzigen Schimmel, den Roqueforts. Neben dem würzigen Käseduft stiegen Louise weitere Gerüche in die Nase – frisch gebackenes Brot, schwarze Oliven und tiefroter Wein wurden aufgetischt.
Gläser wurden gefüllt und geleert, die Frauen lachten. Sie griffen nach den Leckereien, ließen es sich schmecken, streichelten über Arme und Oberschenkel der beiden Männer und mit ihren von Brotkrümeln verklebten Mündern küssten sie deren Wangen. Louise rieb sich den Nacken und biss sich leicht in die Innenseite der Wange. Das tat sie immer, wenn sie nervös war. Sie bewunderte die Raffinesse, mit der die Frauen die Männer umwarben, lauschte ihren lockenden Stimmen und verfolgte aufmerksam ihre wohldosierten Gesten. Das beiläufige Streicheln einer Wange, der auf eine Stirn gehauchte Kuss, die Traube, die sie mit dem Herrn ihres Herzens teilten. Sosehr Louise bewunderte, wie gut die Frauen die Kunst des Werbens beherrschten, sosehr schauderte sie deren Berechnung. Und doch, eines faszinierte Louise: Die Frauen hatten zwar eine Rolle zu spielen, aber wie sie diese ausfüllten, war offenbar ganz ihnen überlassen. Jede hatte ihren eigenen Stil. Belle machte auf zuckersüß bei den Herren, ließ sich dabei aber niemals die Butter vom Brot nehmen. Sie klimperte mit ihren langen Wimpern und schraubte ihre Stimme mindestens eine Tonlage höher, als sie von Natur aus war, sobald sie mit Auguste sprach. Die Frau, die auf Thierrys Schoß saß, gab sich unbeeindruckt von ihm und emotional unnahbar, schaukelte aber auf seinem Knie, und eine Dritte schnalzte ständig mit der Zunge, lachte andauernd viel zu laut und hauchte oder sang ihre Worte mehr, als dass sie sie sprach.
Louise nippte an ihrem Glas. Das erste Mal in ihrem Leben trank sie Champagner. Und als der seine Wirkung entfaltete, traute sie sich endlich und schob sich ein Stück Brie in den Mund. Wie der Käse auf der Zunge schmolz und wie der Perlwein im Mund prickelte! Sie schloss die Augen, um diesen Geschmack ganz in sich aufzunehmen. Als sie sie wieder öffnete, bemerkte Louise, dass Auguste sie beobachtete. Nichts Lüsternes lag in seinem Blick, vielmehr Neugierde.
»Sie sind zum ersten Mal hier, habe ich recht?«, fragte er.
Louise nickte. Ihre Wangen wurden mit einem Mal warm, und sie senkte den Blick, als hätte man sie bei einer Lüge ertappt. Für diese Nacht hatte sie keinen anderen Plan parat, außer dass sie die Chance, die sich ihr bot, nutzen wollte. Nur einmal den Geschmack eines anderen möglichen Lebens kosten – im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war gründlich schiefgegangen. Auguste hatte sofort gemerkt, dass sie nicht dazugehörte.
Louise erhob sich, um zu gehen, doch er griff nach ihrer Hand.
»Nicht doch, bitte bleiben Sie. So habe ich das doch nicht gemeint. Ich bin nur von Natur aus neugierig, und Sie wecken aus einem Grund mein Interesse, den ich selbst noch nicht kenne.« Er lachte.
Louise ließ sich wieder auf den Stuhl sinken. Sie verstand nicht recht, was dieser Auguste da redete.
Der sah sich offenbar zu weiteren Erklärungen genötigt. »In Ihnen glüht etwas, ich weiß noch nicht, was es ist, aber es zeichnet Sie aus. Nicht, dass ich das Bett mit Ihnen teilen will, es gibt andere Mädchen, die sind dafür wie gemacht. Aber Ihre Ausstrahlung ist einfach außergewöhnlich. Sie haben etwas Besonderes an sich, das ich gern näher ergründen würde. Als Maler habe ich dafür einen Blick. Bestimmt haben Sie ein verborgenes Talent.« Prüfend sah er sie an. Dann zog er ein Zigarettenetui aus der Tasche seines Jacketts und öffnete es. Als er Louise eine anbot und diese ablehnte, nahm er sich selbst eine und zündete sie an.
»In den Arbeiterwohnungen in Clichy entfaltet man kein Talent, selbst, wenn man eines hätte.«
Er schwieg eine Weile. Dann sagte er: »Ich war einmal wie Sie.« Er nahm einen tiefen Zug. »Meine Eltern gehörten der Arbeiterklasse an. Nur meine Begabung ermöglichte mir das Studium der Malerei bei Charles Gleyre. Für solche von höherem Stand hätte ein Talent womöglich nicht viel bedeutet, für mich war es die Eintrittskarte in eine neue Welt. Mein Traum war es, Maler zu werden. Wonach verlangt es Sie?«
»Ich weiß nicht, was ich kann, aber ich will jedenfalls keine Wäscherin sein, auch wenn Maman und ich unser klägliches Dasein damit fristen. Ich sehne mich so sehr nach einem anderen Leben. Vielleicht bin ich Ihnen deshalb gefolgt.«
In ihrem Inneren ballte sich ein Gewitter zusammen. Auguste hatte sich selbst befreit, er hatte getan, wovon sie nur träumte. Wie sie stammte er offenbar aus einem Milieu, in dem man kein Glück fand. Wenn es ihm ähnlich wie ihr ergangen war, dann waren es nicht allein die Armut oder die harte körperliche Arbeit, die ihn geschreckt hatten, sondern dass immerfort andere über ihn bestimmt hatten. Wer leben wollte, was er wirklich war, musste einen Ort in der Welt finden, wo er sich nicht erklären musste, wo Ausreden nichts galten und ein Herz zum anderen sprach.
Auguste lehnte sich zurück und sah hinauf in den Nachthimmel. Louise folgte seinem Blick. Ein so voller Mond stand am Firmament und über ihr spannte sich das Sternenzelt.
»Manche dieser Lichter sind längst erloschen, Louise. Wir sitzen hier andächtig und bewundern das Untergegangene. So sind wir Menschen, voller Sehnsucht nach dem Unerreichbaren.«
»Die Sehnsucht«, entgegnete sie leise, »hält zumindest mich am Leben. Wenn ich nur ein bisschen wäre wie einer dieser Sterne, dann wäre mein Leben nicht verschwendet.«
Belle, die den Platz gewechselt hatte und auf den Beinen von Augustes gedrungenem Begleiter Thierry schaukelte, hob zu einem Lied an, das Louise bekannt vorkam, aber sie erinnerte sich nicht, wo sie es schon einmal gehört hatte.
Auguste erhob das Glas zum Toast. »Auf das große Leben, das in uns allen schlummert«, sagte er feierlich, »möge es zum Vulkan werden und die Erde überziehen, möge es Niedergang bedeuten und Aufstieg dieses neuen Jahrhunderts. Wir sind die Kinder an seiner Brust, wir sind seine Boten. Lasst uns Untergang und Neubeginn feiern, solange es uns eben möglich ist. Verschwenden wir keine Zeit, denn diese ist die unsrige.«
Von der Wirkung des Alkohols mutig geworden, stand Louise spontan auf und klatschte Beifall. Sie hatte nur eine vage Ahnung, wovon Auguste eben gesprochen hatte, aber es klang so schön feierlich in ihr nach. Belle jauchzte und Augustes Begleiter beugte sich zu der Frau neben ihm und versank mit ihr in einem tiefen Kuss. Louise griff nach den Trauben und einem großen Stück Brie. Sie schenkte sich selbst Wein nach, der ihr ein federleichtes Gefühl gab, und lauschte den angeregten Gesprächen. Schweigend saß sie da, und nahm doch alles um sich herum intensiv wahr. Wie Belle ihr Glas umklammerte, als habe sie Angst, dass es ihr jemand wieder wegnähme. Wie die Kellner sich zurückzogen und darauf warteten, dass die Gesellschaft zu einem Ende fände. Wie einer der Ober den Kopf auf den Tisch legte. Wie ihre Finger klebrig wurden von der Süße der Trauben und dem Fett des Käses.
Auguste wandte sich wieder an sie. »Möchten Sie uns am Samstagabend begleiten? Ein Freund von mir wird Belle fotografieren, wie Gott sie schuf. Vielleicht ergeben sich auch Möglichkeiten für Sie?«
Was meinte er mit Möglichkeiten? Hatte er sie gerade dazu aufgefordert, sich vor einem Fotografen zu entblößen?





























