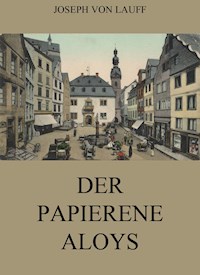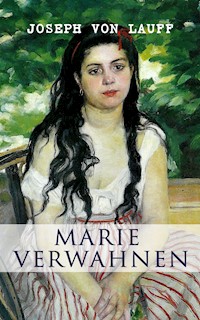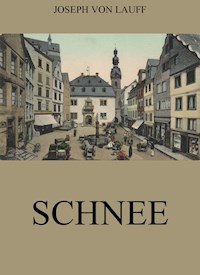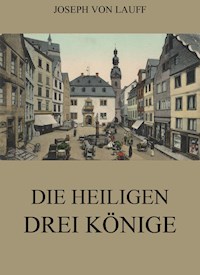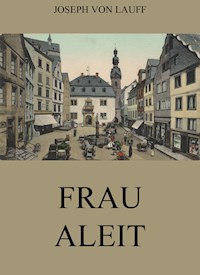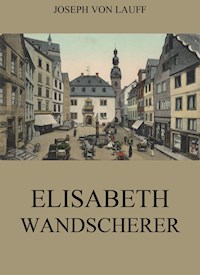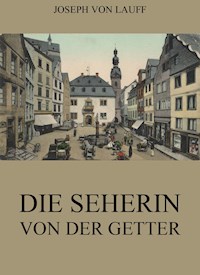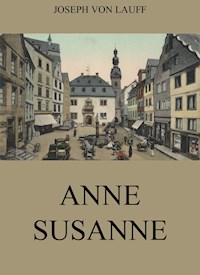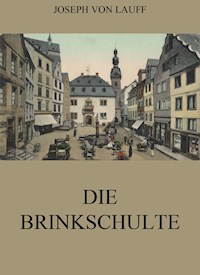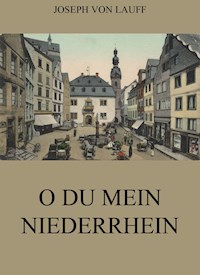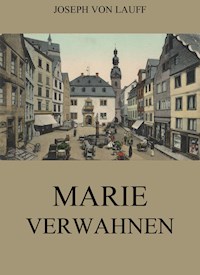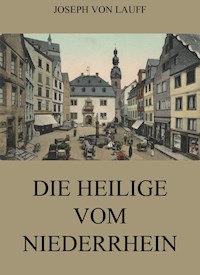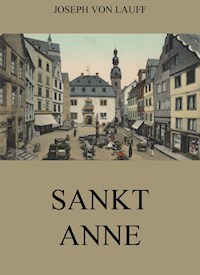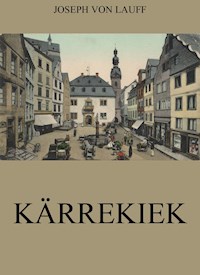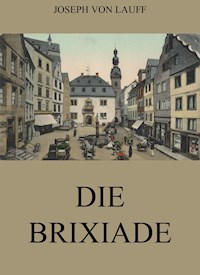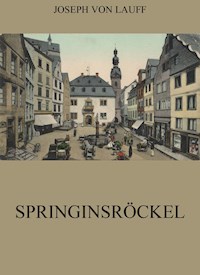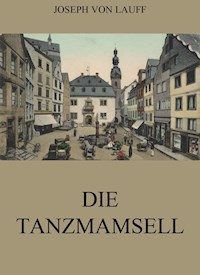
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman vom Niederrhein. Joseph von Lauff war ein deutscher Offizier und Schriftsteller, der 1933 in Cochem verstarb. Lauffs umfangreiches literarisches Werk besteht vorwiegend aus Romanen, Erzählungen und Theaterstücken. In seinen Prosawerken behandelt er meist Themen aus seiner niederrheinischen Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Tanzmamsell
Joseph von Lauff
Inhalt:
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Die Tanzmamsell
I Miekske Pollmann
II Muß i denn, muß i denn ...
III Die Frau Rektern
IV Wandervögel
V Joseph von Arimathia schüttelt sein Bäumchen
VI Was die Göttin der Gerechtigkeit nicht alles zustande bringt!
VII Die Bratäpfel quietschen
VIII Hüben und drüben
IX Nonnenhannes
X Der Boden wankt
XI Alter Sünder!
XII Intermezzo
XIII Der Schlußball
XIV Die Sterbeglocke
XV Arme Seelen
XVI Stoßt an! Herr Sauerbier lebe! Hurra hoch!
XVII Der Kerl im blauen Kittel kommt wieder
XVIII Gewalt
XIX Im Namen des Königs
XX Es mußte so kommen
XXI Ich war es ...
XXII Und dann?
XXIII Entweder du oder ich
XXIV Ostern
Die Tanzmamsell, J. von Lauff
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638858
www.jazzybee-verlag.de
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Dichter, geb. 16. Nov. 1855 in Köln als Sohn eines Juristen, besuchte die Schule in Kalkar und Münster, wo er das Abiturientenexamen bestand, trat 1877 als Artillerist in die Armee ein, wurde 1878 zum Leutnant, 1890 zum Hauptmann befördert und wirkte, einer persönlichen Aufforderung des Kaisers folgend, 1898–1903 als Dramaturg am königlichen Theater in Wiesbaden, wo er noch jetzt lebt; gleichzeitig wurde ihm der Charakter eines Majors verliehen. L. begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit den epischen Dichtungen: »Jan van Calker, ein Malerlied vom Niederrhein« (Köln 1887, 3. Aufl. 1892) und »Der Helfensteiner, ein Sang aus dem Bauernkriege« (das. 1889, 3. Aufl. 1896), denen später folgten: »Die Overstolzin« (das. 1891, 5. Aufl. 1900); »Klaus Störtebecker«, ein Norderlied (das. 1893, 3. Aufl. 1895), »Herodias« (illustriert von O. Eckmann, das. 1897, 2. Aufl. 1898), »Advent«, drei Weihnachtsgeschichten (das. 1898, 4. Aufl. 1901), »Die Geißlerin«, epische Dichtung (das. 1900, 4. Aufl. 1902); er schrieb fernerhin die Romane: »Die Hexe«, eine Regensburger Geschichte (das. 1892, 6. Aufl. 1900), »Regina coeli. Eine Geschichte aus dem Abfall der Niederlande« (das. 1894, 2 Bde.; 7. Aufl. 1904), »Die Hauptmannsfrau«, ein Totentanz (das. 1895, 8. Aufl. 1903), »Der Mönch von Sankt Sebald«, eine Nürnberger Geschichte aus der Reformationszeit (das. 1896, 5. Aufl. 1899), »Im Rosenhag«, eine Stadtgeschichte aus dem alten Köln (das. 1898, 4. Aufl. 1899), »Kärrekiek« (das. 1902, 8. Aufl. 1903), »Marie Verwahnen« (das., 1.–6. Aufl. 1903), »Pittje Pittjewitt« (Berl. 1903) sowie die Lieder »Lauf ins Land« (Köln 1897, 4. Aufl. 1902). Als Dramatiker trat er zuerst hervor mit dem Trauerspiel »Inez de Castro« (Köln 1894, 3. Aufl. 1895). Von einer Hohenzollern-Tetralogie sind bisher erschienen und wiederholt ausgeführt »Der Burggraf« (Köln 1897, 6. Aufl. 1900) und »Der Eisenzahn« (das. 1899); ihnen sollen »Der Große Kurfürst« und »Friedrich der Große« folgen. Lauffs neueste Dramen sind das Nachtstück »Rüschhaus«, das vaterländische Spiel »Vorwärts« (beide das. 1900) und das nach dem Roman »Kärrekiek« verfaßte Trauerspiel »Der Heerohme« (das. 1902, 2. Aufl. 1903). Während L. in seinen Romanen echtes Volksleben des Niederrheins poetisch festhält und in seinen epischen und lyrischen Dichtungen trotz wortreicher Diktion ein starkes Talent verrät, greift er in seinen Dramen, namentlich in den höfisch beeinflußten Hohenzollern-Stücken, oft zu unkünstlerischen Mitteln und erweckte entschiedenen Widerspruch. Vgl. A. Schroeter, Joseph L., ein literarisches Zeitbild (Wiesbad. 1899); B. Sturm, Joseph L. (Wien 1903).
Die Tanzmamsell
I Miekske Pollmann
Kommet alle, reicht mir die Hände und geht mit mir! – ich führe euch in das niederrheinische Land, wohin ich euch so oft geleitet, denn immer und immer wieder muß ich selber in den stillen Erdenwinkel hineinsehn, wo etwas liegt, von dem ich nicht sagen kann, warum es so schön ist, und wo mir immer das Herz schlägt, wie es mir immer geschlagen, als ich noch ein kleiner Junge war, die Schneeflocken leise, ganz leise niederspielten, etwas Geheimnisvolles über die weiche, weiße Spreite ging, und Miekske Pollmann mir von Sankt Nikolas und der kommenden Weihnacht erzählte. Und wenn es dann Sommer wurde, und der warme Blust über die Roggen- und Weizenschläge dahinrauchte ... Und die Mühlen gingen, und die Wasser lagen dann so ruhig in den kreisrunden Kolken, als wäre es Feiertag, und über Dämme und Wiesen wiegte sich die niederrheinische Stille, so still, so unendlich still ... Und aus der Stille wuchsen die niederrheinischen Menschen heraus, die Menschen mit ihrem verschlossenen Wesen und ihrem kantigen Ausdruck in den harten Gesichtern ... Und wenn ich dann in diese harten Gesichter hineinsah, dann sah ich auch bis auf den Grund ihrer Seele, und dann fand ich, daß ihre Seelen anders waren, als die Seelen anderer Menschen. Und dann stand ich und blickte hinein in den Sommertag und hörte die Stille und sah den weichen Rauch, der über die Roggen- und Weizenfelder dahinging. –
Auch heute ist so ein Sommertag; drum kommet alle, reicht mir die Hände und geht mit mir. – Ich führe euch wieder in das Land meiner Jugend.
#####
Um die Spätnachmittagsstunde ging ein merkwürdiger, fast seltsamer Mann durch die Straßen der kleinen niederrheinischen Stadt hin. Er ging eigentlich nicht, wiewackte und latschte vielmehr und hatte beide Hände in den schlotterigen Hosen vergraben. Um den Hals trug er ein schwarzes Tuch, dessen Enden in langen Zipfeln herabhingen, hatte einen blauleinenen Kittel an und eine klebrige Schirmmütze bis tief in den Nacken gezogen. Eine kurzstielige Kalkpfeife brannte im linken Mundwinkel; unter ihm lief das charakteristische Geklapper von blankgescheuerten Holzschuhen. Der hohläugige Kopf war ihm bis auf den leinenen Kittel gesunken. Der Kleidung nach sah er aus wie ein Mensch aus hiesiger Gegend. Aber niemand hatte ihn bis jetzt von Angesicht zu Angesicht gesehn, obgleich er kein landfremder Mann war und immer dort erschien, wo es Trauer und verweinte Augen absetzte. Nur Pitt Hoffmann, der Leichenbitter, der am Hauptmarkt neben der katholischen Pfarrkirche wohnte, kannte ihn näher, denn er war hellsichtig veranlagt und sah daher mehr als die anderen gewöhnlichen Leute. Und wenn er ihn sah, dann kribbelte ihm der Duft nach Firnis und Hobelspänen in die Nase hinein; dann wußte er, daß sein Geschäft blühen und der Totengräber zu tun haben würde. Und dann ging er hin und begoß diese Erkenntnis mit einem doppelt gebrannten Wacholder, denn alles mußte doch im Leben seinen regelrechten Abschluß bekommen.
Auch heute stand Pitt Hoffmann in seiner Wohnung am Fenster.
Da ging der stille Mann im blauen Kittel und mit brennender Kalkpfeife vorüber.
Pitt Hoffmann kannte ihn wieder, drehte sich um, öffnete das Eckschab und genehmigte sich einen kräftigen Wacholder.
»Auf daß das Geschäft blühe,« sagte Pitt Hoffmann, schnalzte mit der Zunge und begab sich wieder ans Fenster.
Der Unbekannte war inzwischen weitergegangen, hatte die katholische Kirche passiert und war auf den stillen Marktplatz getreten. Hier sah er sich um. Er stand scheinbar in Überlegung, was er beginnen solle. Jetzt hatte er gefunden, was er suchte. Er ging ruhig auf die Posthalterei los. Dort angekommen, zog er die rechte Hand aus der Hosentasche und klopfte etliche Male gegen die Tür.
Aber niemand öffnete ihm.
Da trat er an das ihm zunächst gelegene Fenster, hob sich in den Holzschuhen und sah über die gehäkelten Vorsetzer in die Stube hinein.
Es war ein eigentümlicher Blick, mit dem er hineinsah. Der Blick dauerte lange, schien aber nicht mit sich ins reine zu kommen. Da drehte sich die Gestalt im blauen Kittel herum, fast unwirsch und eckig, klapperte die Fliesen herab und trat wieder in das nahgelegene Kirchengäßchen zurück. Hier blieb er stehen. Mit stumpfen Augen sah er über den weltvergessenen Markt fort, ließ aber die Posthalterei nicht außer Acht, denn er wußte genau, was er dort suchte.
Auch Pitt Hoffmann wußte es. –
Mit dem königlichen Posthalter Naatje Ingelaat stand es hundsmiserabel, und seine Pflegetochter Luise, das Kind eines frühverstorbenen weitläufigen Vetters, ging mit rotgeweinten Augen herum und erwartete stündlich das Ableben des Hochbetagten, der sich aber sturköpfig weigerte, mit Spaten und Erde Bekanntschaft zu machen, und von seiner einträglichen Posthalterei und den dreißigtausend Talern, die er sich im Laufe der Jahre erspart hatte, nicht fort wollte. Aber es half ihm alles nichts. Der kurzbeinige Doktor Horré hatte schon recht, wenn er sagte: »Nu geht's bald mit Ignaz kopfüber. Hü, all meine Pferde! Er riecht nach dem Spaten.«
Während nun der arme Naatje Ingelaat mit gefalteten Händen und in seiner Zipfelmütze auf dem Sterbebett lag und auf verlorene Posthornklänge zu hören schien, die fahrig wie zerrissene Bänder und Papierschnipfel durch die Luft flatterten, saß Miekske Pollmann vor ihrer Haustür, strich mit gichtischen Händen über ihr Kattunkleid und beobachtete mit viven Augen die wenigen Leute, die vorübergingen. Ab und zu mußte sie niesen, denn die Sonne stand schon tief und kitzelte mit seinen Strahlenfäden, die über die Dachschräge des gegenüberliegenden Hauses fielen, gerade in ihre Nase hinein. Nun kam es ihr wieder an. Sie mußte zum drittenmal niesen. Das tat denn auch Miekske – und das sah komisch aus, denn sie war von jeher 'ne drollige Person und ein apartes Weibsbild gewesen. Was nun das Aparte anbetraf, so hatte es damit diese Bewandtnis. – Klargeistig, glaubenskräftig – das war sie, und zwei Augen hatte sie im Kopf, die so sammetweich schienen wie die Mysterien der katholischen Kirche; ihre Seele war heiter und ihr Geist übermütig wie 'n Böckchen, das auf einer saftigen Wiese herumkapriolte, aber mit dieser Lustseligkeit harmonierte nicht das Armselige ihres gebrechlichen Körpers. Das war eben das Aparte an Miekske. Ihr klarer, kluger, strenggläubiger Kopf saß ihr tief zwischen den Schultern, die Füße wollten nicht, und die Hände taten immer so, als wenn sie irgend etwas gepackt hielten, und dann wieder so, als müßten sie irgendein Ding, das gar nicht da war, hastig ergreifen. Und das machte die Gicht, die sich schon frühzeitig an sie geschlichen, wie die Flechte Borke und Bast anschleicht, sich festsetzt und das Leben verkümmert – elend verkümmert. Allein ihr Geist besiegte die infame Misere und machte sie fähig, einer Nähschule vorzustehen und ihre sogenannte ›Malör-Penning-Kasse‹ ins Dasein zu rufen – und das war wiederum etwas ganz Apartes im Leben von Miekske Pollmann gewesen. Die ›Malör-Penning-Kasse‹ war ihre ureigenste Erfindung. Sie stand immer auf dem Tisch, wenn die zwölf- und dreizehnjährigen Mädchen in der Hinteren Stube saßen und mit Zwirn und Nadel hantierten. Und wenn dann so ein blutjunges Dingelchen sich aus einem xbeliebigen Grunde mausig machte, schwatzte oder ihm sonst ein Malörchen passierte, dann knöchelte Miekske mit ihren gichtischen Fingern auf dem Nähtisch herum und fragte: »Wer war das?«
»Iche!«
»Adele Knipp, du hast dir hören lassen.Strafe: twee Penning in de ›Malör-Penning-Kasse‹.
Und dann klimperte das kupferne Geldstück in die aufgestellte Blechbüchse hinein, zu den anderen Pfennigen, die ihre Anwesenheit bereits früheren Beschlüssen verdankten. So ging es Tag für Tag und Woche für Woche, und wenn es dann Sommer wurde, die Chausseebäumchen mehlstaubig aussahen und die Äpfel schon rote Backen bekamen, dann wurde die Kasse ausgeschüttet und lustig verjubelt. Ein kleiner Korbwagen kam an, Miekske ließ sich verfrachten, die knirpsigen Mädchen spannten sich vor, und dann ging es hinaus, um da draußen in den Büschen und Alleen von Moyland die aufgespeicherten Pfennige in Stippmilch, Korinthenbrötchen und Spekulatiusmännchen umzusetzen. Das dauerte so lange, bis alles vertan war, Miekske sich aus ihrer Privatschatulle noch drei süße Schnäpschen genehmigt hatte, und die Kinder dann sangen:
»Miekske sall läwe, Ne ›Malör-Kass'‹ dornäwe – Hoch, hoch, hoch!«
die ganze Gesellschaft sich wieder vorspannte und das armselige Frauenzimmerchen nach Hause kutschierte. Hierauf ging's von neuem los: Nähschule, kleine Gesetzwidrigkeiten und scharfe Dekrete – den lieben, langen Winter hindurch, das Frühjahr hindurch, bis es wieder Sommer wurde, die Äpfel rote Backen bekamen und die ›Malör-Penning- Kasse‹ wiederum ihrem Schicksal verfiel und verjubelt wurde.
»Miekske sall läwe ...!«
Ja – Miekske Pollmann war von jeher ein kurioses und apartes Frauenzimmer gewesen! Sie war so apart und kurios wie ihr Bruder, der bislang ein vagabundierendes Leben geführt hatte, jetzt in Rom herumlungerte, in sich gegangen war und auf eine Rentmeisterstelle wartete, die er durch Vermittelung seiner strenggläubigen Schwester und auf die Fürsprache der hiesigen Kleriker hin beim Baron Steengracht in Moyland zu erlangen hoffte. Miekskes Bruder war schon alles und jedes gewesen: Weinreisender, Kommis in der Manufakturwarenbranche, Kassierer bei einer reisenden Zirkusgesellschaft, dann Zuave in päpstlichen Diensten, eine Stellung, die er sicherlich noch bis auf den heutigen Tag innegehabt hätte, wäre nicht die politische Machtstellung des Pontifikats frühzeitig in die Brüche gegangen. Nichts war dem armen Karlo Antonio Pollmann geblieben, als lediglich das Bewußtsein, ein hübscher Kerl zu sein, dem Papst gedient zu haben, sich bei festlichen Gelegenheiten in die Zuavenmontierung werfen und auf eine Rentmeisterstellung in seiner engeren Heimat hoffen zu können – alles! – aber den ›Karlo Antonio‹ ließ er auf seinen Visitenkarten nicht schießen, und noch eins nicht: sein unbändiges Glück bei den Weibern. Das hielt er fest, das verhätschelte er wie ein unerzogenes Kind, denn es war eine Macht- und Lebensfrage für ihn, eine Ankerstelle in seiner desolaten Verfassung. Und wie Miekske auch schreiben mochte, ermahnen mochte, letzteres Glück über Bord zu werfen – Karlo Antonio antwortete stets in der nämlichen Weise: »Das ist nun einmal mein Gusto; habe keine Bange deswegen, aber tue du man ein übriges und besorge mir die Rentmeisterstelle in Moyland.« Und dann war sie auch wieder zufrieden, ließ Gottes Wasser über Gottes Land laufen und freute sich, einen Bruder zu haben, der in Sachen der Kirche die hechtgraue Zuavenjacke und das hechtgraue Käppi getragen und vor dem großen Sankt Peter geschildert hatte und noch immer einen bildsauberen Kerl abgab; denn wenn sie ihren eigenen Körper beguckte, dann allerdings mußte sie sagen, daß es für sie ein leichtes sei, sich die Mannsmenschen vom Leibe zu halten – wohingegen ihr Bruder ... An jedem Finger hing ihm so ein üppiges Frauenzimmer; aber das tat, weil er so ein appetitlicher Mensch war und die Gier der Weibsbilder aufreizen konnte.
»Allesamt Sünder!« meinte die Inhaberin der ›Malör-Penning-Kasse‹ zog ihr vives Köpfchen noch tiefer zwischen die hohen Schultern und machte dabei mit ihren gichtischen Händen etliche Bewegungen, als sei sie gewillt, Fliegen von ihrer bunten Schürze zu fangen – und saß doch tief in Gedanken, denn sie dachte an ihren einzigen Bruder, den schönen Tedesco, an das, was um sie vorging, wes sie täglich sehen mußte und hören mußte, an den Notstand der Kirche, der sich stündlich verschlimmerte und geeignet schien, die schwersten Bedenken in den Köpfen der denkenden, christkatholischen Menschen rege zu machen. Was wollten überhaupt die preußischen Landräte und die Kerle, die noch höher saßen in ihren fetten Ämtern? Anno 71 hatte die verfluchte Geschichte angefangen, und seitdem waren über drei Jahre vergangen. Aber statt besser zu werden – immer tiefer ging es mit den kirchlichen Rechten bergab; Knebel wurden angesetzt, Bischöfe in die Wicken gejagt, und wenn das so anhielt, wenn das weiter so ginge, was sollte dann überhaupt kommen und werden? – Die heilige Kirche und die Herren Kapläne kamen ja nicht aus ihrer Not heraus, und wer sollte dann Kindtaufe halten, die Wegzehrung austeilen und die heilige Firmelung geben? – Die ganze Geschichte war durchsichtig wie 'n Küchensieb. Das Recht wurde zu einer Unrechtssache gemacht. Die Herren Pastöre und Kapläne bekamen Seitentritte, und den lieben Heiland meinte man, und wenn man schließlich so alles bedachte, konnte man noch darauf gefaßt sein, nicht, einmal ehrlich und auf christkatholische Weise begraben zu werden. Aber was sie, Miekske Pollmann, anbetraf – sie ließe sich partout nicht von Pitt Hoffmann allein und 'nem lutherischen Prediger unter die Erde bringen. Lieber noch von 'nem Rabbiner oder 'nem anderen Heiden – ja, das wollte sie, und mit dieser Beteuerung, mit der sie jedesmal ihre kirchlich-politischen Grübeleien abschloß, glaubte sie ihrer Ansicht genug getan und den preußischen Staat in Grund und Boden geblitzt zu haben.
Und so auch heute.
»Lieber von 'nem Rabbiner oder 'nem anderen Heiden!« sagte Miekske mit fester Zuversicht, sprang auf ein anderes Thema über und berechnete im Geiste den Inhalt der ›Malör-Penning-Kasse‹. Hierbei gewahrte sie nicht, daß der Herr Vikarius Joseph Sauerbier die Straße heraufkam, ein Mann mit athletischen Formen, einem Stiernacken und gesunden Zähnen. Aber sein Gesicht war so fromm und gutmütig wie das eines Lammes, wenn auch ab und zu ein energischer Zug um die Mundwinkel des gemächlich näher kommenden Klerikers spielte. Joseph Sauerbier, der Sohn ehrsamer Schneidersleute, war in hiesiger Kirchengemeinde gebürtig. Er sollte, wie sein Vater, das Schneiderhandwerk erlernen, wollte aber nicht, denn er hatte Bärenkräfte, und sein Geist war so klar wie das Wasser im Brunnen. Da aber Vater Sauerbier auf seinen Willen bestand, mußte der Sohn Hals geben, tat's auch, sprang aber in seiner Eigenschaft als Lehrling mit seinen Bärenkräften so forsch auf den Schneidertisch, daß die Planke nachgab und mitten entzwei brach. Da sah Vater Sauerbier, daß es so weiter nicht ginge und fragte: »Was willst du denn werden?« – »Theologe möchte ich werden.« – »Nein,« sagte der Alte, »aber auf Schulmeister kannst du studieren,« tat seine Ersparnisse auf einen großen Haufen zusammen und schickte seinen Sohn auf die gelehrte Schule nach Münster. Und Joseph studierte – und dann, als er die Akademie bezog, schien es so, als wenn er auf den Schulmeister losginge, allein seine Kollegienhefte waren theologischen Inhalts. Das merkten Vater und Mutter Sauerbier in den Sommerferien – und noch eine merkte es, die sich in den kräftigen Studenten vergafft hatte, und das war dem Schmied Derksen seine rotblonde Tochter. Die verfolgte ihn unentwegt mit ihren sinnlichen Augen und sagte: »Wenn einer es machen kann, so kann ich es nur machen,« ging hin, trat vor ihren zerbrochenen Spiegel und, da es Sommer war, tat sie ihren dünnsten Rock an und ein Leibchen von Nessel, das noch feiner als Spinnweb sich anließ, und sah in die Scheibe. Und Anna Derksen war zufrieden mit sich, drehte sich auf ihren Absätzen herum und ging zum Studenten. Als sie aber vor ihm stand, reckte sie ihre Schultern zurück, daß ihr schöner Busen mächtig unter dem leichten Nesselkleidchen hervorsprang. Und wieder lockte sie mit ihren sinnlichen Augen. »Jetzt muß er wollen, wie ich will,« dachte das Mädchen. Allein der junge Theologe wandte sich ab und sagte mit vibrierender Stimme: » Apage, Satanas!« – Da wußte sie, daß er für sie verloren war für immer und ewig. Auch die Eltern wußten es, gaben sich aber schließlich zufrieden, als ihr Sohn zu Ehren und Würden gelangte, seine Primiz hielt und Geistlicher wurde. Und wenn Joseph später seine elterliche Schwelle beehrte, zog Vater Sauerbier ehrfurchtsvoll sein Troddelkäppchen vom Kopfe herunter und sagte zu Schmied Derksen und Anna: »Freut Euch mit mir, denn unser geistlicher Herr Sohn hat heute mit uns einen warmen Löffel Suppe gegessen.« –
Der Herr Vikarius war weiter gegangen. Die Leute, die vor den Häusern saßen, grüßten ihn und meinten: »Jetzt geht Joseph von Arimathia zu Miekske. Nein, was die doch für 'n Glück hat!« – und sie nannten ihn so, weil der Herr Vikarius alljährlich, und zwar um die österliche Zeit, den hölzernen, grellilluminierten Leichnam des Herrn in eine Seitenkapelle der Kirche trug und dort auf gespreitete Leinwand und weiße Papierrosen legte. Das bedeutete das Grab, aus dem der Heiland am Ostersonntage auffahren sollte gen Himmel. Wenn dann alles vorüber war, die Glocken wieder von Rom kamen, trug er das hölzerne Bildnis wieder in den Verschlag der Sakristei zurück, wo es rasten konnte bis zur nächstjährigen Karwoche, in der die Glocken wieder stumm wurden wie die Fische im Wasser. Das war ein schönes Amt, was der Vikar innehatte. Die anderen Geistlichen der Pfarrei konnten es nicht bekleiden, denn ihnen fehlten die Körperkräfte hierzu; aber Joseph Sauerbier hatte sie und war hierdurch Joseph von Arimathia geworden. –
Und Joseph von Arimathia war weitergegangen. Die kleinen Mädchen liefen herbei, tasteten nach seinen Händen und sagten: »Tag, Heerohme!« – und Adele Knipp, die wegen ihres häufigen mangelhaften Verhaltens der ›Malör-Penning-Kasse‹ am meisten Tribut zahlen mußte, stand hinter den Fensterscheiben und knickste; und so, von allen christgläubigen Menschen geehrt, war der Herr Vikarius bis zu Miekske Pollmann gekommen.
Mit seinem blaubedruckten Taschentuch tupfte er sich den Schweiß von der Stirne, reichte der gebrechlichen Jungfer die Hand und meinte: »Tag, Miekske; haben Sie heute schon gebetet?«
»Ja,« sagte Miekske, »das tu' ich allmorgens.«
»Das ist schön und gut von Ihnen,« erwiderte Joseph von Arimathia, »wir haben es nötig, denn trotz des schönen Wetters hängen überall Trauerflore vom Himmel.«
»Ach, ne...!« sagte Miekske. Sie sagte es mit einem gewissen Erstaunen, denn sie wußte so recht nicht, wo der Herr Vikarius mit seinen Trauerfloren hinauswollte. »Aber wieso. denn?« fragte sie in sichtlich bedrückter Stimmung, griff mit ihren zappeligen Händen ins Leere und begann wieder Fliegen zu fangen, die nicht da waren. »Je,« meinte Joseph von Arimathia und drehte den gesunden, freundlichen Kopf auf dem Stiernacken gen Himmel, »Naatje Ingelaat kann so recht keine Luft mehr bekommen. Er geht den Weg alles Fleisches. Bald wird er vor seinem Heiland erscheinen, und das ist ein Glück für den Mann, denn der Heiland hat die schönen Worte gesprochen: Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber was kein Glück für ihn ist, was ihm sehr übel vermerkt werden könnte da oben ...«
Miekske Pollmann hatte einen großen Brummer gefangen.
»Das ist,« fuhr der Herr Vikarius gelassenen Tones fort, »daß er in der Betätigung seines letzten Willens nicht die richtigen Wege gefunden. Seine Pflegetochter Luise und Johannes Wesselink dürften sich aller Wahrscheinlichkeit nach als glückliche Erben betrachten, während wir, die Kirche, die frommen Brüderschaften, das Kloster in einen Sack greifen mögen, der tatsächlich nichts anderes als ein ganz gewöhnlicher Sack ist: leer, ohne Inhalt – und er, was der Herr Posthalter ist, hatte doch früher so schöne Pläne gehabt und so schöne Gedanken ...«
»So 'n christkatholischer Unchrist!« erregte sich Miekske.
»Richtig,« versetzte Joseph von Arimathia. »Ich verstehe Sie, und die übrigen Menschen werden Sie gleichfalls verstehen. Man sollte in dieser verhängnisvollen Zeit, wo die heilige Kirche von Feinden und Widersachern gleichsam wie der große Sankt Sebastianus mit Pfeilen durchspickt wird, alles aufbieten, ihr jammernswertes Los erträglicher zu gestalten. Aber tun es die Menschen, tut es die preußische Staatsbehörde?! – Wir haben den aufgezwungenen Glaubenskampf durchzukämpfen, wir haben die Herren von Bismarck und Falk, wir haben die Maigesetze ... Wir haben häretische Anwandlungen in Hülle und Fülle; keine geistliche Autorität wird gewertet, so daß es möglich wurde, selbst an den hochehrwürdigen Bischof von Köln ...«
»Was ...?!« jammerte Miekske.
»Hand anzulegen,« war die ruhige, aber fatalistische Antwort.
Die Inhaberin der ›Malör-Penning-Kasse‹ erschreckte sich derart, daß sie sich festhalten mußte, um nicht vom Stuhle zu fallen.
»Märtyrer!« sagte der Herr Vikarius und legte die Hände über seine Soutane zusammen. Aber dann kam es über ihn, und er meinte mit energischer, aber verhaltener Stimme: »Ja, dahin ist es, leider Gottes, gekommen! Wir sollen nicht sein wie die Dohlen, die untätig zusehen und nur den Knopf des Kirchturms umschreien; wir gehören hinein in die Kirche. Wachet und betet und opfert! – allein der Posthalter Ingelaat ist nichts weiter wie eine Dohle gewesen. Wir müssen sparen und sammeln, wir müssen zu opfern verstehen, damit es auch der geistlichen Behörde vergönnt ist, den Kampf siegreich durchzuführen, der ihr gegen alle Menschengesetze und Gottesgesetze aufgedrängt wurde von einer Gewalt, die besser getan hätte, sich in Demut zu beugen vor Gott und seinen Stellvertretern auf Erden.«
Joseph von Arimathia wischte sich wieder den Schweiß von der Stirne, während Miekske schwer in Gedanken saß und über die traurigen Zeitläufte nachsimulierte. Und aus ihren Gedanken wuchsen Tränen heraus, und aus ihren Tränen wurde der feste Entschluß geboren, sich tatkräftig in den Dienst der bedrängten und zu Unrecht gemaßregelten Kirche zu stellen. Sie fing denn auch noch etliche Brummer, die weder für sie, noch für die übrige Welt existierten, und sagte dann mit aller Bestimmtheit: »Sehen Sie, Mynheer Vikarius, ich bin ja, was meine eigene Person anbetrifft, nur ein gewöhnlicher und sterblicher Laie, aber wie wäre es nu, wenn ich als erste meine ›Malör-Penning-Kasse‹ auf den Altar der gottesfürchtigen Wohltätigkeit hinlegen täte? !«
»Hm!« machte Joseph Sauerbier, »das wäre nicht übel. Wir sind auch für die kleinste Spende dankbar, wenn sie nur mit ehrlichen Händen gebracht wird.«
»Das soll denn ein Wort sein,« freute sich die armselige Person so recht aus tiefster Seele heraus. »Mir bedrückt es nicht weiter, denn ich hänge nicht am Besitz, und mir scharniert es nicht weiter, denn was meinen Exerzitus ins Grüne, wie ich das immer so zu benennen gewohnt bin, anbetrifft, so können wir das ja bis auf den nächsten Sommer verschieben – und meine kleinen Mädchen sorgen schon dafür, daß die Blechbüchse in den langen Winterabenden wieder voll wird. Greifen Sie daher nur forsch in die ›Malör-Penning-Kasse‹. Sie steht auf dem Tisch in die Hintere Stube. Es ist gerne gegeben.«
Miekske Pollmann mußte an sich halten, um nicht vor lauter Rührung dem Herrn Vikarius ein Küßchen zu geben.
»Das macht Ihnen alle Ehre!« sagte Joseph von Arimathia, »und damit Sie sehen, wie der Herr alles Gute vergilt, wie der Same der Wohltätigkeit geeignet ist, hundertfältige Ernte zu bringen, kann ich Ihnen ein Freudenfähnchen entgegentragen und Ihnen die Mitteilung machen ...«
»Was?!« meinte das arme Persönchen.
»Ihre Bitte, Ihr Gesuch ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Ihr Herr Bruder Karlo Antonio Pollmann wird die Rentmeisterstelle in Moyland erhalten. Danken Sie dem heiligen Vater in Rom, danken Sie der hiesigen Geistlichkeit, durch die es möglich wurde, alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Und danken Sie Gott, daß Herr Karlo in päpstlichen Diensten gestanden und Zuave gewesen. Dieses, mein Fräulein, war der freudige Beweggrund, Sie zu beehren. Und nun: gelobt sei Jesus Christus!«
Miekske Pollmann warf dem Sprecher einen innigen und dankbaren Blick zu.
»In Ewigkeit, Amen,« sagte sie tonlos. »Aber, Mynheer Vikarius, die ›Malör-Penning-Kasse‹ ...!«
»Ja, so,« meinte Joseph von Arimathia, ging ins Haus und nahm die stattliche Blechbüchse vom Tisch, kam wieder zum Vorschein und stolzierte, nachdem er sich nochmals bei Miekske Pollmann bedankt hatte, in den werdenden Abend hinaus.
Und das verlähmte Frauenzimmerchcn sah ihm mit großen, schimmernden Augen nach, versuchte ihren Kopf aus den Schultern zu recken und konstatierte heiteren Gemütes, daß sie durch die Spendierung der weitbauchigen Kasse dem Himmel entschieden um zwei Tagemärsche näher gerückt sei, ein Gedanke, her sie so freudig erregte, daß sie die lieben Engel zu hören vermeinte, die oben in den Abendwolken musizierten, die Zimbel schlugen und geigten.
Und der Abendwind ging durch die kleine niederrheinische Stadt hin, so lind und weich wie Watte und so säuselnd und sacht wie Eulenflug, und er faltete die Soutane des Herrn Vikars still auseinander, und wenn einer subtile Ohren gehabt hätte, um wie eine Spitzmaus zu hören, so hätte er auch die feinen Stimmchen vernommen, die aus den Rockschößen der Soutane und der ›Malör-Penning-Kasse‹ herauskamen. Es waren Mädchenstimmen und doch keine Mädchenstimmen. Es waren vielmehr wieder lebendig gewordene Unartigkeiten und sonstige Dinge, die gegen die Regeln der Nähschule verstießen. Es war ein verhaltenes Kichern und Lachen. Verkupferte Stimmchen ...! – Etliche davon hatten eine ganz besondere Kulör, und wer die kleine Adele Knipp kannte, der wußte auch, daß sie von der kleinen Adele Knipp herrühren mußten. Aber alle hatten den nämlichen Ursprung und schienen glücklich zu sein. Sie konnten auch glücklich sein, denn da sie sich in der schwarzen Soutane befanden, waren sie heilig geworden. Das war doch eine andere Sache, als später profanen Zwecken zu dienen und in Stippmilch, Leckerguts und Korinthenbrötchcn umgewandelt zu werden! Und mit diesen seligen Stimmchen im Rockschoße ging Joseph von Arimathia nach Hause, und als er den großen Markt passierte, stand Pitt Hoffmann noch immer am Fenster, sah mit seinem wächsernen Gesicht und den runden Augen in die immer stärker werdende Dämmerung hinein, die sich langsam und feierlich über Giebel und Dächer ausgetan hatte, und trommelte mit seinen weißen Fingern, die so weich und gelenkig wie die einer Hebamme waren, einen Trauermarsch gegen die angelaufenen Scheiben.
»Auf daß mein Geschäft blühe!« sagte Pitt Hoffmann und vergönnte sich aus seinem Eckschab den dritten Wacholder.
Der Herr Vikarius aber war weiter gegangen. In der Nähe der Sankt Nikolaikirche begegnete ihm der Postillon Stäwe Rademaker, der atemlos und mit verwehtem Gesicht vom Pastorat herkam.
»Was gibt's, Stäwe?« fragte ihn Joseph von Arimathia.
»Ach, Gott, ja – Herr Vikarius I – Mynheer Ingelaat ...«
»Geht es schon so sehr aufs Sterben ...?!«
Stäwe Rademaker knabberte traurig an seinem grauen Schnurrbart herum, der wie eine dicke Bürste über seine Oberlippe herabhing.
»Ja, Herr Vikarius. Der Dechant Steinberger will mit die Wegzehrung kommen.«
Dann trabte er weiter, der Posthalterei zu.
»Amen,« sagte Joseph von Arimathia.
Der unheimliche Mensch aber, der im blauen Kittel und eine Tonpfeife im Munde bislang im Kirchengäßchen gestanden hatte, verließ seinen Platz, sah sich um und schlug den Weg ein, den der Postillon Stäwe Rademaker gegangen war.
Leise, verschüchtert blitzte in der Posthalterei ein Licht auf.
Es war das erste Licht am heutigen Abend.
II Muß i denn, muß i denn ...
Luise Ingelaat, die Pflegetochter Naatjes, ging mit rotgeweinten Augen im Hause herum, und man merkte es diesen Augen nicht an, daß sie noch in den ersten Sommertagen selig und mit einem glücklichen Schimmer in das niederrheinische Land hinausgeblickt hatten, als hätten sie etwas Feiertägiges gefunden. Und sie hatten auch etwas Feiertägiges gefunden.
Damals waren die Chausseebäumchen noch nicht verstaubt; die Wiesen lagen so frisch und gelbgesprenkelt unter dem Himmel, als wären alle Sterne über Nacht heruntergefallen und seien im saftigen Grase haften geblieben. Und die stillen, dunklen Wälder, die den Horizont abgrenzten, winkten aus der Ferne herüber, und der Rhein blinkte dazwischen herauf, und so ein weicher Wind kam von Holland gegangen, scheitelte die Gräser sacht auseinander und umwehte zwei Menschen, die zwischen den Wiesen und inmitten der großen, niederrheinischen Einsamkeit standen.
Und das war sie und Johannes Wesselink, geachteter Leute Kind und ein guter Sohn, der sich in der Welt umgetan hatte, ein junger Zimmermann war, allsonntags über den Büchern saß und das Geschäft seines Vaters kräftig über Wasser hielt, als dieser eine ›Überfahrung‹ bekam und sich dann so ganz leise und sachte und auf weichen Socken aus dem Leben herausgemacht hatte. Dem jungen Zimmermann wuchsen ganz andere Gedanken unter der Stirn, wie man es sonst bei Leuten seines eigenen Standes und Schlages gewohnt war. Sein Sinn war von grüblerischer Natur, und sein Herz hing an Heimat und Scholle mehr wie das Herz von anderen Menschen, denn sie verstanden nicht den merkwürdigen Zauber, der ihrer eigenen Geburtserde anhaftete, aber Johannes verstand ihn und hatte ihn von Kind an verstanden. Denn wenn der Wind über die Gräser seiner Heimat dahinlief, wenn sich das Rohr mit den braunen Wedeln auf- und niederbewegte – dann sprach sie mit ihm, und wenn sich dann die schwarzen, fetten Ackerkrumen mit mannshohen Halmen bedeckten – dann wußte er, daß sie arbeiten wollte, und wenn es dann Abend wurde, die Windmühlenflügel scharfbegrenzt auf der Goldfolie des Himmels ruhten und sich nicht mehr bewegten, und wenn dann die tausend und abertausend Wisperstimmchen in den Wiesenschlägen sich regten, dann war es ihm so, als müsse jetzt das Glück aus der Niederung treten, ihm auf die Schulter tippen und sagen: »Hier bin ich, Johannes.«
So ein Abend war damals gewesen.
Die beiden Menschen standen in der großen Einsamkeit, die noch einsamer wurde, als sich die Fernen umdüsterten und ein großer Vogel über die weite Ebene revierte.
Da drängte Luise ihre volle Gestalt fester in seine Arme hinein, und da er es merkte, wurde er heiß und sagte dann mit verhaltener Stimme: »Das habe ich mir immer gewünscht, ein Glück zu haben, wie ich es heute besitze.«
»Wie meinst du das?« fragte sie leise.
»Weil es aus dem Boden herausgewachsen ist, den ich liebe.«
Da ging ein Schauer über sie fort, und sie küßte ihn lange. Er aber bemerkte, daß sie die Augen geschlossen hielt, als sie ihn küßte.
Und da legte er seine harte Hand um ihre Taille und sagte: »Du mußt mich ansehn, Luise.«
Sie gab keine Antwort, hielt aber ihre Augen geschlossen.
»Du sollst mich ansehn, Luise,« sagte er noch einmal und mit dringlicher Stimme. »Das tut die niederrheinische Erde doch auch, wenn ich arbeitsmüde bin und dann hinausgehe, um in ihr Auge zu sehn. Und du bist doch das Liebste, was ich habe und was mir die Heimat gegeben.«
»Ich bitte dich, laß mich, Johannes.«
»Du willst nicht, Luise?«
»Ich tu' es nicht gerne, denn wenn ich es tue ...«
»Und wenn du es tust?« fragte er mit einem beklommenen Anflug.
»Dann ist es mir, als wenn ich etwas sähe ... als wenn sich etwas zwischen uns drängte ...«
Sie sprach nicht weiter und da wußte er, daß nicht alles so war, wie er es sich bei der Arbeit und in seligen Stunden ausgemalt hatte.
»Gottverdammich!« kam es hart von seinen Lippen herunter.
»Johannes!« rief sie verschüchtert und warf ihre weichen Arme rund um seinen Nacken herum. »Es war ja nichts, lieber Johannes!«
»Nicht?!« sagte er tonlos, »aber mir ist so, als wenn das von früher...«
»Nein, nein, nein...!« sagte sie schluchzend.
Da zog er sie fester an sich und deutete mit der Hand in die umschleierte Landschaft hinein. »Sieh mal,« meinte er dann so ganz still und ganz leise, »das sehen andere Menschen nicht, wenn sie auch wollen. Ich will es dir zeigen, denn da ist etwas in die Gegend hineingekommen, was einem weh tut, wenn man es ansieht.«
»Du grübelst schon wieder,« meinte sie ängstlich.
»Das mußt du in den Kauf nehmen,« sagte er bitter, »wenn wir uns zusammentun wollen; denn es ist ein Stück von mir, was da rungeniert werden soll und absterben könnte. Es ist nicht von selber gekommen. Menschen haben es hineingetragen; es ist Menschenwerk. Es kommt von Rom her – es liegt auf den Kirchen – es kriecht in die Häuser hinein – es geht im Felde herum und zerdrückt den Frieden, den wir hier hatten, als wenn er nur eine erbärmliche Glasscherbe wäre. Und wenn das so weiter geht... Und sieh mal, Luise: wenn ich dann dich besehe und höre, was du mir gesagt hast, dann ist es mir so, als wäre etwas von der großen Not, die im Lande ist, auf dich übergesprungen, und dann sorge ich mich, daß du noch was im Herzen trägst, daß da noch etwas verborgen liegt, was unser Glück tot machen könnte.«
Er sprach nicht weiter. Sie hatte ihn so innig umschlungen, daß er nicht mehr zu sprechen vermochte.
»Das ist nicht wahr! – Das ist lange vorbei...!« sagte sie mit heißen Lippen. »Da sieh nur...«
Und da schlug sie ihre großen Augen auf, die sammetweichen Augen mit der durstigen Seele, und da fand er alles, was er stets in den Blicken seiner Heimat gewahrte, wenn sie ihn ansah: das Tiefe, Klare und das endlose Sehnen – nur das nicht, um das er noch soeben gesorgt und gebangt hatte.
Er hatte in ihnen etwas Feiertägiges gefunden, etwas von dem, was er brauchte, was er immer gewünscht hatte – und da glaubte er ihr und ließ alle Zweifel beiseite und wußte, daß er, der Fünfunddreißigjährige, glücklich werden sollte mit der, die ihren blonden Kopf an seine Schulter gepreßt hielt und nun wie verloren in das eingedunkelte Land sah, das seine Schleier um ein junges Geheimnis legte, das es soeben erlauscht hatte.
Mit diesem Geheimnis im Herzen gingen die beiden durch die stillen Wiesen nach Hause und bewahrten es noch lange vor den übrigen Menschen. Erst um die herbstliche Zeit sollte es offenkundig werden, so verabredeten sie, wenn sie auch nicht verhindern konnten, daß die Wiesen von ihrem Glück erzählten, und einige Leute es ahnten, die gesehen hatten, wie sie Hand in Hand durch den stillen Abend gekommen waren.
Aber die beiden schwiegen, und Luise vergaß, daß sie einmal anders gefühlt hatte wie heute, und Johannes mußte immer an das Feiertägige denken, das auf ihn übergangen, das er zuerst bemerkt hatte, als die Wiesen einschliefen und die eingedunkelte Niederung ihn ansah mit großer Liebe und unendlicher Sehnsucht. Das waren die Blicke von Luise gewesen. Und er dachte daran, wenn er zwischen Gesellen und Lehrlingen mit den schweren Hölzern hantierte, wenn er die Hängewerke richtete und seine Baupläne ausführte; er dachte daran, wenn er Sonntags über seinen Büchern saß, nachgrübelte, seinen eigenen Gedanken nachging und mit tiefer Not und heimlicher Bängnis erkannte, daß sich etwas Dunkles, Schwarzes über seine engere Heimat hinweglegte, daß daraus eine energische, unerbittliche Hand wuchs, den Frieden packte und ihn zu zersprengen drohte, als wäre er nur eine minderwertige Scherbe gewesen. Das Feiertägige seiner Liebe aber verließ ihn nicht, das war sein Eigen geworden.
Und so waren die Tage vergangen und die Wochen vergangen. Ein weicher Spätsommerwind ging über die geworfenen Halme, wehte den Staub über die Chausseebäumchen und blies die Äpfel an, daß sie rote Bäckchen bekamen.
Nur über die Wangen von Naatje Ingelaat legte sich etwas, das dem jungen Zimmermeister nicht gefiel, das ihm Kümmernis machte. Er ahnte Schlimmes, aber Pitt Hoffmann, der es ja wissen mußte, ahnte das Schlimmste, ließ seinen Trauerzylinder bei Schneidermeister Olbers aufbügeln und durch einen neuen Florbesatz aufmunterieren, so daß er wieder so frisch aussah, als wäre er direktemang aus dem Laden gekommen. Und das gehörte sich so, denn Naatje Ingelaat hielt auf Äußerlichkeiten und verdiente es reichlich.
Und Pitt Hoffmann stand noch immer am Fenster.
*
Es war tiefe Dämmerung eingetreten, als Joseph von Arimathia seine Wohnung betrat. Hinter ihm machte auch der Tag seine müden Augen zu, und als er sie zumachte, ließ sich ein dünnes, gespenstisches Klingeln vernehmen, das von der Sakristei der katholischen Pfarrkirche herkommen mußte. Man konnte es für ein Geräusch ansprechen, das sich im Nebel verirrt hatte und jetzt nicht mehr wußte, wohin es seinen Weg nehmen sollte, so unruhig, kränklich und unstet drückte es sich an den Häuserzeilen vorbei, als müsse es irgendwo einen Ausweg gewinnen. Jetzt kam es durch das schmale Kirchengäßchen geklingelt – aber so spitz und verweht die seltsame Schelle auch klagen mochte, ihr wohnte eine geheimnisvolle, fast wundertätige Kraft inne; denn wie sie ertönte, da traten die Leute aus den Häusern und knieten verstört nieder, und die, welche sich auf der Straße befanden, knieten ebenfalls nieder, ließen die Köpfe sinken und machten das Zeichen des heiligen Kreuzes.
»Herr, sei deinem armen Diener Naatje gnädig!« sagten die meisten, und wie sie es sagten, da war auch Pitt Hoffmann mit seiner Frau, die das löbliche Amt einer ehrsamen Hebamme bekleidete, über die Schwelle getreten. Pitt machte eine bedeutsame Pose – und da knieten die beiden wie die übrigen Menschen: sie, die sich freute, wenn sie so einem kleinen Wesen den Eingang ins Leben leichter machen konnte, und er, der sich einen Wacholder vergönnte, wenn einer den dunklen Salto mortale tat und ins Gras beißen mußte. Geschäft ist eben Geschäft; man mußte es nehmen, wie's kam, ganz egal, ob es die Lebendigen oder die Toten spendierten.
Die geisterhafte Klingel war näher gekommen.
Da schlug sich Pitt Hoffmann mit seinen gelenkigen Fingern gegen die Brust und meinte dann mit salbungsvoller Betonung: » Dixi et salvavi ... Mama, bete mit« – denn er sagte der Feinheit und der noblen Lebensart wegen zu seiner Frau immer ›Mama‹ – » dixi et salvavi animam meam.«
Jetzt ging die heisere, kränkliche Schelle vorüber.
Sie wurde von einem kleinen Meßjungen in Bewegung gesetzt, der, mit schwarzem Chorrock und weißem Röckling bekleidet, eine Laterne mit Messingbeschlag in der linken Hand hielt und sie hin und her balancierte. Ein mattes Wachsartigen flimmerte hinter den Scheiben. Ein abgezirkelter Dunstkreis glitt über die Erde und von hier aus über eine kleine Gestalt, die dem Meßjungen folgte. Es war der Dechant Doktor Steinberger, ein tolerant gesinnter Mann, der die Worte des Heilandes nicht nur auf den Lippen, sondern auch im Herzen hatte und sie zu betätigen wußte. Wie sein kleiner Adlatus trug auch er Chorrock und Röckling. Sein Kopf war vornübergebeugt; er sah weder zur Rechten noch zur Linken, und seine weißen, frommen Hände umspannten eine kleine Kapsel mit den Heilssakramenten für christkatholische Menschen, die hier auf Erden nicht mehr mittun wollten und sich anschickten, ein weißes Kleid anzuziehen, um barfuß nach oben zu pilgern.
Die Klingel ging weiter.
»Nu können wir aufstehn, Mama,« sagte Pitt Hoffmann. »Heute in drei Tagen sind wir um fünf Taler zehn Groschen reicher, Mama, denn Naatje wird erster Klasse begraben.«
Hierauf machte er wieder eine bedeutsame Pose, half seiner kompletten Frau auf die Beine und verschwand mit ihr in den dunklen Hausflur.
Und immer noch das Bimmeln – das feine Gebimmel ...! –
Im vorderen Zimmer der Posthalterei lag Naatje zwischen hochgeschichteten Kissen. Im Hause gingen die Mädchen auf Zehenspitzen herum. Der expedierende Sekretär hatte schon lange den Schalter geschlossen, war aber nicht heimwärts gegangen, weil jeden Augenblick das Ableben seines Herren eintreten konnte. Stäwe Rademaker machte sich geräuschlos in den Ställen zu schaffen. Die Halfterketten hatte er durch Stricke ersetzt und eine dicke Streu unter die Pferde geschüttet, damit kein Klirren entstände und das störende Getrampel aufhören sollte.
»Das kann so 'ne arme Seele nicht leiden,« sagte der Alte, »denn sie geht auf Filzparisern herum, und wenn sie verschreckt wird, denn verliert sie die schlenkrigen Schuhe und kann das ewige Leben nicht finden.«
Und dann wischte sich Stäwe über die stahlblauen Augen und horchte in Richtung der vorderen Stube, ob sich noch alles beim alten verhielte.
Nichts ließ sich hören.
»Die arme Seele hat noch nicht den Postschein genommen,« sagte er leise, »sie wartet noch 'n bißchen. – Liese, sei still; du kriegst was auf den Kopp, wenn du mit dem verfluchten Leinewebern nicht aufhörst.«
Friedlich lief der Schein der Stallaterne über die Pferde.
Und da drinnen ...
Man mußte ordentlich zusehen, um Naatje zwischen den hohen Kissen zu finden. Er hatte sich ganz in sich zusammengezogen, so klein und vermickert sah er aus. Das gedämpfte Licht einer Lampe spielte um die eingefallenen Züge, die so durchsichtig wie dünnes Postpapier waren. Aber etwas von Verklärung ging darüber hin, etwas von jener Verklärung, die der gefunden, der leichten Herzens die große, unbekannte Wanderung antritt, um das ewige Reich zu gewinnen. Er hatte den Kampf aufgegeben und sich in Gottes unabänderlichen Willen gefunden.
Luise und Johannes Wesselink befanden sich im Nebenzimmer, während der Rektor Franz Hartjes am Kopfende des Bettes saß, eine Hand des Sterbenden gefaßt hielt und mit ruhigen Augen die Atemzüge des Kranken verfolgte.
Ab und zu sah er in die Nebenstube hinein, als wisse er nicht, warum Johannes Wesselink sich bei Luise befände. Er hätte es aber wissen können, wäre er nicht ein so etwas verwehter Kopf gewesen wie alle Gelehrten. Zudem stand er unter der Fuchtel einer energischen Frau, die, bei allen häuslichen Pflichten, noch die Präsidentschaft des Paramentenvereins besorgte und ihre noch immer respektabelen Reize dazu benutzte, den braven Gatten an der Strippe wie an einem Gängelbande zu halten. Das machte ihn stutzig, unentschlossen und ängstlich, und so kam es denn auch, daß er für gewisse Dinge kein Verständnis mehr hatte, denn er war eben verweht, wenngleich er auch ein denkender und strebsamer Mensch war.
Hartjes hatte das Gesicht einer Spitzmaus, aber das einer gutmütigen Spitzmaus, stand in den fünfziger Jahren und war seit langem ein ständiger Skatkollege von Naatje gewesen – und nun saß er hier, hielt die Hand seines älteren Freundes gefaßt, um ihm das Ende leicht werden zu lassen.
Jetzt bewegte sich Naatje.
»Du,« sagte er mit kaum wahrnehmbarer Stimme, »klopft da nicht jemand?«
»Nein,« sagte Hartjes.
»Aber ich habe es doch deutlich gehört.«
Da drehte sich der Rektor ängstlich herum und sah durch die Scheiben.
»Nein, es hat niemand geklopft,« meinte er schließlich.
»Aber die Tür hierneben steht offen?«
»Ja – die steht offen.«
»Dann mache sie zu,« sagte Naatje und wollte sich in den Kissen erheben.
Da ging Hartjes und machte die Tür zu.
Und dann wurde es wieder still in der Posthalterei, so still, daß man die einzelnen Briefschaften fallen hörte, die draußen ganz sachte in den Einwurf hineinpraktiziert wurden.
Hartjes weinte leise vor sich hin, und wie er so weinte, da tastete Naatje ganz verloren über die Bettdecke hin, als suche er etwas, und da merkte Hartjes, daß er wieder seine Hand haben wollte.
»Da ist sie, da ist sie ...!« meinte der Rektor, und als Naatje sie hatte, da sagte er plötzlich mit deutlicher Stimme: »Laß das man, Hartjes. – Mir wird's ja leicht, und für Luise habe ich schon Sorge getragen. Beim Notar ist das Testament deponiert. Ich gehe ja gern von meinem Geld und der Posthalterei fort, da ich nun weiß, daß es mir nicht ums Sterben so schwer wird. Aber das mit Luise ... das mit Luise ...!«
»Was denn?« fragte der Rektor. Er gab sich einen ordentlichen Ruck, um nicht in seinen Tränen ersticken zu müssen.
»Das mit Luise. Sie hat ja mal früher ... Aber sie ist ja nun wohl mit Wesselink einig ... Da ist sie versorgt für die Zukunft ... Aber wenn sie mit dem anderen Menschen – mit dem da in Rom – mit dem Kerl in der päpstlichen Jacke ...«
Naatje reckte sich auf. Er setzte die letzte Kraft daran und streckte die Hand aus: »Hartjes, dann mag sie ... Hartjes, dann ist alles auf Doktor Steinberger und unsere Kirche ... Hartjes, was ist das ...?!«
»Wo denn?«
»Da klopft es doch wieder.«
»Aber ich bitte dich, Naatje!«
»Nicht?! – Aber da kuckt doch immer einer durch die Scheiben ins Zimmer!«
Dem Rektor lief es kalt über den Rücken.
»Keine menschliche Seele! – Niemand! – Hörst du, Naatje, keine menschliche Seele ...!«
»So ...!« sagte Naatje, fiel in die Kissen zurück und legte sich still auf die Seite. Sein Sprechen wurde nun ein wirres Gerede. Er war wieder ein junger Posteleve, der hinter dem Schalter saß und Briefe sortierte, und dann kamen wieder die dreißigtausend Taler und Luise dazwischen, und Karlo Antonio Pollmann ... Und dann saß er mit seinen Kollegen im Herrenstübchen und hatte einen Grand mit Vieren und angesagtem Schneider in Händen. Sein Reden wurde immer verwirrter und seltsamer, bis er schließlich einschlief, und so ein stiller, seliger Abglanz sich über sein Gesicht austat, als wäre eine sanfte Hand ganz leise darüber gefahren.
In diesem Augenblick war das heimliche Gebimmel, das bisher draußen gewesen, in den Hausflur gekommen.
Auf weichen Sohlen, lautlos und wie ein lieber Sendbote des Herrn war Doktor Steinberger ins Sterbezimmer getreten. Und die Tür nebenan öffnete sich auch, und da kamen Luise und Johannes Wesselink herein, hielten sich bei den Händen und knieten an der Bettlade nieder.
Der kleine Meßjunge steckte zwei geweihte Wachskerzen an, die er aus seinem Röckling zog, und auf zwei Metalleuchter stellte, die das Hausmädchen in die Stube gebracht hatte.
Ängstlich, wie zwei arme Seelchen, die sich scheu im Kreise umsahen, standen die Flämmchen auf ihren niedrigen Schäften.
Über das milde Gesicht des Geistlichen glitt es wie ein überirdisches Licht, und das überirdische Licht ging auch wie erlösend auf die über, die gekommen waren, Naatje die Augen zuzudrücken, wenn sie vergessen hatten, die irdischen Dinge zu sehen und sich daran gewöhnen mußten, in den überirdischen Glanz des ewigen Lebens zu schauen.
Die heilige Handlung ging vor sich – und als sie vorbei war, als Doktor Steinberger, so mild und gütig wie er gekommen, auch wieder die Stube verließ, und das feine Geklingel der Schelle draußen verzitterte, da fühlte Naatje mit der Hand durch die Luft und legte sie zuerst auf den Kopf von Luise und dann auf den Scheitel von Johannes Wesselink ... Und dann flog so ein lustiger Zug um sein Gesicht, als er sagte: »Adjüs, Hartjes ...! – Rademaker soll kommen.«
Und Rademaker kam; er kam um Abschied zu nehmen. Er wußte aber auch, was er seinem Herrn schuldig war, hatte sich seine beste Uniform zugelegt und das Posthorn mit 'nem funkelnagelneuen Bandelier um die Schulter geschlungen.
Mit nassen Augen drehte er seinen Postillonshut zwischen den schwieligen Fingern.
Das sah Naatje noch mit verschwommenen Blicken und meinte: »Stäwe, das ist proper von dir – und wenn es denn alle mit mir wird – so in 'ner halben Stunde – dann weißt du ...«
»Well, Baas – dann weiß ich ...«
Die Worte kamen ihm schwer an; er konnte kaum sprechen.
»Schön so, Stäwe, dann bläst du – dann bläst du ...«
»Ja, Baas – dann blas' ich ...«
Und dann nahm er die Hand des alten Postmeisters und meinte: »Ja, in so 'ner halben Stunde, dann blas' ich. – Na, Baas – adjüs denn.«
»Na, adjüs, Stäwe. – Stäwe, da oben ...!«
Da ging Stäwe in seiner neuen Montur und dem blanken Posthorn zur Türe hinaus. Er mußte sich stramm halten, sonst wäre er vor Schmerz in die Knie gefallen.
Die halbe Stunde verging – und da kam es vom Posthofe her: leise, sanft, aber klar und erschauernd lief es durch den laulichen Sommerabend.
Die Menschen hielten den Atem an, als sie es hörten.
»Muß i denn, muß i denn zum Städtle hinaus ...« klang es feierlich durch die Stille der Nacht hin.
Und da flog so ein schöner Zug über Naatjes Antlitz – und dann schien er auf die weichen, verlorenen Posthornklänge wie im Traum zu hören. Dann war's alle mit ihm.
Friedlich, zufrieden, glücklich war Naatje Ingelaat aus dem Städtle gegangen.
Und Luise drückte ihm die Augen zu, und Wesselink rückte ihm den Kopf bequemer in den Kissen zurecht, und Hartjes legte ihm sanft die Hände zusammen.
Und draußen ging Holzschuhgeklapper.
Naatje hatte doch recht gehabt. Es hatte jemand am Fenster gestanden und durch die Scheiben gesehen. Das war der Mann im blauen Kittel und mit der brennenden Tonpfeife gewesen.
Als alles aus war, ging er klappernd über den Markt fort.
Niemand hörte es, außer Pitt Hoffmann.
»Jetzt ist Naatje gestorben,« sagte er mit einer wehmütigen Pose. »Gott gebe ihm die ewige Ruhe.«
»Amen,« sagte Frau Hoffmann.
»Muß i denn, muß i denn ...«
Leise, wie im Traum verhallten die Posthornklänge.
Stäwe Rademaker aber setzte sich auf eine Futterkiste und weinte bitterlich.
III Die Frau Rektern
Zwei Tage hintereinander waren die Fensterscheiben an der Posthalterei völlig geblendet. Nur in die Stube, rechts neben der Haustür, wo der expedierende Sekretär seinen Arbeitsraum hatte, ließen die schräggestellten Jalousieläden noch eine Art von Dämmerlicht einfallen, das aber kaum hinreichte, die allernotwendigste Helle zu geben. Der Herr Sekretär Severin Piepmann hatte denn auch Mühe genug, die laufenden Arbeiten pflichtschuldigst zu erledigen. Aber er tat es, und während er die diversen Pakete ordnete, die Briefe sortierte, abstempelte und Kasse machte, pfiff er immer und immer wieder von neuem: »Es geht bei gedämpftem Trommelklang ...« und zwar so wehmütig, getragen und in düsterem Moll, daß die Leute, die ihre Korrespondenzen in den Briefkasten warfen, längere Zeit stehen blieben, um sich von der traurigen Weise durchschauern zu lassen.
Am Morgen des dritten Tages, und zwar punkt neun Uhr, schlug die große Totenglocke an. Dreimal schlug sie an mit ihrer feierlichen und sonoren Stimme, um dann von der Sankt Antoniusglocke, Preziosa und Anna Susanna begleitet zu werden. Anna Susanna tat nur mit, wenn eine Persönlichkeit begraben wurde, und ihr schmerzlicher Ruf kostete drei Taler extra.
Als das Sterbegeläut einsetzte, stempelte Severin Piepmann den einundzwanzigsten Brief ab und pfiff dann: »Ich, aber ich traf ihn mitten ins Herz.« Hierauf ließ er den Schalter herunter und ging nach Hause, um sich für das Begräbnis fertig zu machen.
Bei dem ersten Anruf der großen Totenglocke war Pitt Hoffmann auf der obersten Stufe seiner Haustreppe erschienen. Hier blieb er für einige Augenblicke stehen, damit alle es merken sollten, was er doch für ein stattlicher Kerl sei. Auf dem blankrasierten Gesicht, das so proper wie ein frisch gebügeltes Schemischen aussah, lag die große Not und die ganze Kümmernis des heutigen Tages verkörpert. Trotzdem vergaß er nicht, die Würde seines übrigen Menschen gehörig in die rechte Beleuchtung zu setzen. Pitt Hoffmann posierte – stellte den linken Plattfuß etwas zur Seite und wiegte sich, den Zylinder unter fünfundzwanzig Grad nach rechts geschoben, selbstgefällig in den mageren Hüften. Fünf Minuten mochte er so gestanden haben, als er den flottierenden Trauerflor mit seinen schlenkrigen Fingern unter der linken Achsel durchzog und keck über den gekrümmten Arm praktizierte; gleich darauf nahm er den Medaillenstab fester zur Hand, stieß ihn taktmäßig auf und stolzierte dem Sterbehaus zu, um hier auf der Türschwelle die Honneurs für die geladenen Gäste zu machen.
Die Herren Geistlichen kamen, die Leidtragenden kamen; selbst Miekske Pollmann hatte sich von etlichen Mädchen in ihrem Korbwägelchen ankutschieren lassen. Sie wollte doch Zeuge sein, wie Naatje Ingelaat von der schönen Posthalterei fort mußte und in die ›Pierekull‹ getan werden sollte.
Schlag Glock halb zehn setzte sich der Trauerzug in Bewegung.
Frau Rektor Hartjes, geborene Worms, verwitwete König, stand am geöffneten Fenster, als Naatje vorbeikam. Trotz ihrer fünfundvierzig Jahre war sie noch immer eine stattliche, man konnte fast sagen eine üppige Dame, die vornehmlich in sommerlichen Tagen, wo sie gewohnt war, eine dünne Kattuntaille zu tragen, noch Reize besaß, die nicht zu den alltäglichen gehörten. Ein allerliebstes Speckfältchen zog sich zu beiden Seiten des Halses bis zu dem niedlichen Grübchen herab, das sich unmittelbar über dem respektabelen Enkörchen ausgehöhlt hatte. Hier trieb denn auch so ein winziges Goldkreuzchen sein launiges Spiel. Es hob oder senkte sich, je nachdem das Innere der Frau Rektor mehr oder weniger freudig angeregt wurde. In ihren blankgeputzten Augen lag Selbstvertrauen und Würde. Selbstvertrauen, weil sie das von jeher gewohnt war; Würde, weil das zu ihrem Metier gehörte, denn sie konnte sich rühmen, Präsidentin des Paramentenvereins zu sein und die Bruderschaft zur ewigen Anbetung gegründet zu haben. Frau Rektor Hartjes war zudem ein Kirchenlicht, aber ein langes, großes, dickes, das fast mit einer souveränen Verachtung auf Andersgläubige herabschien, sobald es angesteckt wurde – und dieses Kirchenlicht stand nun am Fenster und sah, wie der arme Posthalter vorbeikam.
Sie ließ denn auch alle, Honoratioren und nicht Honoratioren, Revue passieren. Zuerst kam Pitt Hoffmann – aber wie! – Das war verkörperte Wehleidigkeit, in sanftem Tempo dahinschreitende Trauer! Er vereinigte in sich die Allüren eines gespreizten Hofmarschalls und das sanfte Benehmen, die geberische Güte eines Beichtvaters. Er war ein rätselhaftes Wesen, eine Art von Schmierenreporter, ein Großhans, eine klagende Sphinx – Pitt Hoffmann war alles. Ihm folgte die Geistlichkeit. Dann kam der Leichenwagen und das Trauergefolge und ganz zuletzt Severin Piepmann, der noch immer nicht begreifen konnte, daß sein Herr auf den Kirchhof hinaus sollte. Er vergaß sich denn auch und pfiff immer und immer wieder »Es geht bei gedämpftem Trommelklang ...« gegen die Pflastersteine, aber so laut und getragen, daß es auch die Frau Rektorin hören mußte.
»Gefällt mir nicht,« sagte diese indigniert, und sie gedachte schon, vom Fenster zurückzutreten, als sie Frau Pitt Hoffmann bemerkte, die von einem Geschäftsgang zu kommen schien und eiligst mit ihrem schwarzen Täschchen aus Wachstuch nach Hause wollte.
Die kam ihr gelegen.
»Einen Moment, meine liebe Frau Hoffmann!«
»Gerne, Frau Rektoratschülerin,« sagte das vive, pummelige Weibchen, trat in den Hausflur und von hier in die behagliche Stube.
»Ei, schon so fleißig gewesen?«
»Wie sich das so gehört, meine verehrte Frau Rektoratschülerin. Heute morren so um viere 'rum die Frau evangelische Pastorin bedient – 'ne feine Sache, wie wir Wehmütters das heißen – und nu bin ich von Anna Derksen gekommen.«
»Aber ich bitte Sie, meine liebe Frau Hoffmann, doch nicht dem Schmied Derksen ...!«
»Ja – dem Schmied Derksen seine älteste Tochter.«
»Die damals – ich meine, als der Herr Vikarius Sauerbier ...«
»Dieselbigte Anna.«
»Wie ist das nur möglich?!« entsetzte sich Frau Hartjes und schlug vor lauter Erstaunen die Hände zusammen. »Wie ist das nur möglich?!«
»Alles ist möglich,« war die ruhige Antwort.
»Und da haben Sie ...?! – Aber das muß ich näher wissen, das muß ich genauer erfahren ... Bitte, meine liebe Frau Hoffmann, wollen Sie nicht Platz nehmen und sich meines Sofas bedienen.«
»Wie sich das gehört, meine verehrte Frau Rektoratschülerin,« sagte die rundliche Person, stellte ihr Wachstuchtäschchen auf den Tisch und schickte sich an, ihre kompletten Sitzteile in eine bequeme Sofaecke zu schieben.
»Eins zuvor,« meinte Frau Hartjes.
»Bitte,« sagte das rundliche Weibchen und schnellte wieder wie'n Gummiball von dem bereits halbeingenommenen Polster.
»Sehn Sie mal, meine Beste,« erklärte Frau Hartjes, »Sie nennen mich immer ›Frau Rektoratschülerin‹. Das stimmt nicht, das entspricht nicht den wirklichen Tatsachen. Mein Mann ist allerdings Rektor; das Institut, dem er vorsteht, heißt Rektoratschule, und ich kann daher füglich auf den Titel ›Frau Rektorin‹ Anspruch erheben. Falls Ihnen nun dieses zu fern liegt, so bitte ich Sie, mich einfach Frau Präsidentin zu nennen. Die Damen der ewigen Anbetung nennen mich so, Miekske Pollmann tut es, und der Herr Vikarius Sauerbier gibt sich gleichfalls die Ehre – und, Hand aufs Herz, ich schmeichle mir, dieses Titels nicht unwert zu sein, denn, wie Sie selber wissen, bin ich bei der letzten Firmelungsfeier dem hochwürdigen Herrn Bischof als Präsidentin des Paramentenvereins vorgestellt worden.«
»Aber ich bitte Ihnen,« meinte Frau Hoffmann, »das tu' ich ja gerne,« und damit machte sie sich's wirklich bequem auf dem gemütlichen Sofa.
»Und nun – wie ist das mit der Anna Derksen gewesen?« sondierte ihre Partnerin, die sich gleichfalls niedergelassen hatte und ihr Goldkreuzchen zurechtwies, das vorwitzig in den Busen herabrutschen wollte. »Keine pure Neugierde läßt mich diese Frage tun,« fuhr sie erläuternd fort, »sondern lediglich meine Pflicht, mein Recht und meine Stellung als Präsidentin genannten Vereins, der nur unbescholtenen Frauen und Jungfrauen die Mitgliedschaft gestattet. Wie Sie ja wissen, ist Anna Derksen bislang ein regsames Glied meines Vereines gewesen; allein unter den obwaltenden Umständen ... Also – wie ist nun die Sache?«
»Je – wie soll die nu sein!« meinte Frau Hoffmann. »Die Anna ist ja wohl von jeher so'n rassiges Frauenzimmer gewesen. Mit dem Herrn Vikarius hat sie auch anbändeln wollen, als der noch so'n junger Student war.«
»Ist mir bekannt,« sagte Frau Hartjes, »aber der ist ihr bei diesem sträflichen Manöver schön unter die Augen getreten.«
»Wie sich das gehört,« replizierte Frau Hoffmann, »denn er ist immer ein selbstverleugnerisches und edles Faktotum gewesen. Aber was sie ist: sie hat wohl ihre alte Liebe vergessen und ist so dreißig Jahre drüber geworden, denn vor 'nem geweihten Menschen soll die Welt Estimierung besitzen – aber das Rassige, was ihr nu einmal im Blut sitzt, dem kann man nicht wie 'nem Kröpper den Hals umdrehn; das will an die Luft, das will Aufmunterung haben. So hat sie denn auch öfters auf der Bettkante gesessen und hat ihre Beine besehen, und wie sie so kuckte, da kuckte auch immer der erste Geselle Jans in die Stube, und wie das so ist: der hat Gefallen an ihre Beine gefunden, und dann ist das so weiter gegangen, bis ich ihr heute morren bedienen mußte, genau so wie ich mir bei der evangelischen Frau Pastorin bemühte.«
»Nur mit dem Unterschied,« fiel Frau Hartjes dazwischen, »daß die Frau Pastorin, wenn auch – leider Gottes! – keine christkatholische, so doch eine ehrlich getraute Person ist,«
»Wie sich das gehört, meine verehrte Frau Pergamentpräsidentin. Aber auch hier, gütigst zu melden, habe ich durch meine Fixigkeit 'nem properen Jungen das Leben gegeben.«
»Himmlischer Vater!« ereiferte sich die würdige Dame, »das ist ja Sünde, das ist ja eine nichtswürdige, himmelschreiende Sünde!«
»Für mir nicht,« entgegnete Frau Hoffmann mit einem etwas patzigen Tonfall, »denn ich beziehe aus diesem Geschäft meine tägliche Nahrung, und das tägliche Brot kommt von Gott, und was unser himmlischer Vater ...«
»Aber ich bitte Sie,« fiel ihr die Erregte dazwischen, »ich meine Sie ja auch gar nicht, meine beste Frau Hoffmann! Ich meine die andere – ich meine das sündige Mädchen ...! – Da muß ich eingreifen, das verlangt meine Eigenschaft als Präsidentin des Paramentenvereins, das gebietet meine Ehre als Vorsitzende der Bruderschaft zur ewigen Anbetung. Die muß mit Schimpf und Schande ...«