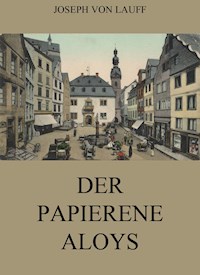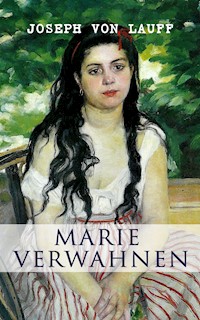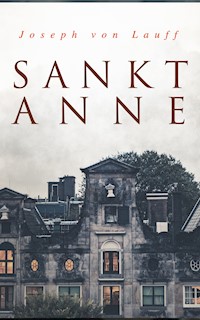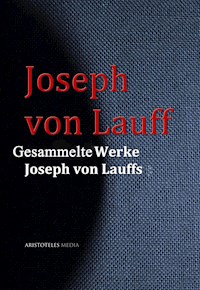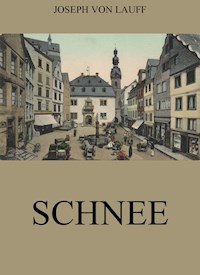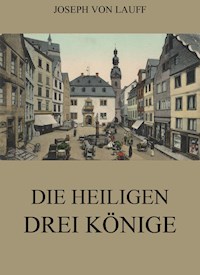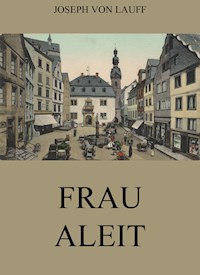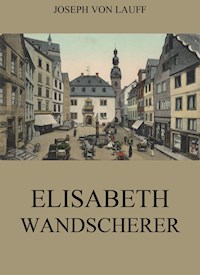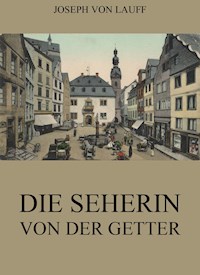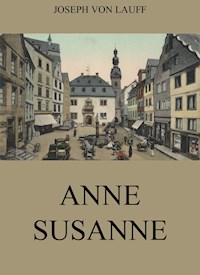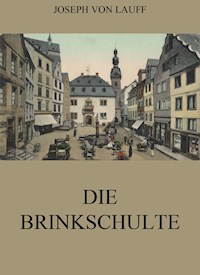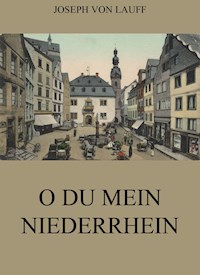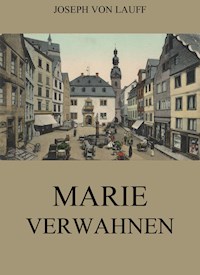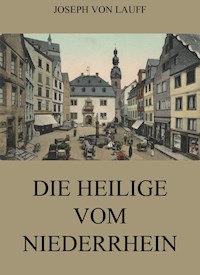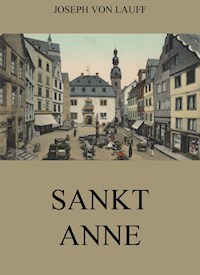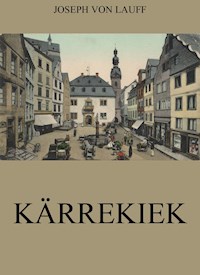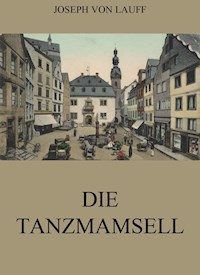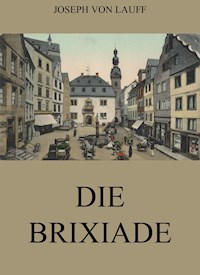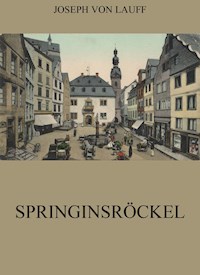
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kurioser Roman vom Niederrhein. Lauffs umfangreiches literarisches Werk besteht vorwiegend aus Romanen, Erzählungen und Theaterstücken. In seinen Prosawerken behandelt er meist Themen aus seiner niederrheinischen Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Springinsröckel
Joseph von Lauff
Inhalt:
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Springinsröckel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Schluß
Sprigninsröckel, J. von Lauff
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638849
www.jazzybee-verlag.de
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Dichter, geb. 16. Nov. 1855 in Köln als Sohn eines Juristen, besuchte die Schule in Kalkar und Münster, wo er das Abiturientenexamen bestand, trat 1877 als Artillerist in die Armee ein, wurde 1878 zum Leutnant, 1890 zum Hauptmann befördert und wirkte, einer persönlichen Aufforderung des Kaisers folgend, 1898–1903 als Dramaturg am königlichen Theater in Wiesbaden, wo er noch jetzt lebt; gleichzeitig wurde ihm der Charakter eines Majors verliehen. L. begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit den epischen Dichtungen: »Jan van Calker, ein Malerlied vom Niederrhein« (Köln 1887, 3. Aufl. 1892) und »Der Helfensteiner, ein Sang aus dem Bauernkriege« (das. 1889, 3. Aufl. 1896), denen später folgten: »Die Overstolzin« (das. 1891, 5. Aufl. 1900); »Klaus Störtebecker«, ein Norderlied (das. 1893, 3. Aufl. 1895), »Herodias« (illustriert von O. Eckmann, das. 1897, 2. Aufl. 1898), »Advent«, drei Weihnachtsgeschichten (das. 1898, 4. Aufl. 1901), »Die Geißlerin«, epische Dichtung (das. 1900, 4. Aufl. 1902); er schrieb fernerhin die Romane: »Die Hexe«, eine Regensburger Geschichte (das. 1892, 6. Aufl. 1900), »Regina coeli. Eine Geschichte aus dem Abfall der Niederlande« (das. 1894, 2 Bde.; 7. Aufl. 1904), »Die Hauptmannsfrau«, ein Totentanz (das. 1895, 8. Aufl. 1903), »Der Mönch von Sankt Sebald«, eine Nürnberger Geschichte aus der Reformationszeit (das. 1896, 5. Aufl. 1899), »Im Rosenhag«, eine Stadtgeschichte aus dem alten Köln (das. 1898, 4. Aufl. 1899), »Kärrekiek« (das. 1902, 8. Aufl. 1903), »Marie Verwahnen« (das., 1.–6. Aufl. 1903), »Pittje Pittjewitt« (Berl. 1903) sowie die Lieder »Lauf ins Land« (Köln 1897, 4. Aufl. 1902). Als Dramatiker trat er zuerst hervor mit dem Trauerspiel »Inez de Castro« (Köln 1894, 3. Aufl. 1895). Von einer Hohenzollern-Tetralogie sind bisher erschienen und wiederholt ausgeführt »Der Burggraf« (Köln 1897, 6. Aufl. 1900) und »Der Eisenzahn« (das. 1899); ihnen sollen »Der Große Kurfürst« und »Friedrich der Große« folgen. Lauffs neueste Dramen sind das Nachtstück »Rüschhaus«, das vaterländische Spiel »Vorwärts« (beide das. 1900) und das nach dem Roman »Kärrekiek« verfaßte Trauerspiel »Der Heerohme« (das. 1902, 2. Aufl. 1903). Während L. in seinen Romanen echtes Volksleben des Niederrheins poetisch festhält und in seinen epischen und lyrischen Dichtungen trotz wortreicher Diktion ein starkes Talent verrät, greift er in seinen Dramen, namentlich in den höfisch beeinflußten Hohenzollern-Stücken, oft zu unkünstlerischen Mitteln und erweckte entschiedenen Widerspruch. Vgl. A. Schroeter, Joseph L., ein literarisches Zeitbild (Wiesbad. 1899); B. Sturm, Joseph L. (Wien 1903).
Springinsröckel
1
»Springinsröckel ...!«
Holla, heda! was war das nur!
Da wieder – aber lauter und schärfer: »Springinsröckel ...!«
Alle Wetter! hatte da jemand gerufen?
Eigentlich nicht! nur die blaugestrichene Tür an der Wirtschaft ›Zur Goldenen Kugel‹ klingelte auf – mit einem schrillen, impertinenten Geschrei, das kurz und abgerissen in dem nadelfeinen Schneegeknister verhallte.
Der Große Markt war weißübersponnen. Ein scharfer Nordost trieb die bitterkalten Flöckchen eiligst zur Seite, wirbelte sie um die schmalstockigen Häuserzeilen und häufelte vor den Türschwellen flaumige Daunenpolster.
»Prr! diese Kälte!«
Die kleine niederrheinische Stadt konnte kaum atmen, so eisig schob der graue, dunstige Silvesternachmittag des Jahres 1861 seine winterlichen Launen über die fröstelnde Landschaft. Die alte Linde, die inmitten des geräumigen Marktes paradierte, erstarrte im Rauhreif, und vereinzelte Spatzen fielen tot von den Dächern herunter.
Alles war mäuschenstill, verklammt, verlähmt in der kalten Einsamkeit, nur – wie gesagt: die blaugestrichene Tür an der Wirtschaft ›Zur Goldenen Kugel‹ klingelte auf – mit einem schrillen, impertinenten Geschrei, das kurz und abgerissen in dem nadelfeinen Schneegeknister verhallte. Gleichzeitig drehte sich ein kleines, zierliches Männchen, dem man ebensogut sechzig wie vierzig Jahre zubilligen konnte, ausstaffiert mit einem kegelförmigen Zylinder, einem silberbeknopften Bambus und einem braunen, wolligen Überrock, der in seiner aufdringlichen Farbe an die einer altmodischen Bunzlauer Kanne gemahnte, auf die Straße hinaus.
Herr Aloys Furtwanger, Junggesell, emeritierter Aktuarius des Königlichen Friedensgerichtes, domiziliert in hiesiger Kirchengemeinde und wohnhaft auf der Grabenstraße, dem Altmännerhaus schräg gegenüber, hatte wie alltäglich in der ›Goldenen Kugel‹ zu Mittag gespeist, sein Schälchen Kaffee getrunken und mit dem gleichfalls auf Ruhegehalt gesetzten Schulmagister Pitt Kaldenhoven eine Partie Domino gespielt und trieb nun in dem sprühenden Schneegeriesel seinen heimischen Penaten entgegen.
Wenn man Aloys Furtwanger ansah, mußte man lächeln, mußte man an etwas Drolliges, Pfiffiges, Wehmütiges denken, hatte man das Gefühl: in diesem eigentümlichen Menschenkind hat der liebe Gott ein sonderbares Wesen auf die Beine gestellt, und dennoch: Aloys Furtwanger war ein Mann der Milde und Güte, des Wohlwollens, des stillen Sinnierens, und seine Seele mutete an wie das schleierweiße Tafeltuch auf dem Altar der ›Sieben Schmerzen Mariä‹. Sein glattrasiertes Gesicht war wie das einer Spitzmaus. Niedlich saß es zwischen den steifen Vatermördern und hatte zwei humorvolle Augen, die in ihrem sanften und beschaulichen Glanz an die eines treuen Pudels erinnerten. Auf seinen schmalen Lippen lagen die Worte Paul Gerhardts »Wach' auf mein Herz und singe«, »Nun ruhen alle Wälder« oder das tiefernste »O Haupt voll Blut und Wunden«, während von Zeit zu Zeit ein Schmunzeln um seine Mundecken spielte, wie es die Abgeklärten an sich haben, die in der Wüste Thebais ihren Herrgott verehren.
Die Hände tief in den Paletottaschen, den silberbeknopften Bambus unter der linken Achsel und den etwas fuchsigen Zylinder den glitzernden Schneekristallen zugekehrt, zog der quieszierte Aktuarius Herr Aloys Furtwanger still seines Weges.
Seine Herkunft war dunkel, dunkel und geheimnisvoll wie das tägliche Erscheinen der Dohlengeschwader, die beim ersten Morgengrauen bis spät in den Mittag hinein den Kirchturm von Sankt Nikolai umkreisten, um dann wieder spurlos bei den purpurblauen Wäldern von Moyland unterzutauchen. Nichts Genaues war darüber in dem kleinen Städtchen ruchbar geworden. Die junge Generation wagte es überhaupt nicht, aus lauter Respekt vor dem artigen Sonderling und Eigenbrödler, dieses geheimnisvolle Dunkel zu lichten. Es kam ihnen vor wie die zarte Patina am großen Weihwasserkessel, in den noch die schöne Maria, Herzogin von Jülich, Berg und Kleve, ihre alabasternen Fingerspitzen getaucht hatte. Nur die älteren Leute steckten von Zeit zu Zeit die Köpfe zusammen. Sie wußten: war da vor vielen, vielen Jahren der Puppenspieler Herr Xaver Anastasius Furtwanger, gebürtig und ansässig auf dem Filder im Württembergischen, in das hiesige Städtchen gekommen. Er begann sein künstlerisches Programm mit der Genovevalegende, um sein Höchstes mit den Vier Haimonskindern und der rührsamen Geschichte von der schönen Magelone auf die Bretter zu stellen. Seine Tochter, ein wunderseltsames Mädchen, mit samtbraunem Haar und Augen wie Weichselkirschen, half ihm dabei und verstand es, den weiblichen Puppen, vornehmlich der schmerzensreichen Gemahlin des Pfalzgrafen, Leben und Bewegung zu geben. Mehrere Wochen zog Herr Xaver Anastasius Furtwanger mit seinem Thespiskarren in den benachbarten Ortschaften umher, erwarb sich Ruhm und klingende Münze, bis er sich sagen mußte: »Die hiesige Gegend ist abgegrast; du mußt deine Künste weiter rheinaufwärts verlegen.« Sein letzter Besuch galt dem kleinen Flecken Kranenburg, der an der holländischen Grenze gelegen war und mit seinem stiernackigen Kirchturm die weite Niederung beherrschte. Das war um die Zeit, als der Roggen blühte und ein warmer Duft alle Äcker erfüllte. Plötzlich verschwand er, wie von der Erde verschlungen, wie mit einer blanken Sense von der Koppel gehauen, um zu Beginn des folgenden Jahres wieder im hiesigen Kirchspiel unerwartet zu erscheinen – mit einem funkelnagelneuen Stück, wie er sagte, und von allen begrüßt und bejubelt. Am dritten Sonntag nach Epiphania stand denn auch an jeder Straßenecke zu lesen: »Aus besonderer Wertschätzung dem löblichen Publiko gegenüber, so mir schon früher treue Gefolgschaft gegeben, wird von mir am heutigen Abend punkt acht die Historie von Doktor Fausten, gebürtig zu Knittlingen bei Pforzheim, nebst Schmachspruch und Kehrab, zum unwiderruflich ersten und letzten Male aufgeführt werden. Hierzu bittet, schon des großen Nativitätenstellers und Nekromanten wegen, um zahlreichen Zuspruch – Xaver Anastasius Furtwanger vom Württembergischen Filder.«
Die Vorstellung ging unter reger Teilnahme der gesamten kunstsinnigen Bürgerschaft vor sich. Alles schwamm in Wonne und Rührseligkeit. Als aber Herr Xaver, in seiner Eigenschaft als Gottvater, aus der Höhe niederdonnerte: »Dies iræ, dies illa!« und die Puppenspieler-Marie zu antworten hatte: »Herr, sei gnädig dem reuigen Sünder!« versagte ihr die Stimme, und ihr schönes Antlitz verfärbte sich und wurde bleich wie ein Sterbelaken. Noch am gleichen Abend wurde die Ärmste bei den Barmherzigen Schwestern gebettet, genas nach Monatsfrist in schweren Mutternöten eines prächtigen Knäbleins, um nach drei Tagen ihr fieberheißes Köpfchen in die Kissen zu legen und den Tod zu erwarten. Und der Tod kam als Freund und Erlöser. Unter allgemeiner Teilnahme wurde sie zur Ruhe getragen und dicht am Kalvarienhügel bestattet. Ihr großes Geheimnis aber hatte sie mit in die Grube genommen.
Herr Xaver Anastasius Furtwanger – so erzählten die Leute – fluchte und wetterte nicht und verwünschte nicht sein trauriges Schicksal. Er haderte nicht, streckte auch nicht die Faust gegen die Verstorbene aus, um über die geworfenen Schollen zu rufen: »Marie, Marie ...! » Dies irae, dies illa...!« Auch forschte er nicht nach dem, der den Leib seiner geliebten Tochter entweiht und zerstört hatte. Er blieb stumm und gelassen, und die Seelenkundigen orakelten: »Drüben in seiner Heimat wird er vergessen.« Allein ihre gute und wohlwollende Meinung verwirklichte sich nicht, war in den Sand geschrieben, verwehte wie ein überständiges Blättchen im Herbstwind. Herr Xaver Anastasius Furtwanger sah den Württembergischen Filder nicht wieder. Kurz nach der Beisetzung seines einzigen Kindes lag er mit ausgestreckten Armen neben dem Hügel der vom Himmel Gesuchten. Seine Züge verklärte ein versonnenes Lächeln. Er schien glücklich zu sein. Nur das Seltsame war: aus seiner rechten Schläfe rieselte ein rotes, haarzartes Fädchen. Seine Seele war bei Gott, und eine feierliche Stimme war bei ihm: » Requiescat in pace.«
Seit diesem Tage hatte die Stadt, da Vater unbekannt, für den kleinen Aloys zu sorgen. Eine ehrsame, wenn auch wenig begüterte Ellenkrämerin, Jungfer Miekske Beiderwand, wohnhaft am Bollwerk, nicht weit vom jüdischen Tempel, wurde gegen kärgliches Entgelt als Pflegerin des elternlosen Kindes angenommen, und sie waltete ihres Amtes mit rührender Einfalt und selbstloser Nächstenliebe, stündlich darauf bedacht, den kleinen Liebling wachsen und gedeihen zu lassen. Eine gütige Vorsehung griff dabei dem alternden Mädchen liebevoll unter die Arme, denn wie auf ein überirdisches Geheiß brachte alljährlich ein Engel des Herrn, und zwar in Gestalt eines schlichten Königlich preußischen Postbeamten, tausend Taler in das Häuschen am Bollwerk, die das armselige Miekske dazu verwandte, ihren Zögling zu einem gediegenen und würdigen Vertreter der menschlichen Gesellschaft heranzubilden, und auch hier, wie bei der Vaterschaft, war der Donator ein verschleiertes Bild, ein mit einem dichten Nebel umstrudeltes Wesen, das spendete und gab, ohne gesehen zu werden. Selbst bei Beginn dieser Geschichte, wo die Ellenkrämerin Jungfer Beiderwand schon längst das Zeitliche gesegnet hatte und Aloys Furtwanger als emeritierter Aktuarius des hiesigen Friedensgerichtes seine einsamen Tage verlebte, klimperten ihm prompt am Tag des heiligen Martinus tausend blanke preußische Speziestaler in die feinpolierte Kirschholzkommode hinein, und das alljährlich, ohne Spesen jeglicher Art, so aus heiterm Himmel herunter – und Aloys Furtwanger sagte sich jedesmal mit bedenklicher Miene: Virgils Georgica II, 490: »Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. Glücklich, wer zu erkennen vermocht die Gründe der Dinge. Leider! im vorliegenden Fall bin ich nicht glücklich.« Aber dann wieder zitierte er die geflügelten Worte: » Amicus certus in re incerta cernitur. Den sichern Freund erkennt man in peinlicher Lage,« freute sich des rätselhaften Angebindes, das ohne Angabe des Absenders aus dem Holländischen kam, häufelte es sorglich zusammen und sagte, ohne weiter darüber nachzudenken: »Ich kann es gebrauchen, denn meine kärgliche Pension würde nicht reichen, mir die Rosen eines sanften Lebensabends um die Schläfen zu flechten. Nehmen wir hin, was Gott uns verstattet. Es hat den Rechten gefunden. Preis ihm und Dank ihm. Ich kann meine Tage in Beschaulichkeit und Ruhe beschließen.«
Der Emeritierte war bis zum stattlichen Rathaus gekommen. Hier hielt er den Schritt an und schaute verloren über den Marktplatz. Welch selige Winterweihe! Welche Ruhe und Feier! Keines Menschen Fuß störte die bleiche Einsamkeit, keines Vogels Ruf ging durch die verhangenen Lüfte. Noch immer glitten die flaumigen Kristalle traumhaft zu Boden, dann und wann von einem scharfen Luftzug zur Seite getrieben. Die alten spanischen Giebel standen in Weiß, in Musselinschleiern, über und über gepudert und in langen Allongeperücken. Die Dämmerungen des Wintertages begannen schon ihre Garne zu spinnen. Aus der Tiefe der Kramläden glitzerten bereits rote, dunstige Lichter, obgleich die Turmuhr von Sankt Nikolai sich erst anschickte, die vierte Nachmittagsstunde über die verschwiegenen Dächer zu rufen. Der Silvesterabend warf seine Schatten voraus, benahm sich wie ein bissiges Frettchen und hauchte immer größere Eisblumen gegen die angefrorenen Scheiben. Feine Nebelstreifen wirrten sich um die Ziegelmauern des Rathauses und strichen eine schmale Gasse entlang, die zur Grabenstraße führte.
In dieser Gasse stand ein winziges Häuschen, sauber gehalten und mit einem Schild über der Türe, auf dem geschrieben stand: »Spitzengeschäft und Feinplätterei von Röschen Jungklaas, Modistin.«
Blütenschmucke Schirtinggardinen gaben den niedrigen Fenstern ein freundliches Aussehn, und hinter diesen Gardinen perlte die Kantilene eines Harzer Kanarienrollers, heimlich begleitet von dem sanften Klingen und Knistern schaukelnder Schneesternchen.
Scheuen Blickes streifte der Aktuarius das vereinsamte Anwesen, denn er wähnte hinter dem im ersten Stockwerk gelegenen Fenster das Antlitz eines Mädchens zu sehen, eines ältlichen Mädchens mit Vergißmeinnichtaugen und langen Ringellocken, die nach Lavendelwasser zu duften schienen. Das Gesichtchen verschwand aber, als der Herr Aktuarius schärfer sondierte. Gleichzeitig tat sich die Tür auf, und eine resolute Frauensperson, strotzend wie eine Pfingstrose, in einem geblümten Rock, einen wollenen Seelenwärmer um die Schultern geschlagen und in spiegelblanken Holzschuhen, trat ihm kurz entschlossen und mit dem ganzen derben Einschlag eines niederrheinischen Menschenkindes entgegen. Man hätte des Glaubens sein können, sie wäre dem fidelen Jan Steen aus dem Rahmen gesprungen.
»Besonders aufzuwarten, Herr Aktuarius, darf ich mir ein Wörtchen erlauben?«
Ihre rotgoldenen Ohrgehänge klingelten.
»Womit kann ich dienen, Jungfer Christine?«
»Mit 'ner akkuraten Antwort, Herr Aktuarius.«
»Dann müßte ich zuvor wissen, Jungfer Christine ...«
»Ja so!« meinte die Alte und praktizierte ihre patschigen Hände in den gehäkelten Seelenwärmer hinein, »besonders aufzuwarten, das wäre schon richtig. Die Sache ist nämlich ... Sie werden gütigst entschuldigen ... aberst die Angelegenheit ist nicht so einfach zu sagen. Schon um dessentwegen nicht, weil es sich um Mamsell Röschen befindet.«
Herr Aloys Furtwanger zeichnete mit seinem Bambus krause Figuren in den kalten Schnee, wobei es ihm etwas bänglich von den Lippen stolperte: »Sie ist doch nicht krank, Jungfer Christine?«
»Besonders aufzuwarten – nein, Herr Aktuarius. Im Gegenteil: sie befindet sich in schönster Verfassung, läßt aberst fragen, warum Sie nicht mehr kommen tun täten.«
Der Herr Aktuarius Aloys Furtwanger hatte in diesem Augenblick einen bitteren Geschmack auf der Zunge.
»Wurde ich denn erwartet, Jungfer Christine?«
»Aberst ich bitte Ihnen um tausend Gotteswillen, mein Bester! Sie tun ja wie ein heuriges Häschen und wissen doch selber: jeden Sonntag sind Sie Mamsell Röschen willkommen gewesen und sind auch erschienen, teils von wegen den Kaffee mit Waffelns, teils von wegen die Karten, um mit ihr 'ne Partie Sechsundsechzig zu spielen.«
»Schon richtig, schon richtig, Jungfer Christine! aber die Zeitläufte, das traurige Wetter ...«
»Besonders aufzuwarten, Herr Aktuarius, das sind keine Gründe.«
Die Augen der behäbigen Dame begannen zu leuchten.
»Nein, mein Gestrenger, das sind keine Gründe, absolut keine Gründe. Man muß sich ja scharnieren bei hellichtem Tage. Die Nachbarschaft hat schon ihre anzüglichen Galoschen verfertigt und Mamsell Röschen mit spitzigen Distelworten beleidigt.«
»Aber ich bitte Sie, Fräulein Christine!«
»Hier ist gar nichts zu bitten, mein werter Herr Aktuarius, absolut gar nichts zu bitten. Es fällt allgemein auf, daß Sie sich unsichtbar machen, so zu sagen in 'nem geisterhaften Zustand umhergehen, und sind doch sonst so'n liebevoller Freund und treues Faktotum gewesen ... allsonntags immer und die hohen Fest- und Feiertage gar nicht zu rechnen ... und das allzeit zu 'nem Kartenpartiechen und zu 'nem Schälchen mit Aufguß ... und nu seit Martini ist das mit einem Male alle geworden. Besonders aufzuwarten, ich bitte, das bedenken zu wollen, denn ich sage das vor Fräulein Röschen, um ihr die Estimierung und die Dekoration zu bewahren. Im übrigen hat sie mit die Sache gar nichts zu schaffen. Meinerseits aberst ... was ich vor mir aus erachte, das ist auf 'nem andern Brette verzeichnet und kommt jetzt an die Reihe.«
Die komplette Dame fächelte sich Luft zu. Trotz der kratzigen Kälte und der schneidenden Schneekristalle war es ihr tropisch heiß unter ihrem Seelenwärmer geworden. Sie schnappte nach Atem und wetzte ihr Mundwerk.
Aber Herr Aloys Furtwanger kam ihr zuvor und sagte mit scharfer Betonung einer jeden Silbe: »Jungfer Christine, ich bemerkte schon eben: Die unbequemen Zeitläufte, das traurige Wetter ... Aber das nicht allein. Sie müssen nämlich wissen, Fräulein Christine: ich bin zurzeit mit allerlei Dingen beschäftigt ... Erinnerungen aus verklungenen Tagen ... Sammlungen aus der Kerfenwelt ... Schnabelkerfe und andere Kerfe ... Ich registriere und sichte. Außerdem beschäftigt mich eine interessante Lektüre. So des Johannes Fischart ›Jesuiterhütlein‹, sein ›Glückhaftes Schiff‹, sein großartiges Prosawerk ›Gargantua und Pantagruel‹, ›Aller Praktik Großmutter‹ und vor allen Dingen seine prächtige ›Flohhatz‹. Inferner ...«
»Halt!« machte Christine. Ihre blankgescheuerten Holzschuhe klapperten energisch zusammen.
»Nein, meine Liebe, jetzt bin ich an der Reihe zu sprechen, habe ich die Verpflichtung, mir gegenüber und Mamsell Röschen gegenüber eine Lanze zu brechen, denn ich entnehme aus der Art und Weise, wie Sie mir begegnen, daß Sie gewillt sind, mir gewissermaßen eine Verfehlung in die Schuhe zu schieben.«
»Das ist allerdings meine Meinung, denn um dessentwegen habe ich Ihnen aufgelauert, um Ihnen meine Ansicht zu sagen. Früher waren unsere Rodongkuchens und Waffelns von der äußersten Sorte, konnten Sie nicht genug davon kriegen, war Ihnen 'ne Partie Sechsundsechzig mit Mamsell Röschen so zu sagen zur zweiten Angewohnheit geworden, heutigen Tages hingegen ... Wo sind Ihre Visiten geblieben? Ihre liebreichen Worte? Ihre feinen Turnüren? Allens für nichts und die Katze. Seit Martini sind Sie nicht mehr über unsern Bordstein getreten, spielen den unsichtbaren Johannes, obgleich Sie sich tagtäglich zur ›Goldenen Kugel‹ begeben, um dort mit Mynheer Kaldenhoven die langweiligen Dominosteine aneinander zu schieben. Herr Aktuarius« – und ihre stattliche Büste ebbte auf und nieder wie eine getragene Dünung – »zwanzig Jahre hindurch bin ich bei Mamsell Röschen in Kondition und Stellung gewesen, habe ihre Feinheiten begutachtet und bin ihr stets liebevoll und freundlich unter die Arme gegangen – und da hat man doch ein gewisses Interesse daran, wie Sie sich hinsichtlich Ihrer sogenannten Freunde benehmen. Zum Beispiel ... Aberst ich will hier keine Namen benennen, sondern nur fragen: Wo haben Sie in all den traurigen Tagen gestochen?«
Dem quieszierten Herrn lief es bald kalt, bald heiß über den Rücken. Er fühlte es selber: er hatte sich der Mamsell gegenüber ins Unrecht gesetzt, hatte etwas versäumt und war zweifellos der Etikette aus dem Wege gegangen, und hätte er sein Gewissen erforscht, so hätte er sich unter allen Umständen sagen müssen: » Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa«. Mein lieber Herr Aktuarius, du befindest dich auf Wegen, die nicht zu den hasenreinen gehören, du hast Nebengedanken und bist etwas in die Irre gepilgert.« – Allein er konnte und durfte diese Nebengedanken nicht auf den Präsentierteller legen, durfte seine geheimsten und verschwiegensten Regungen nicht so ohne weiteres der profanen Welt offenbaren, und daher, um als freier und unbekümmerter Mann zu erscheinen, warf, er sich steif in seine Bunzlauer Kanne hinein und sagte mit forcierter Stimme: »Jungfer Christine, meine Pfade sind die eines Gerechten. Ich habe nichts zu verheimlichen und nichts zu verdecken, und ich muß nochmals betonen: Jeder Mensch hat so seine eigenen Stunden, die ihm gebieten, sich wie 'ne Kastanie in einen Stachelmantel zu hüllen. Man kann nicht immer Karten mischen und Rodongkuchen essen. Es müssen auch Tage geben, die der inneren Beschaulichkeit dienen. So auch bei mir. Sammlungen aus der Kerfenwelt ... Schnabelkerfe und andere Kerfe ... ihr Leben und Treiben ... ihre Fortpflanzungsweise ... Spinnentiere und ihre Abarten ... menschliche Schmarotzer und solche, die es vorziehen, auf der Epidermis irgend eines vierfüßigen Geschöpfes zu vegetieren ... Ich registriere und sichte und habe darüber Mamsell Röschen vergessen. Dann ferner, was ich schon soeben bemerkte: mich beschäftigt zurzeit eine interessante Lektüre. So unter anderm des Herrn Johannes Fischart ›Jesuiterhütlein‹, sein ›Glückhaftes Schiff‹ und vor allen Dingen seine prächtige ›Flohhatz‹.«
Ein abermaliges »Halt!« von seiten der energischen Jungfrau ließ ihn verstummen.
»Herr Aktuarius,« sagte sie, bald aus dem Hochdeutschen ins Plattdeutsche übergehend und mit einer nicht mißzuverstehenden Klangfarbe in ihrer selbstherrlichen Sprechweise, »was Sie da präposionieren, ist ja recht schön und pläsierlich zu hören. Aberst mit Respekt zu vermelden und besonders aufzuwarten – das soeben Erzählte ... Eck weet dat niet en kann dat niet weete; mar dat weet eck: ich habe Ihnen gegenüber meine kriminellen Verdächte.«
Ihre Augen wurden wie Teetassen, und ihre Halbkugeln gerieten in eine erregte Brandung.
»Verdächte?!« rief Herr Aloys Furtwanger ganz aus dem Häuschen, trat einige Schritte zurück und sah auf Christine wie auf das Strafgericht Gottes.
»Ja, meine kriminellen Verdächte.«
»Gegen wen denn, Christine?«
»Gegen Ihnen, mein Lieber, denn wenn einer einem schon mit 'ner Flohhatz unter die Augen begegnet und mit die anderen Fisimatenten, dann ist das gerade so, als wenn einer mit 'nem Messer in 'ne Speckseite hineinstößt und einem weismachen tut: ich will kein Stück davon haben und verzichte auf allens. Nein, mein hochverehrter Herr Aktuarius, Sie imponieren mir gar nicht, Sie können mir leid tun. Sie können Mamsell Röschen und mir ...«
Da war's alle mit dem duldsamen Beamten. Der sonst so ruhige und insichgekehrte emeritierte Vertreter eines Königlich preußischen Friedensgerichtes hob den silberbeknopften Bambus wie einen Marschallstab in die Höhe und krähte: »Mamsell Christine, was soll ich und kann ich?! Was wollen Sie überhaupt von mir, und welche Unterstellungen versuchen Sie unter meine saubere Weste zu schieben? Ich bin doch nicht mit Röschen Jungklaas verlobt oder ihr nach dem Code Napoleon rechtlich angetraut worden! Ich bin ein freier Vertreter der bürgerlichen Gesellschaft, Herr meines Willens und ausschließlicher Anwalt meiner Neigungen und Abneigungen. Wollen Sie mir die ›Flohhatz‹ oder vielleicht die Lektüre des ›Jesuiterhütleins‹ des bedeutsamen und hochseligen Herrn Johannes Fischart verbieten? Oder aber bin ich vielleicht der von mir hochgeschätzten Dame in Gedanken, Worten und Werken zu nahe getreten, etwa im Sinne des Artikels 340 des französischen Gesetzgebers vom 20. März 1804, der da lautet« – und er knurrte ingrimmig in seine Vatermörder hinein: » La recherche de la paternité est interdite? Ich bitte um Antwort, Jungfer Christine, um eine präzise und sachliche Antwort. Da Sie aber nicht imstande sind, mir diese verstatten zu können ... und daher: Schweigen Sie lieber, schweigen Sie unter jeder Bedingung, sonst: Herr Jeses nochmal! wo sollte das hinführen, wenn Sie versuchten, sich in dieser Hinsicht expektorieren zu wollen? Im übrigen« – und der erregte Herr schlug einen versöhnlicheren Ton an – »ich bin gerne bereit ... wenn meine Zeit es erlaubt ... genau so wie in früheren Tagen ... submissest und mit schuldigem Respekt zu vermelden ... Nun, Sie verstehen mich schon, Jungfer Christine. Seien wir Freunde, nehmen wir erneut die alten Beziehungen auf, selbstverständlich ohne Verpflichtung, ohne uns auf die Dauer vor Anker zu legen. Jedem seine persönliche Freiheit. Der Mademoiselle ihre Freiheit und mir meine Freiheit. Quod notamus lex est,« und zum Zeichen dessen lüftete der zierliche, etwas vermickerte Herr seinen Zylinder mit einer leichten, aber äußerst zeremoniellen Grandezza.
Über das pontakrote Gesicht der energischen Dame lief ein freudiges Leuchten. Die verbindlichen Worte des auf Ruhegehalt gesetzten Herrn waren auf fruchtbares Erdreich gefallen. Sie schmunzelte wieder, denn die früheren gemütlichen Plauder- und Dämmerstündchen, gehoben durch eine Partie Sechsundsechzig und diverse Schüsseln mit Waffeln und Rodongkuchen, stiegen vor ihr auf wie eine liebliche Fata Morgana, wie ein Bild der Verklärung. Sie dachte dabei an ihre Gebieterin, an Mamsell Röschen Jungklaas, und in gehobener Stimmung führte sie einen Zipfel ihres molligen Seelenwärmers gegen die tränenden Augen.
In diesem Augenblick klimperten die dünnen und verwaschenen Töne eines Spinetts aus dem kleinen Häuschen herüber, wie die Stimmchen von Zwitschermäuschen, wie das ängstliche und verhaltene Piepsen von unflüggen Vögeln.
Christine horchte auf und tat einen seligen Blick gegen den grauen Winterhimmel, der noch immer mit seinen Myriaden kalten Schneesternchen flinzelte.
»Nu spielt sie die ›Klosterglocken‹,« seufzte sie still vor sich hin. »Nu ist sie wieder ganz Weihe und Wonne. Besonders aufzuwarten, Herr Aktuarius, nu denkt sie an Ihnen. Ach, diese Seele von Frauenzimmer, dieses Bildnis voll inniger Liebe!« und mit weicher Betonung setzte sie hinzu: »Ach, diese Klosterglocken! Dieser Vortrag! Diese sogenannte Kunstfertigkeit! Und das allens um dessentwegen. Eck weet dat niet en kann dat niet weete; mar dat weet eck: Herr Aktuarius, nu dürfen wir uns wieder in 'ner angenehmen Hoffnung befinden. Ich meine die mit die genüglichen Sonntagnachmittagsvisiten, die schummerigen Plauderstündchens und die knappigen Waffelns.«
»Wir dürfen, wir dürfen, Jungfer Christine. Aber alles mit Vorsicht, mit einer gewissen Reserve, so zu sagen mit einer Rückversicherung auf die persönliche Freiheit. In diesem Sinne meine verbindlichsten Grüße, an Mamsell Röschen. Möge Sie einen behaglichen Silvesterabend verleben, gefestet in sich und im Gottvertrauen auf die kommenden Tage. Damit will ich mich empfohlen haben, Jungfer Christine.«
»Merci und meinen gehorsamsten Ausdruck,« sagte die Alte, und sie verfolgte mit großen Augen den Abmarsch des gediegenen Herrn, der unter den spitzen Klängen der ›Klosterglocken‹ durch das schmale Gäßchen der Grabenstraße und seinen häuslichen Penaten zustrebte, und sie verfolgte ihn, bis er untertauchte in dem Gewirr und Geknister der eisigen Flöckchen.
Als er ihren Blicken entschwunden war, kehrte eine gewisse Ernüchterung zurück.
»Was hat er gesagt?« fragte sie sich nach einigem Nachsinnen. »Ja so,« meinte sie endlich. »Wir dürfen, wir dürfen. Aberst alles mit Vorsicht, mit einer gewissen Reserve, so zu sagen mit einer Rückversicherung auf die persönliche Freiheit. Kuck einer mal an! Er mag ja, wie Mamsell Röschen vermutet, ein gütiger und wohlwollender Herr sein, mit Complaisanzen und ähnlichen Dingen. Aberst ich kann mir nicht helfen: ich traue ihm doch nicht; er hat's hinter den Ohren und gibt uns Nüsse zu knacken, Pferdsnüsse mit glasharten Schalen. Dazu muß man 'nen Nußknacker haben.«
So weit Christine.
2
Röschen Jungklaas saß vor ihrem dünnwadigen, engbrüstigen Spinett und spielte die ›Klosterglocken‹ von Wely.
Die grauen Schatten des kalten Wintertages häkelten sich bereits durch die niedrige Stube, allein es war noch immer hell genug, die einzelnen Gegenstände deutlich erkennen zu können. Alles gab sich schlicht und einfach, aber freundlich und seßhaft. In einer Ecke näselte ein blankgewichstes Öfchen, dessen Aufsatz zwei hellgescheuerte Messingschlangen umringelten. Ein großblumiges Sofa nahm die eine Längsseite des Zimmers ein, geschmückt mit perlgestickten Schonern und Schlummerrollen, so recht dazu angetan, ein gediegenes Mittagsschläfchen zu gewährleisten. Daneben stand eine opulente Glasservante, ausstaffiert mit Tassen und Täßchen, Vasen und Väschen und lieben Erinnerungen aus längstverblichener Jugendzeit, während sich auf der gemaserten Plattform ein ausgestopfter Kakadu breit machte, umgeben von Nippsachen, Ammonshörnern und großzinkigen Seemuscheln, die in allen Farben des Regenbogens perlmutterten. Darüber hing unter Glas und Rahmen ein amtliches Schriftstück, dessen Inhalt Röschen immer zum besten gab, wenn sie vornehmen Besuch hatte, und dann las sie mit Stolz und gehobener Stimmung und mit Augen, in denen ein helles Wasser glitzerte: »Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen, haben Uns bewogen gefunden, dem Steuerempfänger Franz August Kasimir Jungklaas in Anbetracht seiner großen Verdienste um Staat und Vaterland Unseren Königlichen Rothen-Adler-Orden vierter Klasse zu verleihen und ertheilen demselben über den rechtmüßigen Besitz dieser Auszeichnung das gegenwärtige Beglaubigungsschreiben mit Unserer eigenen Unterschrift und dem beigedrückten Königlichen Insiegel. Gegeben Berlin, den 14. Mai 1824. Friedrich Wilhelm. – »Und dieser Franz August Kasimir Jungklaas,« fügte alsdann Röschen hinzu, »ist mein Vater gewesen, und wäre es ihm verstattet worden, noch weiter zu leben und seinem wohlgeneigten König zu dienen, den Rothen-Adler-Orden dritter Klasse hätte er sich zweifellos auf die Brust heften können, sich selber zur Freude und seinem König zur Ehre,« und dann schluchzte sie still vor sich hin und hing das amtliche Schriftstück wieder an den vergoldeten Nagel, und es war eine Weihe und ein seliger Friede in der Stube des bereits gealterten Mädchens, wie nicht in der Kirche zu finden ... und jetzt saß Röschen Jungklaas vor ihrem magerstimmigen Spinett und spielte die ›Klosterglocken‹ von Wely, während der Kanarienvogel ganz sacht in die Weise hineindämmerte und spitze Schneekristalle gegen die Scheiben klimperten.
Wie gesagt, Röschen zählte bereits zu den gealterten Jungfrauen, hatte Vergißmeinnichtaugen, straffgescheiteltes Haar und beiderseits zwei zierlich gedrehte Schmachtlocken hängen, die bei jeder Bewegung in ein gelindes Schaukeln gerieten. Die niedliche Figur steckte in einem bunten Kleidchen von Zitz, das sich über einer breitausgelegten Krinoline straffte und steifte. Die resedafarbigen Volants glitten über rahmweiße Strümpfe und Lastingschühchen mit Spitzen von Glanzleder. Alles an Röschen Jungklaas war wie aus dem Ei gepellt, war adrett und wie aus einem Raritätenkasten genommen. Ein Maßliebchen auf einer jungen Frühlingswiese konnte sich nicht lieblicher und freundlicher geben. Nur in ihrem bereits etwas verhutzelten Antlitz, das in jungen Tagen schön gewesen sein müßte und auch jetzt noch des Zaubers nicht entbehrte, standen Blicke, die von einer stillen Resignation und von schönen Hoffnungen erzählten, die sich bis jetzt nicht erfüllt hatten. Allein diese Augen waren gütig und menschenfreundlich und sprachen an wie die schönen Bibelworte, die da lauten: »Und da ich meinem Freunde aufgetan hatte, war er weg und hingegangen. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht; ich rief ihn, aber er antwortete mir nicht,« und wer genauer zusah, konnte auch heimlich drin lesen: »Alles verstehen, heißt alles verzeihen,« aber nur andeutungsweise, mit einem gewissen Vorbehalt und getragen von den Schwingungen einer ängstlichen Seele.
Schon frühzeitig hatte es Röschen gelernt, ihre Hände zu regen und sich auf eigene Füße zu stellen. Die ihr nach dem frühen Tode der Eltern überkommenen Besitztitel waren nicht groß, aber sie verstand es, sie auszumünzen und sich hierdurch ein sorgenfreies Dasein zu schaffen. Ihr Geschäft rentierte sich, und ihr Ruf als Modistin wetteiferte mit dem ihrer gefeierten Kolleginnen in der benachbarten Kreisstadt. Für ihre Feinplätterei, in der mehrere junge Mädchen angestellt waren, hatte sie eine treffliche Stütze in Christine Jordans gewonnen, die nebenher den Haushalt besorgte, sich als die Getreuste aller Getreuen erwies und in Röschen das lieblichste aller lieblichen Wesen erkannte. In Röschen glaubte sie ihr Alpha und Omega gefunden zu haben, ein zärtliches Abbild echter Jungfräulichkeit, die Zierde der Stadt und die Krone aller Modistinnen zwischen Kleve und Xanten. Gewiß, ein zarter Lavendelduft umspielte bereits das liebenswürdige und honorige Mädchen, mehr als vierzig Jährchen hatten ihren blonden Scheitel berührt, und die niedlichen Krähenfüßchen um Augenwinkel und Mundecken waren nicht mehr fortzuleugnen; aber was sollte das alles?! Ihre Taille war wie die einer Wespe, ihr Lächeln wie das Lächeln einer Zentifolie, und wenn sie im Schmuck ihrer weitausgelegten Krinoline, angetan mit Kapotthütchen und seidenem Cachenez, ihre Lastingschühchen auf und nieder bewegte und in den Kirchenstuhl hineinwippte, dann steckten die Frauenzimmer die Köpfe zusammen und tuschelten heimlich: »Nein, dieses Röschen! Die Mamsell ist weiß Gott noch in der Lage, 'nen Mann glücklich zu machen« – eine Ansicht, die auch Christine Jordans vertrat, eifrigst verfocht und mit allen Mitteln einer gesunden Kombinationspolitik zu verwirklichen suchte ... und sie war dabei auf den quieszierten Aktuarius des Königlichen Friedensgerichtes verfallen, von dem schönen Grundsatz beseelt, die klugeingefädelte Angelegenheit habe aufzuspringen wie die Knospe einer köstlichen Christrose in stiller und glorreicher Weihnacht. Alles schien auch zu ihren Gunsten zu sprechen. Die angeregten Tee- und Kaffeevisiten nahmen ihren präzisen Verlauf, die knusperigen Waffeln animierten, und die verschiedenen Sechsundsechzig-Partiechen machten den Eindruck, als wenn sich zarte Bande zu flechten begönnen, als mit einem Male, so aus dem Nichts heraus und gegen alle Gepflogenheit, gegen Etikette und Anstand ... unglaublich und doch wirklich und wahrhaft geschehen: der Herr Aktuarius Aloys Furtwanger war seit Martini nicht mehr über Röschens Schwelle getreten und hatte selbst den Kirchenstuhl, den er sonst mit ihr zu teilen pflegte, ängstlich gemieden, eine unbestrittene Unterlassungssünde, die unangenehm auffiel und Veranlassung gab, das Freundschaftsverhältnis zwischen den allgemein geachteten Leutchen als wenigstens erschüttert hinzustellen.
Vornehmlich hatte Christine schwer darunter zu leiden. Sie zermarterte und zerquälte sich und bot alles auf, die aus dem Leim geratenen Dinge wieder in Schick und Richte zu bringen. Soeben hatte sie damit ernstlich begonnen, hatte den Abtrünnigen zur Rede gestellt und klapperte jetzt, noch ganz benommen von der heiklen Szene, in die warmdurchkachelte Stube hinein, weißübersprenkelt von eisigen Flöckchen, die langsam in dem warmen Hauch des traulichen Öfchens zergingen. Die ›Klosterglocken‹ verstummten.
Röschen erhob sich und sah ängstlich in das gerötete Antlitz der stattlichen Dame.
»Nun?« fragte sie schüchtern.
»Mamsell, ich habe ihm gegenüber meine unmaßgebliche Meinung geäußert.«
»Wieso das?«
»Eck hefft em geseit, aberst feste und mit allen Schikanen.«
Ihre Stimme war wie die eines unnachsichtlichen Gerichtsbeamten geworden.
»Das hätten Sie nicht tun sollen, Christine.«
»Warum nicht? Dickfellige Karnickels und unsichere Kantonisten muß man an ihre Pflichten erinnern, sonst hat man das Nachsehen und kuckt in 'nen Kasten hinein, wo nichts mehr nicht drin sich befindet.«
»Da haben Sie Ihre Rechte überschritten, Christine. Sie sollten in gütiger und sachlicher Weise ihm dartun, daß ich mich freuen würde, wenn die alten Beziehungen wieder Grund und Boden gewönnen.«
»Ist promptens erledigt.«
»Und daß es mir angenehm wäre, mit ihm an Sonn- und Feiertagen wieder Sechsundsechzig zu spielen.«
»Auch dieses.«
»Und daß er es aufgeben möchte, in auffallender Weise meine Person während des Hochamts zu meiden.«
»Eck hefft em geseit,« wiederholte die Alte mit scharfer Betonung eines jeden Wortes und unter dem harten Geklingel ihrer rotgoldenen Ohrgehänge, »aberst nochmals gesagt: feste und mit allen Schikanen, denn Dingen, die nach einer gewissen Biesternis schmecken, muß man auch mit einer gewissen Biesternis seines Herzens begegnen.«
»Mein Gott!« seufzte Röschen, »Sie sind doch nicht zu weit gegangen, Christine? Sie müssen immer bedenken: der Herr Aktuarius ist eine feinbesaitete Seele, ein Mann der Einsicht und des stillen Sinnierens. Sein Fühlen und Erwägen erinnert an den zarten Schmelz von Schmetterlingsflügeln, und seine Forschungen auf dem Gebiet der kleinen Tierwelt haben Anerkennung gefunden und sind in allermanns Munde.«
»Ach, das mit die ›Flohhatz‹! Kann mir gar nicht imponieren, Mamsell, und das, was er mir von dem ›Jesuiterhütlein‹ erzählt hat, besagt nur zu deutlich, daß er auf 'nem minderwertigen christkatholischen Standpunkt herumturnt. Besonders aufzuwarten, Mamsell – es handelt sich hier um pressantere Dinge, und dessentwegen bin ich ihm äußerst deutlich gekommen.«
»Dann haben Sie Ihre Anweisungen weit überschritten.«
Über Röschens Antlitz flog ein ängstliches Zittern.
»Woso denn?« begehrte die Alte auf und zog die Zipfel ihres gehäkelten Seelenwärmers straffer zusammen. »Er hat Ihnen doch ein reguläres Eheversprechen gegeben.«
Röschen trat entsetzt einige Schritte zurück.
»Was hat er gegeben?« fragte sie tonlos.
»Ein Eheversprechen, gehorsamst zu melden.«
»Nein,« sagte die Ärmste und betupfte mit ihrem Spitzentuch die geröteten Augen, in denen ein helles Wässerchen aufglitzerte, »ein solches hat er niemals gegeben.«
»Aberst ein halbes, Mamsell?«
»Auch das nicht. Es ist niemals davon die Rede gewesen, weder in Gedanken, noch in Worten und Werken.«
»Nanu!« sagte Christine und tat so, als wäre sie aus allen Himmeln gepurzelt. »Nu wird's hellichter Tag oder stockfinstere Nacht, je wie man's nimmt. Er ist doch allsonntags bei Sie in der Guten Stube gewesen.«
»Ich kann es nicht leugnen,« versetzte Röschen unter verhaltenen Tränen.
»Und hat unsern Rodongkuchen, unsern piekfeinen Mokka und Peking genossen. Besonders aufzuwarten unsern Mokka und Peking von Harkopp & Söhne.«
»Auch das gebe ich zu.«
»Dann müssen Sie auch zugeben, Mamsell, daß er mit Ihnen Sechsundsechzig gespielt hat, ganz solo, ganz mit Ihnen alleine und vielfach, wenn schön so'n angenehmes Schummern durch die Gardinen hindurchkuckte. Und wenn einer solches besorgt, wenn einer immerzu kommt, verliebte Nasenlöcher macht, unsere Waffelns mangiert und kein Licht haben will, wenn die Karten sich schon mit 'nem gewissen Düstern umziehen – wenn einer so was unternimmt und das mit einer, die als reines Mädchen ihre jungfräulichen Tage vertan hat, der hat ihr auch vor Gott und von Rechtswegen die Ehe versprochen.«
»Mein Herr und mein Jesus!« schrie Röschen und mußte sich an ihrem Spinett halten, um nicht in die Knie zu sinken, »wie kommen Sie auf solche Geschichten, auf solche Beschuldigungen? Wer sagt Ihnen das? Wie wollen Sie das alles beweisen? Wer gibt Ihnen das Recht dazu, solche Ungeheuerlichkeiten auf die Lippen zu nehmen?«
»Mein Standpunkt und mein gerechter Instinktus,« versetzte Christine, und die fünf Finger der rechten Hand lagen beschwörend auf ihrem stattlichen Busen. »Und warum er zeitweilig abgeschwenkt hat,« fuhr sie mit erhobener Stimme fort, »solches kann ich Ihnen auch belegen, denn ich gehöre zu denen, die ihre Beobachtungen machen, ohne dabei als 'ne neugierige Henne verschlissen zu werden. Sie müssen nämlich wissen, Mamsell« – und die resolute Person streckte sich hoch wie ein Scheumann im Kornfeld – »da steckt ein gewisses Faktotum dahinter. Und dieses Faktotum befindet sich in unserem eigenen Hause – und dieses Faktotum ist in unserer Feinplätterei beschäftigt – und dieses Faktotum benennt sich Nellecke und ist dem alten Kaptän Moritz van Dornick die seine, demselben Moritz van Dornick die seine, der im Altmännerhaus wohnt. Tür an Tür mit dem Leinweber Johannes Terstegen. Und das ist die Wahrheit, und so was kann ich auf meine erste heilige Kommunion nehmen und mit meinen zehn Fingern bekräftigen, so wahr mir Gott helfe von jetzt an bis in alle Ewigkeit, Amen.«
Röschen war bleich geworden wie der Schnee, der draußen die Fensternische umglitzerte. Sie ließ ihre Lider herunter wie jemand, der willens ist, in weite Fernen zu lauschen. Dann aber: mit einem Ruck trat sie näher, griff nach der Hand Christinens und zitterte am ganzen Körper. Ihre lichten, vergißmeinnichtblauen Augen gerieten ins Flammen.
»Und da wollen Sie behaupten, Christine, da wollen Sie sagen: dieses Fräulein van Dornick, der ich gut war und die ich wie meinen Augapfel hütete ...«
Christine unterbrach sie mit einer großen Handbewegung.
»Besonders aufzuwarten, Mamsell – von Nellecke will ich absolut nichts behaupten, denn sie soll ja so halber mit dem jungen Terstegen verlobt sein, der auf Schulmagister studiert hat und in Obermörmter 'ne powere Lehrerstelle bekleidet. Nein, von ihrer Seite ist keine Befürchtung zu hoffen. In dieser Beziehung muß ich Ihnen mit der kalten Schulter beglücken; denn sie hält Gott vor Augen und ihren Stand als Jungfer in Ehren. Aberst von seiner Seite, Mamsell, von dem Herrn Aktuarius seiner ... denn ich frage mir immer: Warum hockt er allzeit mit dem alten Moritz zusammen, der gotteslästerlich flucht, immerzu priemt und, wie Herr Johannes Terstegen behauptet, mal an seinem furiosen und immerwährenden Punschtrinken eingeht?«
»Das sind keine stichhaltigen Gründe, Christine, die den Angefeindeten zu belasten vermögen.«
Ihre Stimme fröstelte bei dieser Einwendung wie Espenlaub, und abermals tupfte sie sich mit ihrem Spitzentuch gegen die geröteten Augen.
»Zugegeben, aber ein würdiges Sprichwort besagt: Wer die Tochter liebt, sucht die Mutter zu freien. Da aberst in vorliegendem Fall sich letztere nicht mehr auf Erden befindet, hat sich die Zuneigung auf den alten Moritz gewendet, der, wie ich annehme, mit dem Herrn Aktuarius äußerst dakkor ist. Und besonders aufzuwarten, Mamsell – sie hat ihm schon längst in die Augen gestochen, ich meine: sie ihm und nicht er ihr vom konträrigen Standpunkt, und darin liegt für ihn der Hase im Pfeffer, obgleich ich jetzt freundlicher denke, weil er auf meine richterliche Frage: Herr Aktuarius, nu dürfen wir uns wieder in der angenehmen Hoffnung befinden? gesagt hat: Wir dürfen, wir dürfen! – so daß wir annehmen können: die früheren Tage mit den netten Kleinigkeiten des Lebens sind wieder im Anzug, was ich für äußerst lieblich und bedeutsam ansprechen möchte.«
»Und für Fräulein Nellecke,« setzte die Mamsell ergriffen hinzu, »lege ich meine Hände ins Feuer.«
»Ich gleichfalls dito,« konstatierte Christine.
»Auch für ihn,« folgerte Röschen in schmerzlicher Ergebenheit, »auch für ihn möchte ich dasselbe behaupten; denn alles in allem genommen: er ist mir von jeher ein liebevoller Freund und Berater gewesen, dabei ein Kavalier vom lautersten Wasser. Und wenn er meine Fingerspitzen berührte ... ich sage Ihnen, Christine, wenn er meine Fingerspitzen berührte ...«
Ihre Worte erstickten. Sie mußte sich abwenden, um nicht von der Erinnerung überwältigt zu werden.
»Ja, wenn er meine Fingerspitzen berührte ...«
»Schon möglich,« sagte die Alte, »aber Vorsicht ist von jeher die Mutter des Porzellanschrankes gewesen. Wir müssen ihm gegenüber Beobachtung halten. Wir müssen zusehen, wie er sich mausert, und ob er gewillt ist, den alten, gediegenen Adam wieder gegen den neumodischen in Umtausch zu nehmen ... und die Zeit wird lehren, ob seine Plüschpantoffeln und Ihre feinen Saffianschühchen ...«
»Um Himmelswillen! was wollen Sie damit sagen, Christine?!« freute sich Röschen und war nahe dabei, ihren verhaltenen Jubel laut werden zu lassen.
»Allens was recht ist und was ich vor meinem Herrn und Erlöser verantworten werde,« versetzte Christine, »und damit will ich mich in die Bügelstube begeben und nachsehn, ob die Feinplätterei schon an die Herrschaften verschickt ist, denn morgen rufen sie: Prosit Neujahr! und müssen sich aufs Nobelste herausmunterieren. Mamsell, ich habe die Ehre.«
So Christine, und als Röschen Jungklaas sich umsah, war sie allein in der Stube. Wie ein Wirbelwind drehte sich das Gehörte in ihrem Köpfchen herum.
Sie wußte vorderhand nicht ein und aus. Sie mußte sich setzen, und sie setzte sich auf das blumige Sofa neben der schönen Glasservante mit dem ausgestopften Kakadu, den Ammonshörnern und großzinkigen Seemuscheln, die in allen Farben des Regenbogens perlmutterten. Gottergeben legte sie die Hände zusammen.Ihre feuchten Blicke fielen auf das amtliche Schriftstück, und sie dachte dabei an ihren heimgegangenen Vater, der Königlicher Steuerempfänger gewesen war und im Leben etwas vorgestellt hatte ... und ihre Gedanken gingen in längstverschwundene Tage zurück, wo sie unter vielen Mißhelligkeiten ihre Feinplätterei eröffnet hatte, ihr Spitzen- und Modeunternehmen, und sie konnte zufrieden sein mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit, denn alles blühte und grünte um sie wie in einem Frühlingsgarten, und selbst der Herr Pastor sagte ihr bei jeder Gelegenheit: »Bei Ihnen, Fräulein Röschen, muß der liebe Gott gerne verweilen, denn er gibt Ihnen doppelt und dreifach und hat Sie erhoben unter den Modistinnen in der ganzen Umgebung« und dann verließ er sie stets mit einem gütigen Lächeln. Und ihre Sehnsucht trat leise über den Hausflur, glitt über den knisternden Schnee und verfolgte den Weg, den der Herr Aktuarius eingeschlagen hatte, ganz heimlich und unauffällig, eingemummelt und der Zukunft gedenkend. Sie schloß die vergißmeinnichtblauen Augen, während die Lippen einen Namen stammelten, der ihr schon seit Jahren lieb und teuer gewesen.
»Aloys Furtwanger!« hauchte sie glücklich. »Ach, diese Melodik! So könnte ein Dichter heißen. Aloys Furtwanger!« und sie vergaß alles Leid, das er ihr durch sein Fernbleiben angetan hatte, und dachte nur an die zukünftigen Tage. –
Inzwischen war der einsame Herr Schritt für Schritt über die Grabenstraße gepilgert, und zwar etwas benommen und verweht durch die Auseinandersetzungen, die er mit der alten Christine hatte durchfechten müssen. Wenn er sein Gewissen erforschte, so konnte er es nicht für ganz einwandfrei und selbstlos erklären. Das bedrängte ihn ernsthaft, obgleich er sich sagen mußte: »Strenggenommen habe ich mir nichts vorzuwerfen, habe nichts getan gegen Sitte und Ordnung und bin zeitlebens ein leidlicher und korrekter Beamter gewesen. Und das mit Röschen?! Freilich ist mir zeitweilig der Gedanke gekommen, ihr zuzuflüstern: Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich tun, denn die ganze Stadt meines Volkes weiß, daß du ein tugendsam Weib bist. Aber dann wieder klang es mir zu: Sie ist schon aus dem ersten Schmelz heraus, ist in die sanfte und milde Atmosphäre der Kamille getreten, und wenn sie auch noch immer bezaubert: die Äpfelchen des Paradieses ... Leider, leider!« – und der kleine, zierliche Herr im Zylinder, das drollige Männchen, das in seinem braunen Überzieher wie eine Bunzlauer Kanne aussah, wurde alert und übermütig, schlug mit seinem Rohrstock eine sirrende Volte und sagte: »Leider, leider! denn mein Herz sehnt sich nach Betätigung, nach Anmut und Jugend, nach kerniger und blühender Jugend.« Ach, Gott, ja! die Auferstehung des Fleisches war in ihm, und sie entfaltete sich in der harten Luft wie ein klingelndes Schneeglöckchen in laulichen Märztagen, und dann wieder wurde er im Weiterschreiten ernst und nachdenklich und bröselte still vor sich hin: »Indessen jedoch, du bist unvorsichtig und unbedachtsam gewesen, hättest die Etikette beobachten müssen und die gewohnten Visiten nicht einstellen dürfen. Dieses Verhalten – das ist dein Fehler, deine Unbesonnenheit und dein großes Unrecht gewesen. Aloys Furtwanger, emeritierter Aktuarius am hiesigen Friedensgericht, das muß anders werden, ganz anders ...!«
Aber was half ihm das alles? Die heiße innere Glut gewann abermals die Oberhand, und trotz Winterweh und Winterleid begann das vermickerte Kerlchen hellauf zu singen:
»Rundgesang und Gerstensaft Lieben wir ja alle; Darum trinkt mit Mut und Kraft Schäumende Pokale! Bruder, deine Liebste heißt ...?«
Er schickte sich an, den Namen seiner Angebeteten durch die frostigen Schneekristalle zu rufen, als er jählings verstummte, wie Zacharias, der Oberpriester, verstummte, als er den Rauchaltar des Herrn bediente, denn ein dralles, schmuckes Mädchen überholte ihn, grüßte und ging eiligst vorüber – ein Mädchen in derben Schuhen, aber leicht gefesselt, kerzenaufrecht, rosig überhaucht und die straffe Büste von einer schlichten, wollenen und mit Kaninchenfell verbrämten Jacke verhüllt – ein Mädchen, als schritte ein lachender, lockender Frühlingstag durch den vergrämelten Winter ... und trug ein Körbchen mit geplätteter Wäsche im Arm, und wandte sich dem Altmännerhaus zu, wo es bald darauf im Portal des weitläufigen Gebäudes verschwand, um nicht mehr gesehen zu werden.
»Nellecke!« flüsterte er mit verzückten Augen, schlug zum andern eine sirrende Volte mit seinem silberbeknopften Rohrstock und sagte mit erhobener Stimme: »Ha, das war sie, da ging sie! Herz, was willst du noch mehr?! Und dieses mein Herz sehnt sich nach Betätigung, nach Anmut und Jugend, nach saftigen und prallen Weinbeeren!« und dann Hub er wieder zu singen an:
» Toujours fidèle et sans souci, C'est l'ordre du Crambambuli! Darum trink mit Mut und Kraft Schäumende Pokale! Bruder, deine Liebste heißt ...?
Nellecke!« gab er sich selber die Antwort. »Nellecke, Nellecke!«
Er rief es laut und gediegen, und er konnte auch laut und gediegen rufen, denn er war allein auf weiter Flur und niemand war bei ihm, der imstande war, ihm das süße Geheimnis vom Munde zu nehmen. Nur die spitzen Schneesternchen hasteten lautlos vorüber und betteten sich auf die weiße Decke, die immer höher und flaumiger wurde.
Herr Aloys Furtwanger war nicht wieder zu kennen. Unentwegt hingen seine Blicke an dem grauen Gemäuer, dessen Giebel und gewalmte Dächer dunstig in den Abendhimmel hineinwuchsen.
Das Altmännerhaus war ein Gebäude aus dem fünfzehnten Jahrhundert, aus Klinkern gefügt und zur Förderung der Heiligen, zur Mehrung und Erhöhung der gottesdienstlichen Feier und zur Verwandlung des weltlichen, vergänglichen Gutes in geistliches, unvergängliches um Jesu Christi willen von dem Herrn Provisor Balthasar Heysing und seiner Herzallerliebsten, der ehrsamen Frau Maria Salomea, gestiftet und den bresthaften Menschen dargebracht worden. Über dem Hauptportal befand sich ein Bildstock des mannhaften Ritters und Drachentöters Sankt Georg. Darunter stand in Stein gemetzet zu lesen:
» Hic habitat pauper, dives miserere precantis; Da, centena dabit restituetque Deus,«
welches der hochedle und wohlgelehrte Landdechant hujus loci, Herr Stephan van Hag, also verdeutschte:
»Siehe, hier wohnet der Arme; du, Reicher, erbarme dich seiner; Gib! denn hundertfach weist Gott dir ja alles zurück.«
So der achtbare und löbliche Herr Stephan van Hag. Aber nicht nur bedürftige und bresthafte Leute fanden hier liebevolle Aufnahme, sondern auch solche, die den Lebenssturm und die Anfechtungen des Daseins hinter sich hatten, die sich nach Ruhe sehnten und willens waren, gegen Hinterlegung ihres Ersparten die geruhsame Nacht zu erwarten und die goldenen Bilder, die ihnen die Anschauung des ewigen Gottes verhießen.
Zu diesen gehörte auch Moritz van Dornick, der Schiffskapitän, der Jahrzehnte hindurch den Kohlenfrachter ›Maria, sei mit uns‹, in Firma Matthias Stinnes & Söhne, zwischen Duisburg-Ruhrort und Rotterdam betreut und geführt hatte, und der hochbetagte Leinweber Johannes Terstegen, dessen Sohn Lambert im benachbarten Obermörmter als Lehrer fungierte. Die beiden Herren wohnten Tür an Tür und hatten mit Aloys Furtwanger innige Freundschaft geschlossen, und weil nun Moritz van Dornick ein wäscheblaues Zimmer, Johannes Terstegen ein weißgekalktes innehatte, so hieß jener im Volksmund allgemein der ›blaue‹, dieser der ›weiße Mynheer‹, zwei Titulaturen, die sie mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Würde zu tragen verstanden und sich ehrlich freuten, also angesprochen zu werden.
Im Erdgeschoß des weitläufigen Gebäudes, und zwar hinter dem dritten und vierten Fenster von rechts gerechnet, hatte sich Moritz vor Anker gelegt, und diese Fenster waren es gerade, die der Herr Aktuarius mit einem besonderen Wohlgefallen betrachtete und von denen er sich nicht losreißen konnte, obgleich sie nichts Merkwürdiges zeigten, es sei denn, daß man die beiden strotzenden Meerzwiebeln, die in braunglasierten Töpfen hinter den angelaufenen Scheiben standen, als solches hinnehmen wollte. Auch die sauberen Vorsetzer boten keinen nennenswerten Reiz dar. Schlichte Häkeleien ... und dennoch beäugte er sie, als müsse er die umsponnenen Rahmen wie mit Nadelspitzen durchstechen, um hinter ihnen das entschleierte Bild von Sais zu finden.
Endlich setzte er sich wieder in Bewegung. Nur noch einige Schritte und er hatte sein Anwesen erreicht, das wie eine Nürnberger Spieldose aussah, gelblich gestrichen und mit krapproten Fensterläden versehen. Es lag dem Altmännerhaus schräg gegenüber und gerierte sich zwischen den übrigen Häusern wie ein Teltower Rübchen, das sich unterfing, mit dickleibigen Zuckerknollen Freundschaft zu halten. Es erinnerte an eine Arche Noah, an eine Kokosnußschale, an ein winziges Ding, von dem man nicht wußte, was man seiner Kleinheit wegen eigentlich damit anfangen sollte. Trotzdem machte es einen behaglichen und wohnlichen Eindruck, tat zier und zimperlich und blinkte wie die vergoldete Schnupftabaksdose des Herrn Bürgermeisters, die, wenn er sie aufklappte, schöner glitzerte als die blanke Scheibe des ansteigenden Mondes.
Herr Aloys Furtwanger hatte seinen Drücker gezogen.
Inzwischen war es noch grimmiger und kälter geworden. Die Schneesternchen fielen emsiger und dichter. Der Dezembernebel kam weißer herauf. Wie verwaschene Tücher senkten sich die Schatten des Silvesternachmittages über Giebel und Dächer. Der Laternenmann ging schon von Straße zu Straße, um die Lampen in den öffentlichen Laternen ins Leuchten zu bringen, wenngleich man auch noch nicht sagen konnte: Es ist Abend geworden.
Nein, es war noch nicht Abend geworden. Es war noch immer sichtig, wenn auch diesig auf Erden.
Aloys war gerade dabei, den eisernen Bart im vereisten Schlüsselloch knarren zu lassen, als drüben im Erdgeschoß des Altmännerhauses ein Fenster aufgerissen wurde und eine verrostete, aber mächtige Stimme ertönte: »Auf ein Wörtchen, Herr Aktuarius. Heda, hallo!«
Der Angerufene wandte sich um.
Moritz stand drüben im Rahmen und gestikulierte, was das Zeug halten wollte.
»Heda, holla!« rief er noch einmal.
»Was soll's, Herr van Dornick?« gab der Verdutzte zurück, noch immer den Drücker im Schlüsselloch.
»Wir lassen Sie bitten, ich und der weiße Mynheer!«
»Weshalb denn?!«
»Menschenkind!« brüllte ihm Moritz entgegen, aber mit einer Stimme, die imstande war, einen gestrandeten Dreimaster wieder flott und segeltüchtig zu machen, »Sie könnten doch eigentlich wissen: Silvester und so! Für Punsch und Futterage ist bestens gesorgt ... und da müssen Sie kommen ...«
»Wenn ich denn als Partner, beziehungsweise als stiller Teilhaber ... das heißt auf mein eigenes Konto ...«
»Blexem! Immer toujours wie Sie wollen! Aber wir bitten uns aus: in meiner Behausung. Punkt acht wird begonnen.«
Damit war auch schon das braunrote Gesicht des alten Herrn hinter dem zugeschlagenen Fenster verschwunden.
Gleichzeitig wurde von irgend einer Seite laut und deutlich gerufen: »Springinsröckel!« – ein Name, auf den der Herr Aktuarius hörte wie die Spiegelkarpfen auf den Ton einer Schelle.
Warum? Das soll uns das folgende Kapitel erzählen.
Er wandte den Kopf, sah aber niemand.
Er mußte sich getäuscht haben. Da staubte er sorgfältig den Flutterschnee von seinen Beinkleidern und Schuhen herunter, drehte das Schloß um ... und Aloys Furtwanger, auch ›Springinsröckel‹ geheißen, trat vorsichtig und sacht über seine Schwelle.
3
O dieser Friede, diese Weihe, diese Sauberkeit und diese peinliche Ordnung in dem bescheidenen Zimmer, das der Herr Aktuarius jetzt betreten hatte!
Drüke Anstoots, die Aufwartefrau, die täglich einige Stunden herüberkam, um dem einsiedlerischen Junggesellen das Anwesen unter Lack und Firnis zu halten, war eine gütige Fee, ein Tischleindeckdich, ein Heinzelweibchen, und dabei hatte dieses Heinzelweibchen zweihundert Pfund klevisch Gewicht auf ihre Schultern geladen, war steif wie eine Siegellackstange und dennoch befähigt, wie eine Angorakatze über die Dielen zu gleiten. Unter ihren Händen formte sich alles wie bildsames Wachs, wurde jedes Stäubchen beseitigt, hatten die Spinnentiere kritische Tage erster Ordnung durchzumachen, rumorte das Kanonenöfchen wie ein übermütiger Kobold, strebte auch das Kleinste und Geringfügigste dahin, das unscheinbare Tuskulum zu einem Tempelchen der Freude und des Behagens herzurichten.
Und so auch heute.
Der blankgewichste Wärmespender hatte zartglühende Bäckchen. Dicht neben ihm erhob sich ein Stuhl, über dessen Lehne der Schlafrock des Herrn Aktuarius so zurecht gelegt war, daß sein Inneres die molligen Strahlen aus unmittelbarer Quelle in Empfang nehmen konnte. Die gestopfte Pfeife stand neben der Schreibkommode. Der Fidibusbecher befand sich in Reichweite. Ein Schwefelhölzchen war in seinem Döschen so eingeklemmt worden, daß man es sofort zur Hand hatte, um Feuer zu schlagen. Die Rübsenöllampe fußte, zum Anzünden fertig, unmittelbar neben dem porzellanenen Fidibusbecher. Kurz, es war alles geschehen, dem Siedelmann die späten Nachmittagsstunden des Silvestertages so angenehm wie nur möglich zu machen. Er quittierte dieserhalb auch mit einem dankbaren Lächeln, legte Stock, Hut, Überzieher und den Bratenrock im Nebenzimmer ab, hüllte sich in die Falten des mit Flanell-gefütterten Schlafrocks, setzte die Pfeife in Brand, drückte sich in den bequemen Lehnstuhl hinein, der die ganze Fensternische ausfüllte, und sah auf die Grabenstraße hinaus, die immer dunstiger, insichgekehrter und vereinsamter wurde.
Nur wenige Menschen gingen vorüber. Obgleich sie Holzschuhe an den Füßen trugen, verloren sich ihre Schritte wie das Wuchteln von Fledermausflügeln, so sacht und geheimnisvoll sogen die gespreiteten Daunendecken jedes Geräusch ein, auch das geringste, das etwa versuchte, wie ein Mäuschen zu zwitschern. Die gegenüberliegenden Giebel erinnerten an vermummte Gestalten. Was diese dunklen Mauern nicht alles umschlossen! Ein wenig Freude, ein wenig Sorge und viele Gedanken und Hoffnungen für die Tage des kommenden Jahres, das feierlich heraufschwebte und schon verständnisinnig mit den Glocken fummelte, als wenn es sagen wollte: »Wartet nur ab, bald hat meine Stunde geschlagen. Ihr werdet wissend werden und weinen und lachen, je nachdem die herben und freudigen Lose eure Schwelle betreten.« Schon hier und da hellten etliche Fenster auf, so die beim blauen Mynheer und die bei seinem bejahrten Nachbar, dem Leinweber Johannes Terstegen. Ein paar andere Lichter kamen gerade von der Straße. Es waren die Laternen, die das Altmännerhaus auf beiden Seiten flankierten. Mächtige Dunstkreise hüllten sie ein, und in diesen Dunstkreisen spielten unzählige weiße Fünkchen, gleich Millionen von Eintagsfliegen. Sie glänzten wie Silber.
Aloys Furtwanger verfolgte das geschäftige Treiben mit wachsamen Blicken.
So vergingen Viertelstunden um Viertelstunden.
Von dem nahegelegenen Rathaus brummte die Turmuhr.
Erst fünf! und ringsumher hatten sich schon graue Fäden und Garne gesponnen. In der kleinen Stube zerflossen die Gegenstände. Tische und Stühle und die vollgepfropften Bücherregale waren kaum noch zu sehen. Alles verträumt und verschlafen! Nur das kleine Öfchen schaffte wie ein emsiger Pyrotechniker, funkte und spritzte und ließ helle Partikelchen in den Aschenkasten purzeln. Bei jedem Niedergleiten lief ein helles Blinkfeuer über die blankgescheuerten Dielen.
»Wollen man Licht machen,« sagte der Aktuarius, erhob sich aus seinem Sinnen und Träumen, zündete den Docht an und setzte sich wieder.
Jetzt erstrahlte der ganze Raum in lieblicher Reinheit. Eine Fülle der Dinge kam zum Vorschein, die das Auge verwirrte. Wohin man auch sah – überall wegte und regte es sich wie in dem Laboratorium eines Zauberkünstlers. Man wähnte bei einem Gelehrten zu sein, bei einem Weltweisen, bei einem, der die Quadratur des Zirkels zu ergründen suchte, bei einem, der mit versunkenen Weltperioden auf du und du stand und sich mit der winzigen Tierwelt befreundet hatte, als wenn er ihre Sprache und die Gesetze ihrer Lebensbedingungen verstünde. Schachteln bei Schachteln und Kästchen bei Kästchen! Zwischen allerlei Gesteinarten, bei verkieselten Farnen und Moosen, den Blattnarben der Sigillarien und ähnlichen Gewächsen der Urzeit befanden sich Abdrücke von Rädertierchen und Echinodermen, zierlich geordnet und bereichert durch einen Gipsabguß von Scheuchzers Homo diluvii testis, eine Rarität erster Ordnung, die er dem Wohlwollen eines befreundeten Geologen verdankte. Und dann wieder ... auf Stellagen und Anrichten reihten sich kleinere und größere Glaskasten nebeneinander, angefüllt mit den Präparaten von Käfern und Immen, von Netz- und Gitterflüglern, von Schnabelkerfen, Spinnentieren und Asseln – eine Welt für sich, wunderseltsame Formen und Gegenstände, registriert wie die Akten bei einem Königlichen Friedensgericht, während eine gewählte Bücherei die Wände bedeckte: gesuchte Editionen, voluminöse Bände, teils naturwissenschaftlichen, teils klassischen Inhalts, so, wie bereits gemeldet, des Johannes Fischart ›Jesuiterhütlein‹, das ›Glückhafte Schiff‹, ›Aller Praktik Großmutter‹ und die vielgelesene ›Floh- *hatz‹; dann Achim von Arnims sämtliche Schriften und die seines Schwagers Clemens Brentano, ferner des krausen und gespensterhaften E. T. A. Hoffmann gesammelte Werke mit den köstlichen Tondruckbildern von Theodor Hosemann; vor allen Dingen Shakespeares Dramen, übersetzt und niedergelegt von Johann Joachim Eschenburg, weiland Literaturhistoriker und Professor am gefeierten Carolinum zu Braunschweig. Des Herrn Zachariä Dichtungen schlossen sich an. Ihnen gesellten sich die von Pfeffel und Gellert, von Ebert und Hagedorn und die des trefflichen Papas Gleim, und wenn dessen ›Preußische Kriegslieder von einem Grenadier‹ der Herr Aktuarius in die Hände bekam und seine Blicke auf das ›Siegeslied nach der Schlacht bei Lowositz‹ fielen, dann nahm er einen martialischen Schritt an, deklamierte frisch von der Leber herunter und schlug mit der Pfeife den Takt dazu:
»Gott donnerte, da floh der Feind! Singt, Brüder, singet Gott! Denn Friederich, der Menschenfreund, Hat obgesiegt mit Gott.
Auf einer Trommel saß der Held Und dachte seine Schlacht, Den Himmel über sich zum Zelt Und um sich her die Nacht.
Großartig, was?!« und er rezitierte den gewaltigen Kantus bis zum letzten Vers herunter.
Sein liebstes Buch aber blieb dennoch besagten Johannes Fischarts launige ›Flohhatz‹ oder der ›Wunder Unrichtige und Spottwichtige Rechtshandel der Flöhe mit den Weibern. Weiland beschrieben durch Huldrich Elloposcleron, auch Jesuwalt Pickhart benamset‹, ein seltener Erstdruck aus dem Jahre 1573, in Leder gebunden und ediert in der Offizin von Bernhard Jobin in Straßburg.
Dort lag es, das Büchlein, ihm gerad gegenüber, auf einer sauber gespreiteten Kommode aus Kirschbaumholz, mitten zwischen einem Kunterbunt von winzigen Sachen und Sächelchen, von denen man auf den ersten Blick so recht nicht wußte, wozu und warum man sie eigentlich ins Leben gerufen hatte. Da waren niedliche Wippen und Schlitten, ein Karussell mit Pferdchen und Gondeln, Kanönchen und Kutschen, Drehörgelchen und Rutschbahnen, klitzekleine Trommeln und Schubkarren – alles aus Kartenblättern geschnitten, zusammen gepappt und mit seinen Gold- und Silberfädchen durchsponnen. Die meisten Gegenstände befanden sich unter umgestülpten Wein- und Wassergläsern, denn sie waren so minuziös und windig verfertigt, waren so leichtgeflügelt, daß der geringste Lufthauch sie auf Nimmerwiedersehen hätte fortführen können. Und was das Lustigste schien: hinter diesen Sachen und Sächelchen, dicht an die Wand gerückt, stellte sich eine mit grünem Papier überkleisterte Schachtel, eine Art von Berglehne, die mit kleinen Holzbäumchen umstellt war, ähnlich denen, wie man sie in den Nürnberger Spieldosen findet. Auf diesem improvisierten Hügel nun, inmitten der spinatgrünen Bäumchen, ragte eine Art von Luginsland auf, ein putziges Etwas mit Türmchen und Giebeln, mit Türen und Fallgattern, auf dessen höchster Zinne sich eine Flaggenstange erhob, von der doppeltes Tuch in schwarz-weißen Kulören herunter bammelte. In diesem köstlichen Bauwerk lebte und wirkte ... Ihr müßt nämlich wissen und ich erzählte bereits: der Herr Aktuarius war ein Stoiker und Bastler, ein tiefgründiger Kenner der Naturwissenschaften. Vornehmlich liebte er es, sich mit der Kerfenwelt ins Einvernehmen zu setzen, und als er eines Tages die ergötzliche, kuriose und lehrreiche ›Flohhatz‹ gelesen hatte, schloß er innige Freundschaft mit einem besonders tüchtigen, kräftigen und lebensfähigen Vertreter der Kavaliere im braunen Leibfrack, einem prächtigen Pulex irritans