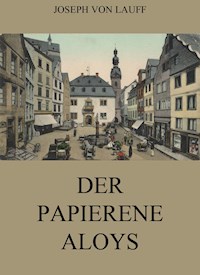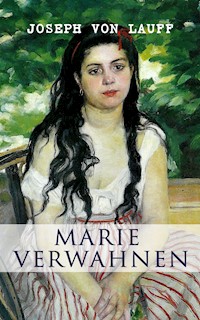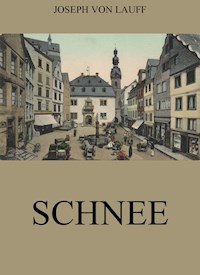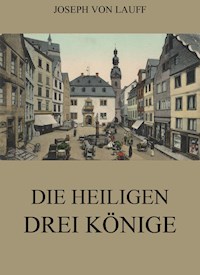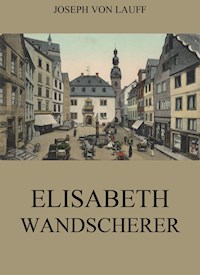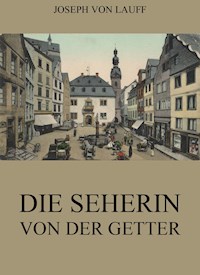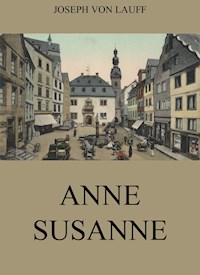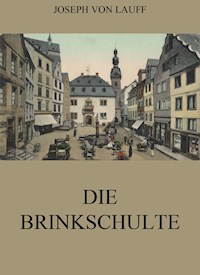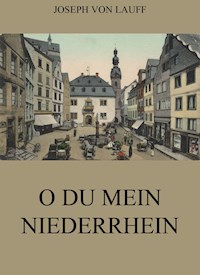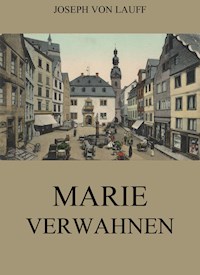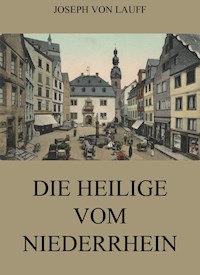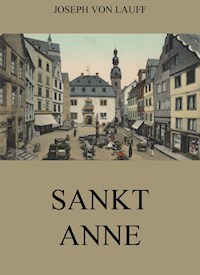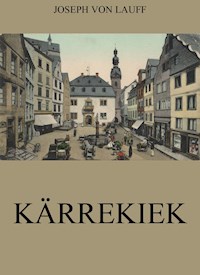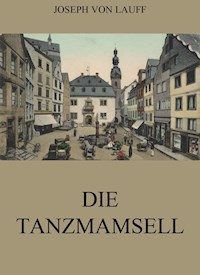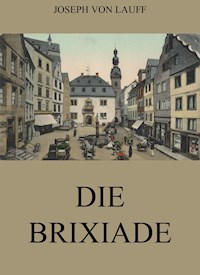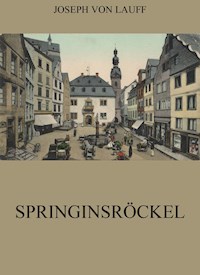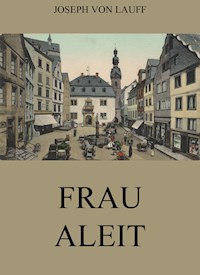
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Frau Aleit" erzählt der Schriftsteller von der tragischen Liebe des Kalkarer Deichgrafen Liffers zu seiner Jugendfreundin Aleit. Noch bevor die Deiche erhöht worden sind zerstörtein Hochwasser die Stadt und die Romanze nimmt einen tragischen Verlauf ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frau Aleit
Joseph von Lauff
Inhalt:
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Frau Aleit
I Beim Kiwi
II Der Deichgräf
III Tütütütü...!
IV Orakel
V Bilder
VI Wenn die Billardkugeln ketschen
VII Die Babbeltjes-Lena
VIII Und Bath-Seba war schön ...
IX Frühlingssturm
X Der selige Tag und was weiter passiert
XI wenn des Haarrauch weht
XII Butterblume
XIII Krispinus kommt wieder
XIV Sulpiz – mein Sulpiz ...!
XV Im ›Blauen Schiffchen‹
XVI Das Testament
XVII Et ging 'ne Pater langs de Kant ...
XVIII Der Deich wird lebendig
XIX Ruhe – und dann ...?!
XX Herrgott, wie warst Du so fern!
XXI Der Trauerkaffee
XXII Die Mission
XXIII Kurz zuvor
XXIV Bibel
XXV Und dann war es Abend geworden ...
Frau Aleit, J. von Lauff
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638740
www.jazzybee-verlag.de
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Dichter, geb. 16. Nov. 1855 in Köln als Sohn eines Juristen, besuchte die Schule in Kalkar und Münster, wo er das Abiturientenexamen bestand, trat 1877 als Artillerist in die Armee ein, wurde 1878 zum Leutnant, 1890 zum Hauptmann befördert und wirkte, einer persönlichen Aufforderung des Kaisers folgend, 1898–1903 als Dramaturg am königlichen Theater in Wiesbaden, wo er noch jetzt lebt; gleichzeitig wurde ihm der Charakter eines Majors verliehen. L. begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit den epischen Dichtungen: »Jan van Calker, ein Malerlied vom Niederrhein« (Köln 1887, 3. Aufl. 1892) und »Der Helfensteiner, ein Sang aus dem Bauernkriege« (das. 1889, 3. Aufl. 1896), denen später folgten: »Die Overstolzin« (das. 1891, 5. Aufl. 1900); »Klaus Störtebecker«, ein Norderlied (das. 1893, 3. Aufl. 1895), »Herodias« (illustriert von O. Eckmann, das. 1897, 2. Aufl. 1898), »Advent«, drei Weihnachtsgeschichten (das. 1898, 4. Aufl. 1901), »Die Geißlerin«, epische Dichtung (das. 1900, 4. Aufl. 1902); er schrieb fernerhin die Romane: »Die Hexe«, eine Regensburger Geschichte (das. 1892, 6. Aufl. 1900), »Regina coeli. Eine Geschichte aus dem Abfall der Niederlande« (das. 1894, 2 Bde.; 7. Aufl. 1904), »Die Hauptmannsfrau«, ein Totentanz (das. 1895, 8. Aufl. 1903), »Der Mönch von Sankt Sebald«, eine Nürnberger Geschichte aus der Reformationszeit (das. 1896, 5. Aufl. 1899), »Im Rosenhag«, eine Stadtgeschichte aus dem alten Köln (das. 1898, 4. Aufl. 1899), »Kärrekiek« (das. 1902, 8. Aufl. 1903), »Marie Verwahnen« (das., 1.–6. Aufl. 1903), »Pittje Pittjewitt« (Berl. 1903) sowie die Lieder »Lauf ins Land« (Köln 1897, 4. Aufl. 1902). Als Dramatiker trat er zuerst hervor mit dem Trauerspiel »Inez de Castro« (Köln 1894, 3. Aufl. 1895). Von einer Hohenzollern-Tetralogie sind bisher erschienen und wiederholt ausgeführt »Der Burggraf« (Köln 1897, 6. Aufl. 1900) und »Der Eisenzahn« (das. 1899); ihnen sollen »Der Große Kurfürst« und »Friedrich der Große« folgen. Lauffs neueste Dramen sind das Nachtstück »Rüschhaus«, das vaterländische Spiel »Vorwärts« (beide das. 1900) und das nach dem Roman »Kärrekiek« verfaßte Trauerspiel »Der Heerohme« (das. 1902, 2. Aufl. 1903). Während L. in seinen Romanen echtes Volksleben des Niederrheins poetisch festhält und in seinen epischen und lyrischen Dichtungen trotz wortreicher Diktion ein starkes Talent verrät, greift er in seinen Dramen, namentlich in den höfisch beeinflußten Hohenzollern-Stücken, oft zu unkünstlerischen Mitteln und erweckte entschiedenen Widerspruch. Vgl. A. Schroeter, Joseph L., ein literarisches Zeitbild (Wiesbad. 1899); B. Sturm, Joseph L. (Wien 1903).
Frau Aleit
I Beim Kiwi
Da liegt ein engbrüstiges Häuschen mit knallrotem Dach inmitten der weiten Niederung, und die tiefhängenden Ziegelpfannen berühren fast den umgeackerten Boden, der sich hier wellenartig von der grasigen Fläche aufhebt. Stocksteife Malven recken sich am niedrigen Giebel. Eine Kappweide mit dichtem Pfriemenschopf, in welchem ein Elstervogel sich angebaut hat, steht seitwärts der ärmlichen Kat und sieht von hier über die vorliegende Deichkrone bis weit in das niederrheinische Land fort. Weiter zur Rechten, aber noch diesseits des Deiches, erhebt sich ein stattlicher Häuserkomplex, den sie im Volke den ›Fingerhutshof‹ nennen, und zwar der auffallenden Giftblumen halber, die hier häufiger denn sonstwo ihre glockenförmigen, leuchtenden Korallen in heißen Sommertagen entfalten. Mehr dem Binnenland zu zeigt sich die markante Profilierung eines massigen Kirchturms. Aus blaugrünen Pappelkronen ragt er empor, steif, ohne jede Architektur – eintönig wie seine ganze Umgebung. Grelle Sonnenreflexe liegen auf dem Schieferhelm. Schwarze Punkte schweben dort auf und nieder. Es sind Dohlen, die Helm und Ziegelviereck umkreisen. Der Turm scheint sein Mittagsschläfchen zu halten; es ist so, als wenn er mit seinen Schallöchern über die Pappeln hinausgähnte. –
Ein Flimmern und Zittern, eine öde Langeweile ging über die Landschaft. Die Gräser bewegten sich nicht, die Kühe lagen wiederkäuend umher, die Grillen hatten ihr Zirpen vergessen, und nur ein nadelfeines Schwirren und Summen war in der Luft, wo sich stahlblaue und goldglänzende Fliegen auf und nieder bewegten. Ab und zu taumelte ein müder Zitronenfalter vorüber. In der zitterigen Luft jenseits des Deiches verschwand er. Fast gleichzeitig strich der Elstervogel mit lautem Gegecker vom Nest, wiegte sich ruckweise über die Wiesen und bäumte in unmittelbarer Nähe des Fingerhutshofes auf eine breitgeästete Pappel.
Ein grobknochiger Mann in den sechziger Jahren mit eigentümlichem Kleinschädel auf den mächtigen Schultern war aus der Tür der armseligen Kat ins Freie getreten. Eisgraue Haare rahmten den Hinterkopf ein. Etwas Wirres, Verwehtes lag auf dem harten Gesicht, das aussah, als wäre es mit ungeschicktem Schnitzmesser aus einem derben Holzklotz herausgeholt worden, und wären nicht die kobaltblauen, klaren Augen gewesen, man hätte den verwitterten Kerl für einen Idioten ansprechen können. Er trug klobige Holzschuhe an den nackten Füßen, war hemdärmelig und hielt eine Last frischgeschälter Weidenruten im Arm.
»Oha!« sagte der Mann, ließ die weißen Gerten zu Boden fallen, schob die rechte Hand über die Augen und sah über den Deich fort. So stand er lange.
»Schwere Brett noch mal! – noch immer nicht ...«
»Was soll's denn?«
Eine unscheinbare Person mit glattgescheiteltem Haar, die Frau des seltsamen Menschen, hatte sich über die Schwelle geschoben. Sie hinkte und machte dabei ein Gesicht, als habe sich auf demselben die Neugierde mit ungelenken Schriftzügen verewigt.
»Na, Du da!«
»Oha!«
»Da gehn doch keine Aale auf dem Deich 'rum spazieren?!«
»Ne – aber sonst wer, sonst wer!« rief der Angesprochene, ohne sich in seiner Beobachtung stören zu lassen. »Aber was ich schon sagte: er kommt nicht – kommt nicht.«
»Wer denn?«
»Der Deichgräf.«
»Ach, der ...!« sagte die Alte.
»Du hast ihn doch selber gesehen; Du siehst doch alles, was zwischen der Bunten Schleuse und Wissel vorbeikommt.«
»Stimmt schon,« meinte das kurzbeinige Weibchen, »das ist so Schlag Klock zwölfe gewesen. Aber was hast Du denn überhaupt mit dem Deichgräf zu schaffen?«
»Mutter, den will ich doch auch hier begrüßen, nach langen zehn Jahren auch hier begrüßen – der ist mir doch ans Herz gewachsen, der Deichgräf.«
»Kiwi, nu hab' Dich man nicht.«
»Oha! – hab' Dich man nicht?!«
»Ja, hab' Dich man nicht,« legte sich jetzt die Alte ins Zeug, »denn der ist jetzt auch nicht besser als die übrigen Leute – der ist nobel geworden, der spuckt jetzt auf Dich gerade wie die da ...«
Mit einer schnellen Handbewegung deutete die Alte über den Deich fort.
»Wie die da in Neu-Luisendorf?«
»Ja – wie die da über den Berg weg.«
»Oha!« sagte der Kiwi.
In seinen Augen begann es eigentümlich zu leuchten. »Schwere Brett noch mal! – ne, Mutter, da über den Berg weg, da gilt kein Prophet nicht, und es steht doch geschrieben: Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, der wird eines Propheten Lohn empfangen.«
»Je – die wußten's wohl besser,« zuckte die Frau mit den Schultern.
»Besser?!«
Der Kiwi reckte sich auf und streckte beide Arme nach oben.
»Wer mich aber verleugnet vor den Menschen,« rief er mit übergeschlagener Stimme, »den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater da oben. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist meiner nicht würdig!«
Mit einem tiefen Seufzer legte er beide Hände zusammen.
»Es sind viele Wohnungen in meines Vaters Hause bereitet ...« begann er flüsternd zu beten, brach aber plötzlich ab und meinte: »Ne, Mutter – bevor die Neu- Luisendörfer selig werden, triumphier' ich zehnmal in das himmlische Reich ein.«
»Ach, was,« sagte die Alte, »mit Dir ist heute mal wieder kein Reden.«
»Oha!« stöhnte der Kiwi, »mit mir ist kein Reden?! – Mutter, wenn ich und die Bibel . , .«
»Herr Jeses, laß mich mit Deiner Bibel zufrieden!«
Der alte Mann stieß einen unartikulierten, fast tierischen Laut aus. Das Gesicht bekam einen kantigen Ausdruck.
»Mutter, wenn ich und die Bibel ...«
»Fang' lieber Schleie und Barsche und mach' Deine Aalreuse fertig, als hier auf Dein dämliches Prophetentum 'rum zu karrjolen! Wir haben's nötig. Die feinsten Bibelsprüche geben keinen Speck in die Pfanne – aber in die Hände gespuckt und arbeiten, Kiwi, das tut es.«
»Will ich ja, Mutter – will ich ja, Mutter.«
»Denn vorwärts!«
»Je, Mutter, wenn nu aber das mit der Bibel...«
»Schafskopp!« sagte die Alte und drehte sich mit unwirscher Gebärde der Tür zu.
Da stand nun der Kiwi. Eine geraume Zeitlang revierten seine lichtblauen Augen verloren über Wiesen und Kolke, dann gab er sich einen merklichen Ruck: »Also denn 'ran an die Arbeit, aber mit Andacht.«
Aus der verschlissenen Samtweste holte er einen irdenen Pfeifenstummel hervor, stopfte ihn mit Krülltabak, setzte ein Schwefelholz an der Velvethose in Brand und begann blaue Wölkchen und Kringel über die Landschaft zu blasen.
»So'n Fraumensch!« muffelte er zwischen den Lippen, »mich und meine Bibel nicht estimieren zu wollen – und dann 's noch mit den Neu-Luisendörfern zu halten ...!«
Er drehte sich in Richtung der Gegend, wo das verhaßte Nest etwa liegen konnte, streckte die Faust aus und sagte: »Aber wehe Dir, Chorazin! wehe Dir, Bethsaida! – Wären solche Taten zu Thyro und Sidon geschehen, als bei Euch geschehen sind, sie hätten vor Zeiten im Sack und in der Asche Buße getan. Doch ich sage Euch: Es wird Thyro und Sidon erträglicher ergehn am Tag des Gerichtes denn Euch. Und Du Kapernaum ...«
»Aus!« schrie in diesem Augenblick eine keifende Stimme von drinnen. »Nu ist's aber satt und genug mit dem verfluchten Geseire. Marsch an die Arbeit!«
»Schön, Mutter,« sagte der Kiwi, ließ sich im Schatten des Häuschens nieder, grapste die geschälten Weidenruten zusammen und begann die Gerten mit fingerfertigen Händen ineinander zu flechten.
Eine große Stille war um ihn. Die weite Welt hielt den Atem an; nur die Weidengerten zischelten leise unter den arbeitsamen Händen, und ab und zu lief ein verlorenes Schwirren und Summen von den Wiesen herüber. Man hätte die Stille greifen können, so nah und ungeniert kam sie auf ihren weichen Schuhen gegangen, sah dem einsamen Mann über die Schultern und folgte den blauen Rauchwölkchen, die sich kräuselnd bei den niedrigen Ziegeln verfingen. Derweilen perlmutterte der Sonnenglanz über die endlosen Wiesenkomplexe. Die Fernen gaben sich wie ein resedenfarbiges Band, das den Horizont abgrenzte. Nur vereinzelte Baumgruppen hoben sich aus der grasigen Fläche, über welche kein Lüftchen streichelte, auf der sich kein Hälmchen bewegte, und die da lag wie eine schnurrende Katze am Ofen, hinter deren Ohren eine behagliche Hand kraute – verschlafen und träumend. Nur das eigentümliche, weltferne, kaum wahrnehmbare Schwirren dauerte weiter und weiter.
Die einlullende Stille drückte dem Kiwi den Kopf leise nach vorne. Da kam der Elstervogel gegeckert und bäumte wieder bei seinem einsamen Nest auf. Das störte den Mann; er riß die Augen auf und sah träumend ins Leere. Das tat er gern, denn in einem solchen Halbdusel wurden alte Tage lebendig. Er konnte sich nicht aller Dinge erinnern; sein Gehirn war nicht wie dasjenige anderer Menschen, es war anders geartet, schwerfälliger, unbeholfener, es war belastet, wenn auch nicht ständig belastet, aber doch immerhin so angekränkelt, nicht alle Dinge in der richtigen Weise aufzunehmen, wie sie sich gaben. Nur vereinzelte Bruchstücke aus seinem früheren Leben drängten sich zeitweilig in seinen Ideenkreis hinein, ohne daß er die Kraft besaß, sie zu fassen, ordnungsgemäß aneinander zu reihen und zu einem regelrechten Ganzen zu fügen. Häufig sah er die Dinge an, wie man die Welt durch einen Straminrahmen ansieht: ungewiß, ohne bestimmte Konturen, nebelartig, verschleiert – und dann wieder bekam der Straminrahmen Risse, lichte Momente taten sich auf, die die Nebel zerstreuten und einen Zustand weckten, der von demjenigen gewöhnlicher Menschen kaum des Nennenswerten abirrte und einen Sinn für praktische Dinge hervorbrachte. Dabei lief häufig ein Scharfblick mit unter, der geeignet schien, die Geisteskräfte des Vereinsamten höher zu werten, wie sie es wirklich verdienten. Nein, der Kiwi war nicht für die Welt und das praktische Leben verloren, er hatte ein Recht darauf, sich zu betätigen, sich nützlich zu machen und Gottes belebenden Odem in sich aufzunehmen – aber dann kamen sie wieder, die Dämmerungen, die seltsamen Nebel, die am fernen Horizont aufstiegen, sich immer näher bewegten, sich türmten und steilten und schließlich aus ihrem Gewölk eine mächtige Hand vorschoben, die in ihren gekrampften Fingern ein aufgeschlagenes Buch hielt: und das war die Bibel ... die Bibel ...!
Josias Spettmann oder, wie ihn die Leute nannten, der ›Kiwi‹ war nicht von Kind an mit dieser geistigen Mißbildung behaftet gewesen. Träumerisch, insichgekehrt – das war er allerdings, und seine wunderliche Körpererscheinung hatte häufiger Anlaß zu unliebsamen Zwischenfällen und Spötteleien gegeben, aber er blieb bis zum fünfundzwanzigsten Lebensjahre ein annehmbares Mitglied der menschlichen Gesellschaft, baute in der kleinen Gemeinde seinen ergiebigen Acker, wußte seinen Nutzen zu ziehen und Geschäfte zu machen und verstand es, sein kleines Anwesen tatkräftig über Wasser zu halten. Daß er eines Tages beim Einbringen des Heues aus der Bodenluke gefallen war und die Augen seltsam verdreht hatte, war scheinbar ohne nachteilige Folgen an ihm vorüber gegangen. Nach einigen Wochen nahm er wieder seine hergebrachte Beschäftigung auf und sorgte wie früher. Ja, er verstattete sich sogar einen eigenen Rauch, warb um ein Mädchen, das nicht jung und nicht schön war, führte sie heim, lebte mit ihr einige Jahre – und da war es mit einem Male gekommen, so ganz mit einem Male gekommen.
Über den Berg fort, auf der unscheinbaren Hügellehne jenseits der kleinen niederrheinischen Stadt, deren massiger Kirchturm aus den Pappelkronen hervorsah, war Josias Spettmann zu Hause. Hier in einer begüterten protestantischen Enklave, die vor Zeiten durch Friedrich den Großen in eine stockkatholische Bevölkerung eingesprengt wurde, hatte er seinen Kohl gebaut, geheiratet und in der Bibel gelesen. Inzwischen war ein ordinierter Adjunktus an Stelle des verewigten Geistlichen Prediger in der Neu-Luisendorfer Gemeinde geworden – und das geschah um die Zeit, da der Roggen in Blüte stand und so ein warmer, duftiger Ährenrauch über die weiten Felder dahinlief. Als es dann Winter wurde, das monotone Klappern der Dreschflegel von den Tennen herkam und der Kanonenofen sich rote Backen zulegte – da, eines Winterabends saß Josias Spettmann bei seinem Weib in der Stube und las in der Bibel. Aber die Frau verstand nicht, was er ihr vorlas, was er überhaupt wollte – er war heute so eigentümlich und seltsam. Draußen lag so ein kalter Schnee, der unter den Füßen zwitscherte, und die weiße Decke dämmerte bläulich ins Zimmer. Die große Standuhr ging wie gewöhnlich, der Kanonenofen plauderte wie an gewöhnlichen Tagen, die Lampe knisterte und brannte wie sonst, und dennoch ...
Da klopfte Josias plötzlich mit der Faust auf den Tisch, schlug eine Stelle in der Postille auf und las mit scharfer Betonung: »Du sollst Deinen Vater und Deine Mutter ehren, auf daß es Dir wohl ergehe und Du lange lebest auf Erden. – Weib, hast Du das immer getan?«
Die Frau sah ihn mit großen Augen an,
»Nun?!«
»Ja,« sagte sie verschüchtert, »Josias, das habe ich Zeit meines Lebens also gehalten.«
»So?!« sagte Josias Spettmann mit verhaltener Stimme, schlug eine andere Stelle auf, erhob sich und las dann: »Du sollst Vater und Mutter verlassen und dem Manne Deiner Wahl anhangen, – Weib, hast Du dem immer Folge gegeben?«
Die Worte saßen. Über das unschöne Gesicht der jungen Frau lief eine ängstliche Spannung. Was wollte ihr Mann denn?
»Weib!« schrie dieser und hatte den Folianten erhoben.
»So wahr mir Gott helfe ...«
»Nein!« schrie Josias und schleuderte die Bibel in eine Ecke des Zimmers, »das hast Du nicht getan; Du hast es mit dem Prediger gehalten, Du hast es mit dem jungen Pfaffen auf der Tenne gehalten!«
Das Weib machte ein stupides Gesicht und stieß einen gellenden Schrei aus: »Josias ..!«
»Ha, Du ...!« knirschte dieser, umspannte ihr Handgelenk und sah ihr ins Auge. Sein Gesicht war eine Grimasse geworden. Jeder Zug, jede Linie in ihm war anders wie früher.
»Du bist nicht auf der Tenne gewesen?«
«Ja, ja, ja!« schrie das Weib auf.
»Wann?«
»Gestern Abend.«
»Und ...?«
»Ich habe Häcksel geschnitten.«
»Und der Pfaffe ...?«
»Das ist ja ein Unsinn, das sind ja ausgestunkene Lügen – das sind ja Gespenster ...! – So wahr mir Gott helfe!« rief sie noch einmal und warf die Arme nach oben, »der Herr Pastor hat nur in der Tür gestanden – hat mir 'nen guten Abend gewünscht und ist dann weiter gegangen,«
»Oha!« sagte der junge Bauer, »das findet sich, das findet sich alles.«
Mit beiden Händen griff er zum Kopf und preßte mit einem häßlichen Lachen die Schläfen. Es war ihm so, als wäre eine kalte, gespenstische Hand über seine Stirne gefahren.
»Das findet sich alles!«
Ungelenk nahm er hierauf die Bibel vom Estrich, riß die Tür auf und trat barhaupt und mit großen Schritten ins Freie.
Draußen lag eine kalte, mondhelle Schneenacht gebreitet. Die weiße Decke quiekste und piepste unter den klobigen Schuhen, als wären dort erstarrte Mäuse wieder lebendig geworden. Die Sterne standen wie kaum wahrnehmbare, lichtschwache Punkte am Himmel. Es mochte gegen zehn Uhr sein. Anderen Tages war Sonntag. In der langen Dorfgasse wohnte kein Leben mehr; die Leute waren bereits schlafen gegangen. Nur weit hinten, neben der Kirche, flimmerte noch ein vereinsamter Lichtschein. Er kam aus dem Pfarrhaus. Die Tür stand allen Gläubigen zu jeder Zeit offen; so war es von jeher in der kleinen, orthodoxen Gemeinde gehalten worden. Ein heller Lichtbalken fiel quer über die Straße. In der behaglich durchkachelten Stube ging der junge Prediger mit großen Schritten auf und nieder. Er trug die feingegliederten Finger auf dem Rücken. So konnte er besser denken und sinnen und sich in dem blumenreichen Garten der Gleichnisse aus dem Neuen Testamente ergehen. Er überlegte seine morgige Predigt. Seine Augen waren von einer samtbraunen Tönung; in ihnen wohnte der Frieden. Jedesmal, wenn er sie gegen das Licht wandte, leuchteten sie auf, und dann stand da eine überirdische Verklärung geschrieben.
Ohne anzuklopfen war Josias Spettmann ins Zimmer getreten.
»Ah, guten Abend, Josias!« sagte der Prediger. »Darf ich wissen, was Sie in so später Stunde nach hier führt?«
»Was mich nach hier führt ...?« fragte Josias.
»Sie wissen,« ergänzte der Prediger in ruhigem Tone, »daß ich gern helfe, wenn es in meinen Kräften steht. Darf ich daher Ihr Anliegen wissen?«
»Mein Anliegen ...?«
Josias war näher getreten. Seine starren Finger umkrampften die Bibel; in den tiefliegenden Augen begann es zu leuchten.
»Ich habe kein Anliegen«, sagte er abgehackt und in trockener Weise. »Schwere Brett noch mal! – ich wollte nur fragen, wo das geschrieben steht, was da heißt: Komm, laß uns buhlen bis an den Morgen, und laß uns der Liebe pflegen; denn der Mann ist nicht daheim, er ist einen fernen Weg gezogen.«
Der Prediger wußte nicht, was er mit dem Fragesteller anfangen sollte. Er wich einige Schritte zurück, besann sich aber und meinte: »Ja, Josias, das steht in den Sprüchen Salomonis geschrieben.«
»Das wissen Sie?«
»Ja, das weiß ich, Josias.«
»Und wo steht, Herr Pastor: Laß Dich nicht Deines Nächsten Weibes gelüsten.«
Spettmann hatte die Bibel erhoben.
Der Prediger entsetzte sich.
»Ja, das, Herr Pastor ...«
Der Geistliche behielt seine Fassung. »Das ist in den zehn Geboten enthalten,« sagte er ruhig.
»Und Sie,« schrie Josias, »Sie schämen sich nicht und haben doch mit meinem Weibe ...«
Seine Stimme schlug um; er taumelte rücklings.
»Sie sind krank oder haben getrunken, Josias. Gehen Sie jetzt ruhig nach Hause. Der morgige Tag wird für Sie Erlösung bringen – Erlösung und Frieden. Und über das Geschehene will ich den Schleier des Vergessens ziehen. Und somit ...«
Die liebevolle Art und Weise des Sprechers imponierte dem Kranken. Ohne daß er es zu hindern versuchte, wurde er von sanften Händen über die Schwelle geschoben. Er stand fröstelnd in der kalten Schneenacht und wußte kaum noch, was sich da drinnen begeben hatte. Es war alles so unbestimmt und verschwommen. Er hatte das Bewußtsein der eigenen Unvollkommenheit. Es kam ihm wie ein Traum vor, an dessen wirre Einzelheiten er sich nur schwer zu erinnern vermochte. Seine Gedanken flatterten wie Fäden im Wind; er konnte keinen mehr greifen. Da begab er sich kopfschüttelnd und taumelnd nach Hause. Er war ruhig wie ein Kind und gefügig wie ein Jagdhund geworden. – Die Nacht ging ohne weitere Kümmernis hin. Am frühen Morgen hingen frische Gardinen von den Fenstern herab; sie waren aus lichten Eisblumen zusammengesetzt. Die Sonne spielte darauf und weckte glitzernde Funken. Darüber freute sich Josias. Über seine kranke Seele lief eine heitere Stimmung. Fast gehobenen Mutes nahm er die Bibel unter den Arm und ging mit seinem Weibe zur Kirche.
Es war der dritte Sonntag im Advent. Auf dem Altar brannten die Kerzen. Wie Armeseelchen standen die matten Flämmchen auf den hohen Wachsschäften. Die kleine Gemeinde war vollzählig erschienen. Mit klopfenden Herzen lauschte sie den Worten des jungen Predigers, der die Lehre des Herrn mit Engelszungen verkündete. Als er geendet, verließ er die Kanzel, wandte sich dem Altar zu und ergriff den Kelch, um das heilige Abendmahl zu spenden. Während der Handlung hatte Josias den Kopf auf die Bibel gesenkt und aus tiefster Seele gebetet. Jetzt erhob sich sein Weib von seiner Seite, faltete die Hände und ging dem Altar zu.
Was wollte das Weib da?! – Eine starre Gewalt saß Josias im Nacken und riß ihn empor. Die schwindsüchtigen Flämmchen auf dem niedrigen Chor tanzten vor seinen Blicken. Er sah jemand kommen; die übrigen bemerkten es nicht, aber er sah es. Es war der unheimliche Geist, der ihn schon gestern abend heimgesucht hatte. Ein Riß ging über sein Gesicht; da verließ er die Stelle, wo er bislang gekniet hatte, und mit glutenden Augen trug er den kleinen Kopf auf dem mächtigen Nacken durch die Kirche bis zur Bank hin, wo das Abendmahl ausgeteilt wurde. Hochaufgerichtet hatte sich Josias an die Seite seines Weibes begeben.
Der Priester erhob den Kelch und sprach die Einsetzungsworte: »Das ist mein Blut, das für Euch vergossen wurde!« und er gedachte ihn schon an den Mund des vor ihm knieenden Weibes zu führen.
Da streckte Josias die Hand aus.
»Halt!« schrie er mit geller Stimme, daß ein Schauer die Kirche durchfuhr, »hier diese ist des Blutes unseres Herrn nicht würdig. Zurück mit dem Kelch! Und Du da – schwören sollst Du mir hier auf die Bibel, daß Du mit meinem Weibe keinen Umgang gehabt hast, denn geschrieben steht: Du sollst Dich nicht Deines Nächsten Weibes gelüsten – nicht ehebrechen sollst Du!«
Josias streckte die aufgeschlagene Bibel über die Bank fort.
Der Prediger hatte seine Fassung verloren; seine Lammsgeduld war zu Ende gegangen. Er wußte nicht mehr, was er sagte, aber er sagte es dennoch.
»Du Narr!«
»Was?!« schrie ihm Josias entgegen.
»Du Narr!«
Der Kelch war dem Prediger aus den Händen gefallen.
Da lief ein einziger Schrei durch die Kirche.
Josias Spettmann war vornüber getaumelt. –
Die Tage vergingen, und als Josias aus seinem Fiebertaumel erwachte, da hatte er kein Erinnern an das Vergangene mehr. Hinter ihm lag Nebel und Dunkel, und wenn er dort einzudringen versuchte, so tastete er nur in Finsternis. Er gesundete zwar, wie er eben zu gesunden vermochte, tat sein Tagewerk noch, blieb aber in unheimlicher Weise mit der Bibel verwachsen, prophezeite aus ihr, sagte gute Ernten und Mißernten voraus und hielt sich für einen, der gekommen, den bestehenden Dingen eine andere Wendung zu geben. Aber die Leute glaubten ihm nicht, und so wurde der Ärmste zum Gespött der kleinen Gemeinde. Das wurmte Josias, und sein Weib hatte Erbarmen mit ihm. Sie veräußerten ihren kleinen Besitz, ließen die Berglehne, zogen ins niedere Land und erstanden das ärmliche Anwesen, das sie jetzt noch bewohnten – und das war vor ungefähr fünfunddreißig Jahren geschehen. Hier, inmitten der endlosen Wiesen, der stillen Wasser und umgeben von dem eintönigen Gesäusel der Pappeln, fand Josias Ruhe und Frieden. Noch in seinen alten Tagen begann er Körbe und Reusen zu flechten, und wenn er nicht über seinen geschälten Weidenruten saß oder den Fischen nachging, streifte er viel in der Gegend umher, folgte dem Lauf der gurgelnden Wasser, war bei den Schleusen zu finden oder machte sich an den Deichen zu schaffen, die hier nach allen Richtungen hin das weite Tiefland durchquerten. Er wußte sie alle mit Namen zu nennen, kannte ihre Vorzüge und Nachteile – und wenn in Frühlingstagen die Kiebitze wieder ins Land kamen, dann folgte er mit lichtblauen Augen ihren Flugkünsten, sah sie schweben und schwanken und ahmte ihren charakteristischen Ruf nach. Und dann sagten die Leute, und besonders die auf dem Fingerhutshof: »Der Kiwi ist lebendig geworden, der Deichvogel ruft – nun ist der Frühling gekommen.«
Aber auch zu anderen Zeiten und bei sonstigen Gelegenheiten ließ er seine Stimme ertönen.
Horch, wie das lautet: »Kiwi! – Kiwi! – Kiwi!«
Und er saß noch immer im Schatten seines ärmlichen Häuschens mit den hängenden Ziegelpfannen, verpaffte gekräuselte Rauchwölkchen aus seiner irdenen Pfeife und stierte ins Leere. Trotzdem arbeiteten seine Hände mechanisch weiter und weiter, Weidengerte fügte sich an Weidengerte; das Flechtwerk nahm Fassung und Form an und zeigte schon deutlich, was für ein Ding das werden sollte.
Die Schatten waren länger und dünner geworden. Das Flimmern in der Luft hatte nachgelassen, eine angenehme Kühle wehte vom Deich, und auf den Wiesen wurden viele Stimmen lebendig.
Von der kleinen Stadt her brummte die sechste Abendstunde herüber.
Da erhob sich der stille Mann, warf seine Arbeit beiseite, schob seine rechte Hand über die Augen, wie er es schon vorhin getan hatte, und sah in die Ferne.
»Noch immer nicht! – Nu wird's aber Zeit,« sagte der Kiwi, ging ins Haus und trat bald darauf wieder ins Freie.
Er hatte sich eine abgegriffene Seidenmütze mit fettigem Schirmrand über die Ohren gezogen.
Sein Pfeischen qualmte noch immer.
Mit großen Schritten und klappernden Holzschuhen ging er ins Land fort.
II Der Deichgräf
Dr werdende Abend hatte den Wind aufgetan. Es war so ein recht steifer, ordentlicher Westwind geworden, der vom Vorland her über den Deich ging und das tiefgebräunte Gesicht eines hohen Mannes in den dreißiger Jahren anblies. Lässigen Schrittes und mit seinen Gedanken beschäftigt, strebte er der kleinen Stadt zu, die ihm schon geraume Zeit vor Augen gestanden. Erst vor wenigen Tagen von dem Gemeinderat und den Geschworenen als Deichgräf bestätigt, hatte er sich in seinem neuen Wirkungskreis umgesehen, hatte Schleusenwerke und die ihm unterstellten Dämme besichtigt, war bei einzelnen Landgemeinden vorgesprochen, um Einsicht in die pflichtigen Grundstücke, die Korporationsrollen und Reallasten zu nehmen, und stand nun im Begriff, heimwärts zu schlendern. Verschiedene Mißstände waren ihm während des Rundganges aufgefallen. Vieles ging ihm durch den Sinn, und er wußte schon jetzt, daß an mehreren Stellen tatkräftige Hebel angesetzt werden mußten, um erfolgreich Wandel zu schaffen. Mit seinen Bedenken hatte er bereits den Schöffen im benachbarten Wissel gegenüber nicht hinter dem Berge gehalten, war aber noch vor der Hand harten Köpfen begegnet, denn die vom Niederrhein haben's nicht eilig, sind schwerfällig im Denken und Handeln wie ihre Ackergäule, die breithufig und mit schellengeschmückten Kummetgeschirren durchs Land klingeln, eine Schwerfälligkeit, die besonders dann in die Erscheinung tritt, wenn es heißt, im allgemeinen Interesse einen Griff in den Beutel zu tun und die harten, blanken Taler auf den Tisch des Gemeindehauses zu legen. Allein das sollte schon werden; er, Gert Liffers, ließ sich nicht so ohne weiteres den Bauerndaumen auf seinen klaren Verstand drücken; er hielt sich Mannes genug, die Sonder-Atouts mit seinen eigenen Trümpfen überzukarten, ein Vorhaben, bei dem er allerdings nicht an den Kartenkönig, an den Donnerjü gedacht hatte, der drüben auf dem Fingerhutshof saß, dem bedeutenden Anwesen, dessen weitverzweigte Gebäulichkeiten mit den tiefhängenden Pfannen- und Strohdächern nunmehr weiter zur Linken in Sicht kamen.
Jetzt hielt der Deichgräf den Fuß an und sah über die Landschaft. Ein gesegnetes Stück Erde lag vor ihm, eine grenzenlose Fläche, deren grüne Halme sich sanft gegen den Abendhimmel bewegten. Es war ein immenser Plan, der, nur von einzelnen Gehöften durchsetzt, sich bis ins Unendliche hinzog. Scharfbegrenzte Linien liefen hindurch, querten sich wechselseitig und gaben der weiten Ebene das Aussehn eines gewaltigen Netzwerks, in dessen Maschen sich kreisrunde Wasser befanden, die wie aufgeschlagene, unergründliche Augen gen Himmel blinkten. Bis weit zum Horizont hin ließen sich die charakteristischen Linien verfolgen, die der des Landes Kundige als Deiche erkannte und die, nach bestimmten Gesetzen geführt, den Zweck hatten, das vornehmlich im Frühjahr zurückgestaute Rheinwasser zu bannen, oder es in weniger gefahrdrohender Weise ins Binnenland überströmen zu lassen. Und ein kräftiger Geruch nach Ringen und Arbeit, ein wohltuender Odem nach fruchtbaren Schollen, nach Schweiß und Brot und Vieh war mit dieser niederrheinischen Erde verbunden, die jetzt vor den Blicken des Deichgräfs sich streckte und da lag, als wäre flüssiges Sonnenfeuer über die unabsehbare Fläche gelaufen. Und der Deichgräf konnte nicht anders, er beugte sich nieder, griff eine Hand voll Humus vom Boden, zerbröckelte ihn zwischen den Fingern und führte die warmen, kräftigen Partikel nach aufwärts. Seine Nüstern öffneten sich. Gierig zog er den Duft ein. Ha, wie das wohl tat! – Ein Hauch von Heimatserde war um ihn; dann ließ er die einzelnen Krumen zu Boden fallen, wo sie achtlos zerstäubten.
Gert Liffers regte sich nicht von der Stelle. Er wurzelte fest, und träumerisch fuhr er sich mit der Hand über die Augen. Er glaubte sich allein – und war doch nicht allein; er merkte es nicht, aber lautlos war die Erinnerung an seine Seite getreten. Sie sah ihn mit großen, sehnenden Blicken an, streckte die Hand aus und zeigte hierhin und dorthin. Und sie raunte ihm alte Geschichten ins Ohr, alte Geschichten, die so wehmütig klangen, und die ihm schon seine Mutter erzählt hatte, wenn sie an der Waschbütte stand, verloren ins Weite stierte, als wenn sie dort ein seliges Glück zu finden hoffte, das sie einstmals besessen. Und die Erinnerung bewegte die duftigen Gräser, weckte allerlei Stimmen im Erlengebüsch, erzeugte riesige Schatten, die mit langen Beinen über die Erde stelzten – und dann kam eine alte Frau mit grauen Haaren und stechenden Augen und ging an der Krücke. Das war die Sorge. Und sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn heimwärts. Aber was sollte er da? – Allerdings – da stand ein wackliges Bettchen; auch ein Tisch war vorhanden, ja, sogar in einer Ecke der erbärmlichen Stube ragte ein Ding auf, das mit einem Brotschrank eine gewisse Ähnlichkeit hatte. Und um den Tisch piepsten und tanzten die Mäuse und machten allerlei Männchen. Aber bei Leibe nicht aus Lebenslust und zum Vergnügen! Es war lediglich Galgenhumor, der die viven Nagerschwänzchen noch lustiger machte und die Mäuseherzchen bewegte. Sie hatten ihr Bündel geschnürt und beschäftigten sich mit Ausziehgedanken, denn was sich im Brotschrank noch an Eßbarem vorfand, lohnte sich kaum der Mühe anzuschroten, geschweige denn hinunterzuknuspern, und endlich: die emsigen Tierchen waren barmherzig, wollten dem kleinen Gert die letzte Schnitte nicht nehmen, und so tanzten und piepsten sie denn hinaus auf die Straße, um anderwärts ihr Glück zu versuchen. Und Mutter Liffers sah ihnen nach und brachte die Schürze nach oben. Sie hörte schlurfende, mühsame Schritte; dann wurde die Klinke gedrückt – hüstelnd war jemand ins Zimmer gekommen. Das war die Alte von eben. Sie führte den kleinen Gert in die Stube, knöchelte auf den leeren Tisch und meinte: »Nu kann's wieder losgehn. Vorwärts!« Und Mutter Liffers war das Herz zum Zerspringen; sie sah sich um und um, nahm den kleinen Gert in die Arme und weinte bitterlich. – Und die Jahre vergingen. Ein kleines, unscheinbares Holzkreuz stand auf dem Friedhof da draußen. Die Inschrift war schon lange verwaschen ... Die Erinnerung wandte sich und deutete auf den Fingerhutshof, hinter dessen Gebäulichkeiten die verschwommene Ferne einen violblauen Schimmer angenommen hatte. Inmitten desselben ragten die Türme von Rees auf, Ein silberlichtes Band kroch am tiefen Horizont hin. Es war der Rhein, der dort langsam vorbei schlich. Der Fingerhutshof lag im Abglanz der untergehenden Sonne. Lichte Reflexe standen in den Fensterscheiben und blitzten ins Land fort. Ein Wagen knarrte und holperte durch die Niederung und fuhr ins Gehöft ein.
»Das ist der Fingerhutshof,« sagte eine raunende Stimme.
Unwillkürlich zuckte der Deichgräf zusammen.
Was wollte die Stimme?
Er suchte seinen Gedanken eine andere Richtung zu geben, aber sie blieben, und die Stimme begann in weichen Tönen zu sprechen, sie drang auf ihn ein und war schließlich so mächtig geworden, daß er sich ihres zwingenden Einflusses kaum noch zu erwehren vermochte.
Die Vergangenheit wollte sich auftun ...
»Ich habe genug gehört,« sagte der Deichgräf, stieß die Erinnerung zurück und ging seines Weges – und als er weiterging, als er in Höhe des Gehöftes gekommen, da saß ein kleines Mädchen an der Böschung des Deiches, still und in sich zusammengekauert, und hielt ein Bündel Wucherblumen im Schoß.
Die näherkommenden Schritte störten es auf. Verlegen ließ es die abgerupften Blumen zu Boden fallen.
Der Deichgräf wollte vorüber – da sah ihn das Kind an. Große Augen standen in dem feinen Gesichtchen. Die dunklen Haare waren auf der Mitte des Kopfes zu einem Knötchen vereinigt. Das kleine Mäulchen öffnete sich, die Hände versuchten unter die Schürze zu schlüpfen, aber Gert Liffers ergriff eine Patschhand und fragte: »Was machst Du hier, Kleine?«
»Da – Blümchen für Mutter.«
»Wie heißt Du?«
»Threschen.«
»Und weiter?«
Das wußte das Kind nicht, oder die Verlegenheit ließ es nicht sprechen. Es schlug die Augen zu Boden und steckte den Zeigefinger verschüchtert ins Mäulchen.
»Wo gehörst Du denn hin?«
»Dahin,« sagte das Mädchen und deutete rücklings. Gleichzeitig hob es das Köpfchen – und da war es dem Manne, als wenn dunkle Wolken zerrissen, als wenn Schleier sich höben, als wenn vergangene Tage ihn ansähen, traurig und in stummer Entsagung.
»Auf den Fingerhutshof?!« stöhnte der Deichgräf.
»Ja,« sagte die Kleine.
Gert hatte aufschreien mögen. Es kam über ihn, als müßte er sein verlorenes Glück, seine begrabenen Hoffnungen, seine einstigen Freuden und Leiden, sein Ein und sein Alles in diesem Kinde umarmen.
Er hob es zu sich empor. Preßte es an sich, und lange, lange ruhte sein Mund auf der Stirn des verschüchterten Mädchens.
»Aleit! – Aleit! – Aleit ..!« klang es aus zerrissenem Herzen. Eine Träne war auf die Wange des Kindes gefallen.
Sanft ließ er es zu Boden gleiten.
Noch einmal sah er das Kind an – tief in die Augen; dann war er weitergegangen. Aber vor ihm ging eine hohe Gestalt, und der Wind wehte einen florigen Schleier gen Himmel, und als er genauer zusah, da war es das Weib, das er verloren hatte für immer.
Threschen hatte sich inzwischen wiedergefunden. Eilig grapste sie mit flinken Händchen die Wucherblumen zusammen, rutschte die steile Böschung herunter, und es währte nicht lange, da klapperten ihre blankgescheuerten Holzpantöffelchen auf ebener Erde. So schnell die hurtigen Beinchen es zu schaffen vermochten, ging es dem nahegelegenen Hof zu.
Gert hatte sich noch einmal gewendet. Mit traurigen Blicken folgte er dem eiligen Mädchen, von dem nur das Köpfchen mit dem braunen Flechtenkrönchen aus den hohen Grashalmen hervorsah. Aber das Geklapper der zierlichen Holzschuhe dauerte weiter, und dann klang ihm eine fröhliche Kinderstimme zu Ohren. Und also tönte es in den Abend hinaus:
»Helder op den Telder, Botter bei den Feß; Moder, maak de Döhr ens op En kiek es, we dor es!«
»Helder op den Telder ...« sagte der Deichgräf. Die Brust krampfte sich ihm bei diesen Worten zusammen. Das hatte er doch auch früher gesungen – mit ihr gesungen, als sie noch klein war, Holzschuhe trug und in einem kurzen Röckchen umherging. Aber das war schon lange gewesen – lange, lange... Und seine Augen füllten sich mit Tränen, er sah in den Abend hinaus, und seine Lippen wiederholten wieder und wieder:
»Helder op den Telder, Botter bei den Feß; Moder, maak de Döhr ens op En kiek es, we dor es!«
und ob er wollte oder nicht: die Erinnerung ließ sich nicht verscheuchen. Sie war stärker wie er, sie war bei ihm, raunte ihm allerlei ins Ohr, und er bemerkte es nicht, daß die Schatten sich längten, daß so ein feuchter, kühler Hauch über die Wiesen dahinzog, und daß dahinten, wo der Deich eine scharfe Krümmung machte, ein eigentümlicher Mensch stand, der blaue Rauchwölkchen aus einer irdenen Pfeife in den Abend hinausblies und ihn schon lange beobachtet hatte.
Der langaufgeschossene Mensch mit den sonderbaren Gesten, dem kleinen Schädel auf den mächtigen Schultern, setzte sich jetzt in Bewegung. Über seine harten, eingetrockneten Züge lief ein heiterer Abglanz. Ja, Josias Spettmann konnte auch freudig gestimmt sein, und er war freudig gestimmt, denn der dort hinten, der so allein stand, den hatte er seit langen Jahren nicht mehr vor Augen bekommen – und er hatte ihn doch schon als Junge gekannt, hatte mit ihm Barsche geangelt und ihm die Strömung des Wassers erklärt, wenn die Stauflut kam und die mulmigen Eisschollen übereinanderknirschten und sich wechselseitig zerrieben. Und der kleine Gert war ein gelehriger Schüler gewesen, hatte den Kopf auf die Dammflanke gelegt, als wenn es dort etwas zu hören gäbe und dann plötzlich gerufen: »Ohm Kiwi, da rummelt's, da will das Qualmwasser ans Taglicht!«
»Qualmwasser?! – Unsinn! – Das sagen die Dämels!«
»Ohm Kiwi, was ist's denn?«
»Schwere Brett noch mal! – das ist das Herz des Deiches – das ist unruhig im Leibe geworden – das will 'raus – das will prophezeien.«
»Ohm Kiwi!«
»Na, was denn?«
»Da laufen die Ratten!«
»Die Ratten – mein Jüngsten?! – dann komm man; nu kann ich's auch nicht mehr halten: das will übers Land weg – das Wasser. Oha! was ich immer schon sagte ...«
Und dann hatte er ihm eine Weidenflöte geschnipselt.
»Da flöt' mal; mußt Dich proper durchs Leben hindurchflöten. Ein Kerl mußt Du werden, so 'n richtiger Deichgräf. Kannst es schon machen, denn Du hast mehr Akki dazu, wie alle die Hammels zusammengenommen zwischen Niedermörmter und Wissel. Nu aber lauf' man nach Hause, grüß' Mutter und laß Dir 'ne Brotschnitte geben.« –
Und der kleine Junge war größer geworden, immer größer und größer, ließ, nachdem er seine Mutter begraben, die Scholle, wo er geboren, schleppte sich mit seinem Päckchen Sorgen und seinem Leid da draußen herum, hatte was prestiert in der Welt und war dann wiedergekommen. – Und nun stand er dahinten als Deichgräf, als ein Mann, den das Leben gerüttelt, der Schwielen in den Händen hatte, die er sich im Kampf ums Dasein erworben – und stierte und stierte ... Und der Wind ging säuselnd über das Tief, und die Grasspitzen wellten sich im laulichen Hauch – fern drüben wurde eine Sense gedengelt. Ein Wetzen und Schleifen glitt über die endlose Fläche. Ein kräftiger Erdgeruch entströmte dem Vorland, die Kolke begannen seltsam zu leuchten. Im nahen Gehöft wieherte ein Pferd auf, eine Kuh brüllte . .. und dann wieder die angenehme, helle Kinderstimme von eben:
»Helder op den Telder, Botter bei den Feß; Moder, maak de Döhr ens op En kiek es, we dor es!«
Die Stille des Abends gab alles in kristallischer Reinheit wieder.
Der Deichgräf zuckte zusammen.
Da hielt es den Kiwi nicht länger,
»Buschur!« schrie er über den Deich fort.
»Gert ...!«
»Kiwi ...!«
Und da standen die beiden: der kräftige, blühende Mann mit dem gebräunten Gesicht und dem stolzen Bewußtsein im Herzen, das Leben noch formen zu können nach seinem Geschmack und wie ihm es beliebte – und der andere, der armselige Mensch, der Gottesnarr, durch dessen Gesichtsfeld traurige Schatten huschten, irre Sterne lichterten, als müßte das sein, als wäre das so immer gewesen; und sie hielten sich bei den Händen gefaßt und konnten zuerst die richtigen Worte nicht finden. Und dann kamen die Worte.
»Zehn Jahre ... !« sagte der Kiwi. »Schwere Brett noch mal! – das hat Euch zusammengeritten da draußen – nobel geworden – Kurasch in den Knochen ... Hahahaha! – es hat Euch gut gegangen, das seh' ich.«
»Stimmt schon,« meinte der Deichgräf. »Und Ihr – wie steht's denn bei Euch noch unter den Pfannen?«
»Noch immer bei Wege. Bastle an meinen Schälweiden 'rum, skandaliere mit Mutter, wenn die Schleie nicht beißen, höre, wie's rummelt im Deich – unsere Katze hat Junge gekriegt ...« und er zählte an den Fingern herunter: »Oha! – zwei hat Barthes van Laak auf dem Fingerhutshof, zwei sind zu Hause, drei sind versoffen und liegen im Kalkflack, und es wäre alles noch zu mäntenieren gewesen, wenn nicht immer die Bibel ...«
Ein häßliches Lachen schlug dem Deichgräf entgegen.
»Ja, Gert, wenn nicht das mit der Bibel ...! – Und er mußte doch schwören – der Schwarzrock. Aber er tat's nicht – tat's nicht, und er hat mich auch für 'nen Narren gehalten, und wer zu seinem Bruder Du Narr sagt ...«
»Ja, ja,« suchte Gert Liffers einzulenken, »das ist aber schon lange gewesen.«
»Was – schon lange gewesen?! – Erst gestern, mein Junge. – Aber die da hinten über den Berg weg, die lassen keinen Propheten nicht gelten. Und unsere Katze hat Junge gekriegt – aber ich sage Euch, Deichgräf,« und seine Stimme nahm einen prophetischen Ton an, »es wird Thyro und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes denn jenen, denn sie haben mir 'nen zölligen Knüppel zwischen die Beine geschmissen – und der Prediger hat nicht auf die Bibel geschworen – und ich mußte mit Mutter von unserm Acker herunter. Aber, Gert, das ist gut so gewesen, denn hier, mang den Katholischen, estimieren sie noch so 'nen alten Propheten. Und die jungen Katzen, die im Kalkflack liegen, mach' ich wieder lebendig, und die mit der Blässe kriegst Du denn, mein Junge. – Oha! – und was ich gesagt hab', brauchte ich nicht herunterzufressen, denn ich habe gesagt: Gert Liffers wird Deichgräf. Na, und bist Du nicht Deichgräf geworden?!«
»Ich danke Dir, Kiwi.«
»Nichts zu danken, mein Junge. Aber Freundschaft – die will ich.«
»Freundschaft?! – die hast Du,« lachte der Deichgräf und hielt ihm die Hand hin.
Über die kantigen Züge des Ärmsten lief ein freudiges Grinsen.
»Na, denn ...« und er schlug kräftig in die dargebotene Hand ein. »Oha! – wie das gut tut, und da wir nu Freundschaft haben, darf ich auch wohl sprechen so frisch von der Leber herunter, denn die toten Katzen schenieren nicht weiter – und wer zu seinem Bruder Du Narr sagt ... Aber das ist nu schon lange gewesen – und da muß ich doch sagen: Deichgräf, paß Achtung – hier stimmt's nicht.«
Mit einer grotesken Bewegung deutete der Kiwi just auf die Stelle, wo sie Fuß gefaßt hatten.
»Hier rummelt was unten! – Hörst Du's nicht, Deichgräf?«
»Ich verstehe so recht nicht.«
»Nicht?!« machte der Kiwi, »aber das räsonniert schon, so lang ich's besinnen kann in meinem dämlichen Schädel. Hier sind die pursten Hammels vergraben.«
»Ja, so,« meinte Gert Liffers, »von wegen des geringen Vorlands und der Führung des Deiches. Das eckt ja – und deshalb bin ich schon bei der Gemeinde vorstellig geworden. Hier muß der Spaten 'ran und abgewallt werden.«
»Brav so,« freute sich der Kiwi. »Paß Achtung! – wenn hier nichts kunträr steht, kein Flügeldeich herkommt – beim nächsten Hochwasser biegt das und baucht das, und denn adjüs, Barthes van Laak; dann kriegst Du das Maul voll, dann schreit das, und brüllt das: Wasser – Wasser – Wasser!«
»Stimmt schon,« sagte der Deichgräf, »und ich wundere mich, daß schon so lange in dieser gottssträflichen Weise ...«
»Bauern,« grinste der Kiwi, »niederrheinische Bauern ...! – Hartköppe – Sturköppe ...! – Das geht so lange, wie's gut geht. – Aber die Blässe, die schwarze Katze mit dem weißen Stern auf der Schnauze, ist wieder lebendig geworden, und da haben die Sturköppe Einsehn bekommen, und Du bist Deichgräf geworden – und nu wird die Sache schon flutschen, denn ich und die Bibel ... Deichgräf, paß Achtung!«
»Darauf verlaßt Euch,« versetzte Gert Liffers und schickte sich an, weiter zu gehen.
»Halt!« sagte der Kiwi; in seinen wasserblauen Augen begann es seltsam zu leuchten,
»Was soll's noch?«
»Sieh' mal,« meinte der Alte und tastete nach der Hand des vor ihm stehenden Mannes. »Du bist mal so 'n ganz kleiner Junge gewesen – und Deine Mutter hatte nicht so viel wie das Schwarze vom Nagel – und Du hast gehungert, gehungert, gehungert. Und dann ist da so 'n ganz kleines Mädchen gekommen, so 'n Kiekindiewelt – und hatte Holzklumpen an und schwarzbraune Haare im Nacken ... Und Du hast mit mir Ratten gefangen, Ratten und Mäuse – und wir haben Barsche geangelt – und Du sahst, wie die Kiebitze flogen – und Du hast gehört, wie's in den Deichen kloppte und kloppte ... Und dann bist Du größer geworden – und das Mädchen ist auch größer geworden – und wir haben Freundschaft geschlossen – und Du hast mich für keinen Narren gehalten wie der schwarze Prediger in Neu-Luisendorf, denn wer zu seinem Bruder Du Narr sagt ... Oha! – und das ist angekreidet, angekreidet für immer. Und darum ...«
Der Alte reckte sich auf. Der kleine Kopf mit den glutenden Augen hob sich auf den mächtigen Schultern. Der überlange Körper schien in den Abendhimmel zu wachsen.
Er stand regungslos.
Jetzt streckte er die rechte Hand über die Landschaft.
»Deichgräf, was liegt da?«
»Der Fingerhutshof.«
»Richtig. – Wer wohnt da?«
»Barthes van Laak«
»Und wen hat er gefreit und geheiratet?«
»Die Aleit.«
»Richtig,« sagte der Kiwi, und seine Stimme nahm einen sonderbaren, fast drohenden Ton an: »Und ich sage Dir, Deichgräf«, und wieder deutete er auf das stille Gehöft hin, »das dürft Ihr nicht sehn, da müßt Ihr immer mit blinden Augen vorüber; der Fingerhutshof ist für Euch nicht da, der ist tot für Euch mit allem, was drin ist.«
»Kiwi ...!«
Gert Liffers fuhr sich mit der Hand über die Augen.
»Tot für Euch!«
»Der da?!«
Der Deichgräf wußte nicht mehr, was er fragte.
»Ja,« sagte der Kiwi. »Streckt Ihr die Hand nach dem da – und ihr ... Der Donnerjü hat's geschworen: Gert Liffers ist nu wiedergekommen, hat er gesagt, aber versucht er's – streckt er die Hand aus ... Oha! – 'ne Bouteille mit Rotspon schlag ich ihm auf seinem Deichgräfenschädel zusammen. Und was Barthes van Laak sagt ...«
»Kommt,« meinte Gert Liffers.
Die beiden Männer gingen zusammen. Sie sprachen nicht weiter. Jeder war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.
Dämmerungen krochen über das Land fort. Die Fernen hatten eine hyazinthblaue Tönung angenommen. Der Kalkflack, der jetzt so friedlich zur Seite des bauchigen Dammes vorüberflutete, gurgelte in weichen Lauten. Wasserblasen stiegen auf und zerplatzten an der ruhigen Oberfläche. Im Schilf war ein Flüstern und Säuseln. Hin und wieder wurde eine Dommel lebendig. In den nahen Erlenbeständen zwitscherte ein verschlafener Vogel. Das Dengeln hatte aufgehört. Vereinzelte Schnitter gingen nach Hause. Sie hielten die blanken Sensen geachselt. Das ersterbende Licht des Abends ruhte auf den blitzenden Schneiden.
An der Bunten Schleuse trennte sich Gert Liffers vom Kiwi.
III Tütütütü...!
Das Haus, wo sich Gert Liffers eingetan hatte, war der Sophie Boß oder, wie sie die Leute allgemein nannten, der ›Laken-Sophie‹ zu eigen. Nach dem gottseligen Ableben ihrer frömmelnden Eltern, die jedes Kastemännchen aus Sparsamkeitsrücksichten dreimal in den Fingern herumgedreht hatten, war es ihr, als der einzigen Tochter, mit dem gesamten Mobiliar zugefallen. Hierzu kam noch ein kleines, auf der städtischen Sparkasse deponiertes Kapital von nahezu achthundert Talern. Da ferner Sophie von jeher ängstlich darauf gehalten hatte, die beiden Zimmer der oberen Etage gut an den Mann zu bringen, selber aber entweder zu Hause oder auf dem Lande herumschneiderte und gewissenhaft dafür sorgte, alles und jedes, was sie erübrigen konnte, einem dickwollenen Strumpfe einzuverleiben, so hatte sie das angenehme Bewußtsein, sorgenfrei und hoffnungsfreudig bis in die späteste Zukunft blicken zu dürfen. Mit den Jahren hatte der Strumpf ein stattliches Ansehen gewonnen, fühlte sich straff und rund an, als wäre die maschige Wolle über eine pompöse Wade gezogen – aber beileibe nicht über ihre eigene Wade, denn ihr Untergestell war von einer beneidenswerten Fülle soweit entfernt, wie der Gesang einer Dohle von dem eines Kanarienrollers. Alert, schnellfüßig, beweglich, kurz ein vives Frauenzimmer, das war sie, aber Waden hatte die Laken-Sophie leider Gottes in ihrem erbaulichen Leben niemals besessen. –
Eine blitzblau angestrichene Tür schloß den niedrigen Flur ab; die schmalen Fensterruten, hinter denen blendend weiße Mullgardinen hingen, waren von der nämlichen Farbe wie die Tür und die aus Latten gezimmerte Bank, die von der Besitzerin des kleinen Hauses so günstig placiert war, daß man von hier aus die breite und lange Grabenstraße genau zu übersehen vermochte. Im Fenster, rechts neben dem Eingang, paradierte jahraus jahrein ein allmächtiger Kugelkaktus. Saftig, strotzend, über und über mit Warzen und sonstigen Auswüchsen bedeckt, lag er so selbstgefällig auf seiner irdenen Scherbe wie so 'n richtiger Protz mit Plüschpantoffeln und Schlafrock im Lehnstuhl – ein jovialer Protz, der an den lieben, langen Wintertagen nichts weiter zu tun hatte, als durch die Scheiben zu kucken, 'ne Pfeife zu rauchen und mit der goldenen Berlocke auf seinem Bäuchlein zu spielen. Kam aber der Sommer ins Land, wurden die Tage schwüler und heißer, begannen die unverschämten Schmeißfliegen empfindlicher zu stechen, dann trat an Stelle des samtnen Schlafrocks ein solcher von grünem Lasting, der über und über mit ziegelroten Blumen besteckt war. Und die Kelche wurden größer und größer, dehnten sich und streckten sich und schienen auf der spinatgrünen Kugel wie feurige Räder zu liegen. Je besser es die Sonne meinte, um so prächtiger begannen die Blumenkelche zu leuchten – und dann kamen die größeren Kinder aus der Nachbarschaft, hoben sich auf den Zehen in ihren blankgescheuerten Holzschuhen und meinten: »Hendrick, no kiek ens, Wilmke, no kiek ens! – de heelmoije Kaktus van Jöffer Boß het fürige Placke ...« und die Laken-Sophie begab sich alsdann unter die neugierigen Kinder, erzählte ihnen Wunderdinge von dem merkwürdigen Verhalten ihres eigentümlichen Pfleglings, der wohl an hundert Stunden hinter Amerika zu Hause wäre, nie Wasser bedürfe und so rund und groß werden könnte wie das mannshohe Bierfaß, dessen Inhalt der dicke Brauer Kobes van de Kamp alljährlich am ersten Kirmestage verzapfte. Sperrangelweit rissen alsdann die Kinder Augen und Mund auf, wunderten sich aber noch mehr über das pompöse Aussehn der Jöffer Boß, die so vornehm und feierlich tat, als wäre sie eine verwunschene Märchen-Prinzessin gewesen; denn sie war ganz in Schwarz gekleidet, hatte ihre strohblassen Haare mit Quittensaft an die Schläfen geklebt und trug auf ihren Schultern ein faltiges Pelerinchen, das aus wenigstens fünf geschachtelten Kragen zusammengestellt war. Dazu funkelte auf ihrem kaum nennenswerten Busen das emaillierte Goldkreuz, das an Größe dem des hochwürdigen Weihbischofs von Münster nicht um ein Titelchen nachgab; und der Kaktus blühte immer schöner und schöner – und die Laken-Sophie erzählte immer interessanter und seltsamer, gestikulierte dabei mit ihren langen Armen immer grotesker auf die gaffenden Kinder ein, reckte sich auf, bis sie schließlich so groß wurde, daß sie fast in das Zimmer der niedrigen ersten Etage zu sehen vermochte. Und der schwefelgelbe Kanarienvogel, der neben dem blühenden Kaktus schon seit vielen Jahren ein beschauliches Dasein geführt hatte, bekam's mit der Sehnsucht, gluckste und begann leise zu schlagen, bis er allmählich eine sanfte Wasserflötenrolle riskierte, die so lieblich klang, daß die kleine Gesellschaft in die Händchen klatschte, mit den Holzschuhen klapperte und glücklich davonlief. Der Kugelkaktus jedoch brachte eine neue Blume hervor; da ging die Laken-Sophie über die Schwelle und machte die blitzblaue Tür zu. –
Auf der anderen Seite der Straße, dem bescheidenen Häuschen schräg gegenüber, standen sieben stattliche Linden. In ihrem Schatten lag ein gefälliges Anwesen. Grüne Jalousien hoben sich freundlich von der weißen Verkalkung. Seitwärts der Tür befand sich ein schwarzes Brett, auf dem zu lesen war, daß hier Johann Peter Gerechtsam als öffentlicher Notarius fungierte. Nicht weit vom Hause des Notars machte sich ein altertümlicher Giebel bemerkbar; er mochte dem Ende des sechzehnten Jahrhunderts seinen Ursprung verdanken. Ganz aus roten Ziegeln aufgeführt, verkragt und mit derben Fialen ausgestattet, schickte er fünf sich immer mehr verjüngende Etagen nach oben, die hinsichtlich des Fensterschmuckes alle die gleiche Ausstattung aufwiesen. Die gehäkelten Vorsetzer, die Schirtinggardinen mit dem aufgedruckten Zeichen ›J.H.S.‹, welches ›Jesus, Heiland, Seligmacher‹ bedeutete, die Kollektion Nachtviolen hinter den Scheiben, in deren Mitte eine stattliche Meerzwiebel prangte – alle diese Dinge bewiesen zur Genüge, daß durch die Korridore und Stuben des hochgegiebelten Hauses ein stiller Geist schlurfte, der die hier wohnenden Menschen an derselben Strippe bewegte. Arme, gebrechliche Leute, aber auch solche, die auf ihrem Lebenswege einen kleinen Zehrpfennig beiseite getan hatten und sich in der Lage befanden, einen geringen Zuschuß geben zu können, hatten hier auf der Grabenstraße und von Gemeinderats wegen ein angenehmes, sorgenfreies Unterkommen gefunden. Obgleich kein stichhaltiger Grund vorlag, den merkwürdigen Ziegelbau mit dem Namen ›Armenhof‹ zu belegen, so war dennoch diese Bezeichnung schon seit Menschengedenken in der ganzen Bevölkerung gang und gebe gewesen. Ebenerdig, und zwar rechts vom Eingang aus, lagen zwei große Räume, die die ehrsame und schon ziemlich betagte Lisbeth Mömmes bewohnte, eine fünfundsechzigjährige, umfangreiche Dame, die, außer ihrer segensreichen Tätigkeit als Vorsteherin einer Kinderbewahrschule, in ihrem Nebenamt mit der Oberaufsicht des ganzen Hauses betraut war. Zur Winterzeit und an sonst unwirtlichen Tagen hielt sie die ihr anvertrauten Hühnchen und Hähnchen in der vorderen Stube zusammen; begann's aber draußen sommerlich und so recht behaglich zu werden, klebten die Schwalben ihre kunstvollen Nester an das alte Ziegelgemäuer des Armenhofes, dann zog die ganze, kleine Gesellschaft mit Stühlchen und Bänkchen auf die Straße hinaus, spielte im Schatten Ringel-Reihe-Rosenkranz oder machte sich mit Fingerhüten in etlichen Sandhaufen zu schaffen, formte Käschen und Torten und trieb sonstige Kurzweil, während Lisbeth Mömmes, mit einer schwarzen Hornbrille angetan, im Binsensessel neben der Haustür thronte, an einem nie fertig werdenden Wollstrumpf hantierte, zeitweilig über die runden Augengläser fortblinzelte und das kleine Kroppzeug bewachte. Hierbei fand sie noch Zeit und Muße genug, die vielfachen Obliegenheiten ihres Nebenamtes tatkräftig in die Erscheinung treten zu lassen. Eine fast holländische Sauberkeit machte sich bis in die entlegensten Winkel bemerkbar; die Stubendielen gaben sich proper wie gescheuerte Tischplatten, und der heilige Joseph, dessen Gipsbild aus einer Nische des unteren Korridors freundlich auf die Eintretenden herabsah, konnte sich auch nicht im geringsten über Vernachlässigung in betreff der ihm zugedachten Ehrungen beklagen. Auf seinem Postament flämmerte stets die ewige Lampe; zeitgemäße Blumen wurden allwöchentlich in Gestalt eines schmucken Kränzleins um das Bildnis gewunden, und nur wenn der Garten nichts mehr hergeben wollte und konnte, traten an Stelle der frischen Blüten weiße Papierrosen, die so eigentümlich rauschten und knisterten, wenn ein Lufthauch sich auftat und hüstelnd die weißgekalkten Gänge durchirrte. Alles und jedes in diesem Hause gab sich wie an einem seidenen Schnürchen. Die Pünktlichkeit selber ging in Gestalt einer würdigen Matrone, mit Kleisterlöckchen und einer blendendweißen Knippmütze ausstaffiert, treppauf und treppab, huschte lautlos über die weiten Flure, öffnete kaum wahrnehmbar die einzelnen Zimmer, sah hinein, ob alles in Ordnung, und zog die Gewichtsteine an – und fing bei Lisbeth Mömmes die prächtige Kuckucksuhr an zu rufen, so konnte man gewiß sein, daß fast gleichzeitig die sämtlichen Uhren im Armenhof, und zwar bis auf die Sekunde, in Tätigkeit traten. Allerdings: die eine meckerte, die zweite krähte, eine andere machte sich durch ihre sonore Stimme bemerkbar, während die des tauben Christ van de Lucht, der ganz oben in der dritten Etage hauste, so heiser sich anließ, daß Lisbeth stets darüber nachsimulierte, ob es nicht angezeigt wäre, der Ärmsten eine Tasse mit heißem Kamillentee hinter die Binde zu gießen. Aber wie dem auch sein mochte, die Hauptsache ließ sich nicht fortdisputieren: alle Uhren, die ihrem Bereich unterstanden, schlugen präzise zusammen, ein Zeichen, daß ein und dieselbe Pünktlichkeit und Ordnungsliebe alle Insassen des Armenhofes beseelte – und so auch heute. – Vier Uhr!
Prompt begannen alle Uhren zu schlagen, und als der majestätische Kuckuck da unten seinen Schnabel zuklappte und zitternd die Holzflügel anlegte, stieß Lisbeth Mömmes ein scharfes »Tütütütü!« aus.
Es war ihr alltägliches Locken, und die ihr unterstellten Kinder verstanden's. Fast gleichzeitig ergriff ein jedes von ihnen sein Holzstühlchen, seinen Fingerhut oder sonstiges Spielzeug und machte sich fertig, nach gemeinsam eingenommener Stippmilch und unter Führung der alten, gluckenden Henne, die sich inzwischen mit Rute, Hornbrille und Strickstrumpf bewaffnet hatte, auf die Straße zu pilgern. Lisbeth befand sich an der Spitze der kleinen Gesellschaft, und unter stetigem ,Tütütütü', das nur zeitweilig durch ein verwarnendes Schnalzen unterbrochen wurde, ging es nach draußen. Hier, unter Gottes freiem Himmel, auf einer fast menschenleeren Straße, machte sich das putzige Völkchen alsbald zwischen den aufgeschütteten Sandhaufen zu schaffen, faßte sich zuerst bei den schmutzigen Händchen und begann singend um die dicke Lisbeth zu tanzen, die sich inzwischen breitspurig auf ihren Binsensessel postiert hatte.
»Schön so,« sagte die Alte, nickte äußerst gnädig und wohlwollend mit ihrer grellfarbigen Bänderfladuse und begann eifrig zu stricken.
»Hopla, Marjännske!« sangen die Kinder; dann fielen sie in die Sandhaufen ein, und mohnblaue Tauben, mit buntem Schiller um den Hals, kamen vom nahegelegenen Rathaus geflogen, rucksten auf den Pflastersteinen herum und blähten ihre Kröpfchen – und die ehrwürdige Dame Lisbeth Mömmes saß mit ihrem runden Bäuchlein, dem hängenden Busen und der blaubedruckten Kattunschürze so steif und regungslos zwischen den Binsen, als wäre sie eine indische Pagode geworden. Und die Stricknadeln klapperten immer leiser und leiser, und über das Gesicht der resoluten Frau lief ein seliges Träumen. Kein Zweifel – sie konnte aber auch immer so angenehm duseln und träumen, ein Zustand, in welchem besonders der schöne Joseph von Ägypten ihre ganze Seele bewegte. Sie hatte überhaupt allwöchentlich zwei Tage zu verzeichnen, die sie die ›Glücklichen‹ nannte. Diese zerfielen ihrerseits wieder in den ›seligen Tag‹ und den ›ägyptischen Tag‹, eine Bezeichnung, die abhängig war von der jeweiligen Stimmung. Beim ›seligen Tag‹ grübelte sie sich in ihre Sterbestunde hinein, brachte ihren Nachlaß in Ordnung, ließ den Herrn Pastor kommen, empfing würdig die letzte Wegzehrung und schlummerte gottselig in ein besseres Jenseits hinüber, nachdem sie zuvor ein Begräbnis bestellt hatte, das sie unbedingt mit dem Tarifsatz ›prima Klasse‹ signiert haben wollte. Hier lag bei ihr jedenfalls der Hase im Pfeffer. Drei Geistliche mußten dabei sein, die Herren von der Orgel durften nicht fehlen, und der Herr Webermeister Janssen, der in seinen Mußestunden das Kornet à piston blies und auch an Kirmessen aufspielte, mußte mit seiner ganzen Kapelle den Trauermarsch ›Nu trinkt sie keinen Rotspon mehr‹ ihrem Sarge vorausblasen. Geld spielte hierbei keinerlei Rolle. Seit Jahren hatte sie für diese glückliche Stunde gespart, und sie freute sich jetzt schon auf den weihevollen Moment, auf die erstaunten Gesichter ihrer lieben Mitbürgerinnen, wenn sie so ›prima‹ auf den Kirchhof hinausfahren konnte. Während des ›ägyptischen Tages‹ hingegen trat sie in eine Art von Seelenverhältnis mit dem ägyptischen Joseph – und dieser Moment, ebenso groß und erhaben wie die ›selige Stunde‹, war für sie jetzt gekommen.
Da saß sie und strickte – und das pharaonische Land wurde vor ihren geistigen Blicken lebendig. Sie hörte die gesprenkelten Schafe blöken, sah die hochbeinigen Kamele durchs Niltal schlendern, die hellen Schellen klingelten auf, und die bunten Fransen der Satteldecken wehten im Wind – und sie selber: mit Joseph, dem Sohne der schönen Rahel, ging sie am seichten Ufer spazieren, und sie führten sich Hand in Hand und sahen, wie große, himmelblaue Kelche auf dem ruhigen Nilwasser schwammen, das ihre Füße benetzte. Und Lisbeth Mömmes war glücklich, hätte es wenigstens sein können, wenn nicht das stolze, üppige Weib gewesen wäre, das sich selbstgefällig in den vollen Hüften wiegte und unter säuselnden Palmenkronen einherkam. Und das war die Potiphar, die Frau des ägyptischen Kämmerers, der den sanften Jüngling von den Israeliten gekauft hatte. Da geschah das Unglück, denn das nacktbusige Weib erwischte Joseph, den Sohn der schönen Rahel, am Ärmel und versuchte alsdann, den