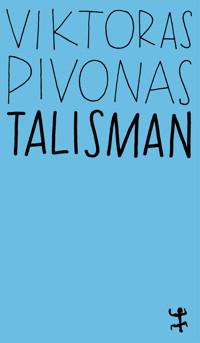Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Am düsteren Ort und in brenzliger Lage kommt eine bunt gemischte Gruppe von Menschen zusammen, die nicht viel mehr als ihr Leben und ihre Erinnerungen gerettet haben. Langsam sind sie bereit, sich gegenseitig kennenzulernen, wenn auch nicht durch Preisgabe ihrer Geschichte, so doch darüber, was sie an Legenden füreinander erfinden. Manche dieser Märchen haben einen wahren Kern, andere einen unwahren. Aber alle diese Erzählungen verfolgen einen höheren Zweck: Sie dienen der Unterhaltung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VIKTORAS PIVONAS
Die tätowierten Augen
¿ Märchen ?
Imprint
Die tätowierten Augen © 2016 Viktoras Pivonas
Published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de
Konvertierung: Sabine Abels / www.e-book-erstellung.de
Es gab einmal, gegen Ende des Krieges, eine kleine Insel des Friedens. Unbemerkt von den kämpfenden Soldaten und von den hin und her strömenden Armeen, und nicht erreichbar für die vom Himmel fallenden Bomben, lag unter den Ruinen einer halbzerstörten Stadt ein altes Kellergewölbe.
In dieses Gewölbe hatte sich ein Dutzend Menschen geflüchtet, die sich nun daran machten, ihre nähere Umgebung und sich gegenseitig kennen zu lernen. Hätte nicht jemand eine Petroleumlampe mitgebracht, es wäre stockfinster gewesen, denn selbst wenn die Tür des Kellers offen gestanden hätte, wäre kein Tageslicht in diese Tiefe gedrungen. Aber auch das Licht der blakenden Lampe reichte nicht aus, den Raum zu erhellen. Selbst wenn die Flüchtlinge nicht so dicht gestanden hätten, wäre es nicht stark genug gewesen, bis zu den Wänden vorzudringen. Und nur wenn sich jemand bewegte, sah man hinter seinem Schatten etwas, was noch dunkler war und was der Anfang eines Ganges oder auch eine Nische hätte sein können.
Doch zunächst standen alle im Kreis und schwiegen und schienen sogar leiser zu atmen. Einen Moment lang war es totenstill. Aber gleich wurde die Stille von einem Geräusch unterbrochen, das sich wie ein fallender Wassertropfen anhörte. Nach einer Pause wiederholte sich das Geräusch. Einer, der einen langen Mantel trug, beugte sich zu der Laterne. Jetzt erkannte man die Hand und das Gesicht eines alten Mannes. Als er die Lampe aufhob, machten ihm die anderen Platz. Langsam bewegte er sich in Richtung des Geräusches. Während die Flüchtlinge im Dunkeln blieben, wanderte das Licht über die steinernen Fliesen. Schließlich erschien im Schein der Lampe ein Eimer und danach ein Wasserhahn, dessen Rohr zwischen den Quadern der Kellerwand verschwand.
Wasser, sagte der Mann und drehte am Hahn. Ein kräftiger Strahl sprudelte in den Eimer. Sofort wurde der Hahn wieder geschlossen.
Wasser, wiederholte er und kehrte zu den anderen zurück. Weil auch jetzt niemand das Wort ergriff, begann der Alte erneut zu sprechen:
Das muss ein Weinkeller sein; als ich herein kam, stützte ich mich auf einige Kisten, in denen Flaschen lagen.
Diesmal ließ er die Lampe stehen. Womöglich noch langsamer als beim ersten Mal bewegte er sich zur Treppe, die aufwärts zum Ausgang führte.
Die Augen, murmelte er, müssen sich erst umgewöhnen. Ja, ja, viele Kisten. Die meisten sind leer.
Es war nicht zu sehen, was er machte, aber nach einer Weile erschien er wieder im Kreis der anderen. Er hatte zwei Weinkisten mitgebracht. Eine davon stellte er hinter sich. Die zweite versuchte er zu zerbrechen. Dazu musste man nicht stark sein, denn die Latten ließen sich leicht auseinanderreißen.
Bitte, sagte eine Frau, wenn uns jemand hört!
Einen Moment hielt der Alte inne.
Wenn wir nichts von draußen hören, antwortete er dann und wies zur Decke des Gewölbes, das im Dunkeln verschwand, wie sollte dann jemand uns hier unten hören?
Aber vielleicht ein Spion, widersprach die Frau.
Jeder von uns, antwortete der Alte, kann für den anderen ein Spion sein. Das Petroleum, fuhr er dann fort, ohne seine Tätigkeit zu unterbrechen, wird nur für einige Stunden reichen. Ein Feuerchen kann nicht schaden. Etwas mehr Licht und Wärme.
Er stapelte die zerbrochenen Latten zu einer kleinen Pyramide, entzündete am Zylinder der Lampe einen Holzspan und damit das aufgeschichtete Holz.
Aber der Rauch, sagte die Frau.
Beruhigen Sie sich bitte, antwortete der Alte. Irgendwohin ist der Qualm der Petroleumlampe auch gezogen. Und wenn der Rauch im Tageslicht austritt - er wies wieder zur Decke - da draußen gibt es noch mehr Rauch.
Dann setzte er sich auf die zweite Kiste. Während das Feuer aufflackerte, zog er seinen Mantel um die Schultern; dabei wurde ein aufgenähter gelber Stern sichtbar. Einen Moment lang schienen alle auf den Stern zu starren. Schließlich wurden weitere Kisten geholt, bis alle um das Feuer saßen.
Ich denke, sagte der Alte, wir können jetzt die Lampe löschen.
Die junge Frau, deren dunkelhäutiges Gesicht von schwarzen Locken umrahmt war, beugte sich über den Zylinder und blies die Flamme aus. Jemand zerbrach weiteres Holz und trug es in die Mitte des Gewölbes.
Ein Weilchen dürfte das reichen, meinte der Alte und dann: Jetzt können wir auch einander in Ruhe betrachten. Vielleicht, doch das müsste jeder selbst entscheiden, vielleicht sollten wir uns vorstellen. Er blickte in die Runde: Ich heiße Abel.
Die anderen schwiegen.
Nun ja, sagte der alte Abel, nun ja, irgendwie könnte er es verstehen, wenn jemand seinen Namen nicht nennen wollte. Es sei ja auch nicht so wichtig. Dabei blickte er einem nach dem anderen ins Gesicht. Neben der dunkelhäutigen Frau stand ein kleiner Junge, der kurz davor war, etwas sagen zu wollen. Aber die Frau legte ihm die Hand auf die Schulter und der Kleine schien hinunterzuschlucken, was ihm eben noch auf der Zunge gelegen hatte.
Als das Feuer immer heller loderte, sah man, dass einer der jüngeren Männer einen Arm in der Schlinge trug. Auf dem Verband zeichnete sich ein dunkler Fleck ab. Der Verwundete trug einen zerschlissenen Militärmantel mit einem Balkenkreuz. Neben ihm stand ein wohl Gleichaltriger mit kantigen Gesichtszügen. Er trug einen Anzug, der ehemals eine Uniform gewesen sein mochte und am Kragen einen ausgeblichenen roten Stern gerade noch ahnen ließ.
Das Feuer brennt viel zu hell, sagte der Verwundete.
Abel bückte sich und zog zwei Bretter aus der Glut. Er legte sie neben die Pyramide und trat die Flammen der Scheite aus. Danach setzte er sich wieder.
Ob man uns wohl etwas Wein gelassen hat? fragte jemand. Statt einer Antwort lachte ein anderer auf und brach gleich darauf sein Lachen ab, als hätte es ihn selbst erschreckt.
Vielleicht, antwortete schließlich Abel, aber bei der Dunkelheit wird es nicht ganz leicht sein, etwas zu finden. Nun, fuhr er fort und blickte den Verwundeten an, es hat ja auch keine Eile, mit dem Wein. Wenn jemand durstig ist, kann er Wasser trinken – und, wie die Dinge liegen, haben wir zum Feiern keinen Grund.
Zum Feiern nicht, sagte der, der eben noch gelacht hatte, aber zum Vergessen.
Alle blickten in seine Richtung; da er aber im Hintergrund saß, war von seinem Gesicht nichts zu erkennen. Außerdem trug er, wie fast alle Anwesenden, einen unförmigen Mantel, unter dem sich noch mehr Kleider ebenso verbergen konnten, wie Gepäckstücke oder gar Waffen.
Vergessen… Ich weiß nicht, nahm der alte Abel den Faden auf, als sei die Lage der Flüchtlinge ganz natürlich und als ging es nur darum, ein Gespräch zu führen:
Mir geht es ganz anders. Mir drängen sich die Erinnerungen auf, so als sei dieser Platz besonders fürs Erzählen geeignet.
Sie haben Nerven, sagte der Verwundete und es klang fast ein wenig vorwurfsvoll.
Nein, nein, erwiderte Abel, ich bin nur alt. Und wenn man alt ist, besteht man fast zwangsläufig aus Geschichten. Würde ich auch noch einen Schluck Wein trinken, könnte ich damit gar nicht aufhören.
Erzähl mal, sagte der Junge.
Vielleicht, antwortete Abel, wenn es niemanden stört, und dabei blickte er in die Runde und versuchte, einen Blick von jedem der um das Feuer Sitzenden aufzufangen, vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte.
Als keiner antwortete – nur die junge Frau schien zu nicken – kroch der Junge auf allen Vieren neben den Platz des Alten, nahm die beiden Scheite und legte sie erneut ins Feuer. Dabei blickte er den Verwundeten an. Der schwieg. Der Junge starrte in die Flammen. Mit leiser Stimme begann Abel zu erzählen. Dabei blickte auch er ins Feuer, so, als würden die springenden Funken ihn an etwas erinnern. Doch kaum, dass er einige Sätze gesprochen hatte, bat eine Stimme von der anderen Seite der Runde: Lauter, etwas lauter, bitte. Abel nickte und begann noch einmal von vorn.
Die tätowierten Augen
Ich kannte einen Mann, der war schon so lange umhergewandert, dass er fast alles Böse gesehen hatte, was es auf der Welt zu sehen gab. Schließlich wurde es seinen Augen zu viel und er drohte zu erblinden. War er früher von Land zu Land gezogen, um die Erde kennen zu lernen, so war er nun ständig auf der Flucht; denn immer wenn er etwas Böses sah oder sehen musste, kostete es ihn einen Teil seines Augenlichts. Sein Dasein wurde immer hoffnungsloser, denn wohin er auch kam, nirgends gab es nur Gutes, und so kaufte er sich schließlich eine schwarze Brille. Nun wurde es womöglich noch schlimmer, denn natürlich lachten die Leute über ihn, dass er, der doch sehen konnte, überall schwarz sah und selbst bei hellem Tag in eine Lage geraten konnte, in die er offenen Auges nie gelaufen wäre. Manche Menschen wollten ihm sogar helfen. Doch sobald sie merkten, dass er eigentlich sehen konnte, beschimpften sie ihn, weil sie glaubten, er wollte sie hintergehen. Ja, das eine oder andere Mal wurde er deswegen sogar verprügelt, so dass er es schließlich aufgab, sich mit einer Brille zu schützen. Nun blickte er wieder den Tatsachen ins Auge und immer, wenn es ein hässlicher Anblick war, dem er nicht ausweichen konnte, sah er wieder ein bisschen schlechter.
Der Mann hatte längst erkannt, dass es so nicht weiterging. Schließlich entschloss er sich, einen Arzt aufzusuchen. Er fand auch den einen oder anderen Doktor, der ihm das sagte, was er selbst wusste, dass er langsam erblindete. Über die Ursachen freilich liefen die Meinungen der Mediziner weit auseinander und wen er auch aufsuchte, jeder vertrat eine andere Ansicht über den Grund des Leidens. Manche machten es sich ganz leicht: Die sagten, das käme vom Alter. Andere verschrieben ihm Tropfen und Salben, so dass er mit tränenden und halb verklebten Augen umherlief. Ein Doktor glaubte sogar, das Böse in ihm selbst zu erkennen und verlangte: Wenn dich dein Auge ärgert, dann reiß es heraus!
So wanderte der Mann weiter und geriet im Lauf der Zeit auf die andere Seite der Erde. Auch dort glaubten die Leute, sie lebten in der Mitte der Welt und die Ärzte hatten eine noch sonderbarere Medizin erfunden. Manche meinten schon deshalb heilen zu können, weil sie barfuß liefen und andere bohrten, um seinen Augen zu helfen, feine Nadeln in seine Ohren, in die Finger und Zehen, auch in Bauch und Rücken. Die Nadeln spürte er wohl, aber nichts wollte helfen. Weil der Mann inzwischen aber so viele Fachleute befragt und Doktoren besucht hatte, erhielt er auch Ratschläge, wohin er sich wenden sollte und im Verlauf weiterer Jahre stellte er fest, dass er die Erde umrundet hatte und an seinen Ausgangspunkt zurückgekehrt war – verzweifelt und unglücklicher denn je. Als er hier von einem hörte, der dadurch die Leute heilen wollte, dass er eine Weile stumm am Kopfende des Krankenbettes zu sitzen versprach, beschloss er, gar nicht erst hinzugehen.
Eines Tages kam er in eine Hafenstadt. Nachdem er in einer Gastwirtschaft einen getrockneten Fisch gekauft hatte, saß er an der Mole und verzehrte sein karges Mal. Schließlich warf er die Gräten ins Wasser. Wie es so ging, sah er gleich darauf die Gräten wieder, weil sie einem Angler, der geduldig neben ihm saß, an den Haken gerieten.
Doch anstatt zu schimpfen, holte sein Nachbar die Angel ein, löste die Gräten vom Haken und warf sie zurück ins Hafenbecken. Danach nahm er einen frischen Köder und legte die Angel aus.
Du bist mir nicht böse? fragte der Mann den Angler.
Der schüttelte den Kopf: weshalb sollte ich?
Merkwürdig, dachte der Wanderer, und fühlte sich, ohne dass er gleich sagen konnte weshalb, ein bisschen wohler. Nicht, dass er nicht im Lauf seines Lebens auch anderswo freundliche Menschen getroffen hätte – doch diesmal kam ihm, ohne dass der Angler sich weiter erklärte, dessen geduldige Art so eigentümlich vor, dass er ihn genauer betrachtete.
Seine Aufmerksamkeit wurde belohnt. Als der Angler ein weiteres Mal seine Schnur hinaus warf, rutschte der Ärmel des Hemdes zurück und ein prächtig tätowierter Fisch wurde sichtbar. Doch war es nicht eine einfache Zeichnung, wie sie manche Seeleute trugen, sondern ein Kunstwerk für sich. Sah man nämlich genauer hin, dann wurde deutlich, dass der tätowierte Fisch genauestens den Muskeln des Armes angepasst war. Bei jeder Bewegung schien es, als bewegte sich der Fisch, als ließe er Flossen und Schwanz spielen oder als schnappte er nach einem Köder.
Ein schöner Fisch, sagte der Angler, als er die Blicke des Mannes bemerkte.
Wirklich, ein schöner Fisch, konnte der nur zustimmen.
Jeder Fischer besitzt so ein Prachtstück, fuhr der Angler fort.
Tatsächlich? fragte der Mann und ließ keinen Zweifel daran, wie erstaunt er war.
Jeder, sagte der Angler stolz.
Und das hilft beim Angeln? fragte der Mann ungläubig.
Unbedingt, antwortete der Angler, sieh her, der Eimer: halb voll mit Fischen – und ich sitze erst seit dem Morgengrauen hier.
Immer nur Fische? fragte der Mann hartnäckig weiter.
Natürlich nicht, manchmal ist schon ein Schuh dabei oder ein Stück Treibholz. Aber was macht’s? Die sehe ich nicht. Ich fange nur Fische. Schließlich geht es allen so.
Allen? murmelte der Wanderer.
Allen, wiederholte der Fischer. Oh ja, allen. Den großen Fressern tätowiert man Kartoffeln und Würste auf den Bauch und den Frauen, die Kinder lieben, Babys an die Brust und…
… und, unterbrach ihn der Mann, den Trinkern macht man rote Nasen?
Nicht nur, antwortete der Angler, sie bekommen ein Bierfass auf den Bauch.
Unglaublich, erwiderte der Mann: aber wenn einer nun die Frauen liebt?
Dann, antwortete der Angler, wird er mit einer Schönheit versehen, lebensgroß. Aber auch wenn ein Weib hinter den Männern her ist, hat es nichts zu klagen. Ihm wird ein Traummann aufgetragen.
Das hilft wirklich? fragte der Mann ein weiteres Mal.
Was soll ich sagen, antwortete der Angler und zog einen zappelnden Fisch aus dem Wasser.
Da wurde der Wanderer sehr nachdenklich und schwieg so lange, bis sich der Angler ihm zuwandte:
Warum sagst Du nichts, Mann? Du weinst ja. Bist Du krank?
Vielleicht, antwortete der, vielleicht bin ich krank. Jedenfalls bin ich schon halb blind und keiner kann mir helfen. Und dann begann er zu erzählen, dass er schon ein halbes Leben lang unterwegs sei, immer auf der Flucht vor dem Bösen. Nein, schloss er seinen Bericht, mir kann keiner helfen.
Der Angler lächelte, zog einen weiteren Fisch an Land und meinte, damit hätte er nun wirklich genug, um heute nicht nur seine Frau und seine Freunde zu ernähren, für einen Fremdling sei auch was da.
Komm, sagte der Angler, sei mein Gast.
Sie erhoben sich und zu seiner Verwunderung führte der Angler ihn in jene Wirtschaft, in der der Reisende den getrockneten Fisch gekauft hatte. Kaum dass sie das Haus betreten hatten, kam schon der Wirt, nahm dem Angler die Fische ab und versprach, sie gleich zuzubereiten.
Während sie sich an den Tisch setzten, kam ein weiterer Gast, dessen Arme über und über mit Trauben bedeckt schienen, so dass man größte Lust bekommen hätte, eine davon zu pflücken, hätte man nicht gewusst, dass auch sie von einem Meister seines Fachs stammten.
Ich brauche dir unseren Winzer wohl nicht mehr vorzustellen, sagte der Angler und bat den Neuen, ebenfalls Platz zu nehmen. Nachdem der sich gesetzt hatte, erzählte er, dass er gerade einige Fässer Wein eingeliefert hätte. Was die beiden denn von einem kräftigen Schluck hielten?
Der Wirt brachte Gläser und nachdem Frau und Kinder des Anglers gekommen waren, saßen alle einschließlich des Wirtes mit seiner Familie bei Fisch und Wein.
Köstlich, sagte der Angler.
Wie immer, ergänzte der Winzer und alle nickten.
Und jetzt zu dir, begann der Angler und wandte sich an den Reisenden, sobald er bemerkte, dass der sich zurücklehnte und Anstalten machte, sich zu bedanken: Ich werde meinen Freunden deine Geschichte erzählen.
Das tat der Angler und obwohl er sie viel kürzer und einfacher erzählte als es sein Gast getan hätte, schwiegen seine Zuhörer betroffen, bis der Wirt schließlich meinte, dass es so einen Fall hierzulande noch nie gegeben habe.
Nein, wiederholte der Wirt, so etwas hatte er noch nie gehört.
Aber, sagte der Winzer, irgendwann ist uns allen geholfen worden.
Der Angler nickte zustimmend:
Eben, warum sollte man ihm nicht helfen können? Sicher, die Sache liegt schwieriger als bei einem Fischer oder Schuster oder bei einem Jäger – aber bisher wurde allen geholfen.
Noch ein Glas, meinte der Winzer und dann sollte unser Freund erst einmal ausschlafen; morgen, wenn sich nur das Wetter hielte, würde man weiter sehen.
Der Wirt stimmte zu. Ein Zimmer sei gerade frei geworden, das könnte der Fremde haben.
Am nächsten Morgen wurde der Mann von einem Mädchen geweckt, das ihm Milch und Brot ans Bett stellte und die Fenster öffnete, weil es doch so ein schöner Tag zu werden versprach. Und erst, als das Mädchen sein Zimmer verlassen hatte, fiel dem Mann ein, wie wunderschön es gekleidet war und noch einen Augenblick später fragte er sich, ob es wirkliche Kleider gewesen waren, die er gesehen hatte.
Kaum war er aufgestanden, klopfte der Winzer an seine Tür. Er müsse zurück zu seinen Weinbergen, sagte er, könne ihn aber ein Stück mitnehmen. Er hätte schon alles mit dem Wirt und dem Angler besprochen. Man sollte sich nur schnell verabschieden und dann wollten sie aufbrechen.
Der Mann lief zur Mole, wo der Angler schon wartete, und nachdem der ihm Glück gewünscht hatte, kletterte er auf den Sitz neben dem Winzer, der seinen leeren Wagen hinaus in die Felder lenkte.
Angelegentlich schaute der Winzer zum Himmel und nickte zufrieden, weil er kein Wölkchen entdeckte. Langsam wurde es wärmer, und als nach einigen Stunden Fahrt die Sonne hoch am Himmel stand, begann der Winzer zu sprechen: