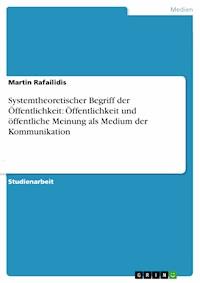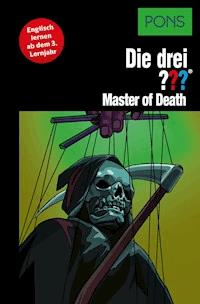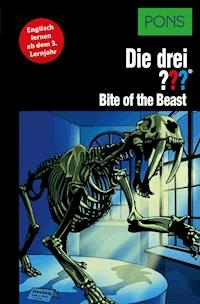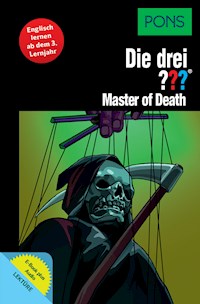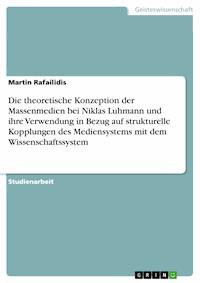
Die theoretische Konzeption der Massenmedien bei Niklas Luhmann und ihre Verwendung in Bezug auf strukturelle Kopplungen des Mediensystems mit dem Wissenschaftssystem E-Book
Martin Rafailidis
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Soziologie - Medien, Kunst, Musik, Note: sehr gut (1), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Institut für Soziologie Erlangen), Veranstaltung: HS Wissensarbeit, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Funktionsweise der Massenmedien anhand ihrer Selektionskriterien für Information zu verdeutlichen. Damit wäre ein Ausgangspunkt gegeben für die Beobachtung eventueller Auswirkungen dieser Selektionskriterien auf die Wissenschaft. Auswirkungen würden sich dann zeigen, wenn die Wissenschaft zunehmend so beobachtet wie das Mediensystem. Dabei scheint es angebracht zu sein, sich einer Wertung der Medieninhalte zu enthalten, da dies lediglich einem Vergleich der einen Konstruktion von Realität mit einer anderen gleichkäme. Dennoch bzw. gerade deswegen lässt sich die Funktionsweise der Medien aus der Betrachterposition des Beobachters zweiter Ordnung besser handhaben. Jenseits von Moralisierungen lässt sich nach negativen und positiven Folgen für das Wissen der Gesellschaft fragen, die sich durch die Art und Weise, wie Medien Information verbreiten, ergeben. Die Arbeit folgt der theoretischen Konzeption der Massenmedien, die durch Niklas Luhmann vorgelegt wurde. Ich werde dabei zunächst die Vorannahmen des operativen Konstruktivismus erläutern, die zu der oben erwähnten Beobachterposition zweiter Ordnung führen. Dabei ist insbesondere der Grundbegriff des Beobachtens von Bedeutung. Auf diesen Vorannahmen aufbauend, stelle ich die Grundkonzeption der Massenmedien dar, die einigen Grundunterscheidungen wie Selbst- und Fremdreferenz folgt, sowie weitere Aufteilungen in Codes und Programmen. Hier finden sich die Begriffe wie Information und Nichtinformation sowie die Aufteilung in Nachrichten, Berichte, Unterhaltung und Werbung wieder. Weiterhin erläutere ich am Beispiel des Programmbereichs „Nachrichten“, wie sich Auswirkungen der Selektionsweise der Medien auf die Gesellschaft verstehen lassen. Die Realitätskonstruktion der Massenmedien ist dabei eine Folge, die sich aus der bestimmten Weise der Erzeugung von Identität und der Einbeziehung von Schemata in das soziale Gedächtnis ergeben. Abschließend ergibt sich noch die Frage nach strukturellen Kopplungen des Mediensystems mit anderen Systemen der Gesellschaft. Luhmann sieht klare Kopplungen mit dem politischen und dem wirtschaftlichen Funktionssystemen, jedoch nur eine geringe Kopplung mit dem Wissenschaftssystem. Einiges scheint jedoch für eine Kopplung zu sprechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
WS 2001/2002 Hauptseminar: Wissensgesellschaft
Vorgelegt am: 21.05.2002
Vorgelegt von:
Martin Rafailidis
Seminararbeit
Thema: Die theoretische Konzeption der Massenmedien bei Niklas Luhmann und ihre
Verwendung in Bezug auf strukturelle Kopplungen des Mediensystems mit dem
Wissenschaftssystem.
Page 3
A. Einleitung
Die Zeitungen, das Radio, das Fernsehen, die Zeitschriften und Journale, die Medien der modernen Massenkommunikation, die sich mit den aktuellen Ereignissen der Gesellschaft auseinandersetzen, erscheinen dem Konsumenten von Zeit zu Zeit als verzerrend oder gar unglaubwürdig. Trotz und oft gerade wegen der großen Vielfalt des Angebots scheint Objektivität und Genauigkeit ein rares Gut zu sein, insbesondere, wenn sich Nachrichten widersprechen oder korrigiert werden müssen. Auch ist ein persönliches Erleben von Ereignissen ganz anders, als wenn ein Beobachter es zum Beispiel im Fernsehen sieht. Jeder, der ein Ereignis selbst miterlebt hat und dieses dann später im Fernsehen noch einmal sieht oder darüber in der Zeitung liest, wird das bestätigen können. Man erlebt Ereignisse selbst ganz anders als in den Medien. Ein Aspekt wird zu kurz gekommen sein und etwas anderes wird zu stark betont worden sein. Zudem wird man das Gefühl nicht los, die Medien würden ständig versuchen, zu manipulieren, sei es durch die Themenauswahl in Berichten, oder direkt und unverhohlen durch Werbung aller Art. Je mehr dieser Umstand der Verzerrung der Realität in der Wissenschaft oder sogar in den Medien selbst betont wird, umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass die Beschreibung der Medien nicht an Ernsthaftigkeit verliert. Denn so wirklichkeitsfremd die ausgestrahlten und publizierten Mitteilungen der Medien zum Teil auch sein mögen, so real sind doch immer noch ihre Folgen1. Besonders gut zeigt sich das im Verhältnis der Politik zu den Medien. Hier ist die Kopplung zwischen beiden Systemen sehr deutlich zu beobachten. Die Politik profitiert stark davon, in den Medien erwähnt zu werden und andererseits wirken die Medien eben durch das Senden politischer Aussagen auf die Politik ein. Eine ähnliche Beziehung zu den Medien ist auch im Bereich der Wirtschaft zu erkennen. Gerade auch die Wissenschaft, die gegenüber den Medien noch als relativ abgeschlossener Bereich galt, scheint sich zunehmend den täglichen Nachrichtenmedien zu bedienen (Weingart 2001, S.280). Andererseits führt die Thematisierung bestimmter wissenschaftlicher Diskurse in den Massenmedien wiederum zu einem politischen Handlungsdruck, der sich auf die Wissenschaft auswirken kann. Und mehr noch: Einige der Selektionskriterien der Medien für Information werden in der Wissenschaft zunehmend übernommen. Information hat die Eigenschaft nach ihrer Sendung zu Nichtinformation zu werden, wodurch ein Bedarf an neuer Information entsteht (Luhmann 1996, S.41f). Die
1Dies ist gemeint im Sinne des Thomas Theorems, wonach die durch die Medien erzeugte Medienwirklichkeit
zwar konstruiert ist aber in den Folgen immer reale Auswirkungen zeigt.
Page 4
Medien interessieren sich daher immer nur für neues Wissen, da neues Wissen ein vormals neues Wissen zu altem Wissen werden lässt, das somit nicht mehr interessiert. Lange ausführliche Erklärungen und differenzierte Analysen, wie sie in der Wissenschaft angestellt werden, sind schon aufgrund der knapp bemessenen Sendezeiten kaum mitteilungsfähig. Die These ist nun, dass sich auch in der Wissenschaft zunehmend das Interesse nur für Neues, im Gegensatz zu dem bisherigen sukzessiven Aufbau von Wissen, allmählich durchsetzen könnte. Altes Wissen würde dann eine Entwertung erfahren oder zumindest als lästiges Anhängsel mitgezogen werden müssen. In der Folge würde es gerade die Grundlagenforschung zunehmend schwer haben genügend Aufmerksamkeit zu erzeugen in einer Zeit, in der es täglich neue Nachrichten, neue Zahlen, neue Entdeckungen und neue Informationen gibt.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Funktionsweise der Massenmedien anhand ihrer Selektionskriterien für Information zu verdeutlichen. Damit wäre ein Ausgangspunkt gegeben für die Beobachtung eventueller Auswirkungen dieser Selektionskriterien auf die Wissenschaft. Auswirkungen würden sich dann zeigen, wenn die Wissenschaft zunehmend so beobachtet wie das Mediensystem.
Dabei scheint es angebracht zu sein, sich einer Wertung der Medieninhalte zu enthalten, da dies lediglich einem Vergleich der einen Konstruktion von Realität mit einer anderen gleichkäme. Dennoch bzw. gerade deswegen lässt sich die Funktionsweise der Medien aus der Betrachterposition des Beobachters zweiter Ordnung besser handhaben. Jenseits von Moralisierungen lässt sich nach negativen und positiven Folgen für das Wissen der Gesellschaft fragen, die sich durch die Art und Weise, wie Medien Information verbreiten, ergeben.
Die Arbeit folgt der theoretischen Konzeption der Massenmedien, die durch Niklas Luhmann vorgelegt wurde. Ich werde dabei zunächst die Vorannahmen des operativen Konstruktivismus erläutern, die zu der oben erwähnten Beobachterposition zweiter Ordnung führen. Dabei ist insbesondere der Grundbegriff des Beobachtens von Bedeutung. Auf diesen Vorannahmen aufbauend, stelle ich die Grundkonzeption der Massenmedien dar, die einigen Grundunterscheidungen wie Selbst- und Fremdreferenz folgt, sowie weitere Aufteilungen in Codes und Programmen. Hier finden sich die Begriffe wie Information und Nichtinformation sowie die Aufteilung in Nachrichten, Berichte, Unterhaltung und Werbung wieder. Weiterhin erläutere ich am Beispiel des Programmbereichs „Nachrichten“, wie sich Auswirkungen der Selektionsweise der Medien auf die Gesellschaft verstehen lassen. Die Realitätskonstruktion der Massenmedien ist dabei eine Folge, die sich aus der bestimmten Weise der Erzeugung
Page 5
von Identität und der Einbeziehung von Schemata in das soziale Gedächtnis ergeben. Abschließend ergibt sich noch die Frage nach strukturellen Kopplungen des Mediensystems mit anderen Systemen der Gesellschaft. Luhmann sieht klare Kopplungen mit dem politischen und dem wirtschaftlichen Funktionssystemen, jedoch nur eine geringe Kopplung mit dem Wissenschaftssystem. Einiges scheint jedoch für eine Kopplung zu sprechen.