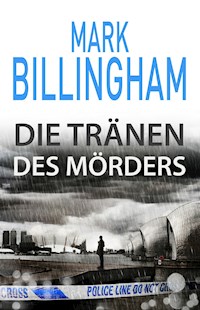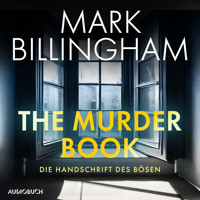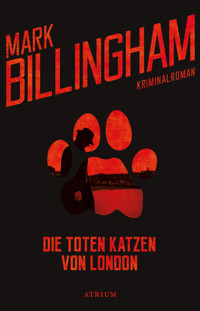
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG Zürich
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
London. In beschaulichen Vorgärten einer friedlichen Wohngegend werden Katzen gefunden, die auf brutalste Weise von einem Menschen getötet wurden. Als die Zahl der toten Katzen immer weiter steigt, wird DI Tom Thorne damit beauftragt, der Sache auf den Grund zu gehen und dem sadistischen Treiben ein Ende zu setzen. Thorne macht sich nur widerwillig an die Arbeit. Bis er erleben muss, dass Tiere manchmal nur der Anfang sind – und dass manche Morde ebenso schreckliche wie überraschende Motive haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Billingham
Die toten Katzen von London
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Stefan Lux
Für Claire, Katie und Jack. Gut, dass Kevin und Stan nicht lesen können …
Ich finde absolut kein Vergnügen in den Stimulanzien, denen ich auf zuweilen so wahnwitzige Weise fröne. Es war nicht die Jagd nach Vergnügungen, die mich das Leben, den Ruf und den Verstand hat riskieren lassen. Es war der verzweifelte Versuch, quälenden Erinnerungen zu entkommen …
Edgar Allan Poe
Das Meer hat Fische für einen jeden.
William Camden
Die Party war in vollem Gange. Der Alkohol aus dem Getränkemarkt floss in Strömen, und das Buffet, mit dem seine Frau sich abgeplagt hatte, wurde gnadenlos geplündert. In diesem Moment entdeckt Andrew Evans die Duchess, und er spürte sofort Übelkeit in sich aufsteigen.
Als er sie sah, stand er im Garten und schaute seinem Sohn, den er achtzehn Monate lang nicht gesehen hatte, dabei zu, wie er vorsichtig eine Plastikrutsche hinunterkroch. Die Duchess stand an der offenen Hintertür, in der einen Hand eine Serviette, in der anderen einen Drink. Sie lächelte und trat zur Seite, um einen Teenager vorbeizulassen. Dann drehte sie sich um und sah Evans an.
Sie winkte und hob den Pappbecher, aus dem sie trank.
»Läuft doch ganz gut, oder?« Evans’ Frau half ihrem Sohn vom unteren Ende der Rutsche herunter und schüttelte den Kopf, als der Junge sofort um das Gerät herumrannte, um erneut hochzuklettern. »Sind einige gekommen.«
»Ja.«
»Und Glück mit dem Wetter haben wir auch.« Sie schaute ihn an. »Alles klar bei dir?«
»Ja, alles prima«, sagte Evans. »Warum auch nicht?« Er streckte die Hand aus, streichelte ihren nackten Arm, stürzte dann den Rest seines Biers herunter und zerdrückte die Dose in der Hand. »Ich gehe kurz rein, um mir noch was zu trinken zu holen.«
Das Willkommen-zu-Hause-Spruchband, das über die kleine Terrasse gespannt war, hing inzwischen ein Stück herab, sodass er sich auf dem Weg ducken musste, als er zur Hintertür ging. Die alte Frau im Türrahmen trat zur Seite, und er ging grußlos an ihr vorbei. In der Küche schnappte er sich das Bier, das er plötzlich dringend brauchte, und umarmte seine Schwester, die offenbar selbst schon einiges getrunken hatte. Als er sich zum Gehen wandte, wurde er von mehreren Leuten angesprochen, mit denen er früher zusammengearbeitet hatte. Er dankte ihnen für ihr Kommen und betonte, dass es ihm viel bedeute, und er werde sich später Zeit für sie nehmen. Dann ging Evans – auch wenn es das Letzte war, was er tun wollte – wieder nach draußen. Er legte im Vorbeigehen seine Hand auf den marmorierten, fleischigen Arm der alten Frau, um ihr zu signalisieren, sie solle ihm folgen.
Kurz darauf trat sie durch das seitliche Gartentor und leistete ihm vor dem Haus Gesellschaft.
»Was wollen Sie hier?« Er trank noch einen Schluck aus der bereits halb leeren Dose.
»Das ist jetzt nicht besonders nett.« Sie klang ehrlich verletzt. »Ich meine, warum sollte ich nicht hier sein?«
»Das ist meine Familie. Freunde.«
»Nun seien Sie nicht so«, sagte sie. »Es ist doch ein besonderer Anlass, oder? Und bis gestern war ich eine sehr gute Freundin.« Sie trat auf ihn zu und stieß mit ihrem Pappbecher an seine Bierdose. »Herzlichen Glückwunsch übrigens!«
Evans starrte sie an und widerstand dem Drang, vor ihr zurückzuweichen.
Die Duchess …
So wurde sie von denen, die sie besuchen kam, genannt, weil sie immer vornehm wie eine Herzogin auftrat. Immer adrett gekleidet und das Haar hochgesteckt. Sie roch nach einem süßlichen Parfum und trug eine Spur zu viel damenhaftes Make-up, als wäre sie die Großmutter von irgendwem. Wahrscheinlich war sie das wirklich, denn sie spielte diese Rolle ziemlich gut. Großmutter von wer weiß wie vielen Kerlen, jedenfalls an Besuchstagen.
Sie strich ihr Cocktailkleid glatt, blickte wieder auf und bemerkte, dass er sie anstarrte. »Wie gesagt, ein besonderer Anlass … Da habe ich mir Mühe gegeben. Das tue ich immer.«
Egal, wie man sie nannte, egal, wie sie aussehen wollte, ihr Akzent war pures Essex.
Er sagte: »Sie sollten jetzt gehen. Wir können das am Telefon erledigen.«
»Ich wollte nur, dass Sie wissen, wie die Dinge liegen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Ihnen die Situation klar ist.«
»Es geht um die zwei Riesen, stimmt’s?« Evans trank noch einen Schluck. »Dass ich noch keinen Job habe, ist wohl klar, oder? Ich meine, es ist schließlich erst ein Tag vergangen. Sobald ich kann, fange ich mit der Rückzahlung an.«
Die Duchess nickte und lächelte. »Das ist nett«, sagte sie. »Und vergessen Sie die Zinsen nicht, mein Lieber.« Sie schüttelte den Kopf und lachte leise, als sei dies ein leidiges Problem. »Und die Zinseszinsen.« Sie beugte sich hinunter und stieß mit dem Finger in einen Blumentopf. »Die braucht dringend Wasser. Die Erde ist knochentrocken.«
»Wie viel?« Die Hand, mit der er die Bierdose umklammert hielt, hatte ein wenig zu zittern begonnen. Um es zu verbergen, hielt er den Arm dicht am Oberkörper.
»So etwa zwölf, glaube ich …«
»Was?«
»Keine Sorge, deswegen bin ich ja hier, oder? Es besteht kein Grund zur Panik, denn Sie können es abarbeiten. Das ist das Schöne daran.«
»Abarbeiten? Wie?« Aus dem Augenwinkel nahm Evans etwas Helles wahr. Er blickte auf und sah einen Willkommen-zu-Hause-Ballon, der sich gelöst hatte und davonflog. Er hörte seine Gäste im Garten lachen.
»Oh, das kann ich nicht genau sagen, mein Lieber. Kleinkram, sonst nichts. Nur ein bisschen Kleinkram. Man gibt mir Bescheid, und ich gebe Ihnen Bescheid, okay?«
»Und wenn ich nicht will?«
»Seien Sie nicht albern, mein Lieber.«
Als die Duchess jetzt auf ihn zutrat, wich Evans tatsächlich zurück und stand plötzlich mit dem Rücken an der Garagenwand. Sie griff nach seiner Hand, und als er sie schließlich ausstreckte, drückte sie ihm ein kleines Päckchen in die Handfläche und umfing seine Finger mit ihren. »Bitte schön.« Sie tätschelte seinen Handrücken. »Ich wette, das können Sie brauchen.«
In den wenigen Sekunden, ehe Evans das Päckchen in seine Tasche gleiten ließ und sich von der Wand abstieß, konnte er sie riechen: viel zu süß, irgendwie kränklich, ihren Nagellack und die Hautcreme.
»Und das hier geht aufs Haus«, sagte sie. »Eine Art … wie soll ich es nennen … Geste des guten Willens.«
Als er wieder durch das Gartentor trat, hörte er sie hinter seinem Rücken kichern. »Ein Willkommensgeschenk von Großmutter.« Und dann: »Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich noch ein bisschen bleibe, mein Lieber? Die Sandwiches sind wirklich köstlich.«
Evans’ Frau kam über den Rasen auf ihn zu. Das Lächeln schwand aus ihrem Gesicht, und sie schien etwas sagen zu wollen, doch er beeilte sich und wich nach links aus, auf die Terrasse, und ging weiter ins Haus. Hinein in den Lärm und das Gewühl. Sofort reckten sich ihm Arme entgegen, doch er schob sich an ihnen vorbei, ging schnell in den Flur und stieg die Treppe hinauf.
Er nahm zwei Stufen auf einmal.
Die Duchess hatte recht gehabt. Er brauchte das, was sie ihm zugesteckt hatte. Aber zuerst musste er sich übergeben.
Er war jedes Mal erstaunt, wie leicht es war. Was zum Teil natürlich an ihm selbst lag, daran, dass er seinen gesunden Menschenverstand benutzte. Die sorgfältigen Vorbereitungen, die Gedankenarbeit. Die Vorsicht, die er jedes Mal aufs Neue walten ließ, und die Weigerung, sich dem Leichtsinn zu überlassen.
Denn bequem waren schließlich sie. So vertrauensvoll und so begierig nach Zuwendung.
Opfer zu finden war nie ein Problem gewesen, im Gegenteil. Und trotzdem erforderte die Arbeit jeden Abend aufs Neue große Umsicht. Gewisse Prinzipien waren zu beachten, zum Beispiel einen Bogen um Kameras und dergleichen zu machen. Er war kein Experte in Sachen Kriminaltechnik, wusste aber genug, um keinerlei Spuren zu hinterlassen. Die Handschuhe waren dick und eher unbequem, doch daran ließ sich nichts ändern. Das Fingerspitzengefühl litt ein wenig, leider, doch er wollte nicht das Risiko eingehen, sich kratzen zu lassen.
Er fühlte noch immer genug. Ja, mehr als das. Was er empfand, brachte ihn … ins innere Gleichgewicht
Es fühlte sich erhebend an.
Ein komisches, altmodisches Wort, doch es klang passend.
Er schüttelte den Kopf, trank Tee und dachte, mit einem Ohr am Radio, darüber nach, wer er war.
Ihm war klar, dass es Menschen gab, die in seinem Tun einen Ausdruck von Hass sehen würden. Doch das war Unsinn, über den es sich nicht weiter nachzudenken lohnte. Und ganz sicher ging es nicht um Sex, schon die Vorstellung war … lächerlich.
Er grinste und schüttelte den Kopf, sobald er auch nur darüber nachdachte.
Musste es überhaupt um irgendwas gehen? War der ganze Wirbel überhaupt nötig?
Eigentlich nicht, wenn man genauer darüber nachdachte, wenn man sich hinsetzte und das, was er tat, ins richtige Licht rückte. Angesichts explodierender Bomben, abstürzender Flugzeuge und Kinder mit Krebs konnten diese lächerlichen Kreaturen doch wohl kaum etwas bedeuten? Worin bestand ihre Rolle im großen Ganzen? Wie viele Menschen würden sie am Ende wirklich vermissen?
Er schaltete das Radio aus und nahm die Tasse mit dem restlichen Tee mit hinaus in den Flur. Beim Austrinken betrachtete er sich im Spiegel. Er überprüfte, ob die Haustür abgeschlossen war, und ging dann ins Wohnzimmer.
Dort blieb er stehen und strich sich mit der Hand über den Bauch.
Er hatte das Gefühl, dass es Zeit wurde, wieder Ausschau zu halten. Wobei er sich natürlich nicht groß anstrengen musste.
Möglicherweise würde er sich sogar ein Paar neue Handschuhe gönnen.
EINS
»Katzen?« Thorne schüttelte den Kopf. »Machen Sie Witze? Ich meine, das sind doch nur … Katzen.«
DCI Russell Brigstocke schob ein paar lose Papiere auf seinem Schreibtisch zu einem ordentlichen Stapel zusammen. »Schon, aber inzwischen sind einige zusammengekommen. Allein in den letzten zehn Wochen gab es fünfzehn Fälle.« In diesem Moment meldete sich sein Handy. Er nahm es in die Hand, wischte und stocherte auf dem Display herum und legte es dann wieder auf den Schreibtisch.
»Ein Haufen tote Katzen, das ist mir schon klar.« Thorne hatte die Berichte über den Fall in den Zeitungen und online verfolgt und wusste, worauf Brigstocke hinauswollte. »Natürlich sind die Menschen erschüttert, und ich kann mir auch vorstellen, dass Ihnen der Chief Superintendent im Nacken sitzt, aber es gibt doch sicher andere, die sich darum kümmern können. Fürs Erste jedenfalls. Ich meine, wir sind hier in der Mordkommission, nicht beim …«
Brigstocke grinste. »Tierschutzverein?«
»Sie sagen es.«
Thorne konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Vielleicht mag unser Täter Katzen einfach nicht. Könnte doch sein, oder? Solche Leute gibt’s. Sie finden Katzen irgendwie unheimlich.«
»Wir müssen die Sache ernst nehmen, Tom.« Brigstocke lehnte sich auf seinem Bürostuhl zurück und fuhr sich durch die Haare, die jeden Tag grauer zu werden schienen. »Ich muss das nicht erklären, oder? Schon gar nicht Ihnen.«
Thorne wusste, dass Brigstocke keine Antwort auf diese Frage erwartete. Thorne kämpfte auf verlorenem Posten. Dass er überhaupt zu kämpfen begonnen hatte, entsprang eigentlich nur einem Reflex. Einer gewissen rebellischen Grundhaltung, die einfach von ihm erwartet wurde, vor allem zu Beginn der Woche, wenn seine Laune nicht die beste war, weil er sich am Wochenende vergeblich zu erholen versucht hatte – mit seiner Freundin Helen und ihrem hyperaktiven Vierjährigen.
Und davon abgesehen wusste er genau, wovon Brigstocke sprach.
Inzwischen galt es als anerkannte Tatsache, dass der leichengepflasterte Weg eines gewöhnlichen Serienmörders – auch wenn es einen solchen eigentlich nicht gab – in vielen Fällen mit dem Töten oder Quälen von Tieren begann. Katzen, Hunde, Vögel. Ebenso wie Brandstiftung oder anhaltendes Bettnässen jenseits eines Alters von fünf Jahren galt es als verräterisches Merkmal im Sinne der sogenannten Macdonald-Triade. In den frühen sechziger Jahren hatte der amerikanische Psychiater John Macdonald auf das Zusammenspiel dieser drei Verhaltensmuster hingewiesen, was dabei helfen sollte, angehende Serientäter zu identifizieren. Ein gewöhnlicher Bulle – und von denen gab es eine ganze Menge – konnte das Glück (oder das Pech) haben, es einmal im Laufe seiner Karriere mit diesem außergewöhnlichen Tätertyp zu tun zu bekommen.
Thorne hatte in dieser Hinsicht sein Soll längst mehr als erfüllt.
Er dachte an den Mann, der seine Opfer ins Koma versetzt hatte, um sie bewegungsunfähig und wehrlos zu machen, zu Gefangenen in ihrem eigenen Körper.
Er dachte an den Mann, der sich die Kinder von Menschen als Opfer wählte, die viele Jahre zuvor selbst ermordet worden waren.
Er dachte an einen Mann namens Stuart Nicklin, der dank Thornes Hilfe für die abartigsten Morde verurteilt worden war, die man sich vorstellen konnte, dessen derzeitiger Aufenthaltsort aber unbekannt war.
Gerade an ihn dachte er noch sehr oft.
Thorne seufzte. »Sie glauben also, dass wir mit Morden rechnen müssen?«
»Mit Morden müssen wir immer rechnen, Tom.« Brigstocke klang mittlerweile ein wenig gereizt. »Damit verdienen wir schließlich unseren Lebensunterhalt, oder nicht?«
»Sie wissen schon, was ich meine.«
»Na ja, wir wollen es natürlich nicht hoffen. Aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit müssen wir einkalkulieren. Und wenn es dazu kommt, müssen wir vorbereitet sein.« Brigstocke nahm seine Brille ab, um die Gläser zu putzen. Er lächelte eisig, ein klares Warnsignal. »Also hören Sie mit dem Jammern auf, und machen Sie einfach Ihre Arbeit.«
Thorne breitete die Arme aus, ganz das Unschuldslamm. »Ich brenne darauf, loszulegen, Russell. Ehrlich gesagt habe ich auch schon eine Idee. Wir könnten versuchen, dem Täter eine Falle zu stellen, und einen Lockvogel einsetzen.«
Brigstocke setzte die Brille wieder auf und verschränkte die Arme vor der Brust. Er sagte nichts, doch seine Miene machte deutlich, dass er ahnte, was als Nächstes kommen würde.
»Je länger ich darüber nachdenke, desto genialer finde ich es.« Thorne erhob sich. »Ich kenne einen Kostümladen, in dem ich das perfekte Outfit besorgen könnte. Dann brauche ich nur noch ein Halsband mit einem Glöckchen …«
Brigstocke schüttelte den Kopf, hielt ein Papier hoch und wedelte damit herum, bis Thorne auf ihn zutrat und es an sich nahm. »Sorgen Sie dafür, dass Sie auf dem aktuellen Stand sind. Der bisherige Ermittlungsleiter sitzt im Revier Kentish Town. Wenn Sie also mit dem Klugscheißen fertig sind, fahren Sie hin und stellen sich ihm vor. Er weiß, dass Sie kommen. Ihre alte Gegend, stimmt’s?«
Bei dem Wort »alt« zuckte Thorne leicht zusammen. Zwar verbrachte er inzwischen neunundneunzig Prozent seiner Zeit mit Helen und ihrem Sohn in Tulse Hill, doch wirklich wohl fühlte er sich im Süden von London noch nicht. Und er bezweifelte auch, dass es jemals so weit kommen würde. Er hasste das tägliche Pendeln nach Hendon. Und er vermisste das Pub und den Inder, als deren Stammgast er sich noch immer betrachtete. Er vermisste es, an Spieltagen anderen Spurs-Fans über den Weg zu laufen. Ja, was Arbeit und Kinderbetreuung betraf, waren seine Lebensumstände ideal für seine bessere Hälfte, und die Mieteinnahmen aus seiner alten Wohnung kamen mehr als gelegen. Trotzdem hoffte er noch immer, dass Helen irgendwann zur Vernunft kommen würde und sie zu dritt auf die richtige Seite des Flusses ziehen könnten.
»Tom?« Brigstocke hielt das Telefon ans Ohr. Er hatte bereits gewählt. »Sonst noch was, womit Sie mich nerven wollen?«
Thorne schüttelte den Kopf und wandte sich ab. Er faltete das Blatt Papier zusammen und steckte es in die Tasche seiner Lederjacke. Er fühlte sich jetzt leichter als noch vor einer halben Stunde. Plötzlich spürte er eine Erregung, nicht nur wegen des Schlagabtauschs mit seinem Chef und der willkommenen Gelegenheit, sich im Bengal Lancer ein Curry zum Mitnehmen zu besorgen, sondern weil es schon immer das Außergewöhnliche gewesen war, das seinen Puls nach oben trieb. Weil immerhin die Chance bestand – gering, aber nichtsdestoweniger verlockend –, dass sein Katzenmörderfall sich zu etwas Größerem entwickeln konnte.
»Sir«, murmelte er und ging zur Tür. Als er sie öffnete, konnte er sich ein »Miau« nicht verkneifen.
In Russell Brigstockes Bemerkung hatte zwar der für ihn typische Zynismus mitgeschwungen, aber letztlich hatte der Mann recht: Morde sorgten dafür, dass Thorne und seine Kollegen ihre Miete bezahlen konnten. Was sie bei ihrer Arbeit durchhalten ließ, war ein ganz spezieller Humor, düster wie die Nacht. Er ölte eine Maschine, deren Treibstoff Gewalt und Grausamkeiten waren. Die schlechten Witze und Albereien waren oft nötig, um mit der unterschwelligen Wut und der Hoffnungslosigkeit fertigzuwerden.
Was natürlich nicht bei allen funktionierte.
Thorne hatte den Rest des Vormittags damit zugebracht, sich durch einen Berg liegen gebliebener Akten zu arbeiten. Doch als er vom Mittagessen zurückkam, hatte die Nachricht von seinem neuen Fall im Büro offenbar bereits die Runde gemacht. Wie erwartet, sah er sich auf dem Weg in sein Büro grinsenden Gesichtern gegenüber und schnappte mehrere Kommentare über »Muschis« auf. Vermutlich war es DI Yvonne Kitson gewesen, die ihm eine Whiskas-Dose auf den Schreibtisch gestellt hatte. Thorne zeigte ihr im Vorbeigehen beiläufig den Mittelfinger. Dass sie seine Begrüßung mit einer unschuldigen Miene erwiderte, bestätigte seine Vermutung. Umgekehrt hätte Thorne sich wahrscheinlich auch den einen oder anderen Scherz erlaubt, auch wenn er bezweifelte, dass er lange Spaß daran gehabt hätte.
Er las die Aufzeichnungen durch, die er von Brigstocke erhalten hatte, und den E-Mail-Anhang, der kurz darauf eingegangen war.
Die Einzelheiten waren tatsächlich grauenvoll.
Während er sich im Detail damit vertraut machte, was so viele hilflose und unschuldige Tiere hatten erdulden müssen, hoffte Thorne, dass diese Verbrechen, so schrecklich sie sein mochten, nicht bloß ein Vorspiel waren. Dass er nicht nur die Anfangskapitel einer billigen True-Crime-Geschichte vor sich hatte, deren Hauptteil erst noch geschrieben werden musste.
Er schaute zu Yvonne Kitson hinüber, und als sie seinen Gesichtsausdruck bemerkte, verschwand ihr Lächeln.
Auf dem Weg zum Kaffeeautomaten ignorierte er das Grinsen eines pickligen DC.
Falls ein mit solcher Brutalität vorgehender Mörder sich tatsächlich entscheiden sollte, sein Repertoire zu erweitern, würde nicht nur er einen Gang höher schalten. Dann würde die ganze Maschinerie, in der Thorne nur ein winziges Zahnrad darstellte, auf Hochtouren arbeiten müssen, mit Volldampf und schnell genug, um mit aller Kraft zuschlagen zu können.
Und dann würden auch alle Witze und Albereien nicht mehr helfen.
ZWEI
Als der Mann, zu dem man ihn geschickt hatte, die Tür öffnete, wartete Andrew Evans ein oder zwei Sekunden, ehe er langsam den Motorradhelm abnahm. So lautete die Anweisung. So hatte man es der Duchess aufgetragen, und die Duchess ihm.
»Das schüchtert sie schon ein, bevor es überhaupt losgeht«, hatte sie erklärt. »Und dann nehmen Sie den Helm ab, damit die Leute sich Ihre große, hässliche Visage in Ruhe anschauen können. Das bringt sie gleich in die Defensive, und sie versuchen erst gar keine Dummheiten.«
Die Frau wusste eindeutig, wovon sie sprach. Er sah, wie der Mann einen halben Schritt zurücktrat, wie die Farbe aus seinen eingefallenen Wangen wich, sobald er begriffen hatte, dass Evans nicht nach dem Weg fragen oder ein Päckchen abliefern wollte.
»Es ist nicht nötig, extra vorbeizukommen«, sagte der Mann.
»Doch, das ist es.«
»Ich bezahle doch, oder?«
Evans blickte hinter den Mann in den Hausflur, dann schaute er sich um, kontrollierte die Straße. Er wollte sichergehen, dass niemand sie beobachtete. »Wir können keine Zeugen gebrauchen«, hatte die Duchess ihm gesagt. »Rein und raus, ehe jemand seine Nase in unsere Angelegenheiten stecken kann.« Er zog die Lederhandschuhe aus und stopfte sie in seinen Helm.
»Nicht schnell genug«, sagte er. »Es reicht nicht mal für die Zinsen.«
»Wollen Sie mich verarschen?«
In der schockierten Miene erkannte Evans sich selbst wieder, am Tag seiner Willkommensparty, doch der Schockzustand hielt nur wenige Sekunden an. Dann ließ der Mann den Kopf sinken und biss die Zähne zusammen. Er schien zu begreifen, dass es dumm gewesen war zu glauben, dass er damit durchkommen würde.
Auch diese Reaktion war Evans vertraut.
»Gib mir alles, was du im Haus hast«, sagte er. »Sofort.«
Er hatte keine Ahnung, wie hoch die Schulden des Mannes waren. Größer als seine eigenen? Oder kleiner? Es ging um Drogen, vermutete er – zumindest sah der Mann auf der Türschwelle danach aus –, aber vermutlich handelten die Leute, für die Evans jetzt arbeitete, mit allem möglichen. Ihm war noch immer nicht klar, warum niemand an seine Tür geklopft hatte, warum sie beschlossen hatten, ihn seine Schulden abarbeiten zu lassen. Doch inzwischen war er klug genug, um keine Fragen zu stellen. Es ging darum, möglichst nicht aufzufallen und einfach den Job zu erledigen. Nicht dass er viel mitzureden hätte. Was immer sein Auftraggeber sich bei all dem denken mochte, es war wahrscheinlich besser, zu denen zu gehören, die bei anderen klopften.
Nach einem weiteren Blick auf den Mann im Türrahmen war er allerdings nicht mehr sicher, wer von ihnen die größere Angst hatte.
»Ich hab nichts hier«, sagte der Mann. »Ein paar Pfund in bar, mehr nicht. Was noch von der Sozialhilfe übrig ist. Fürs Essen für die Kleinen.«
»Du lügst.«
»Ich schwöre es. Glauben Sie, ich würde es Ihnen nicht geben, wenn ich es hätte? Glauben Sie, mir gefällt das hier?«
»Ich glaube, du hast das meiste von deinem Geld genau für das Zeug verprasst, das dich in die Scheiße geritten hat, aber das ist nicht mein Problem.« Evans beugte sich zu ihm vor und senkte die Stimme. »Ich bin nur hier, um Geld einzutreiben, und wenn ich das nicht tue, bekomme ich den Ärger. Und den kann ich nicht gebrauchen.«
»Kommen Sie am Montag, wenn ich den nächsten Scheck vom Sozialamt bekomme.« Der Mann bemühte sich um ein Lächeln. »Bevor das Geld weg ist.«
»Wenn ich noch mal wiederkommen muss, bin ich nicht mehr halb so nett«, sagte Evans.
Der Mann schüttelte den Kopf und trat mit seinem Turnschuh leicht gegen den Türrahmen. »Ich hab nix, Kumpel, und das ist die Wahrheit.« Er hob die Arme und ließ sie wieder sinken. »Alles weg. Meine Freundin hat ein paar Zehner oder so im Portemonnaie, aber wie gesagt, die brauchen wir.«
Evans sagte: »Halt einfach die Schnauze und gib mir das Geld.« Das musste er sagen. Und er legte das nötige Maß an Bedrohlichkeit in seine Worte. Doch noch während er die Augen zu Schlitzen verengte und in seine Jackentasche griff, musste er gegen eine Welle der Sympathie für diesen Mann ankämpfen – mit seinem schäbigem T-Shirt, der schuppigen Haut und den Pickeln um den Mund herum. Es war offensichtlich, welche Fehler dieser Mann begangen hatte, und auch das nervöse Zucken kam ihm allzu bekannt vor. Vor ihm stand jemand, der genau an dem Punkt stand, an dem er sich selbst vor Kurzem noch befunden hatte.
Der Mann öffnete den Mund und wollte etwas sagen. Dann sah er die Pistole in Evans’ Hand.
Die Waffe, die man ihm gestern Abend hatte zukommen lassen. Die ihm an der Straßenecke von jemandem zugesteckt worden war, der ähnlich gekleidet war wie er selbst. Während seine Frau ihren gemeinsamen Sohn ins Bett gebracht hatte …
Essen für die Kleinen …
Der Mann hob die Hände und rief »O Mann« oder »O Gott« oder etwas in der Art. Doch Andrew musste sich anstrengen, um ihn zu verstehen, denn in seinem Kopf summte es wie in einem Bienenstock. Der Tinnitus der Panik und des Schreckens.
Er packte den Griff der Pistole ein wenig fester und richtete sie auf den Mann, so lässig, als wäre sie ein zusätzlicher Finger. »Geld!«, brachte er mühsam hervor.
»Schon gut, Kumpel.« Der Mann trat weiter zurück. »Das Ding ist nicht nötig.«
»Dann hör endlich auf rumzulabern, und gib mir das Geld …« Evans erstarrte, als eine junge Frau hinter dem Mann in der Tür auftauchte. Erst als sie die Waffe sah und aufschrie, bemerkte er das Kleinkind an ihrer Hand, das mit großen Augen zu ihm hochstarrte.
»Halt bloß den Mund, klar?«, rief der Mann.
»Bitte …!«, flehte die Frau.
Der Mann drehte sich zu ihr um. »Geh und hol dein Portemonnaie.«
Die Frau starrte Evans nur an und drückte das Kind, das zu weinen begonnen hatte, fester an sich.
»Hol das verdammte Portemonnaie.«
Als die Frau sich ins Haus zurückgezogen hatte, starrten Evans und der Mann, den er einschüchtern sollte, sich einige endlos scheinende, peinliche Augenblicke lang an. Evans sah die Angst im Gesicht des Mannes, klar, aber er sah noch etwas anderes: Abscheu. Sein Blick war der eines Mannes, der ein anderes Opfer auf den ersten Blick erkannte und der sich im Stillen vor ihm ekelte. Der Blick, den ein Knastbruder einem Mitgefangenen zuwirft, der Pluspunkte sammelt, indem er dafür sorgt, dass seinen Kameraden eine Strafe aufgebrummt wird.
Als Andrew Evans wenige Minuten später auf sein Motorrad stieg, die rund vierzig Pfund und die Pistole in seine Tasche steckte und den Helm aufsetzte, musste er immer noch an diese Szene denken.
Er legte die Hände fest um Gas- und Kupplungshebel. Nicht zuletzt, um sie am Zittern zu hindern.
Er brachte seinen Sohn ins Bett, während seine Frau Paula das Abendessen zubereitete. Nach dem Essen saßen sie zusammen vor dem Fernseher, und Evans tischte ihr wieder mal Lügen auf. Über die angeblichen Vorstellungsgespräche, die er am Nachmittag gehabt hatte, über die Besuche auf mehreren Baustellen, um sich vor Ort zu informieren, ob sie dort Leute einstellten.
»Du findest schon was«, sagte Paula. »Du kannst zupacken. Früher oder später wird das jemandem auffallen.«
»Ja«, sagte Evans. »Das hoffe ich.«
»Wir müssen nur ein bisschen vorsichtiger mit dem Geld umgehen, dann klappt es schon.« Es war nicht leicht für sie gewesen, als er im Knast gewesen war, das wusste er. Und er hasste es, dass sich daran bis jetzt nichts geändert hatte, dass sie zwei Teilzeitjobs hatte, damit sie nicht allein auf seine Sozialhilfe angewiesen waren.
»Mach dir keine Sorgen, ich suche weiter.«
Das Schlimme war, dass er mit der »Arbeit«, der er tatsächlich nachging, keinen Penny verdiente. In Wahrheit hielt er damit gerade eben den Kopf über Wasser.
»Geht’s dir gut?«
Er schaute sie an. »Ja, prima.«
Sie streckte die Hand aus und legte sie ihm auf die Stirn. »Du bist immer noch nicht hundertprozentig fit.«
»Ich werde diese verdammte Erkältung einfach nicht los.« Er griff nach der Fernbedienung, um das Programm zu wechseln. Falls sie das Zittern seiner Hand bemerkte, sagte sie jedenfalls nichts. »Und während der achtzehn Monate im Bau war ich fit wie ein Turnschuh.«
Letztendlich konnte er nichts tun, um das Zittern und die nächtlichen Schweißausbrüche zu verbergen. Er war nur dankbar, dass sie nicht mitbekam, wenn er sich übergab, dass sie nicht hören konnte, wie sein Herz raste. Im Knast war es ihm gelungen, seine Sucht vor ihr zu verbergen. Jetzt, da sie wieder zusammenlebten, war das nicht mehr so leicht. Und Evans wusste, dass seine Frau nicht dumm war.
»Ich gehe morgen noch mal zur Apotheke«, sagte sie.
»Danke.«
»Und ich mache noch einen Termin für dich beim Arzt.«
Abgesehen von dem ersten Mal während der Party hatte er immer das Haus verlassen, wenn er neuen Stoff bekommen hatte und seine Dosis brauchte. Plötzlich war er derjenige, der freiwillig den Hund im Park ausführte. Oder er machte ungewöhnlich lange Einkäufe in den Läden um die Ecke. Bis jetzt war es gut gegangen, doch er war nicht sicher, wie lange er damit noch durchkommen würde.
Mit all den Lügen.
Es sei denn, er wäre der Dumme und Paula wüsste längst Bescheid. Vielleicht hatte sie von Anfang an gespürt, was bei ihm los war, und weigerte sich nur, ihn deswegen zu verurteilen. Vielleicht gestattete sie ihm, die Fassade aufrechtzuerhalten. Sollte sich herausstellen, dass es tatsächlich so war, dann würde er sich jedes Mal, wenn er ihr in die Augen schaute, noch mehr hassen, und Schuldgefühle würden wie saure Blasen in ihm hochsteigen, bis sie in seiner Kehle zerplatzten.
Es gab Augenblicke, in denen er diese verdammte Waffe gegen sich selbst richten wollte.
»Du solltest früh ins Bett gehen«, sagte Paula.
»Eigentlich wollte ich noch mit dem Hund raus.«
»Ist es dafür nicht schon ein bisschen spät?«
Evans stand auf und streckte sich, dann ging er hinaus in den Flur. »Ich glaube, die frische Luft tut mir gut«, sagte er. Von den letzten zehn Gramm, die er bekommen hatte, war noch ein bisschen übrig. Sie waren in einem Umschlag ganz unten in dem Plastikbeutel mit der Pistole gewesen. Seine Lohntüte. »Und die Bewegung auch.« Er kam ins Zimmer zurück, zog seinen Mantel an und beugte sich hinunter, um sie zu küssen. »Ich muss wieder fit werden.«
»Ja, seit du draußen bist, warst du ziemlich viel zu Fuß unterwegs.« Seine Frau lächelte, schaltete den Fernseher aus und griff nach der auf dem Boden liegenden Zeitung. »Wenigstens etwas.«
DREI
Thorne kannte das Revier Kentish Town ziemlich gut. Er hatte hier selbst zwar nie gearbeitet, doch jahrelang nur fünf Minuten entfernt gewohnt. Außerdem war seine Wohnung zurzeit an zwei der hiesigen Streifenpolizisten vermietet. Trotzdem war die vertraute Stimme, die ihm beim Betreten des Großraumbüros entgegenschallte, die letzte, mit der er gerechnet hätte.
»Da leck mich doch … Schaut mal, was die Katze angeschleppt hat.«
Er lächelte. »O Gott, sei uns gnädig.«
Thorne hatte Sergeant Christine Treasure zuletzt vor mehreren Jahren gesehen, als er für eine kurze – und unglückliche – Zeit wieder Uniform tragen musste und als Inspector in ein Revier in Lewisham versetzt worden war. Mit einem Temperament ausgestattet, das perfekt zu ihrem dreckigen Mundwerk passte, war Treasure jederzeit bereit, sich unbeliebt zu machen, was wahrscheinlich dazu beigetragen hatte, dass sie zu den wenigen echten Verbündeten geworden war, die er damals hatte. Genauer gesagt: die er überhaupt je gehabt hatte. Sie hatte ihre Leute im Griff, und Thorne lernte schnell, ihr zu vertrauen, was aber nicht bedeutete, dass die Zusammenarbeit mit dieser Frau eine rundum erfreuliche Angelegenheit gewesen wäre. Der Fall, an dem Thorne damals gearbeitet hatte, hatte ihm einen Krankenhausaufenthalt und schwere Verletzungen eingebracht. Doch jetzt – da er die typisch großherzige Begrüßung vernommen hatte und die grinsende Christine Treasure vor sich sah – erschien ihm eine Schusswunde als unbedeutendes Missgeschick verglichen mit den schrecklichen Erinnerungen an ihre gemeinsamen Einsätze im Streifenwagen.
Die zügellose Treasure am Steuer des Wagens, dem sie den Namen »Muschi-Magnet« verpasst hatte.
Die miserablen Parodien und ihr Mitsingen bei Heavy-Metal-Nummern. Das Furzen auf Wettkampfniveau. Die sexuellen Anspielungen, die unweigerlich folgten, sobald sie ein Lebewesen mit zwei Beinen und Titten entdeckte und die Donald Trump als geradezu feinfühligen Verehrer des weiblichen Geschlechts erscheinen ließen.
Mit einem Tempo, das sie sonst allenfalls im Einsatz an den Tag legte, eilte Treasure quer durch das Großraumbüro auf ihn zu und schlang die Arme um ihn. Ein in der Nähe sitzender Beamter schaute von seiner Zeitung auf und stieß einen Pfiff aus. Das Funkgerät, die Schutzweste und der Gürtel mit Schlagstock, Handschellen und Pfefferspray sorgten dafür, dass die Umarmung ziemlich unbequem ausfiel. Trotzdem fühlte es sich gut an.
»Was zum Teufel machst du hier?«, fragte Thorne.
»Schön, dass du mich vermisst hasst.« Als er sie das letzte Mal gesehen hatte, waren Treasures Haare blond gefärbt und zu Stacheln hochgegelt gewesen. Jetzt trug sie sie länger und nach hinten gekämmt. Sie bemerkte, dass Thorne ihren neuen Look in Augenschein nahm, und lächelte. »Ich mache auf Fünfziger-Jahre-Leinwandgöttin«, erklärte sie. »Die Frauen lieben das.«
»Na ja, göttlich warst du irgendwie schon immer.«
Der Hieb auf seinen Arm rief ihm auf schmerzhafte Weise ins Gedächtnis, dass man sich besser nicht mit ihr anlegte. Er erinnerte sich an den Kinnhaken, mit der sie einen Betrunkenen in der Fußgängerzone von Catford zu Boden geschickt hatte, der dumm genug gewesen war, auf sie loszugehen.
»Mal ernsthaft«, sagte er. »Lewisham ist weit weg.«
Sie schob ihn in die Teeküche und schaltete den Wasserkocher ein. Der Geruch des kleinen Raums – es war eher ein begehbarer Schrank – versetzte ihn abermals in die wenigen, unangenehmen Monate seiner Degradierung zur »Trachtengruppe« zurück.
»Du hast damals immer erzählt, wie toll es hier wäre«, sagte sie. »Da wollte ich mal sehen, ob du bloß rumgelabert hast.«
»Und, hatte ich recht?«
»Ja, ich glaube schon.« Sie warf ihren Gürtel auf den Tisch und schälte sich aus ihrer Weste. Es war kurz nach Mittag, und sie hatte eindeutig gerade die Frühschicht hinter sich. »Hier läuft eine etwas gehobenere Art von Dreck herum.«
»Dreck« war Treasures politisch höchst unkorrekter Begriff für sämtliche Täter, die dreist genug waren, ihren Weg zu kreuzen und ihr bürokratischen Aufwand zu bescheren. Betrunkene Autofahrer, Diebe, Vergewaltiger. Sie hasste sie alle gleichermaßen.
»Außerdem wohnt meine Freundin in Tufnell Park. Praktisch, nicht?« Wieder grinste sie, und die Lücke zwischen ihren Schneidezähnen verlieh ihr ein trügerisch mädchenhaftes Aussehen. »Meine Zukünftige, sollte ich sagen.« Sie streckte eine Hand aus, um Thorne den Ring zu präsentieren, und wackelte wie eine Prinzessin mit den Fingern. »Die Hochzeit ist in zwei Monaten.«
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Thorne.
»Ich bin in ihre Fitnessgruppe gegangen und hab ihr über die Lautsprecheranlage einen Antrag gemacht. Nicht schlecht, hm?«
»So viel Stil hätte ich dir gar nicht zugetraut.«
»Hast du Lust zu kommen?«
»Muss ich einen Hut tragen?«
»Von mir aus kannst du in einem verdammten Tutu aufkreuzen.« Sie hielt einen Becher hoch. »Nimmst du einen Tee?«
»Eigentlich sollte ich los.« Thorne schaute zur Uhr. Für seinen Termin war er schon zwanzig Minuten zu spät dran. Außerdem musste er noch in die vermietete Wohnung, um sich eine feuchte Stelle an der Decke anzusehen. Und dann wollte er noch das Essen abholen.
Treasure zerdrückte ihren Teebeutel. »Du willst zu Onkel Fester, stimmt’s? Wegen der Katzensache.«
»Hast du damit zu tun?«
»Ich hab mit allem zu tun, Kumpel, auf die eine oder andere Art. Hab ein paar Hausbesuche gemacht.«
»Muss ich über den Boss irgendwas wissen?«
»Er ist in Ordnung. Vielleicht hält er dich für ein bisschen unpassend gekleidet, aber er macht sicher keinen Stress.« Sie trank einen schnellen Schluck Tee. »Komm, ich bring dich hoch.«
Thorne folgte Treasure die Treppe hinauf und durch einen mit Teppich ausgelegten Gang in den Teil des Reviers, der das CID beherbergte. Eine Ansammlung kleiner Büros und ein großzügiger Einsatzraum. Er fragte, ob sie nach seinem Termin noch da sein würde, doch sie sagt, sie habe es eilig, in Tufnell Park warte ein heißer Körper auf sie.
Vor dem Büro des Detective Superintendent blieben sie stehen.
»Was wünschst du dir zur Hochzeit?«, fragte Thorne.
»Oh, ein Geschenk ist nicht nötig.«
»Okay, dann eben nicht.«
Wieder versetzte Treasure ihm einen Hieb, aber diesmal nicht so hart. »Ich schicke dir einen Link zur Hochzeitsliste.«
Thorne schüttelte den Kopf. »Hochzeitsliste! Seit du hier bist, bist du eindeutig extravaganter geworden. Lass mich raten: John Lewis? Harrods?«
Treasure grinste und wandte sich zum Gehen. »Lidl«, sagte sie.
Noch ehe er in Simon Fultons Büro Platz genommen hatte, verstand Thorne sowohl den Spitznamen als auch Treasures Bemerkung über seine Kleidung. Der Mann war kahl wie der Onkel der Addams Family, und die Mühe, die er auf seine sonstige äußere Erscheinung verwendete, ließ Thorne spekulieren, ob sein spärlicher Haarwuchs ihn zur Flucht nach vorn getrieben haben mochte. Er wirkte nicht wie ein Mann, der glücklich damit gewesen wäre, sich die Haare quer über die Glatze zu kämmen. Andererseits hatte Thorne nie begriffen, wie irgendjemand damit glücklich sein konnte. Fultons taubengrauer Anzug war nicht von der Stange und lag preislich weit über dem, was Thorne sich leisten konnte. Das weiße Hemd war makellos, und falls er sich die Zähne nicht hatte richten lassen, dann allenfalls deshalb, weil sie nicht gerichtet werden mussten.
Er sah aus wie dieser Schauspieler in Kingsman, auf dessen Namen Thorne gerade nicht kam.
»Normalerweise würde ich fragen, ob Sie gut hergefunden haben«, begann Fulton. »Aber ich schätze, das ist nicht nötig, stimmt’s?«
Der Detective Superintendent war offensichtlich ein Mann, der seine Hausaufgaben machte und die Menschen gern wissen ließ, dass er sie machte. Und der gern so viel wie möglich über die Kollegen wusste, mit denen er zusammenarbeitete. Thorne hoffte nur, dass er nicht zu tief gegraben hatte.
»Ja, ich hab in der Gegend gewohnt«, antwortete Thorne. Mark irgendwas, dachte er – dieser Schauspieler.
Fulton nickte und rückte ein Foto gerade, das gerahmt auf seinem Schreibtisch stand. Seine Familie? Thorne entdeckte keinen Ehering. »Eine schöne Ecke von London«, sagte er. »Na ja, vielleicht nicht, wenn man Katzen liebt.«
»Also gut, was haben wir?«
Auf das »Wir« reagierte Fulton nicht, jedenfalls nicht sichtbar, was Thorne als gutes Zeichen wertete. Bei Kollegen, die sich ihrer Fähigkeiten oder ihrer Autorität weniger sicher waren, hätte es an dieser Stelle zu Reibungen kommen können.
»Das Wesentliche wissen Sie vermutlich bereits.«
Thorne nickte. »Die Zahlen.«
Fulton berichtete ihm trotzdem.
»Bei näherem Hinsehen sind die Zahlen nicht ganz eindeutig. Also, vor etwas mehr als einem Jahr hat uns eine lokale Tierschutzgruppe auf die getöteten Tiere aufmerksam gemacht. Und dafür sind wir ziemlich dankbar.«
»Natürlich«, sagte Thorne, der langsam den Eindruck bekam, dass Fulton vor allem dafür dankbar war, dass er diesen Fall endlich abgeben konnte.
»Die lokale Gruppe sagte, es gebe soundso viele Opfer, und der britische Tierschutzverein behauptet, das sei eine viel zu vorsichtige Schätzung, es gebe in Wirklichkeit soundso viele Opfer … Trotz aller Horrorgeschichten in den Zeitungen liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Inzwischen ist es so, dass Katzen sehr schnell als ermordet gemeldet werden, obwohl ein Tier bloß weggelaufen ist oder von einem Auto angefahren wurde. Aber selbst wenn tatsächlich Vorsatz dahintersteht, lässt sich niemals ausschließen, dass irgendjemand einfach die Schnauze voll davon hat, dass der rothaarige Kater von nebenan ihm schon wieder ins Blumenbeet gekackt hat oder dass irgendein Mistkerl die Aufmerksamkeit der Medien ausnutzt.«
»Ein Trittbrettfahrer?« Thorne unterdrückte ein Grinsen.
Fulton übernahm das Grinsen für sie beide und ließ dabei kurz die makellosen Zähne sehen. »Also, unsere Schätzung liegt bei gut dreihundert Fällen, die wir ein und demselben Täter zurechnen, die Mehrzahl davon im nördlichen London und der näheren Umgebung.«
»Ich dachte, die Tatorte lägen weiter entfernt«, sagte Thorne. »In manchen Zeitungen ist vom M25-Katzenmörder die Rede.«
»Ja, es gab ein paar Tiere, die ein Stück weiter entfernt gefunden wurden«, erklärte Fulton. »Und die vermutlich vom selben Täter getötet wurden. Wie schon erwähnt, lässt sich das kaum präzise sagen. Wir haben sämtliche Informationen einer Fallanalytikerin vorgelegt, die ein geografisches Profil erstellt und uns davon überzeugt hat, dass unser Täter hier in der Gegend wohnt.«
»Wie geht er vor?«
»Ein Teil der Tiere ist von einem Veterinärpathologen untersucht worden, wobei sich herausgestellt hat, dass der Mageninhalt bei allen Tieren Übereinstimmungen aufwies. Vermutlich lockt der Täter sie mit Hühnerfleisch an. Die Todesursache war in sämtlichen Fällen entweder Strangulation oder ein stumpfes Schädeltrauma. Die Tiere sind also betäubt oder bereits tot, wenn ihnen einzelne Körperteile abgetrennt werden. Kopf oder Schwanz normalerweise. Manchmal auch Extremitäten. Ziemlich saubere Schnitte, sodass wir an eine Gartenschere denken.«
»Wie sieht es mit verwertbaren Spuren oder Fingerabdrücken aus?«
Fulton schüttelte den Kopf.
»Kann man bei einer toten Katze überhaupt Fingerabdrücke nehmen?«
»Theoretisch ja, aber wir haben keine gefunden. Auch keine DNA. Wir vermuten, er trägt Handschuhe, weil er nicht gekratzt werden will. Er vermeidet eindeutig Risiken und wurde bisher kein einziges Mal beobachtet. Keine Hinweise durch Überwachungskameras oder automatische Nummernschilderkennung. Er hält sich gern an Wohngebiete, wo es weniger Kameras gibt. Wir halten ihn für alles andere als … impulsiv.«
»Wofür halten Sie ihn dann?«
Fulton beugte sich vor. »Im Lauf der Zeit haben wir mit drei verschiedenen Theorien gearbeitet.« Er zählte sie an seinen Fingern ab. »Zunächst haben wir eine forensische Psychiaterin hinzugezogen … eine Fallanalytikerin von der National Crime Agency.« Sein Zögern reichte aus, um unmissverständlich klarzumachen, was er von solchen »Experten« hielt. »Sie zog anfangs die Möglichkeit in Betracht, dass es sich bei unserem Täter um einen gelangweilten Teenager handeln könnte, kam dann aber zu dem Schluss, dass wir nach einem männlichen Weißen zwischen vierzig und fünfzig suchen.«
»Mit einer ungeklärten Mutterbeziehung.«
»Genau, und da wir sonst nichts hatten, nahmen wir dieses Profil eine Weile als Ausgangspunkt der Ermittlungen. Dann …«, ein zweiter Finger, »dachten wir in eine etwas spezifischere Richtung. Über den Tellerrand hinaus, könnte man vielleicht sagen.« Er lächelte erneut, sodass Thorne mutmaßte, die Theorie, die er jetzt hören würde, stamme vielleicht von Fulton selbst. »Wissen Sie, wie viele Vögel jedes Jahr von Hauskatzen getötet werden?«
»Keine Ahnung«, räumte Thorne ein. »Eine Menge wahrscheinlich.«
»Fünfundfünfzig Millionen.« Fulton lehnte sich wieder zurück. »Ich weiß, es klingt lächerlich, aber in diesem Land gibt es neun Millionen Katzen. Die Zahl basiert also auf der Annahme, dass jede Katze lediglich alle zwei Monate einen Vogel tötet. Wir zogen jedenfalls in Betracht, dass die Person, nach der wir suchen, vielleicht einen besonderen Groll gegen Katzen hegt und aus spezifischen Motiven handelt.«
»Ernsthaft? Eine durchgeknallter Ornithologe?«
»Warum nicht?«
»Ich vermute, Sie haben Bill Oddie zur Vernehmung einbestellt.«
Der Comedian war bekennender Vogelbeobachter, aber vielleicht wusste Fulton davon nichts. Jedenfalls ließ seine Miene nicht erkennen, wie er Thornes lockere Bemerkung aufgenommen hatte. »Diesen Ermittlungsansatz haben wir bis jetzt jedenfalls nicht zu den Akten gelegt«, sagte er stattdessen. Dann hob er den dritten Finger. »Und natürlich haben wir die Steigerungstheorie, die wahrscheinlich auch unsere Fallanalytikerin im Hinterkopf hatte. Und der wir es verdanken, dass Sie und Ihr Team jetzt ins Spiel kommen.«
»Genau«, sagte Thorne und fragte sich im Stillen: Als Kavallerie oder als Sündenbock?
»Bis jetzt können wir dankbar sein, dass es noch nicht zum Übergriff auf Menschen gekommen ist, aber wir wären dumm, wenn wir die Wahrscheinlichkeit nicht in Betracht zögen. Egal, ob eine unserer Theorien zutrifft: Wir müssen ihn schnappen. Oh, und Sie sollten auch wissen, dass mehrere Tierschutzorganisationen zusammengelegt und eine Belohnung von zehntausend Pfund ausgesetzt haben.«
»Wie nett.« Thorne war nicht überrascht. Tierschutzorganisationen waren finanziell oft ziemlich gut ausgestattet. Die meisten von ihnen hatten ein größeres Spendenaufkommen als Kinderschutzorganisationen.
Er war sich nicht sicher, was das über die Spender aussagte.
»Das beweist vielleicht kein großes Zutrauen in unsere Fähigkeiten, könnte sich aber als hilfreich erweisen.«
»Ein Teil der Tiere …«, sagte Thorne.
»Bitte?«
»Sie sagten, ein Teil der Tiere sei von einem Veterinärpathologen untersucht worden. Warum nicht alle?«
Die wenigen Augenblicke des offensichtlichen Unbehagens und der ernste Ton, in dem Fulton antwortete, ließen Thorne endlich den wahren Grund begreifen, warum dieser Fall der Mordkommission übertragen wurde.
»Nun, wie Sie sicher verstehen, können wir für diesen Fall derzeit nicht die Ausgaben rechtfertigen, die bei einem Mordfall selbstverständlich wären.« Fulton schüttelte den Kopf und mühte sich um einen enttäuschten Gesichtsausdruck. »Um ehrlich zu sein war die Fallanalytikerin der äußerste Luxus, den wir uns leisten konnten. Jetzt, wo sich ein spezialisiertes Mordermittlungsteam eingeschaltet hat, dürften die Kosten nicht mehr mit Argusaugen überwacht werden.«
»Ich verstehe«, sagte Thorne.
Nicht mehr euer Problem. Mein Problem.
Er schätzte, dass der DI den Impuls unterdrückte, die Faust in die Luft zu recken, weil der Kelch an ihm vorübergegangen war. Denn schließlich: Sollten die Taten nicht weiter eskalieren, hätten Fulton und sein Team einen Fall am Hals, für dessen Aufklärung sie nicht ausreichend ausgestattet waren. Sollte umgekehrt der Mann, den sie suchten, tatsächlich einen Schritt weiter gehen, sähe Fulton sich der Aufgabe gegenüber, einen extrem gefährlichen Mörder zu schnappen, und darauf war kein Polizist, der seinen Verstand beisammenhatte, besonders scharf.
Ausnahmen bestätigten natürlich die Regel.
Es folgten noch einige Minuten freundlichen Geplauders. Sollten Sie Hilfe brauchen … Ich helfe, wo ich kann … Sie sollten darüber nachdenken, wieder in den Norden zu ziehen … Aber die Frau, nicht wahr …?
Thorne blieb an der Tür stehen. »Bill Oddie ist passionierter Vogelbeobachter.«
Fulton zwinkerte. »Ja, natürlich. Das ist mir schon klar.«
VIER
»Es ist besser. Es ist trotz allem besser.«
Adnan Jandali lag unter einer dünnen, fleckigen Decke auf einem Sofa, das seine Nachbarn ausrangiert hatten, und sprach mit sich selbst. Flüsternd, wie so häufig in letzter Zeit, in den Augenblicken, in denen er nicht einfach zitternd oder zusammengekrümmt dalag. In diesen kurzen Augenblicken des Trostes. Dann stotterte er, weil er nicht aufhören konnte zu weinen, oder er sang – mit tiefer, gebrochener Stimme – und wanderte dabei ziellos von Zimmer zu Zimmer.
Es waren Momente wie schwimmende Wrackteile, an denen er sich festklammern konnte.
Es lief doch gar nicht so schlecht. Wie sollte es auch? Bei diesem Gedanken durchbrach ein schwaches Lächeln die teigige Maske seines Gesichts. Schlecht war eines der ersten Worte gewesen, die er im Aufnahmelager gelernt hatte, denn es war leicht zu merken und hatte alles zum Ausdruck gebracht, was er sagen wollte. In diesen ersten Wochen, als die Hoffnung ihn redselig gemacht hatte und er begierig gewesen war, sie an andere weiterzugeben. Als er versucht hatte, jedem, der ihm zuhören wollte, zu beschreiben, wie es an dem Ort gewesen war, an dem er seine lange Reise begonnen hatte.
»Glaub mir, hier ist es nicht so schlecht …«
So schrecklich er sich jetzt auch fühlte, so schlimm die Dinge auch geworden waren – so schlimm er sie hatte werden lassen –, Adnan vergaß nie, warum er überhaupt hier war. Warum ein Leben in diesem Land so viel besser war als dasjenige, das er zu Hause geführt hatte. Das Leben, das er so lange ertragen hatte, bis ihm keine Wahl mehr geblieben war. Als er damals hier angekommen war, als er und seine Kinder eine Stadt betreten hatten, die nicht in Schutt und Asche gebombt worden war, waren schlagartig alle Zweifel beseitigt gewesen.
Das kühle Wetter war wunderbar.
Die Sprache, die er nicht beherrschte, klang magisch.
Dies war nun sein Zuhause, hatte er sich gesagt. Hier würde er, so Gott wollte, seine Kinder großziehen und sie beschützen. Es würde ihnen an nichts mangeln, und vielleicht würden sie irgendwann ihre Mutter vergessen. Oder zumindest würde sie zur Erinnerung an eine wunderschöne Frau in einer Geschichte verblassen.
Sie würden vergessen, auch wenn Adnan selbst es nicht konnte.
In diesen langen Wochen im Lager hatte alles angefangen. In diesen Wochen, die zu Monaten geworden waren. In denen seine Papiere geprüft und Entscheidungen gefällt wurden. Und seine Kinder bei Fremden bleiben mussten. Er war verwirrt und frustriert gewesen, bis man ihm etwas anbot, von dem man ihm versprach, es würde ihm alles erleichtern und die Zeit schneller verstreichen lassen. Er hatte kein Geld, um es zu bezahlen, doch sie hatten gesagt, das wäre kein Problem.
Freundliches Lachen und aufmunterndes Schulterklopfen.
Sobald du hier raus bist und eine Wohnung hast, kannst du bezahlen.
Es hatte die Dinge erleichtert, da hatten sie nicht zu viel versprochen. Das, was sich in den kleinen Päckchen befand, war sein Heilmittel. Es schaltete sofort die Gedanken ab, die ihn sonst pausenlos heimsuchten. Natürlich, natürlich, konnte er nicht mehr ohne, als er aus dem Lager heraus und wieder bei seinen Jungs war. Er brauchte es mehr denn je, aber er hatte nie genug Geld.
Und jetzt waren ihm die Jungs wieder weggenommen worden.
Jetzt hatte er Schulden. Und Schmerzen. Und ein unaufhörliches Verlangen nach etwas, das er sich nicht leisten konnte.
Das hier ist trotz allem besser.
Es gab ein Sprichwort über den Regen und die Traufe. Er verstand es, weil seine eigene Sprache eine ähnliche Redensart besaß. Es gab immer noch etwas, das schlechter war – so in der Art. Wenn es andersherum lief, gab es kein Sprichwort. Es war einfach das Glück, es muss das Glück sein. Er hatte so lange in der Traufe gestanden, und das jetzt war nur Regen. Auch jetzt, wo er hier lag, mit einem stinkenden Eimer neben sich auf dem Fußboden und einem unsäglichen Schmerz in der Brust, weil er nicht wusste, wo seine Kinder waren, spürte Adnan immer noch Dankbarkeit.
Wieder lächelte er dünn …
Denn immer noch war er dem Allmächtigen für diese Art Regen dankbar.
Der Fernseher war so laut aufgedreht, dass er mindestens eine Minute brauchte, um zu registrieren, dass es an der Tür klingelte. Lange und beharrlich. Es dauerte eine weitere Minute, bis er sich das Gesicht abgewischt und sein Hemd zugeknöpft hatte. Dann öffnete er und sah sich dem Mann mit dem dunklen Motorradhelm gegenüber.
Das kühle Wetter draußen war nicht ganz so wunderbar, wie er einmal geglaubt hatte.
Er sagte: »Ich hab nichts.«
Dann hob er den Arm, um den Schlag abzuwehren, und bemerkte zu spät, dass es kein Schlag war. Das Geräusch, das er hörte, klang, als würde jemand hinter vorgehaltener Hand husten. Noch ehe er auf die Knie sank und seinen Besucher davongehen sah, spürte Adnan, wie ihm das Blut durch die Finger sickerte. Die nächste Traufe, dachte er, war nie weit weg.
FÜNF
Nachdem er seine Wohnung aufgesucht und zu seiner Beruhigung festgestellt hatte, dass seine Mieter es offenbar nicht darauf angelegt hatten, sie komplett zu verwüsten, hatte Thorne sein Essen vom Takeaway-Imbiss abgeholt. Dann fuhr er nach Camden und parkte vor einem Fitnesscenter hinter dem Electric Ballroom. Wenige Minuten später saß er im blitzblanken Empfangsbereich des Studios, beobachtete Männer und Frauen in Elastanklamotten, die gerade ankamen oder gingen. Er wollte sich die gute Laune nicht durch die Einsicht verderben lassen, dass er einem Leben in körperlicher Fitness wohl niemals näher kommen würde als jetzt.
Thorne sah gerne Fußball und auch sonst so ziemlich jede Sportart – wenn es nicht gerade die tödlich langweilige Formel 1 war. Aber er selbst war nie ein begeisterter Sportler gewesen. Vor einigen Jahren hatte man ihn überredet, einen Abend im Hallenfußballteam der Abteilung für Schwerkriminalität mitzukicken. Dabei hatte er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Nachdem er sich zehn Minuten lang hatte vorführen lassen, von Kollegen, die halb so alt waren wie er, hatte er das Handtuch geworfen. Er hatte den Rest der Spielzeit nach Luft ringend im Tor verbracht und ein für alle Mal beschlossen, dass er zu Hause vor seinem Samsung-Fernseher besser aufgehoben war.
Mit einem Bier in der Hand.
Und einem Kebab …
Endlich entdeckte er Phil Hendricks, der – zwei Stufen auf einmal nehmend – die Treppe aus gebleichtem Holz herunterkam. An seiner Schulter hing eine mit Spikes verzierte Leder-Sporttasche, und das absurd enge schwarze T-Shirt brachte seine aufwändigen Tätowierungen zur Geltung.
»Du bist spät dran«, sagte Thorne.
»Tut mir leid, Kumpel.«
»Ich sitze hier schon zehn Minuten. Ich bin total geschafft.«
Hendricks stellte einen Fuß auf Thornes Stuhl, umfasste den Knöchel und bog das Bein zurück. »Ich brauch noch ein bisschen für das Cool-down.«
»Was?«
»Das bringt den Puls wieder runter.« Nach einer Weile richtete Hendricks sich auf und machte sich auf den Weg zum Ausgang. »Damit dein Blutdruck nicht in den Keller geht, weil das ganze Blut sich in den gedehnten Muskeln sammelt.«
Thorne erhob sich und folgte seinem Freund durch die Drehtür. »Wenn du es sagst.«
Hendricks stand auf dem Bürgersteig und setzte dort seine Dehnübungen fort. »Hilft beim Abbau des Laktats und so weiter.«
»Schon gut«, sagte Thorne. »Verschon mich mit dem Kauderwelsch.«
Trotz seiner medizinisch nicht ganz präzisen Ausdrucksweise wusste Hendricks, wovon er sprach. Als Gerichtsmediziner hatte er ziemlich genaue Vorstellungen davon, was ein menschlicher Körper erleiden konnte – wobei Laktat noch das geringste Problem darstellte.
»Nach dem Work-out brauchst du ein Cool-down, Kumpel.« Hendricks grinste, ehe er sich in Bewegung setzte. »Das ist so, wie wenn du das Leergut zum Container bringst.«
Sie gingen zum Spread Eagle am Camden Parkway. Hendricks lud Thorne generös ein. In gespielter Empörung erklärte Thorne, er nehme ein Pint Guinness. »Ich sehe dir gern bei deinem Orangensaft zu.«
»Ich halte mich gern in Form«, sagte Hendricks. »Aber verrückt bin ich nicht.« Er bestellte zwei Pints und deutete dann auf eine Auswahl hausgemachter Brötchen und die Schottischen Eier auf dem Tresen. »Möchtest du was essen?«
Thorne sagte, dass er nur auf einen Drink bliebe und im Kofferraum Essen aus dem Bengal Lancer habe.
»Nanu?«, sagte Hendricks. Er nahm die Gläser und trug sie zu einem Fenstertisch. »Was führst du im Schilde? Willst du Helen mit einer extra-großen Portion Rogan Josh bestechen, um hierherziehen zu können?«
»Träumen wird man noch dürfen«, erwiderte Thorne.
Sie stießen an und tranken. Zwei Medientypen diskutierten an einem Nachbartisch über eine Ausstellung, die sie kürzlich besucht hatten. Und offenbar nahmen sie gleichzeitig am »Wer trägt die affigste Brille«-Wettbewerb teil.
»Was soll eigentlich diese Fitnessclub-Geschichte?«, fragte Thorne.
Die vielen Metallteilchen, die beinahe jede erdenkliche Stelle an Hendricks’ Körper zierten, führten wahrscheinlich dazu, dass er ein paar zusätzliche Kilos auf die Waage brachte, doch er war immer muskulös und fit gewesen. Man hätte ihn leicht für einen etwas exotisch aussehenden Türsteher halten können, wobei er sich nie besondere Mühe hatte geben müssen, seine Figur zu halten. Während der längsten Zeit ihrer Freundschaft hatte Hendricks’ Vorstellung von Work-out darin bestanden, bis zum Abwinken in einem düsteren Club zu tanzen und anschließend, wenn er Glück hatte, eine Marathonrunde Bettgymnastik mit einer Zufallsbekanntschaft dranzuhängen. Seit er sich vor einem Jahr mit seinem Partner Liam häuslich eingerichtet hatte, stand er allerdings plötzlich auf Fitnessstudios.
»Es geht um die hübschen Ärsche in den engen Hosen, stimmt’s?«
Hendricks zuckte die Schultern. »Kein Interesse«, sagte er. »Ich meine, versteh mich nicht falsch, aber ich gehe ins Studio, weil ich mit Liam zusammenbleiben will.«
»Was? Du glaubst, er würde sich aus dem Staub machen, wenn du ein paar Pfund ansetzt?«
»Auf keinen Fall. Er weiß, dass er Glück gehabt hat.«
»Und warum dann? Ich dachte, wenn man mit jemandem zusammenzieht, dann … würde man irgendwie anfangen, sich gehen zu lassen. Du weißt schon, wenn man nicht mehr loszieht, um jemanden abzuschleppen.«
»Es gefällt ihm, dass ich fit bin, das ist alles. Mir gefällt, dass ich fit bin.«
Thorne brummte etwas, stand auf und holte neue Getränke.
»Dann hast du es wohl so gemacht, was? Dich gehen lassen?«, sagte Hendricks, als er wieder zurückkam.
»Nein …«
»Weiß Helen das?«
»Nein … Ihr macht es nichts aus, dass ich nicht wie ein Unterwäsche-Model aussehe.«
Hendricks nickte. »Das hat sie dir so gesagt?«
Thorne antwortete nicht.
»Na also. Würdest du etwas sagen, wenn du denkst, sie wird ein bisschen füllig?«
»Red keinen Blödsinn.«
»Genau. Aber denken würdest du es.«
»Sie muss gar nichts sagen«, erklärte Thorne. »Ich weiß, dass sie nicht so oberflächlich ist. Und sie muss meinen Körper auch nicht hundertprozentig lieben, ihr bleiben ja immer noch mein Wahnsinnsverstand und meine einnehmende Persönlichkeit.«
Hendricks lachte. »Verdammt, du hast echt ein Problem.«
»Halt’s Maul«, murmelte Thorne in sein Guinness.
»Ich meine es ernst. Glaubst du, es gefällt ihr, wenn du dich gehen lässt?« Hendricks beugte sich über den Tisch. »Natürlich drücke ich mich nicht ganz korrekt aus, weil der Begriff impliziert, dass du dir irgendwann einmal Mühe gegeben hättest. Aber du weißt, was ich meine. Meinst du nicht, Helen wäre mit einem Sixpack glücklicher als mit einem Fässchen? Ich sag’s dir, Mann, sie hat neulich sogar mir Blicke zugeworfen. Das zeigt doch, dass sie verzweifelt ist.«
»Ja, ja, alles klar.«
»Du könnest anfangen, indem du den Imbiss-Fraß wegschmeißt.«
»Auf keinen Fall.«
»Oder ihn mir gibst. Zum Glück bin ich ein toller Typ und habe einen hervorragenden Stoffwechsel.«
»Könnten wir das Thema wechseln?«
»Ganz zu schweigen davon, was du deinem Herzen und deinem Blutdruck antust … Diabetes, Herzinfarkt … Neulich hab ich einen Kerl aufgeschnitten, der ein bisschen aussah wie du. Er hatte ringsum eine Fettschicht dicker als eine Packung dänische Butter, eine Leber, die als Pastete hätte durchgehen können, und ein Herz wie ein Beutel Schweineschmalz.«
»Bist du fertig?«
»Kein schöner Anblick. Mehr sage ich gar nicht.«
»Was ist an dem Wort ›Themawechsel‹ so schwer zu verstehen?« Er sah zu, wie der Barkeeper den Männern am Nebentisch riesige Portionen einer Schickimicki-Variante von Fish and Chips servierte. So albern ihre Brillen auch aussahen, waren beide Männer dünn wie Bohnenstangen. Thorne argwöhnte, dass keiner von ihnen einen Gedanken an Cholesterin oder den Body-Mass-Index verschwendete.
Hendricks lächelte und sagte: »Wunden Punkt getroffen? Na gut, also was treibst du hier in der Gegend? Ich weiß, dass der Lancer gut ist, aber …«
Thorne erzählte ihm von den Katzen.
»So was kann leicht richtig hässlich werden«, stellte Hendricks anschließend fest.
»Genau das ist unsere Sorge.«
»Hast du schon mal daran gedacht, dass es mehr als ein Täter sein könnte?«
Thorne wartete ab.
»Zum Beispiel eine Bande wütender Mäuse, die sich zusammengetan haben?«
»Sehr witzig«, sagte Thorne, obwohl die Idee kaum schlechter war als Fultons psychotischer Vogelliebhaber. »Mir stehen die blöden Sprüche schon bis hier.«
»Bestimmt war keiner davon so witzig wie meiner.«
Phils flapsige Kommentare standen wie immer in krassem Gegensatz zu der großen Gewissenhaftigkeit, die er jeden Tag im Umgang mit den ihm anvertrauten Leichen bewies. Darunter waren auch die Opfer diverser Serienmörder gewesen, und Thorne war klar, dass er die Implikationen des Falls, über den sie sprachen, sehr wohl begriffen hatte. Diesmal war einfach Thorne an der Reihe, den vernünftigen Part zu übernehmen, die Erwachsenenrolle zu spielen.
Deswegen schüttelte er jetzt ernst den Kopf. Denn ernst war der Fall, daran zweifelte er keinen Moment. Er hatte es gewusst, noch bevor er Fultons Büro in Kentish Town betreten hatte. Und je länger er darüber nachdachte, desto klarer wurde ihm, dass er schon in Russell Brigstockes Büro eine relativ deutliche Vorstellung davon gehabt hatte, was ihn erwartete. Als er noch protestiert und dumme Sprüche geklopft hatte.
Pfeifen im Walde.
»Die forensische Psychiaterin, mit der Fulton gearbeitet hat, scheint es für ziemlich eindeutig zu halten«, berichtete Thorne. »Auch wenn sie ihren Ruf wahrscheinlich nicht darauf verwetten würde.«
»Natürlich nicht«, sagte Hendricks. »Ich meine, man kann ganz schnell irgendetwas übersehen oder falsch deuten.«
»Sie vermutet eine Eskalation ganz nach Lehrbuch.«
»Ja, danach sieht es zugegebenermaßen aus.« Hendricks nickte langsam und starrte in sein Glas. »Den Gedanken hatte ich schon vor einem Monat, als die Zeitungen anfingen, darüber zu berichten. Ein Verrückter, der die Muskeln spielen lässt, um zu schauen, wie es ihm gefällt.«
»Tja, ich denke, wir können davon ausgehen, dass er seinen Spaß hat«, sagte Thorne.
»Wann war der letzte Vorfall?«
»Der letzte, der mit Sicherheit zur Serie gehört, ist zwei Wochen her, aber seine Spur lässt sich nur schwer nachverfolgen. Manchmal dauert es eine Weile, bis jemand sicher ist, dass sein Haustier verschwunden ist, und selbst dann könnte es einfach weggelaufen sein. In einigen Fällen hat sich auch herausgestellt, dass die Katzen überfahren wurden.«
»Na, wenn er sich tatsächlich noch aufwärmt, klingt es, als hätten wir eine Chance.«
»Wollen wir es hoffen.« Thorne war froh, das »Wir« zu hören. Die Antwort auf eine Frage, die er nicht hatte stellen müssen. Er und Hendricks hatten in beinahe allen Fällen, in denen Thorne Jagd auf einen Serientäter gemacht hatte, eng zusammengearbeitet. Er wollte es diesmal nicht anders haben. Denn trotz aller Frotzeleien waren sie ein Herz und eine Seele, nur so erzielten sie ihre Resultate. Sie lagen auf derselben Wellenlänge, sprachen dieselbe Sprache.
Hendricks stürzte den Rest seines Biers herunter und hob das Glas. »Bist du sicher, dass du keins mehr willst?«
Thorne hätte nur zu gerne noch eins getrunken, sagte aber, er wolle nach Hause, und nicht bloß wegen des Essens.
Als Hendricks mit seinem Bier zurückkehrte, starrte Thorne vor sich hin. »Was ist?«
»Was du eben gesagt hast.«
»Wann?« Hendricks sah, wie Thorne die Hand zum Hals hob – eine unbewusste Geste, die der Pathologe im Laufe der Jahre zu häufig gesehen hatte, um sie ignorieren zu können.
Thorne kratzte sich. Er zog eine Grimasse, als ihn ein Schauder erfasste. »Eben im Fitnessstudio.« Er beugte sich zu Hendricks hinüber und senkte die Stimme. »Was ist, wenn er nicht beim Warm-up ist? Könnte es sich bei dem Täter nicht um jemanden handeln, der das Work-out schon hinter sich hat, und diese Geschichte mit den Katzen ist … etwas anderes?«
»Langsam.« Hendricks hob eine Hand. »Eben hast du vom Lehrbuch gesprochen.«
»Vielleicht brauchen wir ein anderes Lehrbuch.«
»Das ist ein ziemlicher Sprung, Kumpel.«
Thorne schüttelte den Kopf und trank den Rest seines Biers aus. Ihm war soeben die Erkenntnis gekommen, dass ein weiteres Bier doch keine schlechte Idee wäre. Er knallte das leere Glas laut genug auf den Tisch, um Blicke von den beiden Männern nebenan zu provozieren. Er starrte sie an, bis sie sich wieder abwandten.
»Überleg doch mal, Phil. Was ist, wenn der Drecksack beim Cool-down ist?«
SECHS
Wenn man bedachte, dass sie einen großen Teil ihres Berufslebens damit zubrachte, sich in die verworrene Psyche extrem geschädigter Individuen hineinzuversetzen, wirkte Dr. Melita Perera bemerkenswert munter und unbeschwert. Die von ihr verfassten Notizen in der Akte, die Thorne von Fulton erhalten hatte, klangen – nicht überraschend bei Sachverständigenaussagen – ein wenig trocken und akademisch. Bei der Lektüre ihrer psychologischen Einschätzung des unbekannten Verdächtigen hatte Thorne das Bild einer älteren Frau mit Dutt und Tweedrock vor Augen gehabt. Nachdem er sie allerdings gegoogelt hatte, wusste Thorne, dass die Frau Anfang vierzig war, und auf ihren Fotos wirkte sie, als wisse sie sehr genau, was ein Work-out war. Vermutlich ging sie jeden Tag ins Fitnessstudio und an ihren freien Tagen zum Eisklettern.
»Das ist eine interessante Theorie«, sagte sie. Thorne wusste, dass sie ursprünglich aus Sri Lanka stammte, hörte aber nicht den geringsten Anflug eines Akzents.
»Ernsthaft?« Thorne saß an seinem Schreibtisch und versuchte nach Kräften, den Bürolärm vor der Tür auszublenden. Beim Telefonieren kritzelte er auf der Rückseite eines Spesenformulars. »Ich meine, ganz ehrlich … Sagen Sie mir einfach, wenn ich Blödsinn rede. Dann verschwende ich weder meine eigene Zeit noch die Ihre.«