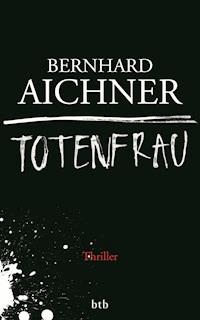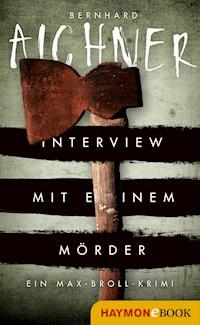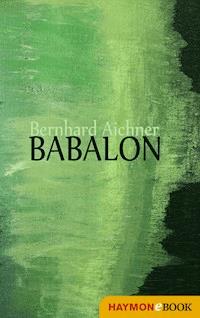24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Alle drei Thriller der bekannten Totenfrau-Trilogie in einem Band!
„Totenfrau“: Blum ist Bestatterin. Sie ist liebevolle Mutter zweier Kinder, sie besticht durch ihr großes Herz, ihren schwarzen Humor und ihre Coolness. Blum fährt Motorrad, sie trinkt gerne und ist glücklich verheiratet. Blums Leben ist gut. Doch plötzlich gerät dieses Leben durch den Unfalltod ihres Mannes, eines Polizisten, aus den Fugen. Vor ihren Augen wird Mark überfahren. Fahrerflucht. Alles bricht auseinander. Blum trauert, will sich aber mit ihrem Schicksal nicht abfinden. Das Wichtigste in ihrem Leben ist plötzlich nicht mehr da. Ihr Halt, ihr Glück. Durch Zufall findet sie heraus, dass mehr hinter dem Unfall ihres Mannes steckt, dass fünf einflussreiche Menschen seinen Tod wollten.
„Totenhaus“: Bei einer Exhumierung auf einem Innsbrucker Friedhof werden in einem Sarg zwei Köpfe und vier Beine gefunden. Schnell wird klar, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss, dass hier die Leichenteile eines vor einem Jahr spurlos verschwundenen Schauspielers liegen. Nur eine Person kommt als Täterin in Frage: die Bestatterin, die die Verstorbene damals versorgt und eingebettet hat. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Brünhilde Blum den Schauspieler getötet hat. Doch die ist wie vom Erdboden verschluckt …
„Totenrausch“: Brünhilde Blum. International gesuchte Mörderin. Liebevolle Mutter zweier Töchter. Seit Monaten auf der Flucht. In Hamburg will sie zur Ruhe kommen, einen Neuanfang wagen, und fast, so scheint es, gelingt es ihr auch. Ausgestattet mit einer neuen Identität und etwas Geld wohnt sie mit ihren Töchtern in einem wunderschönen Fischerhäuschen an der Elbe und arbeitet als Aushilfe in einem Bestattungsinstitut. Alles ist gut. Bis zu dem Tag, an dem sie für ihr neues Leben bezahlen muss – denn der Mann, dem sie das neue Glück zu verdanken hat, fordert ein, was sie ihm versprochen hat. Sie soll für ihn jemanden töten. Das Problem dabei ist nur, dass es sich um einen Menschen handelt, der ihr sehr ans Herz gewachsen ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1085
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Die Bücher:
Alle drei Thriller der bekannten Totenfrau-Trilogie in einem Band!
»Totenfrau«: Blum ist Bestatterin. Sie ist liebevolle Mutter zweier Kinder, sie besticht durch ihr großes Herz, ihren schwarzen Humor und ihre Coolness. Blum fährt Motorrad, sie trinkt gerne und ist glücklich verheiratet. Blums Leben ist gut. Doch plötzlich gerät dieses Leben durch den Unfalltod ihres Mannes, eines Polizisten, aus den Fugen. Vor ihren Augen wird Mark überfahren. Fahrerflucht. Alles bricht auseinander. Blum trauert, will sich aber mit ihrem Schicksal nicht abfinden. Das Wichtigste in ihrem Leben ist plötzlich nicht mehr da. Ihr Halt, ihr Glück. Durch Zufall findet sie heraus, dass mehr hinter dem Unfall ihres Mannes steckt, dass fünf einflussreiche Menschen seinen Tod wollten.
»Totenhaus«: Bei einer Exhumierung auf einem Innsbrucker Friedhof werden in einem Sarg zwei Köpfe und vier Beine gefunden. Schnell wird klar, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss, dass hier die Leichenteile eines vor einem Jahr spurlos verschwundenen Schauspielers liegen. Nur eine Person kommt als Täterin in Frage: die Bestatterin, die die Verstorbene damals versorgt und eingebettet hat. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Brünhilde Blum den Schauspieler getötet hat. Doch die ist wie vom Erdboden verschluckt …
»Totenrausch«: Brünhilde Blum. International gesuchte Mörderin. Liebevolle Mutter zweier Töchter. Seit Monaten auf der Flucht. In Hamburg will sie zur Ruhe kommen, einen Neuanfang wagen, und fast, so scheint es, gelingt es ihr auch. Ausgestattet mit einer neuen Identität und etwas Geld wohnt sie mit ihren Töchtern in einem wunderschönen Fischerhäuschen an der Elbe und arbeitet als Aushilfe in einem Bestattungsinstitut. Alles ist gut. Bis zu dem Tag, an dem sie für ihr neues Leben bezahlen muss – denn der Mann, dem sie das neue Glück zu verdanken hat, fordert ein, was sie ihm versprochen hat. Sie soll für ihn jemanden töten. Das Problem dabei ist nur, dass es sich um einen Menschen handelt, der ihr sehr ans Herz gewachsen ist …
Der Autor:
Bernhard Aichner (1972) lebt als Schriftsteller und Fotograf in Innsbruck. Er schreibt Romane, Hörspiele und Theaterstücke. Für seine Arbeit wurde er mit mehreren Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet, zuletzt mit dem Burgdorfer Krimipreis 2014, dem Crime Cologne Award 2015 und dem Friedrich Glauser Preis 2017.
Die Thriller seiner Totenfrau-Trilogie standen monatelang an der Spitze der Bestsellerlisten. Die Romane wurden in 16 Länder verkauft, u.a. auch nach USA und England. Mit BÖSLAND und DER FUND schloss er 2018 und 2019 an seine internationalen Erfolge an.
Bernhard Aichner
Die Totenfrau-Trilogie
Drei Romane in einem Band
Totenfrau Totenhaus Totenrausch
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
»Totenfrau« Copyright © 2014 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Satz: Uhl + Massopust, Aalen
»Totenhaus« Copyright © 2015 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: © Liashko/Shutterstock Satz: Uhl + Massopust, Aalen
»Totenrausch« Copyright © 2017 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkterstraße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: semper smile Umschlagmotiv: Bernhard Aichner Satz: Uhl + Massopust, Aalen
978-3-641-28112-0
www.btb-verlag.de
»Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.«Friedrich Nietzsche
Acht Jahre vorher
Man sieht alles von oben. Das Meer, das Segelboot, ihre Haut. Eine nackte Frau an Deck, die Sonne scheint, alles ist gut. Sie liegt einfach nur da, schaut nach oben, ihre Augen sind offen, nur sie und der Himmel, die Wolken. Es ist der schönste Platz auf der Welt, das Boot, das ihre Eltern vor zwanzig Jahren gekauft haben, ein Prachtstück, eine Perle, die im Hafen von Triest ihre Heimat hat. Segeln, Leben auf dem Wasser, unter freiem Himmel, dort, wo sonst keiner ist. Nur Wasser weit und breit, Musik in ihren Ohren, und der Schweiß, der sich in ihrem Bauchnabel sammelt. Sonst nichts.
Von Triest zu den Kornaten, seit drei Tagen sind sie unterwegs, sie haben keine Eile, es gibt nichts zu tun. Urlaub mit ihren Eltern, so viele Jahre schon. Bald siebzig sind sie, wettergegerbt, leidenschaftliche Segler beide. Immer schon sind sie auf Booten unterwegs. Schon seit sie ein Kind war. In Badehose und Bikini, niemals nackt.
Vor zwei Stunden hat sie sich ausgezogen, sie hat sich hingelegt, ohne sich einzucremen. Sie will, dass die Sonne sie verbrennt, dass ihre Haut schreit, wenn sie gefunden wird. Nackt will sie sein. Endlich nackt. Niemand mehr, der es ihr verbietet. Kein Vater. Keine Mutter. Allein auf dem Boot, ihre Brüste, die Hüften, die Beine, die Arme. Dieses Lächeln auf ihren Lippen und wie sie sich leicht zur Musik bewegt. Nirgendwo sonst möchte sie jetzt sein. Noch drei Stunden wird sie liegen bleiben, sich strecken, sich räkeln, den Sommer in sich aufsaugen. Drei Stunden lang, oder vier. Bis die beiden endlich untergehen. Bis sie aufhören zu schreien. Bis sie aufhören, Wasser nach oben zu spritzen. Bis sie endlich still sind. Für immer.
Es ist Mittag vor Dugi Otok. Sie rührt sich nicht. Sie ist eingeschlafen, wird sie sagen, sie hat nichts gehört, die Musik war zu laut, die Sonne hat sie müde gemacht. Sie wird auf alle Fragen eingehen, sie wird ihnen Rede und Antwort stehen, und sie wird weinen. Sie wird alles tun, was notwendig ist, alles. Später, nicht jetzt. Jetzt ist da nur der Himmel über ihr, sie malt ihn an mit ihren Fingern, sie zieht Kreise, schreibt in das Blau. Sie malt sich ihre Zukunft aus, sie stellt es sich vor, ihr neues Leben allein. Das Institut, das jetzt ihr gehört. Sie wird alles umstellen, modernisieren, sie wird das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs bringen. Sie wird alles steuern. Sie selbst, nicht Hagen. Sie wird das Boot zurück nach Triest bringen und neu anfangen.
Überall ist Schweiß. Wie sie es genießt, nackt zu sein. Eine erwachsene Frau, die sich von ihren Eltern nicht mehr sagen lässt, was sie tun und was sie lassen soll. Du wirst dich nicht ausziehen, Brünhilde. Nicht auf unserem Boot. Solange wir leben, gelten unsere Regeln, Brünhilde. Jetzt nicht mehr. Es gibt keine Regeln mehr, nur noch sie selbst entscheidet, sie allein. Keine Befehle mehr, keine Verbote. Sie hat sich ausgezogen, sie liegt an Deck und streckt ihren Körper in den Wind. Alles, was sie ist, weht wie eine Fahne, sie blüht auf in der Sonne, sie ist glücklich. Mit jeder Minute, in der sie allein ist, mehr.
Brünhilde Blum. Vierundzwanzig Jahre alt. Tochter von Hagen und Herta Blum. Adoptiert. Sie haben sie aus dem Kinderheim geholt, als sie drei Jahre alt war, sie haben sie aufgezogen wie ein Haustier, sie wurde herangezüchtet zur Nachfolgerin, sie war Hagens letzte Hoffnung, der Familienbetrieb sollte weiterbestehen. Um jeden Preis. Auch wenn es nur ein Mädchen war, das sie adoptieren konnten. Ein Mädchen oder gar kein Kind, hieß es. Die Wartelisten waren lang und Hagens Verzweiflung groß. So groß, dass er sich hinreißen ließ, dass er es sich nach langem Überlegen vorstellen konnte, seinen Betrieb in die Hände einer Frau zu legen, irgendwann. Sie sollte weiterführen, was ihm heilig war, sie sollte erhalten, was er geschaffen hatte, sie sollte für Hagen zum Mann werden. Sie tat alles, was er verlangte, alles, was der Beruf notwendig machte. Das Bestattungsunternehmen Blum war sein Ein und Alles, es war ihm wichtiger als alles andere sonst.
Ein Traditionsbetrieb, ihr Gefängnis, ihr Kinderzimmer. Kurz nach dem Krieg gegründet, zu einer Zeit, als das Sterben zum Geschäft wurde. Was früher die Nachbarn erledigt hatten, wurde 1949 von den Blums übernommen. Die Nachbarn, die geholfen hatten, wenn jemand gestorben war, die sich um die Leichenwäsche gekümmert hatten, um das Anziehen und Aufbahren, die Bestatter lösten sie ab. Was lange Zeit selbstverständlich war, wurde nunmehr zum Tabu. Tote zu berühren, sich von ihnen zu verabschieden, bevor sie in den Kisten verschwanden. Man war froh darüber, dass da nun jemand war, der alles so schnell wie möglich vom Tisch wischte, der den Leichnam abholte und unter die Erde brachte. Sauber und sachlich.
Die Blums waren die Ersten in Innsbruck. Sie lebten gut von den Toten. Zuerst Hagens Vater, dann Hagen, von nun an Blum. Nur Blum, weil sie ihren Vornamen hasste, weil sie ihn nie ertragen konnte, keinen Tag lang. Brünhilde, lass die Toten in Ruhe. Brünhilde, hör auf, mit ihnen zu spielen. Brünhilde, hör auf, deine Finger in ihre Nasen zu stecken. Brünhilde. Ein Name, der nichts mit ihr zu tun hatte, den sie ihr gegeben hatten, weil Hagen deutscher war als erlaubt, weil er Wagner liebte, die Nibelungen, weil er wollte, dass seine Tochter in seine Welt passte. Brünhilde. Ein Name, den sie verbannt hat aus ihrem Leben. Nur mehr Blum. Nicht Brünhilde. Seit sie sechzehn war, seit sie aufgehört hat, Hagens kleiner Soldat zu sein, seit sie nicht mehr uneingeschränkt tat, was er verlangte, nicht mehr gehorchte. Nur Blum. Sie bestand darauf. Egal, ob er sie dafür bestrafte.
Blum. Sie schaut den Himmel an. Sie dreht die Musik lauter, das Boot wiegt hin und her, weit und breit ist da niemand. Keiner, der hilft, keiner, der ihre Schreie hört. Niemand außer ihr. Nackt liegt sie da. Fast so wie die Toten im Versorgungsraum. Auf dem Tisch, kalt, ohne Leben seit sie denken kann. Sie half ihrem Vater, Freunde hatte sie nicht. Der Beruf schreckte die anderen Kinder ab. Dass ihr Vater mit Toten zu tun hatte und auch sie selbst, damit konnten sie nicht umgehen. Blum wurde zum Freak, man machte sich lustig über sie, man grenzte sie aus, spottete, verschwor sich gegen sie. Blum litt. Immer, eine Kindheit lang, eine Jugend. Sie sehnte sich nach einem Freund, einer Freundin, nach jemandem, mit dem sie ihr Leben teilen konnte, mit dem sie reden und lachen konnte. Aber da war niemand, sie blieb allein, sie hatte nichts außer ihren Eltern. Lieblosen Eltern. Eine stumme Mutter ohne Umarmungen und ein Vater, der sie zwang, Dinge zu tun, die ein Kind nicht tun sollte.
Seit sie sieben war, hatte sie die Toten zu versorgen. Du darfst keine Zeit verlieren, Brünhilde, der frühe Vogel fängt den Wurm. Stell dich nicht so an, Brünhilde, sie werden dich schon nicht beißen. Sei kein Mädchen, beiß die Zähne zusammen und hör auf zu weinen. Wenn du jetzt nicht still bist und tust, was ich dir sage, kommst du in den Sarg. Hast du das verstanden, Brünhilde? Da war keine Zeit zu verlieren, sie sollte lernen, damit umzugehen, er verlangte Unmögliches von ihr. Blum wusch den Toten die Haare, sie rasierte sie, sie wusch Blut von ihren Körpern und half beim Anziehen. Als sie zehn war, nähte sie zum ersten Mal einen Mund zu. Wenn sie sich weigerte, sperrte man sie in den Sarg. Unzählige Male, stundenlang im Dunkel, ein kleines Kind, ängstlich, allein. Blum. Hagen brach ihren Willen, jedes Mal von Neuem. Wie sie sich hineinlegen musste und er den Deckel verschraubte. Du lässt mir keine andere Wahl, Brünhilde. Wann wirst du endlich aufhören, dich zu wehren, ich habe keine andere Wahl, Brünhilde. Und Deckel zu. Ein Kind in einer Holzkiste. Sie blieb, solange sie konnte, so gerne wäre sie stärker gewesen, doch sie war nur ein Kind. Wehrlos ertrug sie es, niemand half ihr, keiner kümmerte sich um ihre Tränen, um ihr Flehen. Ich will das nicht tun. Ich kann nicht. Bitte nicht. Kurz bevor sie die Nadel durch das Kinn von unten in eine Mundhöhle stach. Der Faden durch totes Fleisch. Sie hat alles getan, aber es war zu wenig. Egal, wie sehr sie sich danach sehnte, nach Berührung, nach Blicken, die ihr sagten, dass ihre Eltern stolz auf sie waren. Blums Haut blieb allein. Ihr Sehnen blieb ungestillt, sie war nie genug, egal wie sehr sie sich bemühte. Sie war immer nur ein kleines Mädchen. Hilflos und ohnmächtig. Die kleine Blum. Bitte lass mich raus, Papa. Bitte sperr mich nicht ein. Nicht schon wieder in den Sarg, Papa. Bitte nicht.
Es war Strafe und Qual. Was später Alltag wurde, war am Anfang die Hölle. Jeder Handgriff, jeder Blick, die kalte, tote Haut, die sie berührte. Tausendmal wischte sie Augen und Münder aus, reinigte Wunden, da waren Blut und Maden, entstellte Leichen, abgetrennte Körperteile, da war keine Kindheit, keine Torte mit Kerzen, waren keine Puppen, die sie anzog und auszog. Da waren nur Tote. Große Puppen, schwere Puppen, behaarte Arme und Beine, Köpfe so schwer, dass sie sie kaum halten konnte, reglose Münder. Kein Lächeln, kein schönes Wort, gar nichts. Nur ihr Vater, der sie antrieb. Unzählige Leichname, Gesichter, Genitalien und Kot, tote Menschen, die vor ihr herumlagen, um die sie sich kümmern musste. Ein zehnjähriges Mädchen mit Plastikhandschuhen. Und wie die Mutter sie zum Essen rief. So als hätte Blum mit Freundinnen im Hof gespielt. Essen ist fertig. Wascht euch die Hände, Papas Lieblingsgericht wartet. So als wäre alles normal, als wäre alles richtig gewesen. Ein ordentlicher Braten für den Vater, ein Unfallopfer für Blum. Hagen, wie er die beladene Gabel in seinen Mund schob. Blum, wie sie an kaputtes Fleisch dachte, an alte, wundgelegene Männer, an Haut wie Papier, an den Urin und das Blut im Nebenraum, das sie nach dem Essen wegwischen musste. Es schmeckt herrlich, Herta, wie immer ein Gedicht. Und wie Blum den Teller von sich schob.
Seit sie denken kann, waren da Tote. Sie kamen im Leichenwagen, in Transportsärgen, sie kamen direkt aus ihren Betten, in denen sie für immer eingeschlafen waren, sie kamen blutend, verstümmelt, sie kamen mit Herzinfarkten, erstochen, erschlagen, obduziert, sie kamen einfach in Blums Leben, drangen ein in ihre kleine Welt. Niemand fragte sie, ob sie das wollte. Ob sie das konnte. Sie lagen einfach da, tote Menschen auf dem Aluminiumtisch. Angsteinflößend am Anfang, irgendwann aber still und friedlich. Blum freundete sich an mit ihrer Welt, sie begann zu akzeptieren, dass sie keine Wahl hatte, dass sie nirgendwo sonst hinkonnte. Dass sie die Lebenden fürchten musste, nicht die Toten. Es war eine Erkenntnis, die guttat. Mit ihnen allein zu sein. Immer wenn es ging, zog sie sich in den Versorgungsraum zurück. Die Toten wurden irgendwann zu Freunden, sie sprach mit ihnen, Blum war stärker als sie. Sie konnte entscheiden, was mit ihnen passierte. Keiner konnte ihr wehtun, egal, wie schwer und wie groß sie waren, sie bewegten sich nicht mehr. Atmeten nicht, ihre Arme und Beine lagen einfach nur da. Wie Puppen waren sie, große, kalte Puppen, mit denen sie spielte. Sie vertraute sich ihnen an, sagte ihnen alles, immer. Sonst schwieg sie, zu ihren Eltern kein Wort, sie wollte ihre Ruhe, nichts wissen, sie tat einfach, was von ihr verlangt wurde, und zog sich zurück. In ihre Welt. Bis gerade eben.
Blum. Wie die Sonne brennt. Wie gut es tut, dass sie endlich still sind. Mit ihren Eltern auf dem Segelboot, seit sie denken kann. Die jährlichen drei Wochen auf dem Wasser, das wiederkehrende Blau. Es war immer wie eine Auszeit von der Wirklichkeit, ein Traum. Einfach nur schön. Von Triest nach Jugoslawien, nach Griechenland, in die Türkei, nach Spanien. Wochenlang auf dem Boot, wochenlang war das Leben gut. Darauf freute sie sich. Wenn der Anker nach oben ging und der Wind in die Segel fuhr. Wenn Hagen ihr zeigte, was wichtig war, wie man steuerte, wie man überlebte im Sturm. Blum erinnert sich. An alles, was sie gelernt hat, was sie nicht gelernt hat. Die Inseln, der Wind und die Eltern, die sich sogar zu einem Lachen hinreißen ließen. Weil Urlaub war. Ihre Gesichter, die sonst verschlossen waren, öffneten sich, manchmal hatte Blum sogar das Gefühl, dass da Liebe war, kurz nur, ein kleines Aufflackern. Zwanzig Jahre lang suchte sie danach, wartete darauf, sehnte sich danach, ein ganz normales Mädchen zu sein, eine junge Frau, die mehr kann, als nur Leichen zu versorgen. Sie will endlich leben, endlich Entscheidungen treffen.
Sie wird sich nicht rühren, egal, was passiert, nicht bewegen. Da ist nur Blum, und die Sonne auf ihrer Haut. Sie ignoriert die Schreie und das Klopfen.
Zwei schwimmende Körper, verzweifelt. Man sieht sie von oben. Sie versuchen sich festzuhalten, ihre Nägel kratzen immer noch an der Bordwand entlang. Das gute alte Boot, die Leiter, die man nach oben klappen kann, die Leiter, die nicht da ist, wenn man nach ihr schreit. Hagen hat darauf bestanden, alles im Originalzustand zu belassen, keine Umbauten, keine Vorkehrungen für den Ernstfall. Macht euch nicht ins Hemd, nur Idioten vergessen die Leiter oben, sollte mir das je passieren, dann könnt ihr mich absaufen lassen. Wie selbstherrlich er war, wie kleinlaut und hilflos jetzt. Der große Hagen und seine Herta. Kein Weg zurück mehr für die beiden, sie waren einfach hineingesprungen, kopflos, zwei alte Menschen ohne Liebe. Zwei Menschen mit schwachen Herzen, atemlos, panisch. Sie schreien, sie schlucken Wasser. Seit zwei Stunden schon. Sie wollen zurück ins Boot, die Bordwand hinauf, sie versuchen alles, sie treten Wasser, sie schwimmen neben dem Boot, sie weinen, sie schreien, sie prügeln mit Fäusten auf das Holz ein, sie rufen ihren Namen. Brünhilde. Immer wieder Brünhilde. Doch Brünhilde hört sie nicht. Egal, wie laut sie schreien, wie stark ihre Finger bluten. Sie wissen, dass sie sterben werden. Hagen und Herta. Sie wissen es. Dass Blum sie hört, dass sie oben liegt und nichts tut. Nur ihre Musik hört, während das Boot dahintreibt. Sie lächelt, weil sie weiß, dass es bald zu Ende geht. Dass sie aufhören werden zu schreien, dass endlich alles gut sein wird. Warm alles, glücklich fast. Da sind nur sie und der Himmel. Sonst nichts. Endlich leben.
Über drei Stunden in der prallen Sonne. Still brennt ihre Haut. Still. Sie kann nichts mehr hören, kein Klopfen mehr. Niemanden mehr, der ihr sagt, was sie zu tun hat. Hagen und Herta für immer ohne Worte. Nichts mehr, keine Vergangenheit, kein altes Leben, in das sie zurückmuss. Blum wird jetzt steuern, sie wird das Boot zurück nach Triest bringen, sie wird umbauen, die alten Täfelungen aus dem Haus reißen, sie wird eine neue Verabschiedungshalle bauen, einen neuen Versorgungsraum, sie wird das komplette Haus sanieren, bis in den letzten Winkel. Sie wird alles, was an die beiden erinnert, auf den Müll bringen. Blum. Sie ist vierundzwanzig Jahre alt. Sie wird jetzt aufstehen, sich anziehen und die Küstenwache anfunken, sie wird verzweifelt melden, dass ihre Eltern verschwunden sind, spurlos, einfach so, während sie geschlafen hat. Sie wird einen großen Schluck aus Hagens Schnapsflasche nehmen und auf Hilfe warten. Immer wieder wird sie über Funk ihr Entsetzen spielen, sie wird schreien und weinen. Jetzt.
Vierzig Minuten vergehen. Blum sucht das Meer nach ihnen ab, während sie wartet. Keine Spur von Hagen. Von Herta. Nichts. Nur ein Unglück ist es gewesen. Sie sind einfach verschwunden, untergetaucht für immer. Wasser in ihren Lungen, zwei aufgeschwemmte Leichen irgendwann, die man aus dem Meer fischen wird.
Blum. Wie sie an Deck steht und winkt. Wie sie um Hilfe schreit, als sie das Boot sieht. Ein kleiner Segler, nicht die Küstenwache, ein Tourist, der als Erster ihre Verzweiflung spürt. Die zitternde Blum, die erzählt, was passiert ist. Der fremde Mann, der an Bord kommt und ihr hilft, der sich um sie kümmert, der das Boot absucht und seine Augen über das Meer schweifen lässt. Seine Stimme, die ihr guttut, die tröstet, seine Arme, die sich um sie legen. Einfach so, ganz plötzlich Zärtlichkeit. Seine Hände, der Sonnenbrand, ihre Haut. Ich bin eingeschlafen. Es ist meine Schuld, wir müssen sie finden. Wo sind sie, um Gottes willen, wo sind sie nur? Was habe ich nur getan, wir müssen zurück, sie suchen, sie sind nicht mehr da, sie sind weg, einfach weg. Was, wenn sie tot sind? Sie schreit. Laut reißt sie sich von ihm los, sie schlägt sich ins Gesicht, immer wieder, sie gibt sich die Schuld für das, was passiert ist. Es ist meine Schuld, brüllt sie. Als er sie festhalten will, schlägt sie auch ihn, sie weint, sie will sich losreißen, sie muss jetzt alles richtig machen. Blum. Alles, was sie jetzt sagt, alles, was sie tut, muss ihn überzeugen, er muss ihr glauben, er darf nicht zweifeln, keine Sekunde, der fremde schöne Mann. Sie lässt sich festhalten von ihm, sie ist ihm ganz nah, ihr Gesicht an seiner Brust, er hält sie, sie atmet schnell, sie kann ihn riechen, sie hört ihn. Seine Stimme, wie er flüstert. Mein Name ist Mark, sagt er. Ich bin Polizist, alles wird gut.
1
Uma springt. Der kleine Körper fliegt durch die Luft, ein großes Lachen ist in ihrem Gesicht, kleine weiße Zähne, glückliche Augen. Ein kleines Mädchen, drei Jahre alt, wie sie fröhlich landet, sich umarmen lässt, sich an sie schmiegt. Mama, ich habe von einem Bären geträumt, er hat laut geknurrt, er wollte mich fressen. Ich musste davonlaufen, Mama. Blum umarmt sie, streicht zärtlich mit ihren Fingern über den kleinen Kopf, berührt die Kinderwange und sagt ihr, dass der Bär nur mit ihr spielen wollte. Dass es nur ein Traum war. Dir wird nichts passieren, ich beschütze dich. Du musst keine Angst haben. Blum küsst Uma auf die Stirn. Uma Blum, sie ist drei Jahre alt, seit einigen Monaten spricht sie, ein Engel mit blonden Locken. Noch ein Engel. Nela ist wieder eingeschlafen, zufrieden liegt sie im Arm ihres Vaters. Im Ehebett am Morgen. Blum und Mark. Ein ganz normaler Tag.
Vor acht Jahren haben sie sich das erste Mal berührt. Auf dem Boot hat er sie umarmt. Ein wundervoller Mann, vom ersten Augenblick an, plötzlich war er da und kümmerte sich um sie. Mark wartete mit ihr, bis die Küstenwache kam, bis sie Hunderte von Fragen beantwortet hatte. Er blieb einfach da. Er schilderte den zuständigen Polizisten, wie er Blum gefunden hatte, er beteuerte, dass er keinen Zweifel an ihrer Version der Geschichte habe. Alles sprach dafür, dass sie die Wahrheit sagte. Die verbrannte Haut, die Verzweiflung, die Tränen, Blum hatte bei einem tragischen Unfall ihre Eltern verloren. Und Mark hatte sie gefunden. Ein Kriminalbeamter im Urlaub, ein Österreicher wie sie. Leidenschaftlicher Segler, alleinstehend. Alles passte zusammen, es war Schicksal, dass sie sich an diesem Tag begegneten, sie hatten einander gefunden, und sie haben einander bis heute nicht mehr losgelassen.
Ihre ineinander verflochtenen Körper, Haut an Haut, wie sie sich liebevoll berühren. Ganz nah sind sie sich, ihre Münder, die Guten Morgen flüstern, bevor sie beginnen, knurrend mit ihren Kindern herumzubalgen. Uma und Nela. Mark und Blum. Alles fühlt sich gut an, glücklich bleiben sie nebeneinander liegen und schauen zu, wie die Mädchen aus dem Bett steigen und sich auf den Weg zu ihrem Großvater machen. Ich will Kakao, Papa. Ich will Salami, Mama. Wir gehen zu Opa. Ihr seid langweilig. Blum lacht. Mark hält sie liebevoll in seinen Armen, er lässt sie nicht los, schnurrend schmiegt sie sich an ihn. Ich will für immer mit dir in diesem Bett bleiben, sagt sie. Blum genießt es. Alles. Jeden Tag, jede Stunde, ihr Leben. Seit acht Jahren tanzen seine Finger auf ihr, seit sechs Jahren sind sie verheiratet, seit fünf Jahren sind sie eine Familie, leidenschaftlich stürzten sie sich in diese Liebe. Wie ein Rausch ist es, immer noch.
– Mark?
– Ja?
– Kannst du nicht einfach zu Hause bleiben?
– Leider nein, aber ich komme ja wieder. Es ist viel los im Moment.
– Was denn?
– Das willst du nicht wissen, meine Schöne.
– Wir könnten doch einfach so tun, als wäre die Welt nicht da draußen.
– Ja, das könnten wir.
– Aber?
– Ich muss die Bösen jagen.
– Du musst nicht. Du willst.
– Und du willst mit deinen Leichen spielen, ich kenne dich. Lange würdest du es sowieso nicht aushalten hier, in zehn Minuten würdest du aufspringen und mir erklären, dass du dringend eine Versorgung machen musst, dass der alte Herr, der gestern gekommen ist, nicht mehr länger auf dich warten kann.
– Würde ich das?
– Ja, würdest du.
– Zwei Minuten noch, einverstanden?
– Auch zehn, wenn du willst.
– Weißt du, was das Schlimmste wäre?
– Was?
– Wenn du mich nicht mehr halten würdest.
– Ich werde dich immer halten, meine Blume.
– Bitte, hör nie auf damit.
Schon auf dem Boot hatte sie gespürt, dass dieser Mann sie glücklich machen würde. Wie er sie umarmt und getröstet hat, ein Fremder. Ein Kriminalbeamter, wie absurd. Er hätte sie durchschauen können, ihr die Maske herunterreißen und sie einsperren, er hätte alles beenden können, noch bevor es begonnen hatte. Doch es war anders gekommen. Blum wollte, dass die Umarmung, die da plötzlich war, nicht mehr aufhörte, sie wollte diese Arme kennenlernen, diese Hände. Sie wollte ihn haben, zum ersten Mal einen Mann, zum ersten Mal hielt sie es für möglich. Sie war bereit, ihn an sich heranzulassen, ohne Zögern, ohne Angst. Ganz nah. Mark. Er tat ihr gut, er stellte keine Fragen, er ließ sie einfach so sein, wie sie war. Und er ließ sich auch nicht abschrecken von dem, was sie machte, er hatte keine Angst vor den Toten.
Sie traf ihn wieder. Zurück im Hafen von Triest, zurück in Österreich, sie verstanden sich, ohne viele Worte fanden sie sich. Er war ein Freund, ihr Beschützer, er war da, als sie ihre Eltern beerdigte, er war da, als sie das Bestattungsinstitut umbaute, er half ihr, wo er konnte. Und irgendwann war da der erste Kuss. Es passierte einfach. Sie saßen im Kühlraum und tranken Bier, erschöpft und glücklich. Sie hatten den Versorgungsraum neu verfliest, es war Spätsommer, sie schwitzten, sie lachten, sie saßen auf Bierkisten.
– Blum?
– Ja?
– Das ist der geilste Kühlschrank, in dem ich je gesessen bin.
– Du sitzt öfters in Kühlschränken?
– Ich bin Polizist.
– Und Polizisten sitzen in Kühlschränken?
– Selbstverständlich.
– Du bist verrückt.
– Nicht mehr als du. War schließlich deine Idee, das Feierabendbier hier drin zu trinken.
– Es ist unser viertes.
– Hör auf zu zählen, Blum.
– Es stört dich tatsächlich nicht, dass hier normalerweise die Verstorbenen liegen?
– Nein.
– Ich war viel hier, als ich ein Kind war.
– Mit den Toten oder ohne sie?
– Mit.
– Türe geschlossen oder offen?
– Geschlossen.
– Warum?
– Das war mein Versteck. Hier haben sie mich nicht gesucht, ich war oft stundenlang hier. Habe einfach dagesessen und habe sie beobachtet. Wie sie tot waren.
– Etwas kalt vielleicht bei geschlossener Tür.
– Skiunterwäsche, Skianzug, Handschuhe, Mütze.
– Etwas abgedreht, aber dir glaube ich das.
– Kannst du auch.
– Du würdest mich nicht anlügen, stimmt’s?
– Wie meinst du das?
– Du bist ehrlich zu mir.
– Warum sollte ich das nicht sein?
– Ich kann dir vertrauen?
– Warum fragst du mich das?
– Weil ich dich küssen muss.
– Musst du?
– Ich kann nicht mehr anders, seit zwei Monaten will ich es tun, eigentlich wollte ich dich schon küssen, als ich dich auf dem Boot gesehen habe. Es tut mir leid, ich muss es wirklich.
– Du musst mich also küssen? Und dazu musst du mir vertrauen können?
– Wenn ich dich geküsst habe, werde ich dich heiraten wollen. Da ist es von Vorteil, wenn man sich vertraut, findest du nicht auch?
– Du kennst mich doch gar nicht.
– Doch, ich kenne dich.
– Ich habe als Kind mit Toten gespielt.
– Und ich habe Katzen in einen Sack gesteckt und ertränkt. Ich habe Feuerwerkskörper in Frösche gesteckt und zugesehen, wie sie zerrissen wurden.
– Hast du nicht.
– Doch.
– Warum?
– Ich war neugierig.
– Ich auch.
– Deshalb muss ich dich küssen.
– Und ich? Werde ich nicht gefragt?
– Auf keinen Fall.
– Warum?
– Weil du wahrscheinlich Nein sagen würdest.
– Würde ich das?
– Ja.
– Warum bist du dir da so sicher?
– Weil du seit zwei Monaten Angst davor hast.
– Habe ich das?
– Ja.
– Und jetzt?
– Nehme ich dir diese Angst.
Wie schön es war. Wie nah sich ihre Gesichter kamen, ihre Lippen. Wie sie sich trafen, weich, aufgeregt, zitternd. Vertraut und fremd und schön. Mark und Blum im Kühlraum. Wie sie sich küssten, lange und zärtlich.
Bis heute liegen ihre Münder aufeinander, bis heute ist die Angst nicht zurückgekehrt. Seit acht Jahren berühren sie sich, halten sich. Seit acht Jahren der gemeinsame Morgen, das Bett, in dem sie liegen, das Haus, das sie zum Paradies gemacht haben.
Eine Jugendstilvilla mitten in Innsbruck, ein großer Garten mit Apfelbäumen, zwei Geschosse. Als Hagen und Herta unter der Erde waren, hat Blum alles Alte aus dem Haus gerissen, das Schlafzimmer ihrer Eltern, die alte Zirbenstube, die Küche, alles. Nichts mehr blieb, nur die alten Holzböden behielt sie, in stundenlanger Arbeit schliff sie sie ab. Sie putzte und malte, Mark half ihr dabei. Er bot sich an, und sie bedankte sich. Wenn du sonst nichts Besseres zu tun hast. Wie kann ein Mensch nur so freundlich sein? Mark, du bist meine gute Fee. Hast du eigentlich keine Freundin? Er sagte stirnrunzelnd Nein, und Blum genoss es. Dass er immer wieder zu ihr kam, dass er beschlossen hatte, sich um sie zu kümmern. Dass er sie schön fand und Urlaub für sie nahm. Dass er sogar Arbeitskollegen dazu brachte, mit anzupacken, das halbe Landeskriminalamt half mit, Wände einzureißen und Schutt zu verräumen.
Das Haus der Blums wurde ausgehöhlt und neu eingerichtet, die Wände wurden bunt und die alten Geister vertrieben. Gemeinsam mit Mark wanderte sie nachts durch das ganze Haus und räucherte aus. Sie gingen von Raum zu Raum, Rauch stieg auf, der Duft von Wacholder, Zimt und Orangenschalen lag in der Luft. Egal, ob Mark daran glaubte oder nicht, er ging neben ihr, er assistierte der Hexe, er bemühte sich, das Böse zu spüren. Sie durchstreiften das Haus vom Keller bis zum Dachboden, jeder Winkel wurde mit positiven Gedanken geflutet, alles, was gewesen war, verschwand. Die Gedanken an Hagen und Herta, an den Alltag mit ihnen, Blum warf sie in den Müll. Für immer. Was übrig blieb, war ein Wohntraum, eine Oase der Ruhe mitten in Innsbruck, ein modernes Bestattungsinstitut im Schatten von Apfelbäumen, geführt von einer jungen Frau, die den Toten und den Trauernden mit Respekt begegnete. Das Unternehmen begann zu blühen. So wie Blum selbst auch.
Der Kuss im Kühlraum. Mark, der bei ihr einzog. Die Liebe, die die alte Villa plötzlich erfüllte. Alles war wie ein Traum, ein Märchen, das wahr wurde, es war wie in den Büchern, die Blum gelesen hatte, wie in den Geschichten, in die sie sich geflüchtet hatte. Es war das Glück der anderen gewesen, das sie am Leben erhalten hatte, die Sehnsucht danach. Das, woran sie nie wirklich geglaubt hatte, liegt jetzt neben ihr. Immer noch. Acht Jahre später seine Arme um ihre Hüften, sein Atem in ihrem Ohr, sein Flüstern. Alles soll so bleiben, nichts soll sich verändern. Jeden Tag sagt sie es, jeden Tag bittet sie ihn, nicht damit aufzuhören, sie zu lieben. Jeden Tag ein Kuss, bevor sie mit dem Tag beginnen. Dankbar dafür löst sie sich von ihm und springt aus dem Bett. Dankbar für den Kuss. Dankbar für die Kinder. Dass das Glück so weit gehen konnte, damit hätte Blum damals nicht eine Sekunde lang gerechnet. Dass es ihr vergönnt sein würde, kleine Menschen in die Welt zu setzen, zu lieben. Blum wollte damals nicht daran denken, sie stürzte sich in die Umarmung mit Mark. An Kinder zu denken, das hatte sie nicht gewagt. Sie hatte Angst, dass das Glück aufhören könnte, wenn sie es herausforderte, dass die Liebe über Nacht einfach nicht mehr da sein würde. Eigene Kinder zu haben, sie aufwachsen zu sehen, sie zu lieben, Blum wischte die Gedanken daran drei Jahre lang vom Tisch. Mutter zu sein, sie konnte es sich nicht vorstellen, sie hatte Angst, zu wiederholen, was sie gelernt hatte. Die Lieblosigkeit, die Kälte, sie wollte nicht herausfinden, ob sie so war wie Herta und Hagen. Immer war da diese Angst, wenn Mark davon zu reden begann, es schnürte ihr den Hals zu, ließ sie schweigen. Sie traute es sich nicht zu, lange Zeit nicht, doch irgendwann überwand sie sich. Die Sehnsucht wurde zu groß, der Wunsch nach Kindern. Zweimal passierte es. Vor fünf und vor drei Jahren, kleine Wunderwesen. Blum kümmerte sich um jede Träne, um jeden Schrei, sie sorgte sich, berührte sie, wann immer sie konnte, stundenlang trug sie sie, streichelte sie, redete ihnen gut zu. Nächtelang lag sie wach und schaute ihre Engel an, wie sie schliefen. Bis heute zweifelt sie manchmal daran, dass es wahr ist. Dass sie da sind.
2
Uma und Nela. Sie sind oben bei Karl. Marks Vater, der jeden Morgen über seiner Zeitung sitzt, wenn sie in seine Küche stürmen. Ein gütiger alter Mann, der den Kindern Kakao macht, der mit ihnen lacht und bastelt, ihr Opa, der sie liebt und alles für sie tun würde. Uma auf seinem Arm, Nela löffelt Kakao in eine pinke Tasse. Karl erzählt ihnen Geschichten zum Frühstück, er ist ein Segen für alle im Haus. Mark und Blum haben ihn zu sich genommen vor zwei Jahren, eine Zecke hatte ihn gebissen, eine Gehirnhautentzündung war schuld an der Frühpension, daran, dass er sich verändert hatte. Dass er auf Hilfe angewiesen war in manchen Situationen. Hilfe, nach der er niemals verlangen würde, über die er aber froh ist. Es gibt Dinge, die er vergisst, an die er sich nicht mehr erinnert, Alltägliches, das ihm schwerfällt. Mark wollte ihn nicht alleine in seiner kleinen Wohnung lassen, deshalb schlug Blum vor, den ungenutzten zweiten Stock des Hauses umzubauen. Karl sollte bei ihnen wohnen, Blum wusste, wie wichtig er für Mark war. Karl war lange Zeit alles für ihn, Marks Mutter war früh gestorben, da war immer nur Karl gewesen, seit er denken konnte. Wenn er aufwachte, wenn er schlafen ging, immer nur Karl. Sohn und Vater, Alleinerzieher, zwei Männer am Frühstückstisch, väterliche Worte, wenn es die Zeit zuließ. Sie hielten zusammen, so gut es ging. Mark war viel allein gewesen, oft tagelang, Nächte. Ein kleiner Junge allein unter der Bettdecke, ein kleiner Junge, der immer darauf vertraute, dass sein Vater zurückkam. Dass ihm nichts passieren würde, dass das Band zwischen ihm und seinem Vater stärker war als alles sonst. Mark war allein, er trieb sich herum, er war wie ein streunender Hund, doch er war glücklich. So glücklich es ging. Weil Karl sich bemühte. Immer. Auch vor zwanzig Jahren in der Küche, Mark war fünfzehn, er hat Blum davon erzählt, von seinem Leben ohne Mutter, von diesen Gesprächen zwischen Vater und Sohn, die sich so oft wiederholten, von Karl, der mit seinem Feierabendbier am Küchentisch saß, während Mark das Geschirr abspülte.
– Weißt du schon, was du machen willst, Mark? Nach der Schule?
– Ich will zur Polizei. Wie du. Zur Kripo.
– Ach, Junge, du weißt ja nicht, was du da redest.
– Doch, ich weiß es.
– Dieser Beruf ist nicht immer nur schön.
– Welcher Beruf ist das schon.
– Wir haben heute eine junge Mutter in ihrer Wohnung gefunden, sie hatte ihr Baby so lange geschüttelt, bis es tot war. Ihre Schwester hatte sie gefunden und uns angerufen. Die Mutter saß am Boden und hat das Baby gehalten, sie hat geweint, als ihr die Sanitäter das Kind aus den Armen nahmen. Sie hat gesagt, dass das Kind nicht aufgehört hat zu schreien. Sie wollte nur, dass es still ist.
– Wir haben kein Spülmittel mehr.
– Hast du mich verstanden, Mark?
– So ist das Leben, Papa.
– Nein, so ist es nicht, so ist es nur für Leute wie mich, für diejenigen, die sich dafür entscheiden, damit ihr Geld zu verdienen. Du musst das nicht sehen, solche Dinge, du kannst dem aus dem Weg gehen.
– Will ich aber nicht.
– Du solltest studieren, Mark, die ganze Welt steht dir offen, zur Polizei kannst du immer noch gehen.
– Ich will es aber so.
– Warum?
– Wenn es gut für dich ist, dann ist es auch gut für mich.
– Deine Mutter hätte bestimmt gewollt, dass du studierst, Wirtschaft oder Medizin.
– Meine Mutter ist aber nicht mehr da.
– Ich weiß.
– Du musst dir keine Sorgen um mich machen.
– Es tut mir alles so leid, Mark.
– Was?
– Alles.
– Du hast alles richtig gemacht, alles, verstehst du, und jetzt trink dein Bier und hör endlich auf, dir Sorgen zu machen.
Karl. Zwanzig Jahre später erzählt er den Kindern Geschichten. Uma und Nela lieben ihn, seinen Bart, an dem sie ihre Kinderhaut reiben, seine Stimme, seine Arme, die sie in die Luft werfen, sein Lachen. Karls Leben ist einfach geworden, keine Verbrechen mehr, keine Toten, nur noch die Kinder und sein Ohrensessel, in dem er die Tage verbringt. Wie er stundenlang Musik hört, auf der Terrasse sein Gesicht in der Sonne, immer ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Karl. Wie Mark immer wieder nach dem alten Mann sieht, ihn zudeckt, wenn er eingeschlafen ist in seinem Sessel. Die Kinder lieben ihn, es steht in ihren Gesichtern, wenn sie von oben herunterkommen und berichten, was Opa ihnen alles erzählt hat.
Alles, was früher war, ist vergessen. Das Leben vor Mark. Alles, was ist, will sie für immer festhalten. Blum, mit einem Lächeln am Frühstückstisch. Wie Mark seine Kaffeetasse hält und ihr zusieht. Wie sie Butterbrote schmiert, wie sie den Kindern erklärt, dass die Bienen den Honig machen, dass sie nicht trödeln sollen, dass sie in den Kindergarten müssen. Wie ungeduldig sie ist und trotzdem liebevoll, wie sie die Kinder antreibt und trotzdem noch einmal fragt, ob sie noch ein Brot wollen. Wie die Kinder kauen und schmatzen, wie sie den Honig überall auf dem Tisch verteilen, während Blum sich noch kurz mit Mark unterhält, bevor er in den Tag geht.
– Wann kommst du wieder?
– Spät.
– Schwierige Dinge?
– Ja.
– Welche?
– Das willst du nicht wissen, Blum.
– Vielleicht ja doch.
– Die Welt ist schlecht, es reicht, wenn ich mich damit herumschlagen muss.
– Du willst es so.
– Ich kann nicht anders.
– Mein Held, mein Retter, das gute Gewissen der Stadt.
– Etwas Eigenartiges passiert hier.
– Du meinst den Honig?
– Ja, ich meine den Honig.
– Willst du darüber reden?
– Nein.
– Du weißt, dass du das kannst, ich bin einiges gewohnt.
– Ja. Trotzdem nein, ich muss zuerst Gewissheit haben. Im Moment bin ich allein damit, ich bin der Einzige, der ein Verbrechen sieht, wo keines ist.
– Vertrau auf dein Gefühl.
– Das ist ja das Problem, genau das tue ich nämlich.
– Du wirst die Bösen kriegen, du wirst sie hinter Gitter bringen und für Gerechtigkeit sorgen. Und ich werde mich um den alten Mann kümmern.
– Wie ist er gestorben?
– Das willst du nicht wissen.
– Vielleicht ja doch.
– Du bist so süß, wenn du lachst.
– Ach du.
Keine Wut, kein Ärger, keine Traurigkeit, nichts. Es ist nur schön, nichts tut weh, keine Kunden nerven, die Kinder sind pflegeleicht an diesem Morgen. Nichts bereitet ihr Sorgen, es ist ein guter Tag, Blum genießt es, dieses unbeschwerte Gefühl, das Glück, wenn sie ihn anschaut. Mark. Seine Mundwinkel, die nach oben zeigen, die Ruhe, die von ihm ausgeht, die Kraft. Sie fühlt sich beschützt und geborgen, Mark ist Heimat, er ist einfach da, er geht nicht weg. Egal wie laut sie schreit, egal ob sie sich gehen lässt und wütet, egal ob sie manchmal am Leben zweifelt und Angst hat. Mark liegt neben ihr, wenn sie aufwacht. Sie spürt ihn, immer. Mark.
Blum weiß, dass ihn etwas plagt, dass er sich Sorgen macht. Es nagt an ihm, lautlos und heimlich, aber Blum merkt es. Sosehr er sich auch bemüht, seinen Polizeialltag am Eingangstor abzustreifen, es gelingt ihm nicht immer. Blum sieht, wie seine Gedanken rasen, wie er nicht loslassen kann, wie seine Aufmerksamkeit ihr und den Kindern gegenüber immer wieder nachlässt. Mark und seine Leidenschaft für diesen Beruf. Der Kriminalbeamte. Wie er schwärmt, wenn man ihn fragt, was er macht. Dass es keinen schöneren Beruf gibt für ihn auf dieser Welt, dass nichts ihn davon abbringen kann weiterzumachen, weiter an das Gute zu glauben. Er liebt, was er tut, er glaubt daran, und er ist auch bereit, den gewohnten Weg manchmal zu verlassen, um sein Ziel zu erreichen. Mark glaubt an sein Gefühl, er spürt mehr, als er denkt, Logik ist nicht immer seine Sache, er handelt aus dem Bauch heraus, folgt einem Geruch, einem Wort, einem Eindruck. Er glaubt an Intuition, und er glaubt an alles, was ihm sein Vater beigebracht hat, an die vielen Kleinigkeiten, die er über die Jahre beobachtet hat, die Einschätzungen seines Vaters beim Bier am Abend. Die stundenlangen Gespräche über ungelöste Fälle. Noch bevor er sich tatsächlich dazu entschieden hatte, Polizist zu werden. Karl war sein Lehrer, er brachte ihm bei, menschlich zu sein. Was er als Sechzehnjähriger belächelte, beherzigt er bis heute. Manchmal musst du Entscheidungen treffen, Mark. Völlig egal, was die anderen sagen, du wirst das tun, was dir dein Herz sagt. Keine Gewalt, keine Übergriffe. Wenn einer am Boden liegt, trete nicht auf ihn ein. Du bist einer von den Guten. Vergiss das nie. Karl machte aus Mark einen Polizisten. Einen der besten. Einen, der auch einmal Gnade vor Recht ergehen lässt. Mark bemüht sich, immer nach dem Grund eines Verbrechens zu fragen, er will verstehen, wie es dazu gekommen ist, warum jemand straffällig geworden ist. Warum jemand riskiert, geächtet und eingesperrt zu werden. Warum jemand bereit ist, mit einem Vorschlaghammer auf einen Geldautomaten einzuschlagen. Jemand wie Reza.
3
Es war vor sechs Jahren. Reza wollte doch nur das Geld, ein bisschen davon, nur so viel, dass er überleben würde, er wollte sich Essen kaufen, er hatte Hunger. Reza hatte die Überwachungskamera an der Fassade mit einem Stein außer Gefecht gesetzt, die Kamera am Automaten hatte er mit Klebeband verdeckt. Als Mark kam, schlug er gerade zum wiederholten Mal auf den Automaten ein. Mit voller Wucht, dorthin, wo das Geld war, immer wieder. Reza bemerkte nicht, wie Mark auf ihn zustürmte. Mark drückte ihn nach hinten, es war wie im Krieg, ein Soldat am Boden, verletzt, am Ende angekommen, der Feind über ihm, mit einer Waffe in der Hand. Mark, wie er auf Reza zielte, wie er ihn zwang, sich auf den Bauch zu legen, aufzugeben.
Reza ist Bosnier. Seit sechs Jahren arbeitet er nun als Bestatter. Ist Blums Gehilfe, ihre rechte Hand. Er hatte alles verloren im Krieg, seine Brüder, seine Eltern, sein Haus. Alles war verbrannt, nichts mehr war übrig. Dass er überlebt hatte, war wie ein Wunder, er hatte sich versteckt, hatte zugesehen, wie die Serben schlachteten. Von einem Tag auf den anderen musste er lernen, was Krieg bedeutete, wie brutal das Leben sein konnte, der Tod, wie blutig, wie laut. Nichts blieb ihm, niemand, der für ihn da war, sich um ihn kümmerte, Reza war allein, ohne Dach über dem Kopf, ohne Geld, da war nichts mehr. Nur Blut und Krieg und Töten. Wie oft er einfach zugeschlagen hat. Wie einfach es war. Er hat Menschen getötet. Im Krieg, um zu überleben, noch bevor er achtzehn war. Die Erinnerungen kamen zurück, die halbe Nacht lang erzählte Reza, er breitete sein Leben vor ihnen aus. Mark und Blum hörten ihm zu, mit offenen Mündern folgten sie ihm, es waren unglaubliche Geschichten von einem Kind mit einem Gewehr in der Hand.
Mark war auf dem Heimweg gewesen. Dass er den Mann mit dem Hammer überhaupt gesehen hatte, war Zufall. Ein kleiner Blick nach rechts veränderte alles. Rezas Leben drehte sich plötzlich. Womit er gerechnet hatte, traf nicht ein, alles kam anders. Anstatt im Gefängnis zu landen, brachte ihn Mark in die Villa. Anstatt getreten und gedemütigt zu werden, bekam er Essen und ein Dach über dem Kopf. Niemand hatte sie gesehen. Keine Kameras, keine Passanten, nichts war gestohlen worden, es blieb nur ein Sachschaden. Mark entschied einfach, er spürte es, wusste es. Der Mann am Boden war keine Gefahr, ihn einzusperren und zu bestrafen war keine Lösung. Und deshalb nahm er ihn mit nach Hause. Sie nahmen den obdachlosen Bosnier bei sich auf. Vorübergehend. Dass er Jahre bleiben würde, ahnte damals niemand. Blum kochte Hühnersuppe, sie saßen am Küchentisch und hörten ihm zu. Danke, sagte er immer wieder. Danke. Blum zögerte keinen Augenblick. Mark hatte beschlossen, ihm zu helfen, und sie unterstützte ihn dabei. Dass sie zu dieser Zeit nach einem neuen Mitarbeiter suchte, war wahrscheinlich ebenso Schicksal wie der Umstand, dass Reza keine Angst vor dem Tod hatte. Sterben war für ihn lange Zeit Alltag gewesen, die Leichen am Versorgungstisch machten ihm keine Angst. Alles fügte sich, sie bauten die Werkstatt im Souterrain zur Wohnung um, Reza war angekommen.
Er steht im Garten und putzt den Leichenwagen. Seit sechs Jahren ist er Blum treu ergeben, Reza ist ein Gewinn für alle. Die Kunden, auch Karl und die Kinder mögen ihn. Für Uma und Nela war Reza immer schon da, der Mann mit dem Akzent gehört zur Familie, er wirft sie in die Luft im Sommer, er fängt sie auf und lächelt. Reza. Sorgfältig poliert er den Wagen. Mark steigt auf sein Motorrad, Karl wird die Kinder in den Hort bringen, und Blum wird sich mit Reza endlich um den alten Mann im Kühlraum kümmern.
Blum ist neugierig, sie hat den Leichnam noch nicht gesehen, sie weiß nur, dass es ein Kopfschuss war, Selbstmord. Ein vierundachtzigjähriger Mann, der nicht mehr leben wollte, der alles mit einer Kugel beendet hat. Reza und ein Kollege vom Fahrdienst haben ihn gestern von der Gerichtsmedizin abgeholt, die Neugier ist groß, Blum will wissen, wie sein Kopf aussieht, wie groß das Loch ist, das die Kugel in den Kopf geschlagen hat. Nur noch ein kleiner Kuss trennt sie von ihrem nächsten Abenteuer, ein Kuss für Mark. Ich liebe dich, sagt er noch. Dann fährt er los.
Wie Blum ihm nachschaut. Wie alles seinen gewohnten Lauf nimmt, wie der Motor schnurrt, wie ihr Geliebter in den Tag fährt. Zwanzig Meter durch die Einfahrt, Mark blinkt, einmal dreht er sich noch kurz zu Blum und Reza um, dann gibt er Gas. Blum will gerade zurück ins Haus gehen, da hört sie den Knall.
Sie sieht es, einen Rover, ein großes schwarzes Auto, zuerst kann sie nicht einordnen, was da passiert, sie begreift es nicht. Das Auto. Mark. Wie er einfach verschwindet, wie der große Wagen ihn wegschiebt, ihn umwirft. Wie er fällt. Wie er ihn einfach überrollt. Wie Reza zu laufen beginnt. Blum hinter ihm. Wie Mark unter dem Auto verschwindet, wie laut das Metall ist, wie das Motorrad mitgeschleift wird. Mark. Wie er überrollt wird. Wie eine Puppe dreht sich sein Körper, wie Spielzeug fliegt er durch die Luft. Vor ihren Augen. Wie sie zu ihm hinrennt, wie sie ihm helfen will, wie Reza sie zurückhalten will. Und das Auto, wie es einfach wegfährt. Schnell und für immer. Keine Hilfe, kein Bedauern, kein Entsetzen. Nur ein Wagen von hinten, wie er davonfährt. Ein Unfall, ein kaputtes Motorrad auf dem Asphalt. Ein lebloser Körper. Wie er daliegt, sich nicht rührt. Da ist kein Laut. Da ist nichts mehr. Alles, was laut war, ist jetzt wieder still. Fast ist es so, als wäre nichts geschehen. Ein schöner Tag beginnt, die Sonne scheint. Mark liegt in ihren Armen. Blum schreit.
Lange und laut. Minutenlang ihre Stimme auf der Straße. Ihr Flehen, ihr Bitten, ihr Mund, wie er auf- und zugeht. Ihr Oberkörper, der vorwippt, zurückwippt, Marks Kopf in ihrem Schoß, überall ist Blut. Überall sind Tränen, sie rinnen heraus aus ihren Augen, über ihre Wangen nach unten, sie fallen tief, sie berühren ihn, sie wollen, dass er sich bewegt, dass er atmet, etwas sagt. Mark. Den Helm hat sie ihm abgenommen, sie hält sein Gesicht in ihren Händen, sie schaut ihn an, schaut in seine leeren Augen, sie brüllt, sie wimmert, immer wieder streicht sie ihm mit der Handfläche über seine Haare. Alles ist voller Blut, alles ist kaputt, nichts mehr ist ganz. Nichts mehr.
Reza ruft die Rettung an, die Polizei. Wie ein aufgescheuchtes Tier läuft er im Kreis, er weiß nicht, was er tun soll, wie er helfen kann, ausweglos alles. Starrende Nachbarn, entsetzte Gesichter, niemand kann helfen. Keiner kann ihn zurückholen, niemand. Vor fünf Minuten noch war alles gut, vor fünf Minuten war da noch Leben. Jetzt ist da nur noch der Tod. Ganz nah, mit Wucht hat er alles umgerissen, es niedergewalzt. Blum weiß, dass es kein Zurück mehr gibt. Dass er sie nie wieder berühren wird, dass seine Finger schweigen werden, seine Hände, sein Mund. Sie weiß es. Tausendmal hat sie es gesehen, das Leben, das einfach nicht mehr da ist. Nur noch ein Körper, Haut, die kalt wird. Es ist vorbei. Für immer. Keine Gespräche mehr, kein Lachen, niemand mehr, der sie beschützt, der auf sie aufpasst. Mark kommt nicht mehr zurück. Nie wieder. Blum weiß es, sie spürt es, fühlt es. Wie es ihr Herz zerreißt, wie alles in ihr zerschnitten wird. Wie sie immer weiter schreit. Weil der Schmerz von Sekunde zu Sekunde größer wird.
Blum und Mark. Mitten auf der Straße. Das Motorrad liegt fünfzig Meter weiter vorne. Blum hört die Kinder, auch sie schreien, sie weinen, Blum sieht, wie Karl und Reza sie festhalten. Sie wollen zu ihrem Vater, sie wollen zu Blum, sie hören ihre Mutter. Wie verzweifelt sie ist. Wie laut der Schmerz ist. Weil alles in ihr nur noch kalt ist und tot, weil es plötzlich dunkel wird. Dunkel und kalt. Alles. Wie leer alles plötzlich ist. Wie Polizisten aus den Wagen steigen und Sanitäter sie von ihm wegziehen. Blum. Wie ihre Finger ihn ein letztes Mal berühren. Mark. Wie er daliegt und die Spritze in ihren Arm kommt. Wie sie sie festhalten, sie zu Boden drücken, wie sie schreit. Bis es plötzlich warm wird. Bis das Licht ausgeht.
4
Sechsunddreißig Stunden hat sie geschlafen. Immer wieder war sie kurz wach geworden, immer wieder hat sie mit Gewalt ihre Augen zugemacht, sie wollte nicht zurück ins Licht, sie wollte die Wirklichkeit nicht, nichts spüren, nichts sehen, nicht akzeptieren, dass es wirklich passiert ist. Nichts davon. Sie wollte nur schlafen, wieder abtauchen in diesen Nebel, der alles erträglich macht. Blum dreht sich hin und her und schläft wieder ein. Nie wieder möchte sie aufwachen. Sie will sich betäuben, tagelang, Wochen. Erst als Uma und Nela zu ihr ins Bett kriechen und sie streicheln, kommt sie zurück.
Die kleinen Hände auf ihrer Wange, sie spürt die Angst und die Verzweiflung in den kleinen Fingern. Sie hört die tröstenden Worte ihrer Kinder, sie bemühen sich, stark zu sein, sie wollen ihre Mutter zurück, sie wollen, dass sie aufsteht und weiterlebt. Mama, du darfst nicht tot sein. Bitte steh auf, Mama. Du musst die Augen aufmachen, Mama. Bitte. Nela. Sie will in den Arm genommen werden, sie will, dass Blum ihre Tränen auffängt, sie will hören, dass alles gut ist. Die beiden Zauberwesen verstehen nicht, warum ihr Papa nicht mehr da ist. Warum er voller Blut war. Warum sie ihn weggebracht haben. Sie wollen nicht, dass ihre Welt untergeht, dass sie in Gefahr ist, sie wollen Sicherheit, sie wollen sich an ihre Mutter schmiegen, in sie hineinkriechen, sich verstecken in ihr, geborgen sein. Sie wollen so tun, als wäre alles wie immer. Als wäre Mark noch da. Neben ihnen. Atmend, lächelnd. Mama, du musst jetzt aufstehen. Du musst, bitte. Opa hört nicht auf zu weinen. Wir brauchen dich, Mama. Wie die Worte tief in Blum ankommen. Durch die Ohren in ihren Körper, überall hin. In jedem Winkel sind sie, die Hilferufe ihrer Kinder, ihre Angst. Wie diese Worte Blum aus dem Schlaf reißen, ihr plötzlich Kraft geben, sie keinen Augenblick lang mehr stillliegen lassen. Keine Sekunde mehr. Mit aller Kraft richtet sie sich auf und lebt wieder. Ich bin nicht tot, sagt sie.
– Meine Große, wir schaffen das.
– Was, Mama? Was schaffen wir?
– Kommt her zu mir, ihr beiden.
– Was ist mit Papa, Mama? Ich will, dass er wiederkommt.
– Papa kommt nicht wieder.
– Warum nicht?
– Du weißt doch, Nela, Papa ist ein Prinz.
– Na und?
– Prinzen reiten durch die Wälder und kämpfen gegen Drachen.
– Es gibt keine Drachen, Mama.
– Doch, Nela. Es gibt Drachen, und dein Papa hat sich aufgemacht, um gegen diese Drachen zu kämpfen. Euer Papa ist ein sehr tapferer Prinz.
– Warum war da überall Blut, Mama?
– Das war Drachenblut. Der Drache hat euren Papa verletzt, aber jetzt geht es ihm wieder gut. Jetzt reitet er wieder auf seinem weißen Pferd durch den Wald.
– Du schwindelst, Mama.
– Stell es dir einfach vor, Nela, wie er reitet und lächelt.
– Papa hat kein Pferd, er hat nur ein Motorrad. Und das Motorrad ist kaputt. Es lag auf der Straße. Genau wie Papa.
– Eurem Papa geht es gut.
– Papa ist tot.
– Nein.
– Doch, Mama. Papa ist jetzt auch eine Leiche.
– Sei still.
– Sie haben ihn eben gebracht.
– Was redest du da?
– Papa liegt unten im Kühlschrank.
Blum springt auf. Was Nela sagt, ist wie kaltes Wasser. Eiskaltes Wasser, in das sie fällt, in dem sie beinahe untergeht, in dem ihr Herz fast stillsteht, weil es so wehtut, weil alles plötzlich wieder da ist. Weil die Vorstellung, dass die Kinder ihren toten Vater gesehen haben, wie ein Schlag ist. Das darf nicht sein. Nicht so. Nicht, bevor sie sich um ihn gekümmert hat. Sie muss aufstehen, sie muss klar denken, sie muss sich um alles kümmern, das sinkende Schiff wieder auf Kurs bringen. Wo ist Karl? Reza? Warum tut alles so weh?
Mark. Innerlich schreit sie, weint sie, fleht sie. Komm zurück, bitte. Ich brauche dich. Ich kann das nicht ohne dich. Ich kann nicht. Die Kinder. Wie soll ich das machen ohne dich? Ich weiß es nicht. Bitte, Mark. Schau sie dir an. Wie klein sie sind. Wie sie sich an mich klammern. Ich kann das nicht, Mark. Ohne dich kann ich das nicht. Und trotzdem zieht sie sich an und geht mit den Kindern in die Küche. Trotzdem öffnet sie den Kühlschrank und macht etwas zu essen. Trotzdem tut sie so, als hätte sie wieder alles unter Kontrolle. Egal wie laut es in ihr ist, egal ob alles zusammenbricht in ihr, jedes Stück Haut schreit, jeder Zentimeter Fleisch. Alles tut weh, so als würde sie zerrissen werden, in tausend Stücke, alles von ihr. Sie löst sich auf, jeder Handgriff tut weh, jede Bewegung, alles. Trotzdem streicht sie Butter auf das Toastbrot, sie versucht sogar zu lächeln, den Kindern die Angst zu nehmen. Sie darf jetzt nicht weinen. Wie sehr sie es auch will, sie darf es nicht. Verzweifelt sein. Nie wieder aufstehen, einfach liegen bleiben. Reglos, wie tot.
Nebeneinander sitzen sie am Esstisch. Die Kinder kauen, Blum schaut ihnen zu. Alles wird gut, sagt sie und weiß, dass es nicht wahr ist. Nichts wird wieder gut. Nie wieder. Alles, was gut war, liegt jetzt in einem Kühlraum im Erdgeschoss. Seine Hände, sein Lachen. Er wird den Kindern nie wieder vorlesen, nie wieder mit ihnen balgen, kein Feuer mehr machen mit ihnen im Garten. Keine gemeinsamen Lieder mehr, kein gemeinsames Abendessen, keine Ausflüge, kein Urlaub am Meer. Zusammen auf dem Boot. Wie er den Kindern die Schwimmwesten anlegte, wie glücklich sie waren. Blum sieht sie vor sich. Vor einem Monat an den schönsten Stränden Kroatiens. Sie liefen ins Wasser, er warf sie in die Luft, sie waren so glücklich, nichts bedrohte ihre kleine Welt, Mama und Papa waren da, wenn sie einschliefen, sie saßen draußen an Deck und tranken Wein. Da waren ihre Stimmen, da war ihr Kichern, da war dieses große Vertrauen, dass kein Sturm dieser Welt dieses Boot zum Kentern bringen kann. Da war Liebe. Alles war gut. Nachts am Meer.
– Willst du noch mehr?
– Viel mehr.
– Mein liebes Fräulein, Sie sollten seetüchtig bleiben.
– Ich bin im Urlaub.
– Du bist betrunken, meine Blume.
– Und? Spricht irgendetwas dagegen?
– Nein.
– Eben.
– Es ist zu befürchten, dass du heute noch über mich herfällst.
– Ja, das ist zu befürchten, dauert aber noch ein bisschen. Ungefähr eine halbe Flasche noch.
– Trink schnell, meine Schöne.
– Keine Eile, mein Guter.
– Mach schnell, die Sterne gehen gleich unter.
– Tun sie nicht.
– Doch.
– Dann sollte ich wirklich schneller trinken.
– Wir sollten keine Zeit mehr verlieren.
– Sie fallen einfach vom Himmel oder wie?
– Ja, sie fallen alle ins Meer, einfach so. Von oben nach unten, sie tauchen ein und verschwinden. Einer nach dem anderen. Bis der Himmel leer ist.
– Das will ich sehen.
– Das ist wunderschön, Blum.
– Du bist das.
– Was?
– Wunderschön. Mein Mann. Du.
– Mhmm.
– Alles ist schön hier.
– Hast du nicht irgendwann genug davon? Du segelst seit fünfundzwanzig Jahren in diesem Wasser.
– Das ist Heimat.
– Heimat?
– Hier war ich immer glücklich.
– Bis auf den Tag, als ich dich gefunden habe.
– Wie meinst du das?
– Es war alles sehr traurig damals.
– Müssen wir jetzt darüber reden?
– Tut mir leid. Vergiss es einfach, Blum.
– Wenn das so leicht wäre.
– Ich kann dich küssen.
– Hilft das?
– Unbedingt.
– Das Glück hat eigentlich an diesem Tag erst begonnen. Als du auf das Boot kamst. Alles vorher war nur der Sommer. Es gab nur eine Jahreszeit, nicht vier. Keinen Herbst, keinen Winter, keinen Frühling. Es waren nur ein paar Wochen im Sommer.
– Schön.
– Was?
– Du. Alles, was du sagst. Du bist wie ein Gedicht.
– Ich bin betrunken, vergiss das nicht.
– Du bist wie ein schöner Satz.
– Ein Satz?
– Ein wunderschöner Satz. Einer, der dich berauscht, der dich verzaubert, einer, der dich nicht mehr loslässt. Ein Satz, den man spürt. Kein Wort zu viel, einfach und klar.
– Zum Beispiel?
– Der Himmel hat sich langsam gedreht.
– Was hat er?
– Der Himmel hat sich langsam gedreht.
– Verrückter Kerl.
– Wunderschön, oder?
– Mark, mein lieber Mark, du mein romantischer Bulle du. Zuerst fallen die Sterne vom Himmel, und dann dreht sich auch noch der Himmel.
– Genau so ist es. Und das alles nur für dich.
– Lass dich küssen, mein Geliebter.
Mark und Blum. Irgendwo vor Zadar. Nackt an Deck, nackt ineinander, das Meer spiegelglatt und still. Das Meer war Heimat. Und jetzt hat es plötzlich aufgehört. Plötzlich ist es ausgelöscht, ist da kein Rauschen mehr, kein Blau. Mark wird es nie wieder sehen. Da sind nur noch das Kauen der Kinder, die traurigen Augen und die Stille in der Küche. Wie Blum sich erinnern will, mit Gewalt holt sie die Bilder zurück in ihren Kopf, sie will die Wirklichkeit nicht, sie will zurück ins Gestern, zurück auf das Boot, zurück zu seiner warmen Haut. Sie will es. Sie kann es nicht. Sie muss ihre Kinder umarmen, sie muss mit ihnen spielen, ihnen vorlesen, sie muss sich um sie kümmern. Bis die kleinen Augen zufallen, bis die Nacht sie rettet. Dann wird sie zu ihm gehen. Dann erst, nicht jetzt.
5
Wie er daliegt. Sein kaputter Körper. Verletzte Haut. Sie haben ihn aufgeschnitten und wieder zugenäht, sie haben ihm den Kopf aufgemacht, sie haben sein Blut untersucht, seine Organe, sie wollten wissen, ob er nüchtern war, ob er unter Drogen stand, sie wollten ausschließen, dass es seine Schuld war. Nachdem sie zusammengebrochen war, hatte man ihn in die Gerichtsmedizin gebracht, man wollte keinen Fehler machen. Ob bei Fahrerflucht mit Todesfolge obduziert werden sollte, oblag den ermittelnden Behörden und dem Staatsanwalt. Und der hatte entschieden. Dass sein Schädel zerschnitten wurde, dass sein Gehirn entnommen wurde, dass sein Brustkorb geöffnet wurde wie eine Einkaufstüte, dass er wieder zusammengenäht wurde. Sie haben noch mehr kaputt gemacht, noch mehr Wunden in ihn hineingeschnitten. Mark. Seine Hände, sein Mund. Wie er daliegt.