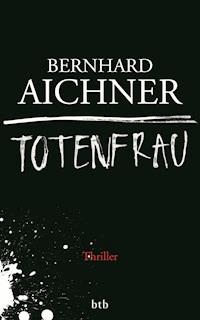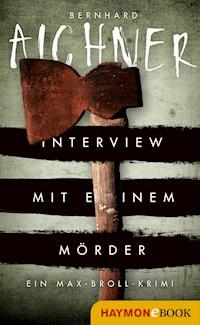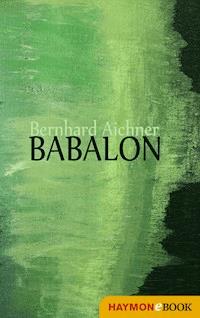Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tag für Tag sitzt Ruben in seinem Sessel und starrt aus dem Fenster. Tag für Tag sieht er den Geldtransporter, der vor der Bank gegenüber hält. Eines Tages steht er auf, geht über die Straße, nimmt einen der unbewachten Geldkoffer und macht sich davon - auf in ein neues Leben. Auf seiner Flucht durch die Nacht gerät er in einen Unfall mitten in einem Tunnel. Während draußen der Schnee fällt und die Straßen gesperrt werden, sind im Tunnel fünf Menschen von der Außenwelt abgeschlossen. Jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte, jeder sein dunkles Geheimnis - ein tödliches Drama nimmt seinen Lauf. In seinem Roman Schnee kommt inszeniert Bernhard Aichner ein packendes Kammerspiel menschlicher Abgründe - virtuos komponiert, temporeich und bis zur letzten Seite fesselnd.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Bernhard Aichner
Schnee kommt
Roman
HAYMON
für meine wunderbare fraudanke und liebe
VALENTIN
Sie lag im warmen Wasser.
Ihre Augen weit geöffnet, zu einem Schrei auseinandergerissen, reglos trieb sie in der Wanne, kleine, unscheinbare Wellen auf der toten Haut. Ihr Kopf untergetaucht, die Haare wild durcheinander, das einzige, das sich noch bewegte.
Valentins Frau war tot.
Er saß neben der Badewanne mit dem Rücken zu ihr, er hielt sich die Hände vor sein Gesicht, tat sie nicht weg, für Stunden. Hinter ihm schwamm sie, unten bei den Füßen der Fernseher, leblos. Den Wannenrand entlang bog sich das schwarze Kabel, es berührte Valentins nassen Arm, friedlich jetzt.
Verzweifelt hatte er sie hochgezogen, sie geschüttelt, versucht, ihren Körper aus dem Wasser zu reißen, sie wieder wach zu machen, mit Händen, mit Schreien, Tränen. Dann hatte er sie losgelassen, sie war seinem Körper entlang nach unten gerutscht. Er war über ihr gestanden und hatte geschrien, er hatte auf die Wand eingeschlagen, laut, immer wieder seine Hand auf den karierten Fliesen. Unten ihre Haut im Wasser, leblos. Er war aus der Wanne gestiegen, hatte sich nicht mehr umgedreht.
Sie lag im Wasser.
Er tat die Hände vor sein Gesicht.
Hinter ihm seine Braut. Er konnte sich nicht umdrehen, er konnte es nicht, denn dann würde es für immer sein, wenn er sich umdrehte, würde sie tot sein, sich nicht mehr bewegen, nur noch daliegen mit diesen aufgerissenen Augen, nichts mehr sagen, ihn nicht mehr berühren, ihre Hand nicht mehr nach ihm ausstrecken. Nichts mehr.
Er spürte sie, drehte sich nicht um. Er weinte. Bis das Wasser kalt war, und noch länger, tagelang, Wochen. Als sie lange schon unter der Erde war, setzte er sich immer noch vor die Wanne, jeden Tag für Stunden die Hände vor seinem Gesicht. Immer an derselben Stelle saß er, spürte sie, wie sie hinter ihm lag, tot war. Sie war seine Liebe, für sie wäre er gestorben, alles hätte er getan für sie, heiraten wollten sie, das weiße Kleid hing im Schrank. Sie hatte ihn geliebt, sie war gut zu ihm gewesen, mit ihr wollte er leben.
Dann fiel der Fernseher in die Wanne und sie war tot.
Er war nicht da gewesen, unterwegs, ihr war kalt, sie wollte baden, ihre Lieblingsserie lief. Sie nahm das Gerät mit ins Bad, stellte es auf den Waschbeckenrand, sie wollte sich etwas Gutes tun, herrlich, das Wasser auf der Haut, der schöne Arzt mit dem Hund auf dem Bildschirm, wohlig, warm, Grey’s Anatomy, Izzie, George, wie sie sich betrunken umarmten. Alles war schön, doch der Fernseher hätte nicht da sein sollen, nicht im Bad, nicht auf dem Waschbecken, nicht dort. Valentin stolperte, er wollte sie küssen, wollte sich zu ihr beugen, riss den Fernseher mit sich, den Arzt und seine Assistentin, Alex, Cristina, alle fielen ins Wasser, waren tot, still.
Er wollte sie doch nur küssen, Valentin, er hatte die elektrischen Leitungen erneuern wollen, seit Monaten, er wollte sich darum kümmern, er wollte sie begrüßen, sie umarmen, sie streckte sich nach ihm aus. Er hatte das alte Haus sicher machen wollen, Schutzschalter, damit nichts passierte, er wollte ihre Lippen auf seinen spüren, ihr nicht wehtun, sie begrüßen nach einer langen Fahrt, sie berühren. Sie nur küssen.
Er kam nicht mehr dazu.
Ihr Körper zuckte wild vor ihm. Der Fernseher schlug im Wasser ein, bevor sein Mund auf ihrem ankam, ihr Lachen wurde zu einer Fratze. Wie sie zuckte. Wie er sich nicht rühren konnte, nicht begriff, was passiert war. Wenige Sekunden nur, dann lag ihr Arm still im Wasser, ihre Hand sagte nichts mehr.
Komm zu mir. Küss mich. Nichts.
Er packte sie. Er riss sie nach oben, er zerrte an ihr, nahm sie, umarmte sie, drückte sie an seine Brust, schrie sie an, er hielt ihren weichen Körper, sie hörte ihn nicht. Sie blieb, wo sie war. Draußen stand der Lkw, der Motor war noch warm, er tat die Hände vor sein Gesicht, weinte.
Jetzt wieder, Monate danach, immer noch.
Es hatte zu schneien begonnen. Valentin dachte an sie, er erinnerte sich an alles, an ihr Gesicht im Wasser, die Haare, ihre Hände. Er sah sie vor sich. Der Schnee kam zu früh in diesem Jahr. Er fuhr im Lkw die Passstraße hinauf, seit sieben Monaten war sie tot.
Die Flocken legten sich langsam nieder, verschwanden, neue kamen, sie tauchten ein in die schwarze Straße, bis sie entschieden zu bleiben, sich übereinanderlegten, dicht aneinanderdrängten. Wie die Fahrbahnränder langsam weiß wurden. Wie er sich an ihre Haut erinnerte, wie sie ihm einfiel, als er den Schnee sah. Wie ihre Haut weiß war hinter ihm, wie alles aufhörte plötzlich, auseinanderfiel. Mit jedem Gedanken zurück. Unerträglich. Was er getan hatte. Wie er den Berg hinauffuhr und sie ihn nicht losließ. Wie ihr Mund zuckte vor seinem, wie sie für immer aufhörte zu reden.
Wie die Flocken durch die Luft flogen, so unbeschwert schienen sie, wie sie vor ihm herumtanzten, wie er sie mit seinem Lkw überrollte, kaputt machte, weil ihm etwas wie Glück unerträglich geworden war.
Dann der Tunnel.
Valentin bekam ihr Bild nicht mehr aus seinem Kopf, ihre weiße Haut, der Schnee. Wie alles zu rutschen begann, wie er das Lenkrad hin- und herriss, wie ihm alles entglitt, wie er alles verlor, wie sie an seinem Körper entlang nach unten rutschte, zurück in die Wanne. Wie die Schneeflocken auf die Windschutzscheibe knallten, wie sie überall waren plötzlich, überall die weiße Haut seiner Frau, die toten Brüste, ihre Augen, der Schnee auf der Straße. Der Tunnel.
Er hatte die Hände vor seinem Gesicht.
DIETER
Immer dasselbe Spiel.
Wenn es gelb wäre, würde er gehen, er würde einfach gehen, seine Sachen packen, sie nicht wieder sehen, es würde ihm egal sein, ob sie leidet, ob sie ihn verflucht, er würde sie verlassen, wenn es gelb wäre.
Er glaubte daran. An seine Entscheidung.
Dieter saß in seiner Kabine und umschlang mit vier Fingern seinen Daumen. Er hoffte, er wollte, dass sich etwas veränderte, er schaute ins Dunkel. Ein Auto, das aus dem Schwarz kam, nur zwei Lichtkegel zuerst durch die Schneeflocken hindurch, dann kam es näher, noch näher, dann sah man seine Farbe, es war grün.
Er würde nicht weggehen, er würde bei ihr bleiben. Sie war der einzige Mensch, den er hatte, der mit ihm leben wollte, da war sonst niemand. Er musste sich zufriedengeben mit ihr, egal, wie sehr er es hasste, sie wegwünschte von sich, er hasste sie, er liebte sie, er brauchte sie, egal, ob ihm schlecht wurde, wenn sie ihn berührte, wenn sie mit ihrer Hand über seinen Kopf strich, ihm Kosenamen zuwarf, ihn tätschelte wie ein Pferd. Er würde sie weiterhin ertragen, er brauchte sie. Kein gelbes Auto. Er würde bei ihr bleiben. Das Auto hatte entschieden. So waren die Regeln.
Nachts eine Straße über die Berge, ein Tunnel, neun Kilometer lang, eine Mautstation, eine kleine Kabine, sein Zuhause. Alles hier war altmodisch, heruntergekommen, die Strecke wurde nicht mehr viel befahren, Renovierung lohnte sich nicht, irgendwann würde man alles stilllegen, keine Autos mehr durch diesen Berg schicken. Die Arbeit warf gerade genug ab, dass er davon leben konnte, er und der Mann auf der anderen Seite des Tunnels, beide in kleinen Kabinen aus Plexiglas.
Dieter arbeitete hier. Er war Mautner, er war einunddreißig Jahre alt, und er wünschte sich etwas anderes. Nacht für Nacht spielte er. Auto für Auto.
Aber nichts geschah, alles blieb, wie es war. Es schneite. Er schaute hinaus und wartete auf das nächste Auto.
Pink. Und er würde kündigen. Wenn das nächste Auto pink wäre.
Aber es gab keine pinken Autos auf dieser Straße. In zwei Jahren kein einziges. Trotzdem pink. Er wollte es wissen, er würde in die Stadt ziehen, diesen Job kündigen und endlich Musik machen, seine Musik. Egal, wie unmöglich es war. Pink. Mit seinen Gitarren in den Norden. Pink. Egal wohin, egal, wie schwierig es sein würde, was auf ihn zukommen würde, egal was. Nur weg von ihr. Von seiner Kabine. Diesem Tunnel.
Pink. Dieter presste seine Finger aneinander.
Die zwei Lichtkegel kamen auf ihn zu, alles könnte sich verändern, alle Farben waren möglich, es kam unter den Scheinwerfer vor der Mautstelle, er war sich sicher, es gab pinke Autos zwischen diesen Bergen, alles war möglich in dieser Nacht. Es kam näher. Dieter presste seine Lippen zusammen. Er sah es. Ein Audi. Nicht pink. Nur blau. Tief atmete er ein und aus.
Ein Schwarzer am Steuer, daneben eine Frau.
Dieter presste Luft zwischen seinen Lippen nach außen, der Schwarze streckte seine Kreditkarte aus dem Auto, sprach nicht, schaute feindselig, er schien wütend. Dieter gab ihm die Quittung.
Falsche Farbe, dachte er, falsches Auto, falsche Welt, alles falsch. Wie immer.
Er war enttäuscht, er war erleichtert, beides, er überlegte, er war sich nicht mehr sicher, er wollte nichts riskieren, er spürte, dass etwas Besonderes war in dieser Nacht, er entschied sich für Orange. Wenn es orange wäre, würde er gehen. Orange ist häufiger als pink, flüsterte er vor sich hin.
In dieser Nacht würde er Glück haben.
Der Schwarze schrie die Frau an, die neben ihm saß, Dieter hörte ihn, während die Scheibe nach oben ging, dann verschwand das Auto im Tunnel. Stille. Er dachte an Köln, dorthin wollte er, nächtelang träumte er, suchte nach Gründen zu gehen, nach Entscheidungen, die jemand für ihn treffen sollte.
Orange, dachte er. Große Entscheidungen brauchen besondere Farben. Und alles wieder von vorne. Das nächste Auto würde über seine Zukunft entscheiden. Jede Nacht dasselbe Spiel. Dieter führte Listen, erstellte Statistiken, machte kleine Kreuze in kleine Spalten. Am häufigsten kam Rot. Aber diesmal sollte es Orange sein. Etwas sollte passieren, sich verändern. Jetzt.
Es kam unter den Scheinwerfer. Und es war rot.
Dieter machte ein Kreuz in eine Spalte und rieb sich die Hände. Nichts veränderte sich, er träumte weiter von Köln, er suchte sich neue schrille Farben, die ihn festhielten, die alles so ließen, wie es war.
Es war Nacht. Er putzte sich die Nase, es war kalt draußen, Schnee fiel vom Himmel. Der Winter kam zu früh in diesem Jahr. Das rote Auto hielt neben seiner Kabine, die Scheibe ging nach unten. Wieder ein Paar. Dahinter gleich der nächste Wagen. Er war gelb. Zwei Autos zu spät. Sein Herz pochte, er hatte Glück gehabt, er war dankbar, dass er sich nichts gedacht hatte in dieser Runde, dass er sich nicht noch einmal für Gelb entschieden hatte. Dass alles so blieb, sein Leben, wie es war. Er brauchte sie doch, was sollte er ohne sie, sie schaute auf ihn, sie war da für ihn. Weggehen von ihr. Das konnte er nicht. Dieter dachte an Türkis, an Braun, an die unmöglichsten Farben.
Das rote Auto neben ihm. Das Fenster, wie es nach unten ging, seine Gedanken an die Wohnung, in der er mit ihr lebte, ihre Fürsorge, wie sie über seine Haare strich mit ihrer alten Hand, ihre Ratschläge, ihre Ängste, das rote Auto und die Stimme, die plötzlich in seine Kabine kam, dieser Mann, dieses Gesicht, wie es aus dem roten Auto schaute, entstellt, abstoßend.
Gedankenverloren starrte er ihn an, er konnte sich nicht abwenden, starrte ihn einfach an, zwei Sekunden, drei, eine Ewigkeit, seine Augen blieben kleben an diesem Gesicht. Er wollte das nicht, er konnte nicht anders.
So etwas hatte er noch nicht gesehen. Hässlich, durchfuhr es ihn, angsteinflößend, der Fahrer. Ein Paar in einem roten Auto. Wie sie ihn anlächelte, wie sein Gesicht ihn ekelte, wie er ihm die Quittung gab, wie er sich nicht abwenden konnte, starrte.
Alles Lüge, dachte er. Die machen sich etwas vor. Wie kann sie ihn lieben, wenn er so aussieht, mit ihm zusammen sein. Er schüttelte den Kopf, versuchte zu verstehen, was er eben gesehen hatte, dieses Gesicht, die schöne Frau am Beifahrersitz, wie sie ihn angelacht hatte. Der Wagen fuhr in den Tunnel, das Bild blieb in seinem Kopf. Kurz schaute er dem Auto nach, nahm das Geld des nächsten Fahrers, grüßte nicht, sagte nichts, schaute nur, gab ihm das Restgeld.
Die Autos verschwanden im Tunnel.
Es wurde wieder still in seiner Welt. Nur das Neonlicht in seiner Kabine, das leise Surren. Er warf dieses Bild aus seinem Kopf, er versuchte es, er zerrte es nach außen, spuckte es aus. Es war still in seiner Kabine.
Er musste sich um die Farben kümmern, das nächste Auto würde kommen, er musste eine Farbe wählen, überlegen. Dieses Gesicht, fremde Menschen, die an ihm vorbeifuhren, jede Nacht die flüchtigen Blicke in andere Leben, kleine Eindrücke, die nicht lange blieben. Sein Alltag, seine Kabine, die Autos, alles, was er hatte.
Dieter rieb sein Gesicht.
Eben war noch Sommer gewesen. Er beobachtete die Schneeflocken, die auf der Straße landeten, sie tanzten im Scheinwerferlicht, dichtes Schneetreiben plötzlich, große, kalte Flocken. Wie sie vor ihm aus dem Nichts auftauchten, aus dem Schwarz herausfielen. Wie sie die Straße langsam weiß machten.
Es war warm in seiner Kabine.
Du bist hier zuhause, sagte er sich, du kannst hier nicht weg, du gehörst hierher, dein schöner Sessel, mach dir nichts vor, dein kleines Radio, es ist warm hier. Was willst du noch, deine Kabine, deine Straße, deine Schneeflocken. Du bleibst, wo du bist, bis morgen früh, und am Abend kommst du wieder, fünf Nächte in der Woche, das ist dein Leben. Und Ende.
Kein normales Leben, sagte seine Mutter.
Was ist schon normal, sagte Dieter.
Er hasste sie dafür, er wollte weg von ihr, er konnte nicht gehen, konnte sie nicht alleine lassen, er wollte kein Kind mehr sein, ihr Kind, sich nicht mehr bemuttern lassen, nicht mehr für sie da sein, für ihre Fürsorge, nicht mehr mit ihr sein jeden Tag. Er wollte weg von ihr.
Doch kein Auto kam, nur Flocken.
Die Fahrbahn wurde weiß, alles war still, nur das Surren der Neonröhren. Er öffnete das Fenster und hörte zu, wie sie fielen, lautlos fast, nur ein leises, dumpfes Geräusch, wenn sie im Weiß eintauchten. Kaum hörbar, wie Bewegungen in Watte. Flocken, die ankamen mitten in der Nacht. Nur er und der Schnee. Schnee in seinem Vorgarten, dachte er, Passanten in Autos. Da und wieder weg. Nur diese Flocken im Scheinwerferlicht, wie sie durch die Luft wirbelten, so viele, unkontrolliert, unzählbar.
Schön, dachte er. Wie die Landschaft Winter wird.
Dieter steckte seinen Kopf durch das kleine Fenster. Er schloss die Augen, spürte die Flocken im Gesicht, das Schmelzen auf seiner Haut, er hörte nichts außer dem Schnee, er öffnete den Mund und fing sie mit seiner Zunge, er bewegte sie hin und her, hob und senkte seinen Kopf. Wie sie ihn kalt berührten. Flocken, so groß wie Briefmarken. Mitten in der Nacht auf seiner Zunge.
Plötzlich das Motorengeräusch in seinem Vorgarten.
Wie es schnell näher kam. Dann der Knall. Wie der Lkw umkippte hinter der Wand aus Schnee, wie Blech und Eisen auf ihn zukamen, wie Tonnen über den schneebedeckten Asphalt rutschten. Zuerst nur der Lärm, so nah, unsichtbar, gleich bei ihm, mitten in seinem Garten. Wie er den Schnee auf seiner Zunge verschluckte, hinhörte. Er bewegte sich nicht.
Alles ging so schnell, sein Mund war geschlossen, die Flocken auf seinen Haaren, den Wangen, auf den Lippen, das Geräusch noch lauter, sein Blick geradeaus in den Schnee.
Er riss den Kopf zurück, hinein in seine Kabine, er sah ihn, plötzlich war er da, Funken flogen zwischen den Flocken, Eisen auf Asphalt war laut, einfach umgekippt, viel zu schnell. Er kam auf ihn zu.
Alles veränderte sich.
Dieter sprang aus der Kabine. Er lief, drehte sich nicht um, lief, sprang. Der Lkw schlitterte über den Asphalt. Sein Zuhause wurde aus der Verankerung gerissen. Er warf sich in den Straßengraben, blieb liegen, drehte sich um, sah, wie der Lkw sein Leben verschluckte, es einfach wegschob, es zwischen sich und der Tunnelwand zerquetschte, seine kleine Kabine, alles, was er hatte. Ohrenbetäubender Lärm, ein Knall, lauter als alles vorher in seinem Leben.
Dieter schloss die Augen, schützte seinen Kopf mit seinen Händen und Armen. Dann war es wieder still. Totenstill.
So wie sonst auch. Nur die Schneeflocken waren laut.
SUZA
Sie war leer.
Keine Kraft mehr, keine Lust auf das, was sie tat, kein Verständnis, in jeder Minute der Gedanke an Flucht, Abscheu in ihr. Und Leere. Sie konnte nicht mehr. Überall blinde Menschen.
Warum verschwenden sie Geld für Dekoration, dachte sie, für Licht, für Kostüme, wozu. Es war dunkel in dieser Halle, für all diese Menschen war es einfach nur dunkel. Nichts, nur Geräusche, Gerüche, eine Rede irgendwo vorne, kein Licht, weiß gedeckte Tische, Rosenschmuck, blaue Tischkärtchen in Blindenschrift.
Wozu? Sie machte Erinnerungsfotos, drückte immer wieder auf den Auslöser, sie fragte sich wofür, aber sie drückte. Sie war müde, sie konnte diese blinden Menschen nicht mehr ertragen, sie wollte etwas anderes um sich, keine weißen Stöckchen mehr, kein Klappern, tipp, tipp, tipp. Immer Mitleid im Raum, immer etwas im Weg, immer nur Dunkel um sie herum.
Achthundert Blinde waren auf diesem Kongress in Malmö, sieben davon hatte sie hergebracht. Seit vier Jahren die Arbeit im Blindenverband, seit vier Jahren diese Gedanken, wie es wohl ist, dieses Leben im Dunkel. Suza war fasziniert gewesen am Anfang, neugierig, voller Bewunderung für diese Menschen, sie wollte alles wissen, verband sich selbst die Augen, um zu erfahren, wie es sich anfühlte, sie löcherte die Blinden mit Fragen, sie wollte verstehen, wie es möglich war, dass sie trotzdem lachten.
Ich könnte das nicht, hatte sie immer wieder gesagt. Nichts mehr sehen.
Ich kann das nicht mehr, hat sie zu dem Schwarzen an der Hotelbar in Malmö gesagt.
Was, hat er gefragt.
Es ertragen, dass sie mich nicht sehen, hat sie geantwortet.
Er hat lautlos genickt und sie war ihm dankbar für dieses Nicken.
Er war nicht wegen des Kongresses in der Stadt, er war Kunsthändler, etwas in der Art, hatte er gesagt, nichts Konkretes, hatte sie gedacht, aber interessant. Endlich etwas anderes zwischen all der Blindheit. Sie genoss es, ihn kennenzulernen, es war ihr egal, dass er schwarz war. Er war schön und er starrte sie an mit gierigen Augen. Nach sehr langer Zeit spürte sie wieder Blicke auf sich, auf ihrer Haut, ihren Brüsten, überall waren sie.
Ihre Blinden hatten sich bereits schlafen gelegt, sie hatte sich beim Lift von ihnen verabschiedet, ihnen noch die tägliche Portion Honig um ihre blinden Mäuler geschmiert und ihnen die Zunge herausgestreckt. Anschließend hatte sie sich an die Bar gesetzt.
Sie sehen nichts, egal, wie hässlich die Fratze ist, die ich ihnen schneide.
Aber sie spüren es, hatte einmal eine Freundin gesagt, sie merken es, wenn man unehrlich zu ihnen ist, wenn man sich über sie lustig macht, wenn man sie verspottet.
Schwachsinn, hatte Suza erwidert. Nichts haben sie gespürt.
Sie saß an der Bar und trank. Neben ihr Maurice mit großen schwarzen Händen und diesen Augen, die zwei Stunden später alles sahen, was Suza war, jeden Zentimeter Haut, wiederauferstehende Leidenschaft. Sie hat ihn mit auf ihr Zimmer genommen, hat sich verführen lassen von ihm, hat sich ihm hingegeben.
Lass deine Augen offen, hat sie geflüstert, immer wieder, dann hat sie ihn angeschrien, ihn an seinen Haaren gezogen.
Schau mich an, schrie sie. Schau mich an.
Sie wollte nicht, dass er aufhörte, sie zu sehen. Der Blinde im Nachbarzimmer hörte ihr Stöhnen, drehte sich hin und her, er schlief lange nicht ein. Maurice schaute Suza an. Er machte sie glücklich in dieser Nacht.
Später erinnerte sie sich daran, wie zärtlich er damals gewesen war, ohne viel zu wollen, hatte er sie begehrt, verwöhnt, sie schön gefunden, mit allem, was sie war. Er war anders gewesen damals. Er hatte sich um sie bemüht, sie zum Lachen gebracht. Er hatte versucht, mit ihr einen Weg aus ihrer blinden Welt zu finden, Ideen gesponnen, wie sie etwas anderes machen könnte, sie unterstützt, sie ernst genommen mit allem, was sie sich wünschte. Er hatte versucht, Wege zu finden, neue für sie zu bauen. Dazwischen hatten sie sich geliebt.
Suza war glücklich gewesen und Maurice hatte begonnen, ihr Leben zu verändern. Nach und nach war aus Susanne Suza geworden.
Klingt wie ein Kunstwerk, hatte er gesagt.
Sie hatte gelächelt und sich in seinen Armen versteckt. Sie war fasziniert gewesen von ihm, von dieser Frechheit, mit der er der Welt begegnete, von dieser unbeschwerten Art. Maurice hatte sie gepackt, sie mitgerissen, und sie hatte alles zugelassen, genossen. Eine Zeit lang war alles zitronengelb. Eine Zeit lang.
Wie anders er jetzt war. Mitten in der Nacht durch die Berge mit ihm. Nichts mehr von dem Begehren, nichts Leichtes, unerträglich die Tage.
Er war wie ein Ausweg gewesen am Anfang, eine Türe, die aufgeht, die einen an einen anderen Ort bringt, weit weg, in ein anderes Leben. Einfach aufstoßen, hineingehen, leben, war auf dem Bild neben der Tür gestanden.
Jetzt waren alle Eingänge zu. Sie war unglücklich mit diesem neuen Leben, die Tür ging nicht mehr auf, ein großer, schwarzer Mann stand davor und brüllte sie an, er berührte sie nicht mehr, benutzte sie nur, dieses Leben machte keinen Spaß mehr.
Es geht nicht um Spaß, schrie er und nahm die Quittung.
Suza fühlte sich unwohl, sie wollte weg, wollte nicht bei ihm sein, neben ihm in diesem Auto sitzen, mit ihm in diesen Tunnel einfahren, mit ihm ein Leben verbringen, nichts davon.
Der junge Mann in der Kabine schaute teilnahmslos zu Suza, dann zu Maurice, dann wieder geradeaus. Maurice kurbelte die Scheibe nach oben und brüllte. Suza saß still neben ihm. Wütend, aber still. Sie wollten in die nächste Stadt, eine Ausstellungseröffnung, er hatte alles organisiert. Suzas Augen folgten den Schneeflocken. Maurice spürte ihre Veränderung, bedrohlich, er war aggressiv, er wollte das nicht, nichts davon, er gab Gas.
Blinde wissen nicht, wie das ist, sagte sie, wenn Flocken fallen.
Suza wusste es.
Hör endlich auf zu jammern, schrie Maurice. Du kannst jetzt nicht aufhören.
Er schaute sie an, lächelte.
Suza drehte sich zu ihm hin.
Ich kann, sagte sie.
Sein Mund verschluckte das Lächeln, das für sie gedacht gewesen war. Er hätte sie erschlagen wollen für diesen Satz, für alles, was sie ihm antat, was sie bereit war kaputtzumachen.
Sie war ruhig. Er schrie, fluchte, es war ihr egal. Sie würde jetzt damit aufhören, von ihm weggehen. Sie hörte ihn schreien, sie zitterte, sie blickte ihn nicht an, schaute geradeaus, in die Schneeflocken. Egal was er tun würde mit ihr. Sie war sich sicher, sie hatte sich entschieden. Alles würde gut werden. Sie wusste das.
Sie fuhren in den Tunnel.
MELIH & DINA
Sie stand mitten auf der Straße.
Die Hände wild fuchtelnd in der Luft rief sie etwas, sie hüpfte auf und ab, ging nicht zur Seite, blieb einfach stehen zwischen den Schneeflocken. Sie wollte mitgenommen werden, sie wollte in dieses Auto, sie wollte nicht länger frieren, keine Minute länger allein sein.
Bleib stehen, flüsterte Dina dreimal hintereinander.
Was soll das, sagte Melih. Was will sie, sie soll verschwinden, weg mit ihr, weg.
Nicht so laut, flüsterte Dina, er wacht sonst auf.
Melih bremste. Weit und breit war nichts, nur Landstraße, kein Auto, nur diese Frau, sonst nichts. Er hasste diese Nacht, er hasste den Schnee, er hasste diese Frau auf der Straße, er hasste alles, sein Leben, den Fensterheber, Dina, den Rückspiegel, alles. Nichts war gut, leicht. Nichts wie es sein sollte.
Die Fremde hieß Claudia.
Aufgeregt stürzte sie auf das Auto zu, steckte den Kopf durch das Beifahrerfenster und redete los.
– Nehmen Sie mich mit, bitte, er hat mich hier aus dem Auto geworfen, mir ist kalt, nehmen Sie mich mit, lassen Sie mich einsteigen, er hat mich ausgesetzt wie einen Hund, einfach ausgesetzt, nur bis in die Stadt. Mir ist kalt. Wie einen Hund ausgesetzt.
Melih unterbrach sie schnell, unfreundlich, er wollte, dass sie still war, Aktan nicht weckte.
– Beruhigen Sie sich. Hören Sie auf damit, warten Sie. Sprechen Sie leiser. Unser Sohn, er wacht sonst auf. Was glauben Sie eigentlich, was fällt Ihnen ein?
– Dieses Schwein, Sie müssen mich mitnehmen. Mir ist kalt. Bitte. Ich kann nicht länger hierbleiben, ich habe nur dieses Kleid, keine Hose, keinen Pullover, ich will in Ihr Auto. Jetzt.
Dina wollte diese Frau zum Schweigen bringen, sie schaute ihr in die Augen, schüttelte den Kopf, sie deutete auf den Rücksitz, auf das schlafende Kind, sie fuchtelte mit den Händen, legte die Finger auf ihren Mund, deutete, riss die Augen auf, zischte. Aber Claudia hörte nicht auf, ihr Kopf war bereits im Wagen, mit Gewalt wollte sie auch den Rest von sich durch das Fenster ins Warme zwängen.
Ihre Stimme war verzweifelt, laut, sie fror, sie duldete kein Nein. Melih schaute zu Dina, sie löste den Sicherheitsgurt und stieg aus. Claudia atmete auf, rieb sich die Hände, hüpfte auf und ab, wärmte sich.
– Setzen Sie sich nach vorne, ich gehe nach hinten zu Aktan.
Melih war wütend. Alles passierte einfach, keiner fragte ihn.
– Dina, was machst du? Lass das, sie soll bleiben, wo sie ist. Dina, bleib sitzen.
– Sei still, Melih.
Er verfluchte diese Frau, alles, was passierte, die Nacht, den Tag, alles war falsch. Dina atmete tief durch und gab ihren Platz frei, sie wollte verhindern, dass Aktan aufwachte, dass sein Schreien diese Nacht füllte, der schlafende Junge auf der Rückbank.
Claudia lief um das Auto herum, packte Dina, drückte sie an sich, umarmte sie.
Danke, sagte sie, um vieles leiser als vorher. Danke in Dinas Ohr.
Dina verdrehte die Augen und stieg hinten in den Wagen. Melih fuhr los.
Von Minute zu Minute wurde sein Leben komplizierter, alles war so schwer, er wusste nicht mehr, was er tun sollte, er wollte mit Dina reden, aber es war so schwer, es war unmöglich, und das machte ihn kaputt. Jede Minute mehr. Und jetzt diese Frau. Er schaute nach rechts, plötzlich ein Kleid, frierende Haut. Nur eine Sekunde blieb sein Blick auf ihr liegen, dann wieder zurück auf die Straße, zurück zu Dina, im Rückspiegel seine Frau. Eine Sekunde nur der Blick auf den Schenkel neben sich, fremde Haut und der kurze Gedanke, einfach zu gehen, stehen zu bleiben, auszusteigen, zurückzugehen, wo er hergekommen war, sie alleinzulassen mit dem Kind, einfach wegzulaufen, weil alles so schwer geworden war.
Er schaute seine Frau an im Rückspiegel, sie nickte nur, zog die Brauen nach oben und rollte die Augen. Sie tat das oft. Er beschwerte sich, sie verteidigte sich. Immer dasselbe Gespräch, in Varianten.
Frau und Mann. Melih und Dina.
– Wie du mit den Augen rollst.
– Lass mich doch. So bin ich.
– Muss das sein?
– Das mache ich immer schon.
– Das stimmt doch nicht. Und außerdem ist das noch lange kein Grund, nicht damit aufzuhören.
– Lass doch meine Augen aus dem Spiel, warum tust du das, worum geht es denn in Wirklichkeit? Sag es mir. Komm schon, rede.
– Wieso? Was? Was soll ich? Hör doch auf.
Dinas Stimme wurde weicher.
– Irgendetwas ist doch mit dir.
– Was denn? Was, Dina? Du bist so negativ! Was soll denn sein? So verdammt negativ! Deshalb rollst du auch mit deinen Augen, du bist streitsüchtig.
Er schaute sie nicht an, blickte auf den Boden oder an ihr vorbei, er ahnte, dass sie mehr wusste, als sie sagte, immer wieder diese Andeutungen. Sie machte ihm Angst.
– Es ist nichts, verdammt. Lass mich doch einfach.
– Irgendetwas ist. Ich kenne dich. Du verbirgst etwas.
– Was?
Dina schwieg. Melih entschied sich, sie anzugreifen, um das Schlimmste abzuwenden.
– Warum tust du das? Ich will das nicht mehr. Kannst du nicht endlich damit aufhören? Du bist widerlich!
Er rollte mit den Augen, machte sie nach, übertrieb.
– Ich bin unglücklich.
Dina schaute ihn an, sagte sonst nichts, stellte nur diesen kleinen Satz in den Raum, ließ ihn allein damit, schwieg.
– Du hast doch alles.
Dina schwieg. Melih schwieg. Es dauerte lange, bis einer von beiden wieder zu sprechen begann, sie überlegten, tanzten vorsichtig um den anderen herum, wollten keinen Fehler machen, nichts verlieren. Dann wieder Melih.
– Jetzt hör doch bitte auf, ich kann das nicht mehr hören. Immer dasselbe Gejammer: Du bist unglücklich, dein Türke redet nicht mit dir, und wieder, du bist unzufrieden, du bist unglücklich, und so weiter, immer dasselbe Lied. Ich mache alles falsch, ich habe mich verändert, ich bin nicht sensibel genug, ich verschweige dir etwas. Scheißdreck, Dina. Lass es. Bitte. Du hast dein Haus, du hast alles, was du wolltest. Was willst du denn noch von mir?
– Dich.
Wieder schwiegen beide.
– Du hast mich doch. Was willst du denn? Du bist so unzufrieden, bekommst einfach deinen Hals nicht voll. Steigerst dich da irgendwo hinein. Ich habe doch alles für dich getan. Ich halte das nicht mehr aus.
– Du belügst mich.
Immer waren diese Gespräche so. Seit Monaten. Immer Vorwürfe, immer Ausflüchte, gegeneinander, nicht mit. Dina trieb ihn in die Ecke, Melih bekam kaum noch Luft. Sie setzte ihn unter Druck. Er konnte nicht mehr, er musste mit ihr reden, heute, in dieser Nacht.
Dina saß hinten und schwieg, ihr Kind schlief, die Fremde vorne flüsterte. Dinas Lippen pressten sich aufeinander, ihre Augenlider. Kampfstellung, sagte Melih immer, aber in Wirklichkeit versuchte sie ihre Tränen unten zu halten, sie in Schach zu halten. Sie verstand nicht, warum er sie nicht bei sich sein ließ, warum er nicht mehr redete mit ihr, es ihr nicht sagte. Von Woche zu Woche verschloss er sich mehr, die Liebe verbarg sich, ging unter, tauchte nur noch selten auf, Sorgen waren in seinem Gesicht, immer wenn sie ihn anschaute. Er versteckte sich vor ihr.
Die Fremde vorne redete. Sie wollte höflich sein, fragte, erzählte.
Melih bewegte immer wieder den Kopf. Nur Ja und Nein, kein Laut, kein Gespräch, nichts Freundliches, nur widerwillig sein Kopf, wie er sich bewegte, seine Mundwinkel unten. Claudia spürte die Spannung im Wagen, sie schaute hinaus, rieb sich die Hände, nahm sich zurück, versuchte nicht nachzudenken, sie starrte in den Schnee, spürte, wie langsam alles wieder warm wurde in ihr.
Melih lenkte das Auto durch den Schnee, er dachte an die Türkei, an dieses Leben vor Dina. Wie gerne er mit ihr zusammen war, wie schön es sein konnte, wie schwer alles geworden war. Dass es aufhören musste, dass er etwas unternehmen musste. Dass er ihr die Wahrheit sagen musste.
Die Anhalterin war still jetzt. Dina im Rückspiegel. Ihre Augen waren wieder geöffnet, auf ihm, in ihn hinein.
Rede mit mir, sagten sie. Ihre Augen, alles in ihrem Gesicht.
Es war still, keiner sagte etwas. Zehn Minuten lang hörte man nichts, keinen Laut, nur das Geräusch des Motors, das der Reifen, die durch Matsch, über Schnee fuhren.
Dann wachte Aktan auf.
Claudia hatte geniest, laut. Aktan begann zu schreien. Er brüllte los, hörte nicht auf. Dina versuchte ihn zu beruhigen, aber nichts half, nichts konnte ihn besänftigen. Melih schaute immer wieder zurück, er betete, dass die Stille wieder zurückkommen würde, er rutschte nervös auf seinem Sitz hin und her, er hätte alles getan, damit er wieder einschlief. Doch Aktan schrie.
Melih fuhr. Aktan schrie. Dinas Augen rollten wild. Claudia machte sich klein und starrte hinaus in den Schnee.
RUBEN
Er fuhr durch die Nacht.
Manche Dinge verändern dein Leben, hatte seine Großmutter gesagt, manche Dinge, die dir keine Wahl mehr lassen.
Sie war neunundachtzig gewesen damals, sie hatte Ruben am Arm genommen, ihn festgehalten und ihm die Welt erklärt, liebevoll, eindringlich.
Du wirst einfach in eine andere Richtung geschleudert, manchmal offensichtlich, manchmal merkst du es kaum. Aber es passiert.
Das ist dann wohl Schicksal, hatte Ruben mit einem Lachen geantwortet, auch wenn er nicht daran geglaubt hatte.
Sie hatte ihm die Wange getätschelt und gesagt, er würde schon noch sehen, das Schicksal treffe alle, da könne sich keiner heraushalten.
Großmuttergeschichten, hatte er gedacht.
Es kommt, wie es kommt, hatte sie gesagt.
Ruben erinnerte sich an sie, an die Gespräche mit ihr, an die Dinge, die sie wusste und mit ihm teilte, er erinnerte sich, wie sich alles veränderte, an das Seebad, an alles, was danach war. Er schaltete den Scheibenwischer ein. Der Schnee machte ihm Angst, es waren nur Sommerreifen am Wagen, es war dunkel, er war lange nicht gefahren. Dunkel. Wie seine Welt zu Ende war plötzlich.
Er fuhr über die Bergstraße, er wollte weg, weit weg, wollte an nichts mehr denken, was gewesen war, doch es kam immer wieder, ging nicht weg, blieb in seinem Kopf. Scheinwerfer auf der Gegenfahrbahn, wie sie aus dem Schwarz kamen, zwischen den Flocken herausstachen, auf ihn zu. Die Gedanken daran, jedes Detail, immer wieder fiel es ihm ein, das kalte Wasser im See, ihre warme Haut in der Umkleidekabine.
Er fuhr durch die verschneiten Berge. Der Schnee. Wie alles dunkel war. Wie es passiert war, wie alles aufgehört hatte plötzlich.
Er war Schauspieler damals, bald fünfzig, geschieden, er hatte noch einmal die Liebe gefunden, Lisbeth.
Wunderschön, jung, nur wenig älter als seine beiden Kinder, wie gut sie ihm tat. Wie er sie auszog im Seebad. Es war Sommer. Er liebte sie, das Leben meinte es gut mit ihm, er genoss sie, ihren Körper, ihr Lachen, jedes Wort von ihr, jeden Blick. Lisbeth war alles für ihn.
Sie küssten sich in der Umkleidekabine am Steg, sie hatten Lust, wollten nicht warten, waren gierig, ungeduldig. Er hatte ihr gerade das Bikinioberteil ausgezogen, ihre Haut in den Mund genommen, als das Gebäude einstürzte. Die Sonne schien, alles hätte gut sein können, aber der Steg, die Kabinen, das Café über ihnen, alles brach zusammen, tauchte mit ihnen ein in den See.
Ihre kleinen Brüste wurden von Holzbalken und Metallgeländern nach unten gedrückt. Ruben versuchte sie zu halten, doch sie war zu weit von ihm, er wurde noch tiefer nach unten gerissen. Weit weg von ihr.
Lisbeth wurde gerettet, nach oben gezogen. Zwischen den vielen Beinen an der Wasseroberfläche sah er noch einmal, wie schön sie war, wie sie immer kleiner wurde, wie sie verschwand. Ruben sank tiefer. Nur noch Holz und Seegras, wie es kalt wurde, wie der Balken, der ihn beinahe erschlagen hatte, mit ihm nach unten schwebte. Tiefer, kälter. Es wurde immer dunkler. Grünes Seegras. Schwarzes Seegras.
Alles war wieder da. Nach mehr als einem Jahr kamen die Bilder zurück in seinen Kopf. Wie er unterging, das Bewusstsein verlor. Wie er wieder aufwachte nach Monaten und Lisbeth suchte, sie nicht fand.
Das Schneetreiben wurde dichter, er fuhr langsam. Der Scheibenwischer mitten in der Nacht. Der alte Saab. Gutes Auto, dachte Ruben.
Er fuhr durch die Nacht. Rubens Blick immer wieder im Rückspiegel, immer wieder suchten seine Augen die Straße ab. Niemand folgte ihm.
Da war nur Schnee, nichts sonst.
CLAUDIA
Als sie in sein Auto stieg, waren die Wiesen noch braun. Als er stehen blieb und sie hinauswarf, schneite es, sie hatte nur dieses Kleid an, sie wehrte sich, er packte sie am Arm, zog sie auf die Straße, ihre Tasche blieb im Kofferraum.
Sie wollte sitzen bleiben, ihr Leben weiterleben, weiterfahren, ihm die Geschichte zu Ende erzählen, die sie begonnen hatte, mit ihm zusammen sein, ihn anlächeln, Kinder haben mit ihm irgendwann. Etwas Ähnliches vielleicht. Sie wollte daran glauben, auch wenn sie wusste, dass es anders sein würde. Um jeden Preis fast, ein bisschen Liebe, einen Mann, Zärtlichkeit, endlich. Jemandem vertrauen, ihn an sich heranlassen, Stück für Stück, langsam.
Doch er wollte weiter, schneller, tiefer.
Er zog sie aus dem Wagen. Er schlug die Türen zu und fuhr. Sie fror, sie wollten ins Wochenende, sie hatte geglaubt, dass er es ernst meinte, geduldiger war als die anderen, einfühlsamer. Dass er sie verstand, es akzeptierte, sie einfach so sein ließ.
Eine besondere Frau, hatte er gesagt.
Sie war dreißig und Jungfrau. Und er wollte sie ficken. So einfach war das.
Er hatte wieder die Hand unter ihren Rock geschoben, sie hatte sie wieder weggetan, ihn angelächelt und seine Hand gehalten, zärtlich, aber bestimmt.
– Bitte nicht.
– Nicht schon wieder. Es reicht jetzt, meinst du nicht?
– Ich möchte ja mit dir zusammensein.
– Dann verhalte dich auch so.
– Ich will mit dir zusammensein, ohne dass du deine Finger in mich hineinsteckst.
Er war wütend, schüttelte den Kopf, es kochte in ihm, war kurz davor, aus ihm zu platzen.
– Du bist ja nicht normal.
– Warum sagst du das? Worum geht es hier?
– Um deine Fotze. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst.
Claudia schwieg kurz, sie versuchte die Fassung nicht zu verlieren, die Tränen unter Kontrolle zu halten.
– Warum tust du das. Ich dachte, du liebst mich.
Er lachte laut auf, übertrieben, er schaute zu ihr hinüber, schüttelte den Kopf, klopfte mit dem Finger gegen seine Stirn.
– Du bist ja nicht normal, wie lange soll ich denn noch warten, soll ich durchdrehen neben dir, wie denkst du dir das? Ich bin auch nur ein Mensch.