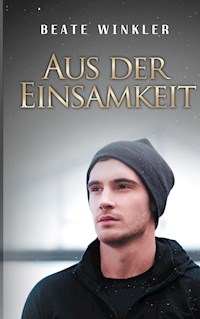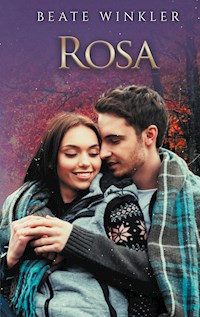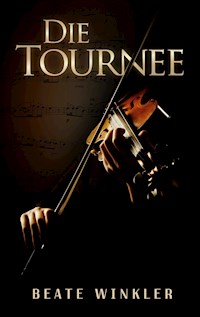
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Miriam und Leo mögen auf die Außenwelt wie ein ungewöhnliches Paar wirken: Sie ist eine erfolgreiche Violinistin, er ein blinder Psychologe. Ihr Leben pendelt zwischen einer innigen Zweisamkeit, in der sie in Gesprächen und in der Musik zusammenfinden, und den Tourneen von Miriam, die jedes Mal für beide eine fast unerträgliche Trennung bedeuten. Miriam reist von Stadt zu Stadt und fühlt sich in der Fremde trotz all der Menschen, die sie umgeben, allein. Leo bleibt in seiner Routine zu Hause zurück und sucht Gesellschaft mit Freunden und Familie, um die Leere in der Wohnung zu vertreiben. Doch diese eine Tournee wird mehr als eine örtliche Trennung sein. Sie wird zu einer unerwarteten Herausforderung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miriam und Leo mögen auf die Außenwelt wie ein ungewöhnliches Paar wirken: Sie ist eine erfolgreiche Violinistin, er ein blinder Psychologe. Ihr Leben pendelt zwischen einer innigen Zweisamkeit, in der sie in Gesprächen und in der Musik zusammenfinden, und den Tourneen von Miriam, die jedes Mal für beide eine fast unerträgliche Trennung bedeuten. Miriam reist von Stadt zu Stadt und fühlt sich in der Fremde trotz all der Menschen, die sie umgeben, allein. Leo bleibt in seiner Routine zu Hause zurück und sucht Gesellschaft mit Freunden und Familie, um die Leere in der Wohnung zu vertreiben. Doch diese eine Tournee wird mehr als eine örtliche Trennung sein. Sie wird zu einer unerwarteten Herausforderung.
Beate Winkler, 1973 in Hamburg geboren, studierte Medizin in Lübeck. Ihre Weiterbildung zur Kinderonkologin absolvierte sie in Tübingen und Würzburg. Seit 2015 lebt sie mit ihren zwei Söhnen in ihrer Heimatstadt. Sie arbeitet weiterhin als Ärztin und schreibt in ihrer Freizeit. Die Tournee ist ihr achter Roman.
Außerdem von Beate Winkler erschienen:
Viersamkeit Flucht in die Zweisamkeit Aus der Einsamkeit Der eigene Weg Das Implantat Rosa Die Worte in unseren Händen
Meine Welt sind die Töne.
Die Menschen meist körperlose Stimmen, die sich aus dem Beben der Geräusche herausheben, die erklären, die mich führen, die mit ihren Worten die Welt aufleben lassen.
Doch es gibt einen Raum, eine Situation, wo ich bin wie alle anderen: das Konzert.
Wenn ich meinen Platz gefunden habe, wenn die Gespräche verstummen, lasse ich mich in dieser vollkommenen Stille nach dem Eingangsapplaus in meinen Sitz sinken und warte auf den ersten Ton.
Ich warte auf den Einlass in die Welt der Musik, in diese besondere Welt, die auch mir ohne Worte, ohne Erklärungen zugänglich ist.
Rosa Treppin – Die akustische Dimension
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
I
Er zögerte nur kurz in seinem Spiel, eine minimale kaum hörbare Verlangsamung des prestissimo, als er hörte, wie sich ein Schlüssel im Schloss drehte. Tief Luft holend senkte er das Kinn in die Mulde seiner Violine und fuhr mit entschlossenem Strich fort. Im Hintergrund lauschte er den Geräuschen, wie sie die Schuhe von den Füßen streifte, der Reißverschluss ihrer Jacke, dann ihre leise tappenden Schritte. Sie hatte ihre Hausschuhe stehen gelassen, musste strumpfsockig sein, ihr schleichender, wie katzenhafter Gang. Seine Töne fluteten weiter den Raum, die rasche, wütende, kraftfolge Tonfolge, die er mit Macht seinem Instrument entlockte. Er war nicht voll auf seine Musik konzentriert, seine Finger senkten die Saiten wie fremdbestimmt, im Hintergrund arbeitete sein Radar, spürte er ihr Nahen. Er lockte sie weiter mit der Musik, bis sie ganz nah war, bis ihre Arme sich sanft um seine Hüften legten und sie einen zarten Kuss in seinen Nacken hauchte. Ihm lief ein Schauer über den Rücken, als er die Geige absetzte, sie und den Bogen fest in seiner Hand, diese nach unten gleiten ließ, in der Drehung, die er vollführte, mit der er sich ihr zuwandte. Seine freie Hand glitt ihren Arm hoch, umfasste mit aller Zärtlichkeit ihre Wange und er erwiderte ihren Gruß, seine Lippen fanden ihre. Noch in dem Temperament des Stückes gefangen drang seine Zunge mit aller Macht voller Wollen in ihren Mund. Sie erwiderte es, ein paar Takte der Musik hatten gereicht, sie in die gleiche Stimmung zu versetzen, in der er festhing. Seine Hand in ihrem Nacken drängte er ihr seinen Kuss auf, solange bis ihnen der Atem wegblieb. Er spürte sie Abstand nehmen.
»Die Zigeunerweisen von Sarasate?«
»Ja.«
»Ich habe sie dich noch nie spielen hören.«
»Ich glaube, ich habe sie zuletzt zu Schulzeiten gespielt.«
Seine Hand war immer noch in ihrem Nacken, er spürte ihr Kopfschütteln, sein Daumen auf ihrer Wange ihr Lächeln.
»Und du kannst sie immer noch auswendig? Du bist wirklich unglaublich! Sollen wir eine zusammenspielen?«
»Nein, lass mal. Wir können Abendbrot essen, der Tisch ist schon gedeckt.«
Er zog sie noch einmal kurz zu sich heran und löste sich schließlich aus der Umarmung. Er bemerkte ihr Zögern, die Frage, die ihr im Kopf herumging, aber sie ließ ihn.
»Ist gut. Ich geh schon mal in die Küche.«
Er verharrte noch einen Moment, während er ihr erneut mit seinen Ohren folgte. Sie hatte so gut gelernt, ihn mit ihren Worten informiert zu halten. Er genoss diese Interaktion, das Rücksichtsvolle, das Verständnis, das darin lag. Seine Hand glitt am Couchtisch entlang, bis sie auf den rauen Stoff des Geigenkastens stieß, vorsichtig bettete er sein Instrument hinein, verschloss das Gehäuse und stellte die Violine an ihren angestammten Platz neben dem Sofa.
»Ich mache einen Tee, ja?«, neben ihren Worten klackte schon der Deckel des Wasserkochers und der Wasserhahn begann sein Strömen.
»Wie wäre es mit einem Wein?«
»Haben wir etwas zu feiern?«
»Nein, einfach so. Einen roten, okay?«
Auf ihre Bejahung glitt er um den Küchentisch, seine Hand tastete nach der Arbeitsfläche, diese entlang, bis sie an den sie begrenzenden Kühlschrank stieß, ein wenig weiter nach hinten, das Gestell, das bis zu drei Weinflaschen beherbergen konnte. Er griff nach der obersten, drehte sie in der Hand so, dass sie das Etikett würde studieren können.
»Ein Merlot? Wäre das recht?«
»Absolut. Ich hole die Gläser«, ihre sich entfernende Stimme, »möchtest du zum Essen etwas Musik? Wir könnten den Sarasate noch weiter genießen.«
»Lieber etwas Ruhigeres.«
Ihr Lachen. »Du hast doch eben wie ein Verrückter gespielt.«
»Du hast doch den ganzen Tag Musik gemacht. Klingeln dir nicht die Ohren?«, er hörte, wie sie neben ihm Platz nahm, nur eine Ecke des Tisches zwischen ihnen, und reichte ihr die Flasche, »schenkst du ein?«
»Du weißt, dass es für mich nie genug Musik sein kann«, das Plätschern des Weines, der sich im Glas verfing, »hier.«
Er griff nach dem Weinglas und ließ die Hand mit dem Glas über dem Tisch schweben, wartend auf ihr Näherkommen. Das reine a, als ihre Gläser zusammenstießen. Er lächelte innerlich bei dem Gedanken an ihren Weinglas-Kauf damals. Sie hatten sich mit den verschiedenen leeren Weingläsern zugeprostet, sie aneinander klingen lassen und ihre Wahl nach dem Ton getroffen, der erklungen war. Er hatte die Verwirrung des Verkäufers gespürt und ihn informiert, dass sie Musiker waren, der Klang eines Glases eine besondere Bedeutung habe. Es hatte dem Verkäufer ein erstauntes Lachen entlockt.
Er lauschte dem Ton hinterher.
»Du weißt genau die richtige Füllhöhe?«
Sie lachte: »Ja. Wir können ja erstmal genau so viel trinken, bis wir uns einen Ton tiefer wieder treffen?«
Das Treffen der Gläser, der Gleichklang, wie in ihrem Leben. Er nahm einen Schluck des fruchtig, vollmundigen Weins. Seine Hand glitt suchend nach ihrer über den Tisch. Sie stellte ihm ihre zur Verfügung, sanft strich er über ihren Handrücken, ihre Finger verhakten sich ineinander.
»Entspann dich und genießen wir den Wein.«
»Ein glissando?«
»Lieber als eine Tonleiter«, er lauschte dem Chopin, den sie aufgelegt hatte, »wie war dein Tag?«
Sie berichtete, das Orchester, der ziemlich gestresste Orchesterleiter, wie immer, wenn sie kurz vor ihren Aufführungen standen. Am Nachmittag der Unterricht, die unterschiedlichen Schüler, der hochbegabte Dreizehnjährige, der an nichts dachte, außer seine Musik, sein Außenseiterstatus, danach das fünfzehnjährige Mädchen, an dem alles Protest schien, von den aufgerissenen Jeans, dem tief-schwarzen Look bis zu ihrer blau-gefärbten wilden Haarmähne.
Er unterbrach sie: »Damit … mit diesem Aufzug, was zeigt sie damit? Du verstehst es als ein Statement, oder?«
»Ja, sicher.«
»Erklär es mir.«
»Sie zeigt damit, dass sie anders ist. Sie schreit es sozusagen heraus, dass sie sich auf keinen Fall anpassen will.«
Er schüttelte den Kopf: »Ihr seid wirklich verrückt. Wenn du ihren Aufzug abziehst, ist sie dann wirklich so?«
Er hörte, wie sie die Luft ausstieß.
»Warte«, ein kleines Lachen, »ich schließe übrigens gerade die Augen, um, wie hast du gesagt, ›den Aufzug abzuziehen‹.«
Auch er lachte: »Wahrscheinlich eine gute Idee. Willkommen in meiner Welt.«
»Also, den Aufzug abgezogen«, ihre Stimme war nachdenklich, langsam formulierte sie ihre Worte, »sie … sprachlich ist sie sehr … wohlerzogen, sehr eloquent, eigentlich fast fein. Sie ist ehrgeizig. Sie spielt wirklich gut Geige.«
»Macht dir der Unterricht mit ihr Spaß?«
»Ja, mehr als mit den meisten anderen.«
»Du bewunderst sie ein bisschen für den Mut, ein klassisches Instrument zu spielen in einem Outfit, das so gar nicht dazu passt?«
»Kann sein. Sie ist mir sympathischer als die superfleißigen Langweiler.«
»Als du fünfzehn warst, bist du auch ausgebrochen? Hast du nach außen zu verstehen gegeben, dass du dich … anders fühlst?«
»Nein, ich war immer angepasst. Meine Eltern hätten niemals zugelassen, dass ich mich so kleide.«
»Hättest du es gern gemacht?«, er strich über ihre Hand, die weiter warm in seiner lag.
Für einige Momente, bis ihre Antwort kam, hingen nur die Töne von Chopin in der Luft, eine der wunderbaren Solopassagen aus dem zweiten Klavierkonzert.
»Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich … scheue Auseinandersetzungen. Ich falle nicht gern auf.«
»Du fällst auf, sobald du deine Geige in der Hand hältst.«
»Das ist etwas anderes.«
»Als Solistin stehst du voll im Rampenlicht, so sagt man das, oder?«
»Hm. Ich … mag das nicht wirklich.«
»Aber du kannst es«, mit den Worten zog er sie auf seinen Schoß und umarmte sie. Seine Hände suchten ihr Gesicht, er umfasste es mit beiden Händen und schenkte ihr einen zärtlichen Kuss.
Sie widmete sich ihm, ihre Finger durchkämmten sein Haar, sie verfingen sich kurz in seinen Locken.
Schließlich lösten sich ihre Lippen von seinen.
»Und dein Tag?«
»Alles wie immer.«
»Und deshalb spielst du wie ein Teufel Sarasate?«
Er schmiegte sich an sie. Sie würde spüren, dass ihn etwas umtrieb.
»Weißt du, dass es ein Buch gibt, dass ›Der Teufelsgeiger‹ heißt?«
»Leo, du lenkst ab.«
Er seufzte: »Ich … mag nicht darüber reden, okay?«
»Herr Psychologe, gerade Sie sollten wissen, wie wichtig das Reden ist, dass man sich die Dinge von der Seele reden sollte. Du forderst jeden Tag deine Patienten dazu auf, sich dir anzuvertrauen.«
»Ja, ich weiß. Ich kann das gerade nicht. Genießen wir lieber den Wein und machen es uns gemütlich.«
II
Die Geige im Anschlag stand sie und starrte bis in die letzte Faser gespannt auf den Dirigenten. Den ersten Satz hatte sie schon hinter sich gebracht. Gleich würde er kommen, dieser zweite Satz, das Adagio. Das Stück, das ihr Leben verändert hatte.
Seine Arme hoben sich, sein Blick schweifte in die Runde des Orchesters, bis er schließlich an ihrem hängen blieb und seine Hände, die kurz hochgezogenen Augenbrauen, ihnen allen den Beginn signalisierten. Miriam setzte zusammen mit dem Orchester ein, das lange g, ein f, darunter das Orchester in seinen warmen, tiefen Akkorden, wie etwas Weiches, Sanftes unterlegte es ihre Melodie. Sie schloss die Augen. Die Noten benötigte sie schon lange nicht mehr. Seit Jahren verließ sie sich beim Solo-Spiel auf ihr Gedächtnis. Sie hatte sich von Leo trainieren lassen, ihn immer wieder nach seinen Methoden gefragt, wie es ihm gelang, die Stücke in allen Einzelheiten in seinem Gedächtnis abzuspeichern, und schließlich festgestellt, dass es auch ihr nicht schwerfiel. Ihr Bogen glitt sanft über die Saiten, sie entfaltete die wunderbare Melodie …
Ihr Maestro hatte sie vor einigen Monaten gebeten, den Solopart beim Violinkonzert in g-moll von Bruch zu übernehmen. Sie hatte ihn ungläubig angestarrt. Dieses Konzert? Gerade dieses Konzert? Sie hatte versucht abzulehnen. Nein, das könne sie nicht. Der Maestro hatte sie verwirrt angesehen. Aber, Miriam, den Bruch kriegen Sie doch auf jeden Fall hin, Sie haben schon viel größere Hürden genommen. Sie hatte nochmal den Kopf geschüttelt. Nein, dieses Konzert könne sie nicht spielen. Es sei etwas Privates. Der Maestro hatte sie eingehend betrachtet und ihr eine Woche Bedenkzeit eingeräumt. Sie hatte den Probenraum mit einem Herzklopfen verlassen. Auf dem Nachhauseweg erst in der S-Bahn, dann in der U-Bahn, schließlich zu Fuß, bis ihre Füße sie die Stufen ihres Treppenhauses in den vierten Stock hochgetragen hatten und sie etwas außer Atem ankam, hatte sie die Melodie des zweiten Satzes förmlich gequält. Sie war in ihrem Kopf gewesen, immer wieder die gleiche Tonfolge, die sich in ihrem Hirn eingebrannt hatte, damals als Leo das Adagio zum Vorspiel gewählt hatte, um dem Orchester beizutreten. Das kleinliche Gefühl des Neides, das in ihr hochgekommen war, als sie ihn hatte spielen hören, ihre Angst, dass er sie von ihrem Platz der ersten Violine verdrängen würde. Die erstaunliche Reaktion des damaligen Dirigenten, der ihm mit einer gewissen Traurigkeit in der Stimme den zweiten Platz zugewiesen hatte. Ihre unendliche Erleichterung. Und die Scham, als sie begriff, dass Leo den ersten Platz nicht einnehmen sollte, wegen seiner Behinderung, wegen seiner Blindheit, die sie anfangs gar nicht wahrgenommen hatte. Er hatte das Stück auswendig gespielt, das allein war unter guten Musikern erstmal nicht ungewöhnlich gewesen. Die beim Spiel geschlossenen Augen hatte sie seiner Konzentration auf die Musik zugeschrieben, seinen stets gesenkten Blick einer Schüchternheit zugerechnet. Bis er, nach seiner Annahme des zweiten Platzes, darum bat, darum bitten musste, dass man ihm seinen Platz zeigte und er sich umgedreht hatte und nach dem Einpacken seiner Geige den Blindenstock hatte aufschnappen lassen. Ein Raunen war durch das Orchester gegangen, offenbar hatten alle anderen sich ebenso täuschen lassen wie sie selbst und sein Anderssein nicht bemerkt. Der Orchesterleiter hatte sie aufgefordert, ihm zu helfen und ihr war nichts übriggeblieben, als auf ihn zuzugehen, auf den Menschen, den sie eben noch als Konkurrenten gefürchtet hatte. Sie erinnerte noch heute, wie sie ihre Geige zur Seite gelegt hatte und sich auf ihn zubewegt hatte, sich fragend, was er von ihr wahrnahm. Als sie bei ihm angekommen war, unter den Augen all ihrer Orchestermitglieder, die sicher ihren Schreck gespürt hatten, denen sicher ihre Angst um ihre Position bewusst war, hatte sie nicht gewusst, was sie sagen sollte. Wie sie ihn begrüßen sollte. Die Stille hatte sich zwischen ihnen derartig in die Länge gedehnt, dass der Maestro schließlich eingeschritten war und übernommen hatte, das ist Miriam, unsere erste Violinistin, so oder ähnlich waren seine Worte gewesen. Leo hatte sie mit seiner warmen, tiefen Stimme freundlich begrüßt, sicher ihre Verwirrung bemerkt. Sie hatte keine Antwort gehabt, nur ein paar Töne, sie hatte die ersten Töne des Adagios leise, sehr leise, hoffend, dass sie unhörbar für das Orchester wären, gesummt. Ihn dabei beobachtet, wie er eine straffere Haltung annahm, die Augenbrauen erstaunt hochzog. Schließlich seine Hand ganz sanft an ihrem Ellbogen und seine Bitte, ihm den Platz zu zeigen. Er freue sich, mit ihr zusammen zu spielen …
Das Adagio hatte sie zusammengebracht, es hatte ihr Leo beschert. Sie hatte nie gewusst, wie sie auf andere Menschen zugehen sollte. War immer wieder Opfer ihrer Schüchternheit gewesen und hatte sich so allein gefühlt. Nie hatte sie es für möglich gehalten, auf einen Menschen zu treffen, den sie an sich heranlassen würde.
Die Melodie immer noch in ihrem Kopf, hatte sie die Haustür geöffnet und Leo über die Distanz etwas atemlos einen Gruß zugesandt. Sie hatte sich Zeit gelassen, ihre Jacke mit einer derartigen Langsamkeit abgestreift und aufgehängt, bis Leo bei ihr angekommen war.
»Hallo Miriam«¸ er hatte sie fest in die Arme geschlossen, »du bist ja ganz außer Atem. Alles in Ordnung?«
Sie hatte sich einer Antwort enthalten, sich an ihn geschmiegt, in seine Umarmung fallen lassen, die Augen geschlossen und seine Wärme genossen. Seine Hände waren zärtlich ihren Rücken auf und ab gewandert.
»Komm doch erstmal rein«, damit hatte er sie ins Wohnzimmer geschoben und weiter, bis sie gemeinsam auf dem Sofa gelandet waren, »ist etwas passiert?«
Seine ganze Pose war Aufmerksamkeit gewesen, er sah sie nicht an, wie immer war sein nichts sehender Blick auf den Boden gerichtet, aber seine Körperspannung zeigte ihr, dass er sofort erfasst hatte, dass etwas vorgefallen war. Sie konnte nichts vor ihm verstecken, von der ersten Sekunde ihres Kennenlernens an schien er förmlich in ihr lesen zu können, manchmal war es anstrengend, sie hatte keine Chance sich vor ihm zu verstellen. All die Mechanismen, die sie entwickelt hatte, damit die Menschen um sie herum ihr nicht nahekamen, zunächst in der Familie, dann auch in der Schule und im Orchester, funktionierten bei ihm nicht. Obwohl er nicht sehen konnte, sah er durch all ihre Mauern, die Fassade, die sie so mühevoll errichtet hatte, mühelos hindurch.
»Nein, alles gut. Nur die Treppen.«
»Miriam … «, er sagte es mit aller Zärtlichkeit, seine Hand strich sanft über ihr Bein. Sie ließ einen weiteren Moment in Stille verstreichen. Schließlich holte hatte sie tief Luft geholt: »Pagagno hat mich gebeten, das Solo im ersten Violinkonzert von Bruch zu übernehmen.«
Sie hatte den ganzen Heimweg überlegt, wie sie es ihm sagen sollte und keine Idee gehabt. Und jetzt passierte das, was ihr mit Leo immer wieder geschah, mit Leo wie mit niemandem sonst, sie sagte einfach, was sie umtrieb, ohne Umschweife oder Verschnörkelungen, einfach so.
Seine Hand auf ihrem Oberschenkel hatte in ihrem Streicheln innegehalten und ein Lächeln hatte sich auf seinem Gesicht ausgebreitet. Immer wieder staunte sie, woher er die Fähigkeit für diese mimischen Spiele hatte, er, der nie hatte sehen können. Es musste eines unermüdlichen Trainings als Kind bedurft haben. Es machte ihn so viel sympathischer in der Kommunikation als die anderen blinden Menschen, die sie über ihn kennengelernt hatte und sie hatte registriert, dass er seine Mimik nur denen gegenüber einsetzte, die sie sehen konnten. Wenn er unter anderen blinden Menschen war, wurde sein Gesicht ebenso ausdruckslos wie das der anderen und er transportierte all seine Emotionen über seine Stimme.
»Miriam, wie schön! Herzlichen Glückwunsch! Es ist ein so wundervolles Konzert.«
»Leo, ich habe noch nicht zugesagt.«
»Aber warum denn?«
»Du weißt, warum«, sie hatte einen Moment auf seine Antwort gewartet, gehofft, dass er ihr eine Erleichterung, eine Versicherung, hätte geben können. Er hatte ihr nicht den Gefallen getan, also hatte sie sich weitergemüht. Er hatte ganz still dagesessen und einfach auf ihre Erklärung gewartet. Stockend hatte sie weitergemacht: »Es … ist unser Stück. Ich … werde diese Melodie nie wieder aus dem Kopf bekommen. Die Art, wie du sie gespielt hast. Es war so … vollendet. Ich werde das niemals so spielen können.«
Seine Antwort war wortlos gewesen, er hatte in seinem samtenen Bariton angehoben, die Melodie des Adagios zu summen, wie sie es damals getan hatte, als sie sich das erste Mal begegnet waren und ihr die Worte gefehlt hatten, und sie in den Arm genommen. Ihr waren vor Erstaunen und Dankbarkeit die Tränen gekommen und sie hatte schon am Folgetag ihrem Dirigenten die Zusage zu diesem besonderen Konzert geben können …
Sie endete im piano, ein leises es, das Orchester in Es-Dur unter ihr. Sie horchte für einen Moment in die Stille, öffnete schließlich die Augen und schüttelte die Trance, die sie ergriffen hatte, ab. Sie spürte die Blicke aller auf sich ruhen. Keiner wusste um die Bedeutung dieses Stücks für sie, es war ihr völlig unklar, wie sie dieses Adagio auf die Bühne bringen sollte, wenn er, Leo, im Publikum sitzen würde, um ihr zuzuhören. Er war immer, wenn es ihm möglich war, anwesend in ihren Konzerten, bei all ihren Heimspielen dabei, nur bei den Tourneen begleitete er sie nicht. Sie hatte das manchmal, oft, traurig gemacht, seine Weigerung mitzufahren und an ihren Erfolgen teilzuhaben. Aber sein Ablehnen war strikt gewesen, komplett und rigoros. Fremde Umgebungen waren eine Herausforderung für ihn, eine Herausforderung, die er immer wieder nicht annehmen wollte. Er wollte keine Abhängigkeit von ihr, noch mehr schien es aber etwas anderes, das ihn abhielt, sie zu begleiten. Er wollte sie nicht beschränken, wie hatte er gesagt? Kein Klotz an ihrem Bein sein. Sie solle ihre Tourneen einfach genießen und sich keine Gedanken um ihn machen.
Manchmal zweifelte sie, ob ihm klar war, wie alleingelassen sie sich mit dieser Ablehnung fühlte. Ob er je verstanden hatte, wie unwohl sie sich inmitten ihrer Mitmusiker fühlte? Den Menschen, mit denen sie Tag für Tag zu tun hatte. Hatte er je bemerkt, wie sie sich hinter der guten Musik, die sie machte, und einer gewissen Unnahbarkeit verschanzte, damit sie sie alle in Ruhe ließen? Nichts wäre ihr lieber, als nach den Konzerten, mit ihm allein die Bühne und das Konzerthaus zu verlassen, all die Menschen hinter sich zu lassen, um einfach mit ihm zu sein, allein mit ihm …
Der Maestro suchte erneut die Aufmerksamkeit seiner Musiker und sie hoben an, den dritten Satz zu spielen. Wie befreit spielte Miriam das Finale des Konzerts.
In der S-Bahn hatte sie einen Fensterplatz erkämpft. Die Geige zwischen den Beinen lehnte sie die Stirn an das Fenster und ließ die Stadt, ohne sich um einen Fokus zu mühen, an ihrem Blick vorbeigleiten. Es würde in den nächsten Wochen endlich wärmer werden, sie würden hoffentlich die winterlichen Tage bald hinter sich lassen können, das triste Grau würde sich bald in ein leichtes Hellblau wandeln und wieder mehr Licht in ihr Leben lassen. Ihre Gedanken glitten zu Leo, der kein Empfinden für Farben, Helligkeit und Dunkelheit hatte, ihre Fähigkeiten, ihm irgendetwas von ihrem Sehen, der bunten Welt um sie herum, zu vermitteln, waren beschämend gering. Immer wieder war sie an seinen Fragen gescheitert, hatte sie irgendwann aufhören müssen zu erklären, weil er ihr nicht folgen konnte. Er hatte es ihr nie übelgenommen, es blieb ihnen nichts übrig, als diese Unterschiedlichkeit zu ertragen. Auch ihr war bis heute unklar, wie er sich orientierte, wie er zurechtkam, immer wieder bewunderte sie seine Fähigkeiten und sein exzellentes Gedächtnis. Die S-Bahn fuhr in einen Bahnhof ein, sie verlangsamte ihr Tempo und kam so zum Stehen, dass Miriams Blick an einem großen Plakat hängenblieb. Eine Werbung für einen Rotwein, ein Merlot. Miriam konnte sich ein Grinsen kaum verkneifen. Der Merlot gestern Abend. Wie schön war es gewesen. Erst war Leo etwas merkwürdig gewesen nach seinem Sarasate-Solo, ihr hatte sein Kuss in seiner Wildheit gefallen, dann dieser Rotwein, die Flasche, die sie, so anders als sonst, bis zur Neige geleert hatten. Ihr war der Wein zu Kopf gestiegen, sie war das Trinken ebenso wenig gewohnt wie Leo, der sie unsicher auf seinen Beinen in Richtung Schlafzimmer gelotst hatte. Kraftvoll hatte er sie entkleidet, während ihre Finger ungeschickt an seinen Hemdknöpfen geruckelt hatten. Er hatte gelacht, du hast gar kein Licht angemacht? Sie hatte bejaht. Umso besser, wie herrlich. Sie waren auf dem Bett gelandet, seine Hände überall an ihr. Sie hatte sich der Dunkelheit und seinen Händen hingegeben, schweigend, weil sie wusste, dass er es liebte, dass er keine Worte mochte, die den Akt störten. Sie hatte die Augen geschlossen, alles war Gefühl gewesen. Er hatte es durchgezogen. Der Wein hatte sie gemeinsam fliegen lassen.
Erst heute Morgen als sie mit einem schmerzenden Kopf aufgewacht war und sie seine Hand träge über ihren Bauch streicheln spürte, waren ihr unbewusst die Worte entflohen. Leo, wir haben nicht aufgepasst. Er hatte sie schweigend zu sich herangezogen. Manchmal war er so, schweigend und ohne Worte. Völlig untypisch für einen Blinden. Er konnte meist so gut reden, die Menschen redend einfangen, er hatte es sogar zu seinem Beruf gemacht. Sie konnte mit niemandem so reden wie mit ihm, so anders, als wenn viele Menschen um sie herum waren, wie oft fehlten ihr die Worte oder sie hatte schlicht keine Lust, sich auf das Geplänkel einzulassen. Er hingegen war eloquent, er konnte mit seinen Worten ganze Gruppen von Menschen mitreißen. Wenn sie mit ihm allein war, konnten sie gemeinsam im Gespräch versinken, aber wenn es intim wurde, wurde er still. Es war kein unangenehmes Schweigen, mehr schien er komplett in sich zu ruhen. Es musste mit seiner Kindheit zu tun haben. Wie lange hatte er nicht erzählt, aus was für einer Familie er kam. Wie lange hatte er gebraucht, um ihr in diesem, ihm so unglaublichen wichtigen Punkt, zu vertrauen. Der Abend gestern, ihr ungeplantes Zusammensein, was wenn …?
Die Lautsprecheransage, Sternschanze, sie schreckte auf und drängelte sich an den Menschen vorbei, um gerade noch rechtzeitig auszusteigen.
Leo hörte, wie die Tür ins Schloss fiel. Müde senkte er den schmerzenden Kopf in seine Hände. Frau Müller hatte er für heute abgehakt. Ihre unsinnigen Sorgen, ihre Exaltiertheit. Er ertrug sie. Er hörte ihr zu, gab ihr ein paar Ratschläge und überlegte immer wieder, ob sie nach zwei Wochen wieder erscheinen würde. Sie brauchte ihn nicht wirklich, er war sich sicher, dass sie das wusste, und fragte sich, warum sie immer noch kam. War es vielleicht schick, wenn sie ihren Freundinnen von dem blinden Psychologen erzählen konnte, zu dem sie regelmäßig ging? Es war müßig darüber nachzudenken. Sie war eine Privatpatientin, sie zahlte gut. Also machte er weiter. Immer wieder fragte er sich, ob er den richtigen Beruf ergriffen hatte. Warum hatte er das Zuhören und die Sorgen und Nöte der Menschen auseinander nehmen zu seiner Profession gemacht? Das Studium war ein einziger Stress gewesen, fachlich spannend, aber rein technisch nicht an seine Blindheit angepasst, immer wieder hatte er um Unterstützung bitten müssen, sie in dem sozialen Umfeld seiner Psychologie-Kommilitonen auch sehr großzügig erhalten. Er hatte das einerseits genossen, andererseits hatte seine Hilflosigkeit und ihre Unfähigkeit, von sich aus auf ihn zuzukommen, einmal selbst nachzudenken, dass es ihm helfen würde, wenn sie den Text vorlesen würden und ihn nicht nur still für sich lasen. Immer wieder hatte er darum bitten müssen. Nie war einer von sich aus darauf gekommen. Aber er hatte sich durchgekämpft, mündliche Prüfungen, oder diktierte Aufsätze, er hatte seine sprachlichen Fähigkeiten immer wieder einsetzen können, um sie alle zu beeindrucken. Letztlich, auch wenn ihm einige Patienten nicht genehm waren, er insgesamt dachte, dass ihre Sorgen minim waren im Vergleich zu dem, was andere Menschen, die die wahrscheinlich niemals einen Psychologen aufsuchen würden, durchmachen mussten, war es trotzdem ein Beruf, der ihm auf den Leib geschnitten schien. Er musste nur zuhören und reden. Es war völlig irrelevant, dass er nicht sehen konnte, für einige seiner Patienten unter Umständen sogar sehr angenehm. Er glaubte manchmal, dass die Menschen sich ihm gegenüber eher öffneten, weil er sie nicht mit seinen Augen beobachten konnte. Dass er dies auf andere Weise tat, sicher deutlich intensiver, als sie erfassen konnten, stand auf einem anderen Blatt.
Plötzlich musste er an Miriams Worte von gestern Abend denken, ihre Worte, als er ihre Frage geblockt hatte: Herr Psychologe, gerade Sie sollten wissen, wie wichtig das Reden ist, dass man sich die Dinge von der Seele reden sollte. Gestern Abend hatte er die Kontrolle verloren, der komische Tag, sein Versuch, den Frust an der Violine abzubauen, bevor sie nach Hause kommen würde, dann der Wein, den sie schneller und ausgiebiger als sonst genossen hatten, die Trunkenheit, in der sie ins Schlafzimmer gestolpert waren und alles danach. Miriam würde heute das Violinkonzert von Bruch proben. Er dachte ein paar Wochen zurück, als sie ihm voller schlechten Gewissen von dem Angebot erzählt hatte. Sie beide liebten dieses Stück, es bedeutete alles, ohne dieses Stück gäbe es sie zwei gar nicht. Ursprünglich war es sein Stück gewesen, er liebte das Adagio so sehr, dass er seine Tante, seine so unendlich geduldige Geigenlehrerin, die es auf so wunderbare Weise vollbracht hatte, ihn, ohne irgendeine Visualität, an dieses Instrument heranzuführen, gezwungen hatte, es immer und immer wieder mit ihm durchzugehen. Sie las die Noten, sie spielte eine Passage, er lauschte. Sein absolutes Gehör machte es ihm leicht, die Passagen nachzuspielen, aber er benötigte mehrere Anläufe, um es sicher in die Finger zu bekommen. Es war meist harte Arbeit und hatte sehr viel Fleiß seinerseits bedurft, damit er gut auf dem Instrument wurde, aber er hatte sich von ihrer Begeisterung mitreißen lassen und viel Zeit in das Geige-Spielen gesteckt. Zeit, die andere beim Sport oder vor dem Fernseher oder Computer verbrachten. Er hatte sie nie verschwenden wollen und immer hart gearbeitet. Jetzt sollte Miriam dieses Solo in einem Konzert spielen und sie hatte sich kaum getraut, ihm dies zu gestehen. Er selbst würde wohl nie die Gelegenheit hierfür bekommen. Sie würde es sein, die ihr Stück der Öffentlichkeit präsentieren würde. Sie würde großartig sein. Was für ein Gefühl würde es für sie sein, wenn er in ein paar Wochen im Publikum säße, und sie das Adagio spielen würde? Wie würde es ihm selbst damit gehen? Und wie würde es für Miriam sein?
Es klopfte, der Luftzug der sich öffnenden Tür. Er hob den Kopf.
»Leo, hier ist Herr Oertel. Er ist ein bisschen früh. Hast du schon Zeit?«
Er holte tief Luft und setzte ein Lächeln auf, wie es die Sehenden so gerne hatten. Jedes Mal, wenn er es nutzte, schien es die Stimmung weicher zu machen: »Ja, sicher. Herr Oertel wollen Sie auf dem Sofa Platz nehmen? Wie geht es Ihnen heute?«
Die Therapiestunde nahm ihren Lauf, für die folgenden fünfundvierzig Minuten schob er die privaten Gedanken zur Seite.
Herr Oertel war sein letzter Patient an diesem Tag. Er glaubte, ihn mit seinen Worten unterstützt zu haben, mit ihm gemeinsam eine Idee entwickelt zu haben, wie er wieder einen Draht zu seiner Frau bekommen könnte, die ihm seit einem Fehltritt misstraute.
Nachdenklich verstaute Leo die Sachen in seinem Rucksack. Hoffentlich würde es zwischen Miriam und ihm selbst niemals so weit kommen. Er betete, dass er sich immer ausreichend in der Gewalt haben würde, um einen Fehltritt, wie Herr Oertel ihn begangen hatte, vermeiden zu können. Aber Herr Oertel hatte sich seine Probleme irgendwie selbst eingebrockt, er hätte nicht fremdgehen müssen und jetzt musste er mit der Wahrheit klarkommen, dass er es dennoch getan hatte. Leo schulterte den Rucksack und ließ seinen Blindenstock aufschnappen, er schmunzelte bei dem so vertrauten Geräusch und machte sich auf den Weg, der Stock lag ihm Sicherheit gebend in der Hand. Sein Arbeitsweg war einfach. Sie wohnten nicht weit entfernt in Eppendorf, ein fußläufiger Arbeitsweg, wer hatte das in Hamburg schon. Er warf Sabine, die er an der Anmeldung noch tippen hörte, einen Abschiedsgruß für heute zu, öffnete die Tür und trat aus seiner Praxis, die er gemeinsam mit zwei Kollegen betrieb, hinaus in den kühlen Februartag. Er sog die frische Luft einmal tief ein, wandte sich nach links und ging in seinem gewohnten Rhythmus, innerlich die Schritte zählend, er war dies so gewohnt, dass sein Hirn dies ohne sein Zutun machte, im Unterbewusstsein, darüber konnte er seinen Gedanken freien Lauf lassen. Er war müde nach der gestrigen Nacht, aber sein Arbeitstag heute war in aller Gewohnheit verlaufen. Wie anders war es gestern gewesen …
Ein Fahrradklingel unterbrach seine Gedanken. Er schwenkte nach links auf die Hauswand zu, in seiner Routine aus dem Konzept gebracht, stellte er sich für einen Moment still hin, bis der Fahrradfahrer, der doch auf dem Gehweg gar nichts zu suchen hatte, an ihm vorbeigezogen war. Seufzend setzte er sich wieder in Bewegung, er war zu unaufmerksam gewesen. Wie viele Schritte noch bis zu der kleinen Seitenstraße? Die Häuser waren dicht an dicht gebaut, kein Sonnenstrahl oder Wind, der zwischen ihnen hindurchstreichen könnte. Er schob seine wabernden Gedanken zur Seite und konzentrierte sich auf den Weg. An der letzten Ecke, die ihn in seine Straße führen würde, hielt er inne. Wieder manövrierte er sich aus dem Zentrum des Gehwegs und zog sein Handy hervor. Er entsperrte es und gab ihm mündlich eine kurze Nachricht ein.
»Papa, bist du zu Hause? Könnte ich spontan vorbeikommen? Jetzt gleich?«
Das Handy sagte ihm, dass die Nachricht durchgegangen und offenbar gleich gelesen war. Leo wartete. Schon nach kurzer Zeit wieder die Stimme des Handys, die die Worte seines Vaters für ihn übertrug. Immer noch fühlte es sich komisch an, ihn zu hören. Aber die Technik half.
»Ja, gern. Freue mich.«
»Ich gehe jetzt bei mir zu Hause los. Ich bin in etwa einer halben Stunde da.«
»Bis gleich.«
Leo ließ das Handy in die Tasche gleiten und änderte die Richtung zur nächstgelegenen U-Bahnhaltestelle. Er erreichte den Bahnsteig sich an der Seite am Treppengeländer hochhangelnd, um dem Feierabendgedrängel wenigstens etwas zu entgehen. Auf dem Bahnsteig stellte er sich geduldig wartend an seine übliche Position. Er war zu träge, seine Uhr zu konsultieren. Die Bahnen fuhren um diese Zeit ohnehin mit einer hohen Frequenz. Nach kaum einer Minute hörte er den Zug einfahren, seinen Stock vorgestreckt wie ein Warnsignal bahnte er sich den Weg, er brauchte nur den Stimmen der sich Unterhaltenden zu folgen, um in etwa zu wissen, wo die Tür sein würde. Er erfasste den Griff, betrat den von Gesprächen und Gerüchen schwirrenden Waggon und drückte sich gleich in die Ecke neben der Tür. Er schrak zusammen, als jemand ihn antippte.
»Wollen Sie sich nicht setzen? Hier gleich würde jemand einen Platz für Sie frei machen.«
»Nein, danke, lassen Sie mal. Ich fahre nur ein paar Stationen.«
»Oh, ja dann.«
Er mochte diesen Platz direkt an der Tür. Er ersparte ihm das Geschlängel durch die Masse an Körpern, die um diese Uhrzeit wie zu einem einzigen großen Klumpen zusammengeschmolzen schienen.
III
Leo verharrte einen Moment vor der Haustür, er sog den so vertrauten Geruch des Treppenhauses ein, lauschte dem leisen Knacken der alten Holztreppen. Schließlich drückte er den Klingelknopf. Immer wieder musste er über den scheppernden Klang der alten Klingel den Kopf schütteln. Er hatte seinen Vater darüber informieren wollen, ihn bitten wollen, das alte Ding reparieren zu lassen, aber irgendwie hatte er es nie getan. Auch die scheppernde Klingel war Erinnerung. Die Schritte seines Vaters auf dem knarrenden Holzboden, bevor die Tür geöffnet wurde und ihm der gewohnte Geruch nach Farben und Terpentin entgegenwehte.
»Hallo Papa.«
Das Streichen der Hand seines Vaters auf seinem Oberarm war die schweigende Antwort, dann das Auffordernde in seiner Berührung, das ihn eintreten ließ. Die Tür hinter ihm klappte zu und er fühlte sich unmittelbar in die Tage seiner Kindheit zurückgeworfen, in die Stille und diesen Geruch nach Farben. Sie grüßten sich erneut in einer freundlichen Umarmung, bevor Leo den Stock in die gewohnte Ecke stellte und seinen Rucksack an der Garderobe hinterließ, ebenso wie die Jacke. Sein Vater abwartend neben ihm.
Leo wandte sich ihm zu und formte deutlich und lautlos: »Gehen wir ins Wohnzimmer?«
Ein Tippen an seinem Arm war die Antwort: »Ja.«
Sie nahmen beide auf dem Sofa Platz, schräg einander zugewandt, ihre Knie berührten sich. Sein Vater würde nicht den Anfang machen. Seine Hand lag warm auf seinem Oberschenkel, er wartete, dass er, Leo, beginnen würde. Er würde sich fragen, warum er hier plötzlich und unerwartet auftauchte. Es entsprach kaum ihrer Interaktion. Sie hatten eine Regelmäßigkeit in ihren Treffen. Er ging jeden Samstag am Nachmittag zu seinem Vater, oder fast jeden. Wenn er mit Miriam etwas vorhatte, konnte er seinem Vater problemlos absagen, er war ihm nie offensichtlich böse gewesen. Er schien sich zu freuen, wenn Leo kam, aber klagte nicht, wenn es nicht so war. Sein Vater hatte noch kein einziges Mal dieses Samstagstreffen abgesagt. Leo waren sie auch wichtig, so dass Miriam den Samstagnachmittag meist allein verbrachte. Sie hatte bei diesen Treffen nichts zu suchen. Es war zu schwierig, immer wieder die Brücke zu bauen. Und wenn Miriam dazukam, zerstörte sie die intime Zweisamkeit, die Leo mit seinem Vater genoss. Leo hatte gar nichts sagen müssen, Miriam hatte es nach einem einzigen Treffen erfasst und sich zurückgezogen. Er hatte ihr gegenüber ein schlechtes Gewissen gehabt, sie gefragt, ob sie es tolerieren könnte, wenn er sich jeden Samstag allein zu seinem Vater aufmachte, ob sie sich nicht zurückgesetzt fühlte. Sie hatte ihn in den Arm genommen und in sein Ohr geflüstert. Ich weiß, wie wichtig er dir ist, geh nur zu ihm. Es ist alles gut. Er war gerührt gewesen. Trotzdem packte ihn jeden Samstagnachmittag die Ambivalenz.
Die Hand seines Vaters mit einem fragenden Strich an seinem Arm. Leo straffte sich, er begann stimmlos zu sprechen und parallel zu gebärden. Es war immer noch die Variante, wie er am schnellsten mit seinem Vater kommunizieren konnte. Sie könnten die Technik nutzen, häufig war in der Familie jemand da, der übersetzen konnte, aber am liebsten blieb ihnen beiden die direkte Kommunikation.
»Warum ich gekommen bin? Gestern in der Praxis … «, das Tippen seines Vaters auf dem Oberschenkel, dieses ja, ich komme mit, sie hatten es sich irgendwann angewöhnt, sonst fehlte Leo die Rückbestätigung, dass sein Vater ihn verstand, »kam ein junges Mädchen.«
Leo ließ die merkwürdige Situation in sich wieder aufleben.
… Das Klopfen an seiner Tür.
»Leo, kannst du mal kommen? Da fragt jemand nach dir.«
»Ich soll rauskommen?«, es war ungewöhnlich. Normalerweise brachte Sabine, die Sprechstundenhilfe, immer die Patienten zu ihm.
»Ja, ich glaube, diesmal schon.«
»Okay«, er erhob sich von seinem Stuhl, seine linke Hand glitt an seinem Tisch entlang, fünf Schritte bis zu der offenstehenden Tür, dann die rechte Hand an der Leiste, die er auf Hand-Höhe hatte an die Wand im Flur anbringen lassen. Er bewegte sich auf den Tresen zu, ihn empfing zunächst keine Stimme. Er hatte das Gefühl, dass mehr als eine Person dort standen. Als er den Tresen erreicht hatte, hatte er sich in die Richtung gewandt, in der er die Personen vermutete.
»Hallo, ich bin Leo Treppin. Psychologe. Sie wollten mich sprechen?«
Er hörte ein Räuspern, dann eine tiefe, ältere, männliche Stimme: »Hallo Herr Treppin. Mein Name ist Hansen, ich bin der Begleiter und Dolmetscher von Frau Anna Meininger, sie steht hier neben mir.«
»Dolmetscher?«
»Ja, Frau Meininger ist taubblind.«
Leos Hand hatte sich um den Anmeldetresen gekrallt: »Taubblind?«, er hörte selbst die Heiserkeit in seiner Stimme.
»Ja. Ist das ein Problem für Sie?«
Leo hatte den Kopf gesenkt und schließlich ein Nein hervorgepresst: »Kommen Sie doch mit in mein Zimmer. Wir müssen das ja nicht hier im Flur klären.«
Er war vorausgegangen, bemüht, seinen Atem und sein rasendes Herz unter Kontrolle zu halten.
»Nehmen Sie doch auf dem Sofa Platz.«
Er hörte, wie sich zwei Personen niederließen und setzte sich selbst auf das zweite Sofa, das übereck zu dem anderen stand.
»Also, was gibt es?«
Wieder dieses Räuspern. Hansen strömte den Geruch nach einer ganzen Zigarettenfabrik aus, darunter ein derb riechender Schweiß, der ihm Übelkeit verursachte. Und er sollte ein Taubblinden-Assistent sein? Es musste eine Zumutung für einen taubblinden Menschen sein. Der Körpergeruch dieses Mannes würde viele andere Gerüche, die Orientierung geben könnten, übertönen. Hansen war so präsent, dass Leo die junge Frau neben ihm kaum ausmachen konnte. Er meinte aber zu wissen, dass sie sich so hingesetzt hatten, dass sie näher zu ihm saß.
»Also, ja, wir sind auf Veranlassung von Frau Meiningers Eltern hier. Sie hat vor zwei Jahren die Schule beendet und ist wieder zu Hause eingezogen, dort scheint alles schwierig zu sein.«
»Ihre Eltern hören?«
»Ja, sie sind ganz normal. Frau Meininger zieht sich komplett zurück. Sie kommen nicht an sie heran. Sie muss planen, was sie jetzt machen will, aber sie kümmert sich um nichts. Ihre Eltern glauben, dass sie depressiv ist. Sie steht an manchen Tagen kaum auf. Sie haben zusammen mit der Schule beschlossen, dass sie einen Psychologen aufsuchen soll. Ich kann dabei dolmetschen. Vielleicht schaffen Sie es, mit ihr ins Gespräch zu kommen.«
»Wie kommen Sie gerade auf mich?«
Er räusperte sich erneut: »Ehrlich gesagt, war das nicht ich. Die Idee zu ihnen zu gehen, kommt von Frau Meininger selbst. Sonst wollte sie zu niemandem gehen. Keine Ahnung, woher sie von Ihnen weiß.«
Leo lauschte den Worten, parallel versuchte er auszumachen, ob Hansen dolmetschte, aber er hörte nichts. Gebärden konnte er meist akustisch gut ausmachen, Lormen war schwieriger.
»Warten Sie mal kurz. Während wir hier reden, dolmetschen Sie für Frau Meininger, oder?«
Hansen lachte auf: »Nein, was erwarten Sie? Ich werde sie hinterher informieren.«
Leo schluckte, wieder war seine Stimme leise und heiser: »Wie kommuniziert sie? Lormen? Taktile Gebärden?«
Er spürte Hansens Verwunderung und lächelte in sich hinein. Hansen hatte keine Ahnung, wer er war. Er hatte sich nicht einmal bemüßigt gefühlt, über ihn im Internet zu recherchieren, bevor er mit ihr hierhergekommen war.
»Sie gebärdet taktil. Woher wissen Sie …?«
Leo rutschte etwas näher zu dem anderen Sofa, die Hand suchend nach der jungen Frau ausgestreckt. Nach ihr, die er kaum wahrnehmen konnte. Seine Hand schwebte eine Weile in der Luft, bevor er sachte an ihr Knie stieß. Sie schrak zusammen. Er rutschte noch ein wenig näher zu ihr, spürte, wie sich ihr Körper erstaunt straffte.
Ihre Hände fanden sich mühelos und er begann: »Hallo Anna, mein Name ist Leo. Du wolltest mit mir sprechen?«
»Sie gebärden? Das gibt es doch nicht.«
Leo gab seine Antwort zweisprachig, er spürte die Hände des Mädchens sanft auf seinen.
»Ja, mein Vater und meine Schwester sind taub.«
»Sowas, meinen Sie, sie hat das gewusst, und wollte deshalb zu Ihnen?«
Parallel kamen ihre Hände unter seinen in Bewegung: »Ja, ein Mädchen aus der Schule hat von dir erzählt. Du musst mir helfen«, parallel quatschte Hansen weiter. Leo schüttelte den Kopf, sanft unterbrach er Anna: »Warte kurz, wenn es dir recht ist, schicke ich deinen Dolmetscher erstmal raus. Okay?«
Ihr Okay kam mit einer erfreuten Wucht.
Er wandte sich an Hansen: »Herr Hansen, wir beide kommen klar. Wollen Sie nicht für einen Moment nach draußen gehen? Würden Sie Frau Meininger in einer halben Stunde wieder abholen kommen?«
»Sind Sie wirklich sicher? Können Sie sie verstehen?«
»Ja, alles gut.«
»Ich werde für diese Zeit bezahlt.«
Leo legte Freundlichkeit in seine Stimme: »Das macht doch nichts. Machen Sie einen Spaziergang und genießen Sie die Pause.«
Als er Hansen hinauskomplementiert hatte, öffnete er das Fenster. Er begab sich zurück zu Anna und ließ sich neben ihr auf dem Sofa nieder. Ihre Hände fanden sich unmittelbar.
»So ist es besser, oder?«
»Ja, danke!«
»Also, Anna, warum bist du gekommen?«
»Du musst mir helfen.«
»Ja, das hast du eben schon gesagt. Wie soll ich dir helfen?«
Die vorsichtige Hand seines Vaters riss Leo aus seinen Gedanken.
»Gestern kam ein Mädchen in deine Praxis?«
»Ja, Papa, entschuldige. Ich war in Gedanken.«
»Alles gut. Was war so besonders?«
Leo griff nach den Händen seines Vaters, er wollte nur gebärden, nicht sprechen. Er spürte, wie sein Vater sich ihm weiter zuwandte, er nahm an, dass er jetzt seine Augen schloss. Er hatte es ihm erzählt, dass er dies tat, dass er sich so besser auf die Gebärden, die unter seinen Händen entstanden, konzentrieren konnte. Es war eine gleichberechtigte Kommunikation, die Einzige, die sie hatten. Sein Vater unterbrach das Sehen, er selbst schaltete sein Hören fast komplett aus. So wurden sie sich ähnlich, kamen sie sich nah.
»Sie heißt Anna, ist etwa zwanzig Jahre alt und … sie ist taubblind.«
Leo hörte, wie sein Vater erstaunt Luft holte. Seine Hände waren plötzlich weg, als hätten die Worte sie verbrannt. Er stand auf und bewegte sich fort, bis er fast außerhalb von Leos Radar war. Sein Vater war so leise, dass er ihn oft kaum hören konnte. Das war ungewöhnlich für einen Gehörlosen, aber sein Opa hatte ihm das Leise-Sein antrainiert. Leo stand ebenfalls auf, er nahm an, dass sein Vater die Nähe des Fensters gesucht hatte und seinen Blick nach draußen schweifen ließ. Es war ein typisches Verhalten seines Vaters, immer wieder war er aus den Gesprächen geflohen, hatte sich ihnen entzogen. Leo erreichte ihn, strich vorsichtig über seinen Rücken und lehnte sich an seinen Vater, dessen Arm sich unmittelbar um ihn legte. Er spürte, wie sein Vater ihn zu sich zog. Sie schwiegen, bis Leo es nicht mehr aushielt. Er war zu seinem Vater gefahren, weil er erzählen wollte, von Anna, der Patientin, die ihn gestern so aus der Bahn geworfen hatte, über die er sich nicht getraut hatte, mit Miriam zu reden, in der Annahme, dass diese unmöglich würde erfassen können, was eine taubblinde Patientin, die unerwartet in seiner Sprechstunde auftauchte, mit ihm anrichtete.
Leo suchte die Hände seines Vaters.
»Papa, können wir reden, bitte?«
»Ja, entschuldige.«
Sie blieben in dem kühlen Streifen, den das etwas undichte Fenster ausstrahlte, stehen, sich halb einander zugewandt und Leo berichtete von den Nöten, von denen Anna ihm erzählt hatte. Von ihrer praktisch kompletten Isolation zu Hause, wo niemand sie verstand, dem plötzlichen Verlust all ihrer Freunde, die sie kaum selbstständig erreichen konnte, von ihrem Alleinsein, der Überforderung ihrer Eltern, ihrem Frust, dem Streit, ihrem Rückzug, weil sie immer wieder das Gefühl hatte, alles nur falsch zu machen, ihnen eine Last zu sein. Sie musste dort raus, sie wollte arbeiten, aber sie bekam keine Unterstützung. Hansen, der dolmetschen sollte, war kaum der Gebärdensprache mächtig, und interessierte sich nicht für sie. Er machte seinen Job mehr schlecht als recht, schleppte sie tageweise durch Hamburg, nahm sie zu welchen Unternehmungen auch immer mit und ließ sie unverstehend danebenstehen. Es war Anna wie ein Wunder vorgekommen, als er endlich zugestimmt hatte, dass sie diese Praxis aufsuchten. Er hatte das als Unsinn abgetan, sich aber schließlich nach vielen Wochen ihrer Beharrlichkeit ihrem Wunsch ergeben und sie in die Praxis gebracht.
Sein Vater folgte der Geschichte schweigend. Leo wusste, dass sie ihm mindestens so nahe gehen würde wie ihm selbst.
»Papa, wie in aller Welt kann ich ihr helfen? Seit sie gestern gegangen ist, kriege ich sie nicht mehr aus meinem Kopf. Ich bin genervt von meinen anderen Patienten mit ihren im Prinzip bedeutungslosen Wehwehchen. Ich habe nicht einmal Miriam von Anna erzählt.«
»Kommt sie wieder?«
»Ja, nächste Woche.«
»Warum ist sie taubblind?«
»Ich habe sie nicht gefragt. Sie könnte ein Usher-Syndrom haben. Ich denke, sie war schon immer taub und ihr Sehen ist langsam schlechter geworden. Sie gebärdet sehr gut. Sie spricht, glaube ich, kaum.«
»Anders als Mama.«
Leo zuckte zusammen. Sein Vater stieß auf den Kern seines Unbehagens zu, unerbittlich. Es war die ehrliche, so direkte Kommunikation der Gehörlosen, sie redeten praktisch nie um etwas herum.
»Ja, du weißt, dass ich Mama nicht als einen taubblinden Menschen in Erinnerung habe. Für mich war sie immer nur blind. Sie hat mit mir gesprochen. Ich habe ihre Stimme bis heute im Ohr.«
Die Hand seines Vaters strich zärtlich über seinen Arm: »Ich weiß, Leo. Du warst noch so klein.«
»Wie konnte sie nur so autark sein, Papa? Wie habt ihr beide zusammen es hinbekommen, euch so über eure Behinderungen zu erheben? Wie habt ihr es bloß geschafft, ein fast normales Leben zu führen? Eine Familie zu gründen … «
»Wie gut, dass wir uns getraut haben, Leo.«
Er spürte, wie die Arme seines Vaters ihn warm umfingen, dann wieder die Worte bildende Hand in seiner: »Du kannst doch ebenso stolz auf dich sein. Schau, was du erreicht hast. Du hast dich durch dieses Studium gekämpft, in einer fremden Stadt, ohne wesentliche Hilfe. Du arbeitest seit mehreren Jahren selbstständig und verdienst deinen eigenen Lebensunterhalt. Du hast eine Freundin, mit der du die Begeisterung für die Musik teilst.«
»So soll es doch auch sein, Papa. Das muss alles gehen. Die Umwelt muss einem nur die Möglichkeit dazu geben. Hast du eine Idee, wie ich ihr helfen kann?«
»Wenn sie so gut gebärdet, warum bringst du sie nicht am Wochenende mal mit zu einer der Aktionen im Gehörlosenverband? Dort könnte sie vielleicht neue Menschen kennenlernen.«
»Ja, vielleicht wäre das zumindest ein Anfang.«
»Obwohl … «
»Obwohl?«
»Es gibt nicht mehr viele junge Gehörlose dort. Sie treffen sich alle draußen unter sich. Den Gehörlosenverband scheinen nur noch wir Alten zu brauchen. Und … «
»Was, Papa?«
»Praktisch alle Kinder bekommen heute ein Cochlea Implantat, wenn sie gehörlos sind. Wir werden immer weniger.«
Leo spürte die Trauer in den Worten, seine Hand suchte die Wange seines Vaters, er strich tröstend darüber.
»Nicht alle, Papa. Denk an Mia.«
Leo erfühlte das Lächeln im Gesicht seines Vaters und versuchte sein Gesicht in eine ähnliche Form zu bringen. Sein Vater würde es studieren, er las immer darin, solange sie nicht redeten. Mia, seine große Schwester, die einen Mann geheiratet hatte, der Sohn gehörloser Eltern war, und mit dem sie inzwischen zwei taube Kinder bekommen hatte. Mia, die nur für ihn an ihrem Sprechen gefeilt hatte.
»Schön, dass du gekommen bist, Leo. Sollen wir noch zusammen zu Abend essen?«
»Nein, Papa. Ich glaube, ich muss mal nach Hause. Miriam gibt sonst noch eine Vermisstenanzeige auf.«
»Wollt ihr nicht am Samstag mal wieder zu zweit kommen? Ich würde mich freuen. Wir haben ja heute unter uns geredet.«
»Gerne, Papa. Ich habe dich lieb.«
»Ich dich auch. Komm gut nach Hause. Oder soll ich dich schnell fahren?«
Normalerweise schlug Leo das Angebot immer aus, weil es ihn unselbstständig wirken ließ. Aber heute? Er war müde nach dem Rotwein von gestern Abend, der letzten Nacht und erschöpft nach dem Gespräch mit seinem Vater. Immer wieder vergaß er, welche Anstrengung es für sie beide bedeutete. Es war so viel langsamer als ihre jeweilige normale Kommunikation, aber wenigstens hatten sie diese Möglichkeit. Es war verlockend, sich nicht nochmal durch Hamburgs öffentliches Verkehrssystem mit all den Menschen und dem Lärm zu quälen.
»Heute nehme ich das sehr gerne an, Papa.«
Er genoss die schweigende Autofahrt mit seinem Vater. Sie verabschiedeten sich mit einer Umarmung voneinander.
IV
Leo zückte den Hausschlüssel. Mit einem Knarren öffnete sich die alte verzogene Haustür. Er trat langsam seinen Aufstieg an. Diese Treppenfluchten, heute nahm er sie in Ruhe, mit jedem Stockwerk streifte er ein Stück mehr des stillen Kokons ab, der ihn immer im Zusammensein mit seinem Vater umfing. Mit jeder Stufe bereitete er sich darauf vor, wieder in die hörende Welt einzutauchen. Schon durch die geschlossene Wohnungstür nahm er die Musik wahr, Geige und Klavier. Während er den Schlüssel leise im Schloss drehte und den Klick erspürte, bevor sich die Tür öffnete, lauschte er dem Stück, das mit dem Öffnen der Tür plötzlich laut und ungehemmt zu ihm drang. Er zog die Augenbrauen hoch. Die zweite Violinsonate von Bartók, das Stück dürfte selbst für Miriam eine Herausforderung sein. Die zum Teil dissonanten Klänge schmerzten in seinen Ohren nach der wohligen Stille, die er mit seinem Vater genossen hatte. Er stellte den Blindenstock zur Seite, den Rucksack daneben, weiter lauschend, erwartend, dass Miriam ihn gehört haben würde und sie ihre Musik unterbrechen, dass sie auf ihn zukommen würde, ihn in Kenntnis setzen würde, wer da mit ihr spielte. Nichts dergleichen geschah. Leo war müde, er kämpfte mit dem Kopfschmerz, der bei seinem Vater in den Hintergrund getreten war, ihn jetzt aber angesichts der wilden Musik wieder mit voller Wucht traf. Miriam hatte Besuch. Sie hatte heute Morgen nicht erzählt, dass jemand am Abend kommen wollte. Also wahrscheinlich etwas Spontanes, wie üblich unter ihren Musikerfreunden. Er glitt Richtung Wohnzimmer und blieb die Hand am Türrahmen in dessen Eingang stehen.
»Hallo Miriam.«
Die Musik stoppte sofort, erst war die Violine still, das Klavier klimperte noch einige Töne hinterher, dann schwieg es auch.
»Oh, hallo Leo. Nuno ist hier. Er ist spontan mitgekommen. Ich dachte, du kommst früher. Wir haben uns erstmal die Zeit bis zum Abendbrot mit Musik vertrieben. Aber jetzt, wo du da bist, könnten wir zum Abendbrot schreiten. Ich habe einen Nudelauflauf gemacht.«
Leo sog den Duft ein, er war unaufmerksam gewesen. Zunächst war er froh, dass diese Musik sistiert hatte, dass die Töne nicht weiter seinen schmerzenden Kopf quälten.
»Hallo Nuno. Ja, Abendessen ist eine gute Idee. Es duftet lecker.«
Er hing immer noch im Türrahmen und wartete auf sie.
»Hi Leo, wir haben uns lange nicht gesehen.«
»Noch nie, meinerseits wenigstens, um genau zu sein.«
Nuno lachte, parallel hörte Leo ein Klacken, Miriam legte die Violine auf dem Tisch ab. Einen Augenblick später war sie endlich bei ihm, ihre Arme umfingen ihn, er schloss die Augen und legte den schmerzenden Kopf auf ihre Schulter. Warum hatte sie gerade heute Nuno Einlass gewährt in die Intimität ihrer Wohnung? Er strich einmal sanft über ihren Rücken und machte sich schließlich wehmütig von ihr los.
»Lass uns in die Küche gehen.«
Der Abend war in einem üblichen Muster vorbeigezogen. Leo, der Miriam anfangs irgendwie müde erschienen war, war beim Abendessen aufgetaut, er hatte Nuno rasch in eine musikalische Diskussion verwickelt und die beiden waren, während sie nebenher aßen, tiefer und tiefer in die Abgründe der Musiktheorie vorgedrungen. Miriam war ihnen schweigsam gefolgt, hatte den ein oder anderen Kommentar hinzugefügt und sich nebenher um die Logistik des Abendessens gekümmert. Sie hatte ihn so gekonnt unterstützt wie immer, wenn Fremde mit ihnen am Tisch saßen und in der Regel dort ein Chaos anrichteten, das Leo unmöglich durchschauen konnte. Also tat sie ihm redend, instruierend auf, schenkte Wein und Wasser nach und machte ihm das Essen leicht. Für Miriam war diese Aufmerksamkeit inzwischen selbstverständlich. Sie beide benötigten sie nur, wenn Besuch da war. Wenn sie unter sich waren, hatte alles seinen angestammten Platz auf dem Tisch, so dass Leo sich mühelos selbst zurechtfinden konnte. Sie hatten anfangs vorsichtig versucht, auch ihren Freunden diese Achtsamkeit beizubringen, waren aber kläglich gescheitert, so dass sie rasch, ohne es zu diskutieren, jeder für sich entschieden hatten, dass dies ihre Aufteilung war, wenn sie Besuch hatten. Miriam kümmerte sich um die Logistik und Leo nahm die Rolle des Unterhalters ein. Er beherrschte dies bis zur Perfektion. Immer wieder war Miriam seine Wortgewandtheit, letztlich auch die Fülle seines Wissens, all die Themen, die er bedienen konnte, fast unheimlich. Heute genoss sie das Vertraute ihrer Interaktion. Sie hatte überhaupt nicht vorgehabt, Nuno zu sich nach Hause einzuladen, aber dieser hatte sie bedrängt, doch mit zu ihm zu kommen, er war ihr so nahegetreten, dass sie schließlich diese Ausflucht angetreten hatte. Insgeheim hatte sie gehofft, dass Leo vor ihr zu Hause sein würde und sie sich nicht allein mit Nuno würde herumschlagen müssen. Unerwarteterweise war er nicht da gewesen. Unsicher, wie sie mit Nuno ins Gespräch kommen sollte, hatte sie ihn gezwungen, mit ihr die Küche zu entern und sie zu unterhalten, während sie