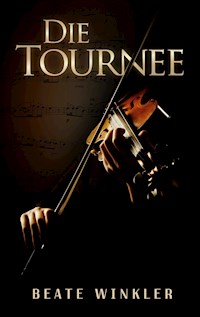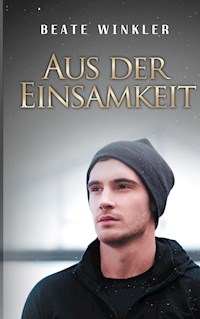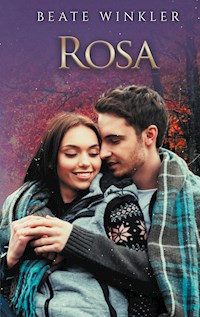Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ben ist stumm. Er studiert Biochemie und lebt zusammen mit seiner Schwester Hannah. Er spielt Squash mit ein paar Kommilitonen und ist ansonsten für sich. Er hat keine Sprache. Wenn er sich äußern möchte, muss er zum Stift greifen. Als seine Schwester und ihr Freund sich näherkommen, fühlt er sich so fehl am Platz, dass er beginnt nach einer neuen Bleibe zu suchen. Durch puren Zufall landet er in einer Wohngemeinschaft, in der Gebärdensprache gesprochen wird. Seine Mitbewohner bieten ihm Unterricht an. Ben zögert, doch schließlich widmet er sich der für ihn neuen Sprache. Einiges bleibt schwierig, doch er erlebt die Möglichkeiten, die eine aktive Sprache ihm gibt. Plötzlich gibt es Worte in seinen Händen, er kann sich äußern, zeigen, wer er ist und was er denkt. Er taucht ein in diese Sprachgemeinschaft. Er findet Freunde und seine erste Liebe. Er fühlt sich mit Bennet, Lena, Hans, Vera und vor allem Sophia so zu Hause, so angenommen wie nie zuvor in seinem Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 788
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ben ist stumm. Er studiert Biochemie und lebt zusammen mit seiner Schwester Hannah. Er spielt Squash mit ein paar Kommilitonen und ist ansonsten für sich. Er hat keine Sprache. Wenn er sich äußern möchte, muss er zum Stift greifen. Als seine Schwester und ihr Freund sich näherkommen, fühlt er sich so fehl am Platz, dass er beginnt nach einer neuen Bleibe zu suchen. Durch puren Zufall landet er in einer Wohngemeinschaft, in der Gebärdensprache gesprochen wird. Seine Mitbewohner bieten ihm Unterricht an. Ben zögert, doch schließlich widmet er sich der für ihn neuen Sprache. Es bleibt schwierig, doch er erlebt die Möglichkeiten, die eine aktive Sprache ihm gibt. Plötzlich gibt es Worte in seinen Händen, er kann sich äußern, zeigen, wer er ist und was er denkt. Er taucht ein in diese Sprachgemeinschaft. Er findet Freunde und seine erste Liebe. Er fühlt sich mit seinen Mitbewohnern so zu Hause, so angenommen wie nie zuvor in seinem Leben.
Beate Winkler, 1973 in Hamburg geboren, studierte Medizin in Lübeck. Ihre Weiterbildung zur Kinderonkologin absolvierte sie in Tübingen und Würzburg. Seit 2015 lebt sie mit ihren zwei Söhnen in ihrer Heimatstadt. Sie arbeitet weiterhin als Ärztin und schreibt in ihrer Freizeit. Die Worte in unseren Händen ist ihr siebter Roman.
Außerdem von Beate Winkler erschienen:
Viersamkeit
Flucht in die Zweisamkeit
Aus der Einsamkeit
Der eigene Weg
Das Implantat
Rosa
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
I
»Hallo, Kleiner!«
Nicht gerade meine Lieblingsbetitelung, ich sah kurz zu ihr auf und nickte. Hannah beugte sich zu mir herunter und nahm mich von hinten halb in den Arm, parallel fiel ihr Rucksack auf den Boden. Sie war stürmisch wie immer. Als sie einen Blick auf den Bildschirm des Laptops erhaschte, hielt sie abrupt inne.
»Was … machst du da, Ben? Suchst du etwa nach einer Wohnung?«
Wie immer sprach sie gleich für mich mit. Hannah war meine jüngste ältere Schwester. Sie war mir nah, viel vertrauter als die beiden Größeren. Wir hatten schon als Kinder zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Als sie nach ihrem Abitur auszog, blieb ich als jüngstes Kind allein zurück. Zwei Jahre später hatte ich ebenfalls meine Prüfungen erfolgreich absolviert, weder für Hannah noch für mich hatte es eine Frage darüber gegeben, ganz selbstverständlich war ich ihr nach Süddeutschland, nach Tübingen gefolgt. Ich zog mit in ihre Wohnung ein, das war praktisch und für unsere Eltern günstiger.
Eigentlich war es perfekt, ich hatte Hannah an meiner Seite, keiner kannte mich besser, keiner konnte mich besser unterstützen. Unsere Eltern waren beruhigt, weil sie über Hannah von mir hörten, sozusagen über meinen Werdegang durch sie informiert waren.
Wir lebten zusammen wie Bruder und Schwester, sprachen uns ab, wer wann einkaufte, es gab einen Putzplan, ein wenig wie in einer WG oder in einer Kommune. Es war alles gut und ruhig, sortiert. Ich merkte manchmal kaum, dass ich zu Hause ausgezogen war. Aber ich fühlte mich nicht kontrolliert durch Hannah. Wir lebten unter einem Dach, oft nebeneinanderher, jeder ging seinem Studium und seinen Hobbys nach und manchmal trafen wir uns fast zufällig zu Hause. Ein gemeinsames Abendessen oder Frühstück – eigentlich schön, nicht allein zu sein.
Hannah stupste mich an, sie hatte sich neben mich auf das Sofa fallen lassen und widmete mir einen kritisch-fragenden Blick.
»Ben, willst du ausziehen? Suchst du nach einer anderen Bleibe? Gefällt es dir hier nicht mehr?«
Ich zuckte die Schultern. Sie stöhnte ein wenig.
»Was ist los, Ben? Erzähl!«
Sie fischte einen Block und einen Stift vom Tisch, hielt mir meine ewigen Begleiter auffordernd unter die Nase. Gleichzeitig klingelte es: meine Erlösung. Keine Diskussion jetzt. Ich fuhr den Laptop herunter, griff kurz nach Block und Stift und schrieb: Muss zum Sport. Morgen reden wir, ja?
Es war nicht nett von mir, ich ließ sie mit dem Satz sitzen, warf nicht einmal einen Blick zurück. Ich ergriff meine Sporttasche, die schon vorbereitet im Flur auf ihren abendlichen Einsatz wartete, und flüchtete aus der Wohnung, vor einem wahrscheinlich schwierigen Gespräch.
Unten wartete Tony auf mich, schon in Sportklamotten, sein Rennrad zwischen den Beinen.
»Hey, Ben, alles klar?«
Ich hielt den Daumen hoch, wir klatschten uns zur Begrüßung ab.
»Was für ein cooles Wetter, fast schade, die Zeit beim Squash drinnen zu verbringen. Also, auf geht’s!«
Ich hatte inzwischen mein Fahrrad losgekettet, die Tasche geschultert, so fuhren wir los.
»Danach Biergarten? Bei dem Wetter, wie wär’s?«
Ich nickte, nicht sicher, ob Tony es aus dem Augenwinkel erkennen würde. Eigentlich egal, er würde sicher nachher noch mal fragen. Beim Court trafen wir Axel und Martin, damit war unser Vierer komplett. Wir spielten in wechselnder Besetzung. Es tat gut, sich zu bewegen, den Ball wie einen Blitz durch den Court zu jagen, die Augen überall, gespannt bis in die letzte Faser, maximale Aufmerksamkeit, Schnelligkeit, Kraft, ein paar Tricks und unerwartete Bälle – ich mochte das.
»Mann, Ben, was ist denn heute los mit dir? Frust oder warum drischst du so auf den Ball ein?«, Tony holte den Ball aus der hinteren linken Ecke, schüttelte den Kopf und murmelte vor sich hin, »die Dinger sind echt nicht zu kriegen …«
Ich grinste, Augenbrauen hoch, und schwang den Schläger lässig in der Hand, das Signal zum Weitermachen.
»Okay, okay. Aber hab Erbarmen, sonst bin ich in zehn Minuten am Ende.«
Ich versuchte mich ein wenig zurückzuhalten. Tony hatte recht.
Immer wenn mir etwas zu schaffen machte, tobte ich mich beim Sport aus. Meist war ich dann noch besser als sonst und ein nicht besonders netter oder rücksichtsvoller Gegner.
Ja, ich rang mit etwas, die Wohnung … Mist, den Ball verpasst, jetzt nicht denken, spielen, sonst verlierst du. Wir spielten etwas gesitteter weiter, nach eineinhalb Stunden war es vorbei. Alle vier verschwitzt, erschöpft und glücklich von den Endorphinen, die durch unseren Körper strömten.
Tony grinste: »Also, Leute, noch in den Biergarten? Das Wetter ist himmlisch.«
Wie erwartet, Wiederholung der Frage. Wir stimmten zu.
Frisch geduscht auf die Fahrräder, und wir fuhren am Neckar entlang bis zu unserem Standardbiergarten. Wir eroberten einen Platz am unteren Ende der Bierbank mit Blick auf den Neckar, der um diese Jahreszeit eher einer trüben Pfütze als einem echten Fluss glich.
Die Kellnerin kam rasch, die anderen gaben ihre Bestellung auf.
Tonys Blick zu mir: »Was nimmst du, Ben? Wieder ein Radler?«
Ich nickte, einfacher, wenn man ein Standardgetränk hat. Die drei versenkten sich ins Gespräch. Unsere Getränke kamen. Ich nippte gedankenverloren an meinem Radler und hörte ihnen nur halbherzig zu. Über der braunen Brühe des Neckars schwebte ein Mückenschwarm, lästiges Beiwerk des Sommers. Der Biergarten war brechend voll, jeder wollte sich einen schönen Abend draußen in der untergehenden Sonne machen. Alle kamen hierher, Jung und Alt, Touristen und Einheimische, Familien, Gruppen und Pärchen. Hunde lagen im Staub, ein kleiner Junge lief wackelig zwischen den Tischen herum und klaubte immer wieder den einen oder anderen Kiesel auf.
Die Wohnung … eigentlich war es so eine gute Lösung mit Hannah zusammenzuwohnen. Allein würde es vielleicht schon schwierig mit den Besichtigungen werden, Telefonate, Termine ausmachen … Das Problem war Karl, Hannahs Freund. Eigentlich mochte ich ihn, ein netter Kerl. Sie waren seit ein paar Monaten zusammen. Ich sah, wie gut er Hannah tat, er trug sie auf Händen, machte ihr Komplimente, kleine Geschenke, sie machten gemeinsam Ausflüge. Natürlich kamen sie auch zusammen in unsere Wohnung. Zum Abendessen, sie schliefen gemeinsam, morgens musste man sich im Bad sortieren, dann Frühstück. Sie sehen sich verliebt an und reden und reden und reden. Am Anfang saß ich bei den Mahlzeiten dabei, versuchte zuzuhören, immer in Sorge, dass mich eine Frage träfe. Er wollte nett sein, mich einbinden. Ich fand es anstrengend, hätte lieber einfach nur zugehört. Immer öfter zog ich mich zurück, wenn sie zusammen nach Hause kamen. Ich blieb in meinem Zimmer, gab vor, zu lernen, machte etwas an meinem Computer, was auch immer. Hauptsächlich vermisste ich die Zweisamkeit mit Hannah, die ruhigen Stunden, die wir zuvor so oft gemeinsam genossen hatten. Zusammen essen, Fahrrad fahren, ins Kino gehen, vor dem Fernseher abhängen. Jetzt machte sie das alles mit Karl. Ich wusste, dass es richtig war, eben der Lauf der Dinge. Ich hatte immer gewusst, dass ich keinen Anspruch auf sie haben könnte, dass irgendwann jemand kommen würde und ihr wichtig ist, wichtiger als ihr kleiner Bruder. Mir blieb nichts anderes übrig, ich musste mich der Realität stellen. Wahrscheinlich war es höchste Zeit, dass ich wirklich begann, auf eigenen Beinen zu stehen und nicht am Rockzipfel meiner großen Schwester zu hängen.
»Hey, Ben, ich fahre nach Hause. Du auch?«
Ich stimmte mit einem Nicken zu. Wir radelten noch ein Stück gemeinsam, dann bog Tony ab. Ich nahm die Unterführung unter den Gleisen am Hauptbahnhof, die Trennung der Innenstadt von der Südstadt. Je näher ich unserer Wohnung kam, umso langsamer wurde ich. Ob Hannah noch wach war? Vielleicht war sie auch zu Karl gefahren … Hauptsache kein Gespräch mehr heute Abend.
Ich war müde und wollte nur noch schlafen.
Ich hatte Glück. In der Wohnung regte sich nichts, als ich leise die Tür aufschloss und in das Halbdunkel trat. Ich bewegte mich fast wie ein Einbrecher, als gehörten diese Wände schon nicht mehr mir, als sei der Abschied schon vollzogen.
Im Bett öffnete ich noch einmal meine Merkliste auf der Immobilienhomepage – wahrscheinlich würde es teurer werden als jetzt oder viel weniger schön. Ich füllte einige Kontaktformulare aus, für den eigentlichen Besichtigungstermin sollte man eine Telefonnummer angeben. Ich gab unsere Festnetznummer an, Hannah würde mir helfen. Ich würde mich morgen wohl oder übel der Diskussion mit ihr stellen müssen.
Nach einer unruhigen Nacht gelang es mir am nächsten Morgen, unbemerkt aus der Wohnung zu schlüpfen. Uni – Vorlesungen und Praktika, in der Regel eine gute Ablenkung, aber heute war ich nicht wirklich bei der Sache. Es war schon später Nachmittag, als ich mich auf den Heimweg machte. Wieder kam ich zu Hause an, mit einem unguten Gefühl im Bauch. Wir mussten reden …
Ich dachte kurz darüber nach, das Gespräch vorzubereiten, schon etwas aufzuschreiben, um mich zu erklären, bevor sie begann zu fragen. Ich verwarf den Gedanken jedoch, es würde schon gehen.
Noch mal klickte ich durch das Internetportal, ein paar neue Einträge. Ein WG-Zimmer in der Südstadt, gleich um die Ecke. Als Kontakt war eine Handynummer angegeben mit dem Vermerk »Bitte nur SMS« – ich schmunzelte, nichts lieber als das. Manchmal ist es doch einfacher als erwartet.
Aus einer Laune heraus schrieb ich auf die Anzeige, nur ein Vorname war angegeben: Liebe Lena, ich hätte möglicherweise Interesse an dem Zimmer in der WG. Gibt es einen Termin für eine Besichtigung? Ben Weller
Es klopfte, Hannah steckte den Kopf zur Tür herein.
»Hi, Ben. Können wir jetzt reden, bitte?«
Ich nickte und machte ihr Platz auf meinem Bett. Wir saßen halb einander zugewandt im Schneidersitz, unsere typische Gesprächsposition. Man kann sich ansehen, die Züge des anderen studieren, die Haltung mehr spüren als sehen. Man ist sich nah, kann sich aber auch ausweichen, den Blick abwenden – und Hannah kann mir beim Schreiben einfach zusehen.
»Und hau heute bloß nicht wieder einfach ab!«
Ich machte ein zerknirschtes Gesicht. Unsere Blicke trafen sich kurz, eine stumme Entschuldigung, Hannah verstand sie.
»Also, was ist los? Suchst du wirklich eine Wohnung?«
Wieder suchte ich nur ihren Blick, sie las forschend in meinem.
Schließlich wandte sie sich ab und fragte ganz leise: »Es ist wegen Karl, oder?«
Sie sah auf, in meinen sich abwendenden Blick. Ich konnte sie nicht ansehen, zuckte die Schultern und nickte vorsichtig.
»Aber warum, Ben? Er ist so nett zu dir. Du bist unfair …«
Sie machte eine Pause, die Stille füllte den Raum. Sie knetete die Hände in ihrem Schoß, wischte sich mit dem Handrücken über die Augen. Sie weinte, das wollte ich nicht. Nicht weinen. Ich legte meinen Arm um sie. Zeit für meinen Block, für das Schreiben, meine einzige Ausdrucksmöglichkeit.
Ich bin von Geburt an stumm. Keiner weiß so genau, warum. Zunächst war es niemandem aufgefallen, nach all den Mädchen in meiner Familie, hieß es wieder und wieder, Jungen seien eben Spätzünder und es sei nicht selten, dass sie mit drei noch immer nicht sprechen. Und zu meiner Mutter: Du musst es ihm nicht durchgehen lassen, warum gibst du ihm die Marmelade, wenn er nur mit dem Finger darauf weist, zwing ihn zu sprechen, belohne ihn, dann wird es schon werden.
Es dauerte lange, bis sie mich schließlich untersuchten und ich mit den Logopädie-Stunden beginnen musste. Es war in der Vorschulzeit und es war furchtbar. Es funktionierte einfach nicht. Sie unterstellten mir psychische Probleme, meinen Eltern noch Schlimmeres. Es klappte nicht, ich sprach nicht, es war ein Ding der Unmöglichkeit. Ich gab mir Mühe, kämpfte mit mir selbst. Die Erfolgserlebnisse blieben aus. Meine Mutter erbarmte sich meiner nach einigen Monaten und beendete diese Stunden, die mich so quälten. Meine Mutter ist eine unkonventionelle Frau. Sie zuckte die Schultern, ließ sich von niemandem hereinreden und nahm mich an, wie ich war. Statt der nervenaufreibenden Sprachstunden übte sie mit mir das Schreiben. Ich lernte schnell, zu groß war das Bedürfnis, mich auszudrücken, mein Gegenüber verstehen zu lassen, was los war. Meine Mutter erzählt heute noch, dass ich unermüdlich schreiben geübt und schnell gelernt hätte. Meine Ausdrucksmöglichkeit, die einzige eindeutige, differenzierte, bis heute.
Man nutzt das Schreiben nicht so wie das Reden. Es ist langsamer und umständlich, nicht schlagfertig. Man denkt beim Schreiben mehr über das nach, was man wirklich sagen möchte, es ist festgelegt, schwarz auf weiß. Immer wieder staune ich, wie viele Worte die Menschen jeden Tag verbrauchen, ohne wirklich etwas zu sagen. Als würden sie sprechen, um Laute von sich zu geben, als müssten sie beweisen, dass sie da sind.
Ich begann zu schreiben, Hannah saß angelehnt an mich und sah mir dabei über die Schulter, sie schniefte noch ein wenig. Ich schrieb zunächst zögerlich. Oft fiel es mir schwer, den Anfang zu finden. Hannah, du verstehst mich falsch.
Sie zog die Augenbrauen hoch und grinste sogar ein wenig. Mein ewiges Problem, mich verständlich zu machen.
Ja, es ist wegen Karl. Aber nein, ich bin nicht eifersüchtig. Ich mag Karl. Ich sehe, dass er dich mag und du ihn. Es ist alles gut. Nur – wenn ihr zusammen seid, komme ich mir wie das fünfte Rad am Wagen vor. Ich habe das Gefühl, ich störe. Karl ist mein Schweigen nicht gewohnt. Es ist komisch für ihn. Ihr seid nicht unbefangen, wenn ich dabei bin. Ich möchte auf keinen Fall provozieren, dass ihr euch meinetwegen streitet. Ich möchte nur nicht stören. – Außerdem wird es vielleicht Zeit, dass ich wirklich auf eigenen Beinen stehe, du kannst ja nicht meine Nanny sein, bis ich 90 bin.
Sie sah mich mit großen Augen an, die Tränen waren zu kleinen Salzspuren auf ihrem Gesicht getrocknet. Langsam machte sich ein kleines Lächeln auf ihrem Gesicht breit. Schließlich schloss sie mich in die Arme. Mich wieder wegschiebend, musterte sie mich kritisch.
»Bist du ganz sicher, Ben?«
Ihr könntet sogar zusammenziehen, groß genug ist es ja hier.
Sie lachte.
»Jetzt mach aber mal langsam. Ganz ehrlich: ein neues Zimmer wird nicht einfach zu finden sein. Das meiste ist entweder teuer oder schlecht.«
Ich zuckte die Schultern.
»Aber man kann ja mal anfangen. In Tübingen willst du aber schon bleiben, oder?«
Ja, sicher. Ich habe schon für einige Wohnungen angefragt und unsere Telefonnummer hinterlegt. Kannst du die Termine für mich ausmachen?
»Ja, das kann ich. Ich komme auch gerne mit gucken. Ich muss doch sehen, wo mein kleiner Bruder abbleibt.«
Ich würde sie brauchen, es ist zu schwierig allein. Hannah würde für mich die Termine ausmachen, mit mir die Wohnungen ansehen, mit den Vermietern reden … Ob sie wohl eine Wohnung oder ein Zimmer an einen Stummen vermieten würden?
Das Telefon unterbrach unser Gespräch. Eigentlich war es glimpflich ausgegangen. Ich hätte mir nicht so viele Sorgen machen müssen. Hannah kennt mich so gut. Der einzige Mensch neben meiner Mutter.
Da war sie schon wieder.
»Der erste Termin steht, gleich morgen.«
Wir meisterten die Besichtigungen gemeinsam, letztlich immer ein ähnliches Schema. Am ersten Abend zeigte uns ein Mittvierziger eine Einzimmerwohnung mit Küchenzeile, nicht direkt in Tübingen, ein paar Dörfer weiter. Hannah und ich waren zusammen mit dem Fahrrad gefahren, die Distanz prinzipiell okay, aber doch unpraktischer, als in der Stadt zu wohnen.
Der Makler wartete schon vor dem Haus, als wir ankamen. »Meyer.«
Er schüttelte erst Hannah, dann mir die Hand.
»Hannah Weller. Das ist mein Bruder Ben. Für ihn gucken wir die Wohnung an.«
Ich schüttelte schweigend die Hand von Herrn Meyer, sein Blick glitt an mir vorbei. Immer wieder fiel mir auf, wie oft Menschen miteinander redeten, ohne sich anzusehen. Herr Meyer grüßte nicht einmal mit einem Blick. an.
Er ging uns voran, die Treppe hinauf, redete vor sich hin und pries die Wohnung
»Sie ist im zweiten Stock, klein, aber fein. Und günstig.«
Er schloss die Wohnungstür auf, uns weiterhin den Rücken zugewandt.
»Zu wann soll es denn sein?«
Hannah warf mir einen fragenden Blick zu. Ich zuckte kaum merklich die Schultern.
»So bald wie möglich. Ab wann ist sie denn frei?«
»Oh, sie steht schon seit ein paar Monaten leer.«
Damit betraten wir eine in Düsternis gehüllte Wohnung, die Vorhänge geschlossen, es roch muffig. Er machte Licht.
»Na ja, ein wenig lüften müsste man hier.«
Ich ließ den Blick durch den jetzt in grelles Licht getauchten Raum gleiten, die Küchenzeile ein wenig schäbig, aber sauber. Kühlschrank, Herd, Spüle, was man so braucht. Das Zimmer vielleicht zwanzig Quadratmeter groß, am Boden ein alter Teppich, die Farbe undefinierbar, ein paar Brandflecke in der Mitte des Raums. Herr Meyer redete weiter mit Hannah, ich hörte kaum zu, es zog mich zum Fenster. Ich schob den dunkelroten Vorhang ein wenig zur Seite.
Herr Meyer im Hintergrund: »Die Wohnung geht nach Süden, Sie müssten ganz gut Licht hier haben.«
Nach Süden, der Blick nach draußen – über die Landstraße, die durch das Dorf führte, dahinter einige ältere Häuser, dann die Felder – ganz okay.
Herr Meyer machte schon weiter.
»Das Bad, das müssen Sie noch sehen. Das fehlt ja noch. Es ist vielleicht ein wenig klein. Aber Sie wollten ja allein hier einziehen, oder?«
Herr Meyer drehte sich zu mir um und nahm mich plötzlich direkt ins Visier.
Ich lugte an ihm vorbei in ein winziges Bad mit Dusche, im Beige der Siebziger. Ich spürte seinen Blick auf mir ruhen, ach ja – seine Frage. Ansehen und nicken. Herr Meyer musterte mich ein wenig irritiert.
»Ja, Sie haben schon alles gesehen. Was gibt es noch an Fragen?«
Mir schossen ein paar durch den Kopf. Wer wohnt denn noch hier? Unten habe ich sechs Klingeln gesehen. Junge Leute oder nur ältere? Familien? Gibt es auch größere Wohnungen hier? Wie oft fährt der Bus nach Tübingen?
Hannah übernahm: »Was hatten Sie noch gesagt, soll das Zimmer kosten? War das kalt oder warm?«
Er nannte eine Zahl, die eigentlich zu hoch war für die Wohnung, ihre Größe, ihre Lage.
»Und Ihre Provision?«
»Drei Monatsmieten. Junger Mann, was machen Sie denn eigentlich? Arbeiten Sie?«
»Mein Bruder studiert noch. Biochemie.«
Er hatte zu mir geblickt, wandte sich jetzt wieder Hannah zu. Langsam war er ein wenig irritiert, dass alle Antworten von ihr kamen.
»Ja, können Sie sich das eigentlich leisten? Wie sind Ihre Sicherheiten? Oder zahlen Ihre Eltern?«
»Ben jobbt nebenher, unsere Eltern steuern etwas zur Miete bei.«
Fast unwirsch unterbrach er sie: »Sagen Sie mal, reden Sie immer für Ihren Bruder? Er kommt ja gar nicht zu Wort.«
Hannah und ich tauschten einen Blick, sie zwinkerte mir zu und grinste ein wenig: »Ja, das tue ich. Ben ist stumm.«
Klassisch Hannah, sie liebte es, die Leute vor den Kopf zu stoßen. Es war ein Spiel, wie oft hatten wir es gespielt. Sie redete einfach für mich, es war immer ein wenig, als sei ich kaum da. Die Umgebung nahm es erst hin, im Laufe der Gespräche fiel in der Regel meine Schweigsamkeit doch auf und irgendwann, wenn sie sich trauten, kamen die Fragen: Warum reden Sie für ihn? Wollen Sie nicht einmal selbst Stellung beziehen? Oder etwas Ähnliches. Hannahs Antwort immer kurz, knapp und direkt.
Herr Meyer guckte genauso irritiert, wie wir es erwartet hatten. Er holte erstaunt Luft. Sein Blick wich meinem aus. Er murmelte vor sich hin.
»Stumm … was es alles gibt«, dann sah er auf, zu Hannah, nicht zu mir, »das müsste ich erst mal mit den Vermietern besprechen, ob ihnen das eigentlich recht ist. Hätten Sie es nicht gleich sagen können? Dann hätte ich es vorab besprochen und wäre nicht umsonst hierhergekommen.«
Hannah sah ihn scharf an.
»Warum besprechen? Macht es einen Unterschied, ob man sprechen kann oder nicht, solange man die Miete pünktlich zahlt?«
Er begann ein wenig zu stottern: »Na ja, die Vermieter … sie müssen es zumindest wissen. Er …«, es war, als sei ich gar nicht da, »kann ja nicht einmal telefonieren, wenn es ein Problem gibt. Es ist schwierig, Dinge zu besprechen. Sie werden ja nicht immer verfügbar sein, oder?«
»Ben kann gut allein auf sich aufpassen. Er kann schreiben oder sind die Vermieter des Lesens nicht mächtig?«
Hannah drehte mal wieder auf, ich warf ihr einen warnenden Blick zu.
»Aber, Ben, das kannst du doch nicht so auf dir sitzen lassen.«
Ich sah sie nur an, meine Antwort im Kopf: Hannah, er will sie doch nur informieren, sie fragen. Das ist doch okay.
Meyer guckte von einem zum anderen.
»Na, lassen wir das. Wahrscheinlich wäre es ja wirklich kein Problem. Haben Sie denn prinzipiell Interesse an der Wohnung?«
Der Blick nach draußen, die Felder im Hintergrund, ich sah ihn an und nickte.
»Also dann – machen wir es gleich fertig?«
Er zückte ein paar Papiere. Hatte er nicht noch mit den Vermietern sprechen wollen?
Hannah stellte sich neben mich.
»Wir überlegen es uns und rufen Sie an, ja? Sie wollten doch noch mit den Vermietern reden und wir haben noch ein paar weitere Objekte zur Besichtigung. Es ist ein bisschen weit draußen hier. Vielleicht ergibt sich noch etwas Besseres. Ich melde mich Anfang der Woche bei Ihnen.«
Meyer, der schon eifrig mit seinen Zetteln herumgewerkelt hatte, den Kugelschreiber bereits gezückt, ließ alles etwas enttäuscht wieder sinken. Wohl doch nicht das schnelle Geld.
»Also gut. Meine Nummer haben Sie ja.«
Wir fuhren zurück Richtung Tübingen, bis Hannah plötzlich an einer Heckenwirtschaft abstieg und ihr Fahrrad an den Zaun lehnte.
»Komm, trinken wir noch etwas. Lass uns das mit der Wohnung besprechen.«
Wir ließen uns auf einer Bierbank nieder. Ein uralter Baum breitete seine Äste schützend über den Tisch und spendete ein wenig Schatten. Hannah bestellte zwei große Apfelschorlen, durstig nach unserer Fahrradtour. Mein Blick glitt über die Felder, die sich in der untergehenden Herbstsonne endlos zu erstrecken schienen.
Hannahs Hand berührte meine, ganz leicht.
»Hey, Ben.«
Sie holte mich in die Realität zurück. Ihr fragender Blick. »Wie hat dir die Wohnung gefallen?«
Ich zückte meinen Block.
Ganz okay. Bisschen weit draußen. Der Blick über die Felder war schön.
Sie lächelte ein wenig, ihr Kopf schräg gelegt, blinzelte sie gegen die Sonne.
»Du bist so ein Träumer, Ben. Eigentlich ist die Miete zu hoch für die Ausstattung. Und sie ist verdammt weit draußen. Wie willst du es abends mit dem Sport machen? Willst du die Tour wirklich viermal am Tag fahren?«
Ich musste grinsen: Dann bräuchte ich keinen Sport mehr.
»Mensch, Ben. Natürlich brauchst du ihn. Wie willst du sonst mit deinen Kumpels Kontakt halten?«
Hannah hatte recht. Tony, Axel und Martin – ich wäre nicht Mitglied der Truppe, wenn sie mich nicht als Squashpartner bräuchten. Ich war zuverlässig, sagte praktisch nie ab. Ich war gut und wir hatten zusammen Spaß am Spiel. Verband uns sonst noch etwas? Mit Tony vielleicht, mit den anderen sicher nicht.
Hannah leerte ihre Apfelsaftschorle fast in einem Zug und warf mir einen auffordernden Blick zu.
»Also, wir suchen weiter, oder?«
Wir suchten weiter, verbrachten jeden Abend der Woche mit ein oder zwei Besichtigungen. Jede Wohnung hatte ihr Manko, zu weit weg, zu klein, zu schäbig, zu teuer.
Freitagabend waren wir beide ziemlich genervt und desillusioniert. Wir hatten gemeinsam unser Abendessen gekocht und verspeist. Es war so schön, so vertraut mit Hannah. Wir standen gemeinsam in der Küche, einer schnippelte Gemüse, einer kochte, Hand in Hand, wir brauchten keine Worte. Hannah hatte von ihrer Woche in der Uni erzählt.
»Magst du noch einen Tee, Ben?«
Sie sagte es schon halb im Aufstehen, kurzer Blick zurück, um mein Nicken zu erwischen, eigentlich wusste sie die Antwort schon.
Mit zwei dampfenden Bechern landeten wir auf dem Sofa.
»Am Wochenende fahre ich mit Karl weg. Du hast die Wohnung ganz für dich allein. – Wo wir hinfahren?«
So machte Hannah es oft, sie stellte die Fragen an meiner Stelle.
»Wir fahren auf die Alb zum Wandern, solange das Wetter noch so schön ist«, sie unterbrach sich unvermittelt, »Ben, mit der Wohnung – willst du es dir nicht noch einmal überlegen? Von mir aus musst du nicht ausziehen. Du störst nicht. Nicht Karl und mich schon gar nicht. Willst du nicht doch einfach bleiben?«
Ich sah sie einen Moment an, bevor ich vorsichtig den Kopf schüttelte.
Sie machte weiter.
»Ich habe auch mit Karl darüber gesprochen, meinst du nicht, dass es zu einsam für dich wird, ganz allein in einer Wohnung? Ich … also wir haben uns Gedanken darüber gemacht.«
Ihr denkt über mich nach? Redet über mich wie Eltern über ein Kind? Ein Sorgenkind? Ich merkte, wie sich meine Stirn in kritische Falten legte. Hannah sah es sofort. Es gab niemanden, der intensiver meine Mimik in einem Gespräch studierte.
»Ärger dich nicht gleich, Ben. Es ist nicht böse gemeint. Karl meinte, ob nicht eine WG vielleicht eine gute Idee wäre.«
Eine Wohngemeinschaft? Ehrlich gesagt glaubte ich nicht, dass ich, gegen welche Konkurrenz auch immer, einen guten Stand hätte. Sie würden im Zweifel immer jemanden vorziehen, der mit ihnen reden konnte.
Ich weiß nicht.
»Wir können ja die Suchstrategie erweitern und mal sehen, was so auf dem Markt ist. – Du, ich schlafe heute Nacht bei Karl. Wir wollen morgen früh zeitig los.«
Sie pflanzte noch einen Schwesterkuss auf meine Wange, bevor sie ging und mich allein in unseren vier Wänden zurückließ.
Später am Abend durchbrach das Klingeln des Telefons die Stille der Wohnung – meine Mutter, sie hinterließ ein paar Sätze auf dem Anrufbeantworter.
Ich griff zu meinem Handy und schrieb ihr eine Nachricht.
Hallo, Mama. Hannah ist bei Karl. Sie wollen am Wochenende wandern gehen. Hallo, Ben. Gut von dir zu hören. Und deine Pläne für das Wochenende?
Weiß noch nicht. Sport, lernen.
Hannah hat von deinem Wohnungsprojekt erzählt.
Ich stöhnte innerlich, nie konnte sie etwas für sich behalten.
Ja.
Musst du wirklich unbedingt ausziehen, Ben?
Weiß nicht. Ich gucke.
Warum? Wo ist das Problem? Es hat doch immer so gut geklappt mit euch beiden.
Jetzt hat sie Karl.
Du kannst ihr keinen Vorwurf machen. Das musste irgendwann kommen, Ben.
Ich mache ihr keinen Vorwurf.
Magst du Karl nicht?
Doch.
Also, dann lass es, wie es ist. Hannah hat erzählt, du hättest das Gefühl zu stören. Sie war deswegen ganz aufgeregt. Sie möchte das nicht. Sie würde sich sehr wünschen, dass alles so bleibt, wie es ist.
Ich möchte nicht, dass sie sich aufregt, Mama. Ich habe ihr keinen Vorwurf gemacht.
Was ist es, Ben?
Es …
Ich zögerte fortzufahren. Das Problem mit dem Schreiben. Geschrieben ist geschrieben, noch viel mehr als Gesagtes gesagt ist.
Ja? Sag schon, Ben. Es ist nicht schlimm. Wir sind unter uns.
Es fühlt sich nicht mehr an wie zu Hause. Fünftes Rad am Wagen, wenn Karl da ist.
Meinst du nicht, dass ihr das besprechen könnt?
Nein. Niemand meint es böse.
Jetzt benötigte meine Mutter einen Moment für ihre Antwort.
Also eine eigene Wohnung – mein Kleinster …
Ich konnte sie über die Zeilen förmlich melancholisch lächeln sehen.
Ja, ich möchte Hannah nicht im Weg stehen.
Und unabhängiger werden?
Ja.
Meinst du, du kommst klar?
Meine Mutter war vielleicht die Einzige, die einfach so fragen konnte, so fragen durfte. Sie war nie um meine Behinderung herumgestrichen, hatte es einfach akzeptiert, dass ich bin, wie ich bin. Aber sie wusste um die Probleme, die Schwierigkeiten, die es manchmal machte.
Ich werde es versuchen. Ist vielleicht an der Zeit.
Viel Glück bei deiner Suche. Halte mich auf dem Laufenden.
Wir verabschiedeten uns. Wie gut, dass es all diese Möglichkeiten der schriftlichen Kommunikation gab. Wie hatte man das bloß früher gemacht, wenn man nicht sprechen konnte? Für mich war manchmal die Kommunikation über die Distanz per Schriftverkehr einfacher als direkte Gespräche. Es war gleichberechtigter, alle mussten schreiben.
Gerade wollte ich das Handy zur Seite legen, als noch eine Nachricht aufpoppte. Lena – die WG mit dem Kontakt nur per SMS, ich hatte es fast vergessen.
Hallo, Ben. Entschuldige, dass ich mich erst jetzt melde, war die ganze Woche unterwegs. Noch Interesse an dem Zimmer? Hättest du eventuell morgen Vormittag gegen 10 Uhr Zeit für eine Besichtigung? Dann sollten die meisten von uns da sein. Lena
Per Du, irgendwie klang sie nett.
Ja, das geht. Wie ist die genaue Adresse? Wie viele seid ihr? Ben
Sie gab die genaue Adresse durch, es war tatsächlich nur um die Ecke.
Wir sind fünf. Alles andere morgen. Dir einen schönen Abend.
Bis morgen.
Gedankenverloren legte ich das Handy zur Seite. Morgen um zehn – Hannah wäre nicht dabei. Ich würde es allein stemmen müssen. Na ja, ich wollte schließlich selbstständiger werden, oder?
Am nächsten Morgen wurde ich früh wach. Noch Zeit, um eine Runde zu joggen und den Kopf freizubekommen. Ich änderte meine übliche Tour, um an der Adresse der WG vorbeizukommen. Ein älteres Haus mit einem verwunschenen Garten. Ein paar Stufen führten zur Eingangstür, darauf zahlreiche Blumentöpfe mit den unterschiedlichsten Pflanzen. Im Vorgarten ein verwitterter Holztisch, umgeben von mehreren nicht zusammenpassenden Stühlen. Es sah gediegen aus, gemütlich, in einer ruhigen Seitenstraße. Mein Herz klopfte nicht nur vom Joggen, als ich weiterlief. Aber ich ermahnte mich, mir nicht zu große Hoffnungen zu machen. Sie hatten bestimmt viele Bewerber bei der guten Lage und dem Preis.
Als ich frisch geduscht in der stillen Wohnung auf meinem Toast herumkaute, gingen meine Gedanken auf Reisen. Eine WG, eigentlich eine schöne Vorstellung, immer Menschen um sich zu haben, nicht allein zu sein. Menschen, die mich kennen würden. Der Anfang war vielleicht schwierig, aber dann würden sie sich an mich gewöhnen, aufhören zu fragen. Am Tisch sitzen mit den anderen …Wie früher zu Hause, einfach dabei sein, alle anderen reden, erzählen, was sie erlebt haben. Ich war immer mittendrin, ohne dass jemand mich zum Erzählen aufgefordert hatte. Ich durfte dabei sein, zuhören, dazugehören, obwohl ich nur schweigend ihren Gesprächen lauschen konnte und selten aktiv daran teilnahm. Es war okay gewesen zu Hause. Sicherheit und Geborgenheit … Ob ich das je wieder woanders finden würde?
Eine Stimme in mir mahnte, es nicht zu wichtig zu nehmen, nicht zu hohe Erwartungen zu haben. Es war nur ein Besichtigungstermin für eine WG. Sie würden perplex sein, jemand, der Zettel schreiben muss, um sich verständlich zu machen. Schwierig für eine WG, alle anderen Bewerber wären sicher einfacher, passender …
Ich mochte es mir kaum eingestehen, aber seit ich an dem Haus vorbeigelaufen war, konnte ich meine Aufregung nur schwer unterdrücken. Es hatte mich angesprochen. Zudem die SMS von Lena, so nett und unkompliziert …
Kurz vor zehn lief ich in meinem üblichen Outfit, Jeans, T-Shirt, Sportschuhe, los. Ich hatte mich mehrmals versichert, Block und Stift wirklich eingesteckt zu haben.
Das Gartentor quietschte beim Öffnen. Auf dem Gras schimmerten in der Morgensonne hunderte Tautropfen. Auch die verschiedenen Gewächse, die mich den Treppenaufgang hochgeleiteten, waren von der herbstlichen Feuchtigkeit überzogen.
Vor der Tür angekommen zückte ich meinen Block und schrieb vorab meine erste Notiz. Um das Vorstellen würde ich nicht herumkommen: Hallo, ich bin Ben Weller. Ich habe mit Lena für 10 Uhr einen Besichtigungstermin für das WG-Zimmer ausgemacht. – Ich bin stumm, aber höre ganz normal.
Der letzte Satz, ein Standard. Sonst gab es immer Verunsicherung: Stumm? Taubstumm? Ich weiß, dass es das Wort eigentlich nicht mehr gibt, aber das ist die Assoziation, die so vielen durch den Kopf geht. Sie sind ohnehin verunsichert, wissen nicht, ob ich sie verstehe, sprechen manchmal laut, langsam oder verzerrt, als wäre man blöd.
Ich drückte die Klingel, ein Ding-Dong hinter der Tür, außerdem blitzte etwas für einige Sekunden.
Es dauerte eine ganze Weile, ehe sich die Tür öffnete. Eine junge Frau, etwa so alt wie ich, lange blonde Haare, die wirr auf ihren Rücken fielen. Jogginghose, T-Shirt. Ich musste lächeln, sie sah ziemlich verschlafen aus.
»Oh, du bist sicher Ben Weller? Ich bin Lena. Komm doch rein. Warte kurz.«
Damit ließ sie mich in dem kleinen Flur stehen, eine Garderobe, lauter Jacken in verschieden Farben und Größen, auf dem Fußboden ein Riesendurcheinander an Schuhen – von Pumps bis zu schweren Bergschuhen war alles dabei, auch eine ganze Menge Turnschuhe, vielleicht gab es auch andere Sportler hier, wäre schön …
Ich blieb im Halbdunkel der Garderobe stehen. Während ich alles inspizierte, klangen mir noch Lenas Worte in den Ohren, mehr ihre Stimme als die Worte. Sie war gestolpert beim Sprechen, die Laute waren kehlig, mit weniger Modulation als üblich. Nur per SMS …
Sie kam zurück.
»Hey, Ben, komm mit in die Küche, hier ist es so dunkel.«
Ich folgte ihr in eine große Wohnküche, dominiert von einem alten Mahagoni-Tisch in der Mitte. Lena lehnte daran und sah mich voll an, parallel fingerte sie an ihrem linken Ohr herum.
»So, noch mal hallo. Jetzt bin ich online«, sie schob die langen Haare ein wenig zurück, gab den Blick frei auf ein kunterbuntes Hörgerät, »also kurz vorab: ich bin schwerhörig, fast taub. Aber mit den Dingern hier verstehe ich alles ganz gut. Du musst mich angucken beim Sprechen, dann ist es kein Problem, okay?«
Ich nickte. Wahrscheinlich wirkte ich ebenso verstört, wie häufig die anderen, wenn Hannah von meiner Stummheit erzählte. Deshalb nur per SMS …
Lena machte schon weiter. Sie redete, locker an den Tisch gelehnt, und hatte mich dabei fest im Blick: »Das Haus ist von meiner Oma. Keiner sonst aus der Familie wollte es haben. Für mich allein ist es natürlich zu groß, auch zu teuer, deshalb kam mir die Idee mit der WG. Die gibt es inzwischen seit drei Jahren.« Sie zog mich weiter. »Komm, unser Wohnzimmer, Gemeinschaftsraum, wie immer du es nennen möchtest.«
Sie öffnete die Tür zu einem großen Raum, das Fenster gegenüber der Tür gab den Blick frei auf eine Terrasse und einen Garten, der in ähnlich wenig gepflegtem Zustand war wie der Vorgarten. Ich sah mich weiter um. Fernseher, Sessel, Stühle, ein zerknautschtes Sofa. Mein Blick blieb an dem glänzend schwarzen Klavier in einer Ecke hängen, daneben weitere Stühle, Notenständer, als würde hier regelmäßig Musik gemacht werden. Es zog mich fast magisch an – ein Klavier, wie hatte ich es vermisst in unserer Wohnung. Wir hatten es nicht mitnehmen können, nicht genug Platz und zu Hause wollten die anderen natürlich auch weiterhin spielen.
Lena neben mir war still geworden, ich spürte ihren Blick in meinem Rücken, als ich auf das Instrument zuging. Sie kam hinterher.
»Machst du Musik? Spielst du Klavier?«
Ich sah kurz auf, öffnete den Deckel, mein Blick glitt über die schwarzen und weißen Tasten, denen man so wundervolle Töne entlocken konnte.
»Dann bist du eigentlich ganz richtig hier.«
Ich warf ihr einen erstaunten Blick zu, wie wäre Musik für sie, wenn sie kaum hören konnte? Sie verstand meine Frage, ohne dass ich sie stellen musste, und lachte.
»Guck nicht so komisch. Ist eine halbe Musiker-WG hier. Ich kann ja mein Hören einfach ablegen, wenn es mich nervt, von mir aus können sie dann üben, bis sie schwarz werden«, wieder ihr forschender Blick.
Ich wusste, dass jetzt die Frage kommen würde, die irgendwann immer kam, wenn es zu lange keine Antworten gab.
»Mensch, Ben, du sagst ja gar nichts. Du brauchst nicht so schüchtern oder verunsichert sein, ich verstehe dich schon. Versuch es einfach.«
Ich zückte als Antwort meinen vorbereiteten Zettel, er passte nicht mehr ganz, es war aber schneller als einen neuen zu schreiben.
Hallo, ich bin Ben Weller. Ich habe mit Lena für 10 Uhr einen Besichtigungstermin für das WG-Zimmer ausgemacht. – Ich bin stumm, aber höre ganz normal.
Sie guckte genauso verwirrt auf meine Zeilen wie alle anderen, wenn ich mich outen musste. Ich war am Klavier stehen geblieben und beobachtete sie. Nach der kurzen Verwirrung sah Lena auf, ein Lachen im Gesicht. Plötzlich war sie ganz aufgeregt.
»Stumm … Ben, was für ein Luxus für mich. Ich kann einfach lesen, was du schreibst, ohne mich so konzentrieren zu müssen. Und du wirst nichts in meinen Rücken sagen, was ich wieder nicht mitbekomme. Du wärst die ideale Ergänzung zu unserer Truppe hier.«
Ich machte ein fragendes Gesicht.
»Das erzähle ich dir später. Erstmal zeige ich dir dein Zimmer, deswegen bist du ja eigentlich gekommen. Es ist ganz oben, zweiter Stock.«
Sie stiefelte schweigend vor mir eine enge Treppe hoch, machte auf dem ersten Absatz halt, suchte wieder den Blickkontakt, bevor sie weiterredete. Für mich eine schöne Art zu kommunizieren.
»Hier im ersten Stock haben Vera, Hans und ich unsere Zimmer. Hier ist auch ein Bad.«
Sie lief weiter, im zweiten Stock ging sie nach rechts und öffnete die Tür am Kopf des Flurs. Sie gab den Blick frei in ein nicht so großes Zimmer, Dachschrägen, ein Dachfenster, die Decke holzgetäfelt, dazu ein uralter Holzfußboden. Ein weiteres Fenster an der Stirn des Hauses, mit Blick auf die Alb. Ich ging zum Fenster und sah schweigend hinaus, was für eine Aussicht. Ein schnuckeliges, kleines Zimmer. Die Wohnküche unten, ein Klavier. Es könnte ein Zuhause werden. Lena hatte zu mir aufgeschlossen, tippte mich an und versuchte in meinem Blick zu lesen.
»Gefällt es dir?«
Sie fragte es vorsichtig, leise. Das Fenster war unten beschlagen.
Ich malte zwei Buchstaben in die Feuchtigkeit: JA.
Lena lachte und malte einen Smiley dazu.
Es war nicht nur das Zimmer und das Haus mit dem Garten, was mich fast magisch anzog. Natürlich war es auch Lena, fast taub, biss sie sich hier allein durch und imponierte mir. Ihre Art zu reden, das Suchen des Blickkontaktes, deutliche Lippenbewegungen, manchmal halb verschluckte Wortenden. Ihre Reaktion auf das Eröffnen meiner Stummheit, nachdem sie mir schon das ganze Erdgeschoss gezeigt hatte. Ihre kurze Verwirrung, dann ihr Lachen, ihr »Was für ein Luxus für mich.«
Meine Behinderung als Bereicherung für einen anderen Menschen – das war noch nie passiert. Ich war auf einer normalen Schule gewesen, hatte immer nur Kontakt zu anderen »normalen« Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, war immer ein wenig im Hintertreffen. Nie hatte ich Kontakt zu anderen gehabt, die auch an einer Behinderung litten. Es hatte sich einfach nicht ergeben, ich hatte nie danach gesucht.
Lena tippte mich wieder an, holte mich aus meinen Gedanken.
»Du bist so ein stiller, nachdenklicher Mensch, hm? Komm, lass uns runtergehen. Ich sammle die anderen zusammen, zum Kennenlernen.«
Sie war schon fast auf und davon. Ich erwischte sie noch eben an der Schulter.
Warte, erzähl mir kurz von euch.
Sie kam zurück und hockte sich auf die enge Fensterbank. Ich setzte mich daneben und sie begann zu erzählen.
»Also, erster Stock habe ich ja schon gesagt, Vera, Hans und ich. Hier oben Sophia, Bennet und … vielleicht du?«, sie streifte mich mit einem verschmitzten Lächeln, »Vera und Sophia sind Zwillinge, Vera studiert Medizin, Sophia Musik. Hans ist auch Musiker. Bennet ist gehörlos, er studiert Mathematik – also eine ganze Studenten-WG.«
Sie sah mich an, pausierte, ließ mir Zeit zum Schreiben.
Und was machst du?
»Ich bin die einzige Nicht-Studentin, ich bin Physiotherapeutin. Und du? Studierst du?«
Biochemie.
»Puh, das wird ja immer intellektueller hier. Nichts für ungut, wir sind wirklich eine nette Truppe. Magst du noch ein wenig von dir erzählen? Dann kann ich es unten weitergeben, vielleicht einfacher als mit Zettel und Stift.«
Sie dachte nach, anders als die meisten. Ich schrieb ein paar Sätze, meine Herkunft Hamburg, meine drei großen Schwestern, mein Zusammenwohnen mit Hannah.
»Machst du Sport, Ben?«
Joggen, Fahrrad fahren, Squash, Tennis.
»Das klingt gut, es sind genügend sportliche Leute hier, wir können sicher mal etwas zusammen machen. Und Musik? Spielst du Klavier? Noch etwas anderes?«
Klavier und Cello.
»Das wird Sophia, Vera und Hans freuen. Komm, lass uns jetzt runtergehen«, sie warf im Gehen einen Blick zurück, als ich noch zögerlich auf dem Fenstersims sitzen blieb.
»Keine Angst, Ben. Sind wirklich alle ganz nett und unkompliziert hier«, sie unterbrach sich, »hättest du wirklich Interesse? Mich würde es freuen …«
Ich nickte, sie lächelte.
»Na ja, erst mal musst du uns alle kennenlernen. Wer mit einziehen darf, entscheiden wir gemeinsam. Pass auf, Ben, geh doch schon runter in die Küche oder sieh dich ein bisschen um. Ich sammle mal alle zusammen, damit ihr euch kennenlernt, okay? Wir sind übrigens eine Langschläfer-WG.«
Ich zog belustigt die Augenbrauen hoch, hatte ich schon bemerkt, Lenas verschlafenes Auftreten an der Haustür vorhin und in dem Haus regte sich noch kein Mucks.
Lena war fort und begann ihre Weckaktion, ich war nicht sicher, ob mir das recht war. Direkt fünf neue Menschen auf einmal … Ich genoss noch einen Moment die Ruhe und ließ den Blick durch das Dachzimmer schweifen, begann im Geiste meine Dinge hier unterzubringen. Bett und Schreibtisch, für Bücherregal und Kleiderschrank war nicht allzu viel Platz, aber es würde schon gehen.
Ich begab mich nach unten, wie es Lena vorgeschlagen hatte. In die Küche, ich blieb einfach dort, wollte nicht allein in dem fremden Haus herumgeistern. Auch nicht am Tisch sitzen und auf alle warten. Ich sah aus dem Küchenfenster in den Vordergarten. Alles wucherte wild durcheinander. Sie könnten einen Gärtner gebrauchen. Aber irgendwie auch schön, alles wuchs, wie es wollte, war nicht zurechtgestutzt. Zwischen dem Unkraut leuchteten noch einzelne bunte Blüten hervor, Astern, Herbstblumen … Ich mochte es, am Fenster zu stehen und die Welt da draußen zu beobachten. Ich sah zu und war selbst woanders, nicht Teil der Welt, trotzdem gefiel es mir. Es war die gleiche Position, die ich in größeren Runden im Gespräch innehatte.
Ich schreckte auf, als jemand hinter mir einen Stuhl geräuschvoll vom Tisch abzog. Ich sah mich um. Ein junger Mann, rot gelockte Haare, grüne Augen, ein scharfer, fragender Blick. Wortlos sah er mich an, zog einen weiteren Stuhl vom Tisch und wies darauf. Hans oder Bennet? Er schien auf jeden Fall über meine Stummheit informiert. Ich setzte mich dazu, zückte meinen Block.
Hallo, ich bin Ben.
Er las, bat dann mit einer Geste um meinen Stift und ergänzte.
…net.
Wir grinsten uns an. Sogar ähnliche Namen.
Weiter kamen wir nicht, weil die anderen vier die Treppe hinunterkamen. Plötzlich waren alle in der Küche, sie redeten durcheinander.
»Wer möchte Tee? Kaffee?«
»Deckt doch mal den Tisch, dann können wir alle zusammen frühstücken.«
»Ben, du bleibst doch, oder?«
Mein Nicken. Bennet stand auf, um Teller und Besteck zusammenzusammeln. Eine der Zwillinge räumte parallel heraus, was der Kühlschrank hergab, und zählte nebenher alles auf.
»Käse, Aufschnitt, Butter, Milch, Saft – wir haben eine Bombenausstattung alle gemeinsam.«
Mein Blick wanderte von einem Zwilling zum anderen. Es war unglaublich, diese Ähnlichkeit. Ein langer dunkler Zopf fiel der einen den Rücken herunter, der anderen hingen die Haare offen herab. Beide in Jeans und Bluse. Die mit den offenen Haaren räumte am Kühlschrank, die zweite stand plötzlich an der Stuhllehne neben mir und setzte sich. Sie sah sich belustigt in dem lebhaften Chaos der jetzt menschengefüllten Küche um. Ihre Hand tippte leicht an meinen Unterarm, hatte Lena vorhin auch gemacht, ungewöhnlich. Sie sah mich freundlich und ruhig an. »Du bist also Ben?« Ich nickte.
»Sophia«, die Musikerin, »wenn du magst, führe ich dich ein wenig ein. Am Kühlschrank meine bessere Hälfte Vera, eben neben dir Bennet, Lena kennst du ja schon. Und das ist Hans.«
Hans saß am Kopf des Tisches in eine Zeitung vertieft, sah kurz auf und nickte mir zu. Um ihn herum Vera, Lena und Bennet, er ließ sich bedienen und rührte keinen Finger. Sophia streifte nach der fast geflüsterten Vorstellungsrunde kurz meine Hand und machte sich daran, einen Obstsalat zu schneiden. Sie machte es still vor sich hin. Ebenso wie Bennet, der, ohne ein Wort zu verlieren, Kaffee und Tee kochte. Vera und Lena arbeiteten und redeten nebenher. Lena musste immer wieder ihre Tätigkeit unterbrechen, um Vera folgen zu können, war aber erstaunlich sicher und schlagfertig. Fast ebenso verwunderlich war, wie gut Vera an Lenas kommunikative Bedürfnisse angepasst war. Sie redete nie, bevor Lena aufsah, und suchte immer wieder auf dem optischen Weg ihre Aufmerksamkeit.
Irgendwann war alles so weit, der Tisch bog sich unter Leckereien. Alle nahmen Platz. Bennet landete wieder an meiner Seite, am Kopfende des Tisches, auf seiner anderen Seite Vera, dann Lena. Hans gegenüber von Bennet und Sophia rechts von mir. Ob sie wohl so eine Tradition für ein spätes gemeinsames Wochenendfrühstück hatten?
Mir blieb keine Zeit, weiter nachzusinnen. Lena stellte mich vor.
»Also, ihr alle. Das ist Ben. Er ist wegen des Zimmers gekommen. Hab ihm schon alles gezeigt und du warst nicht abgeneigt, oder?«
Ich nickte. Parallel zu Lenas Lippen waren Veras Hände in Bewegung gekommen. Es dauerte einige Sekunden, bis ich begriff, dass sie für Bennet dolmetschte.
Lena fuhr fort: »Ich hatte euch allen schon kurz gesagt, dass Ben stumm ist. Also erzähle ich ein bisschen, was er mir vorhin aufgeschrieben hat. Ist das okay?«
Wieder nur mein Nicken. Bennets Hand fuhr durch die Luft, ein Winken in meine Richtung. Seine Hände redeten weiter. Ich sah an seinem Gesichtsausdruck, dass er etwas fragte, verstand aber nichts. Plötzlich waren alle Augenpaare erwartungsvoll auf mich gerichtet, nur Hans las weiter in seiner Zeitung. Was immer Bennet gefragt hatte, er sah mich erwartungsvoll an. Als ich nicht antwortete, machte sich eine tiefe Enttäuschung auf seinem Gesicht breit. Wieder war es Sophia, die mich vorsichtig antippte.
»Bennet hat gefragt, ob du gebärden kannst.«
Ich schüttelte den Kopf und sah, wie Bennet, Vera und Sophia fragende Blicke wechselten. Ich war durcheinander, verstand die Sprachkultur an dem Tisch nicht mehr, spürte nur die große Enttäuschung. Lena rettete die Situation: »Dann erzähle ich einfach weiter. Also, Ben ist aus Hamburg, hat drei ältere Schwestern. Er wohnt aktuell mit einer seiner Schwestern zusammen, sucht aber etwas Neues. Er studiert Biochemie.«
Bennets Hände kamen in Bewegung, kein Ton, nicht einmal Lippenbewegungen. Sophia übersetzte, leise und zurückhaltend. »Bennet fragt, in welchem Semester du bist.«
Ich zeigte eine Drei.
»Kommt, lasst uns erst mal etwas essen. Wir können parallel weiterreden. Wer möchte Kaffee?«
Kaffee- und Teekanne machten die Runde. Das Geschirr ein bunt gewürfeltes Durcheinander. Ob ich eigenes mitbringen sollte? Ich verharrte halb in meinem Essen. Woher war ich so sicher, dass ich das Zimmer bekommen würde? Für mich gab es keine Frage, ich wollte. Es war bezahlbar, die Lage perfekt, die Leute … Ich betrachtete und lauschte still, wie ich es gewohnt war. Die Gespräche flogen über den Tisch, wie es eben ist, wenn sechs Menschen zusammen essen. Nur hier war es zweisprachig. Vera und Bennet gebärdeten, Sophia sah an mir vorbei, ihnen zu. Lena verwickelte Hans in ein Gespräch, gute Bedingungen für sie, die anderen waren leise und störten ihr akustisches Verstehen nicht.
Lena sah in die Runde: »Ich würde das Zimmer liebend gerne Ben geben. Hat jemand etwas dagegen?«
Vera grinste mich über den Tisch an: »Nein, cool. Eigentlich fehlst du noch hier.«
Bennet klopfte mir auf die Schulter, Daumen hoch. Ob er gar nicht sprach? Wie ich?
Hans musterte mich: »Lena hat erzählt, du machst auch Musik? Klavier und Cello?«
Mein Nicken.
»Dann würdest du dich also an dem ewigen Üben von Sophia und mir nicht stören?«
Kopfschütteln. Wieder Sophias Hand auf meinem Arm, leicht und vorsichtig.
»Vielleicht machen wir mal was zusammen?«
Ich nickte. Lena übernahm wieder.
»Also, Ben – alle einverstanden. So schnell ging es noch nie. Was hast du noch für Fragen?«
Ich nahm meinen Block und schrieb. Im Augenwinkel sah ich, wie Bennet irgendetwas zu Vera sagte.
Was soll es genau kosten? Wann könnte ich einziehen?
Lena nannte einen Preis, der fair wirkte.
»Einziehen kannst du eigentlich sofort. Wann es für dich passt.«
Ich muss es noch mit meinen Eltern und meiner Schwester besprechen. Ich würde das Zimmer gerne nehmen, sehr gerne bei euch einziehen. Kann ich mich nach dem Wochenende per SMS bei dir melden?
Lena las einfach vor, was ich geschrieben hatte, und nahm dann selbst einen Stift.
»Ja, oder schreib eine E-Mail. Hier ist meine Adresse. Oder – komm einfach noch mal vorbei. Hier ist eigentlich immer jemand zu Hause. Und du wohnst ja nicht weit weg.«
Lena stand auf, um mich zur Tür zu bringen. Ich ließ zum Abschied noch einmal meinen Blick gleiten, sah jeden kurz an. Am längsten blieb ich bei Sophia hängen.
Auf dem kurzen Fußweg in meine alte Wohnung purzelten meine Gedanken durcheinander. Eine neue Wohnung, eine WG mit anderen, die Musik machten, das Klavier, Bennet gehörlos, Lena schwerhörig. Sie waren gewohnt, dass Kommunikation schwierig sein kann. Vera und Sophia … ähnlich und doch verschieden, eine lebhaft, eine ganz still. Warum sie wohl beide die Gebärdensprache beherrschten?
II
Zu Hause angekommen ließ ich mich auf das Sofa fallen und starrte Löcher in die Luft. Diese WG, sollte es wirklich klappen? Nach all den elenden Löchern und unfreundlichen Vermietern, die ich diese Woche mit Hannah gesehen hatte, dieser Lichtblick heute Morgen. Vielleicht hatte ich einmal Glück. Ich musste meinen Eltern schreiben, mich mit ihnen arrangieren, das Finanzielle klären und den Vorwurf an Hannah, der keiner war. Wie würde Hannah reagieren? Würde sie es wirklich verstehen, sich mit mir freuen? Oder würde sie doch enttäuscht sein, ihr kleiner Bruder endlich flügge …
Ich schaltete den Laptop an, um meinen Eltern eine E-Mail zu schreiben, die Situation noch mal zu erklären. Wie gelähmt saß ich vor dem weißen Bildschirm, die richtigen Worte wollten nicht kommen. Ich war zu aufgeregt. Ich kannte das an mir, die Schwierigkeit, Anfänge zu finden. Ich war mir selbst noch nicht darüber klar, was diese WG mir bedeuten könnte, wie es für mich werden würde. Zu viele Gefühle, Freude und Aufregung, aber auch Angst, dass doch noch etwas schiefgehen würde. Sie mich doch nicht haben wollten, jemand anderes mir zuvorkäme. Oder dass ich einzog und es schwierig werden würde. Frustriert machte ich den Laptop aus. Ich ging in den Keller und holte mein Fahrrad hervor. Bewegung war, wenn ich durcheinander war, oft das Beste, sich ablenken, sich körperlich betätigen.
Es war ein herrlicher Herbsttag. Ich fuhr los, nach Süden aus der Stadt heraus. Es wurde eine große Runde, weiter und weiter. Die Sonne im Gesicht, den Fahrtwind in den Ohren. Die Bäume begannen sich bunt zu färben, die Sonne fiel in Streifen durch die Blätter, hell, dunkel, hell, dunkel, fuhr ich durch den Wechsel von Licht und Schatten. Bergauf im Stehen, langsam, mühsam – bergab, leichter, aber voller Konzentration über unebenen Waldweg, Baumwurzeln, das Laub feucht auf dem Boden, eine Rutschpartie. Es war genau das, was mir guttat, die Augen auf den Boden vor mir, immer wieder kurz der Blick weiter nach vorne, kein größeres Hindernis übersehen. Parallel die Ohren gespitzt, Vögel, die zwitschern, mein Fahrrad, unter dem Äste krachen, kristallklare Luft, sonst nichts. Keine Technik, keine Menschen. Nur die Natur und ich. Keiner wollte etwas von mir, ich brauchte nicht zu reden. Meine Behinderung spielte keine Rolle, solange ich allein war.
Ich kam aus dem Wald und fuhr weiter an einem Feld entlang. Getreide, in voller Reife wogten die Halme in Wellen im Wind. In der Ebene, leichteres Terrain, Raum, um die Gedanken schweifen zu lassen.
Solange ich allein war, war ich normal, wie alle anderen. Es war die große Gefahr meiner Einschränkung, meiner Stummheit, dass es immer einfacher war, allein zu sein, sich zurückzuziehen, den Kontakt zu anderen zu scheuen, die Menschen zu meiden. Jedes Aufeinandertreffen war erst mal eine Mühsal, man musste sich erklären, erstaunte, verwirrte Blicke. Die meisten trauten sich in kein Gespräch mit mir, zu ungewohnt, jemand, der schreiben muss, weil er nicht reden kann.
Diese WG – vielleicht eine Chance? Andere Menschen, mit ähnlichen Problemen. Würden sie mich verstehen? Vielleicht sogar besser als meine Mutter oder Hannah, weil sie es am eigenen Leib erlebten, in einer ähnlichen Situation waren?
Vielleicht auch eine Gefahr. Wahrscheinlich wären sie einem Rückzug gegenüber weniger tolerant. Den Rückzug in mein Schneckenhaus, immer wieder brauchte ich ihn. Ich brauchte es, allein zu sein, um mir über die Dinge klar zu werden. Mochte oft nicht über sie reden, wenn ich selbst mit meiner Analyse nicht fertig war, immer in der Sorge, dass sie mich mit ihrer Einstellung, die sie so einfach und eloquent äußern konnten, einfach in die Ecke reden würden. Es war mir zu oft passiert. Wenn man nicht reden kann, kann man sich schlecht wehren, man ist nicht schnell genug, nicht gewandt genug.
Nach der riesigen Runde und einer warmen Dusche fiel ich erschöpft und glücklich auf mein Bett. Mit einem Buch und Musik machte ich es mir gemütlich. Wieder die Flucht in eine andere Welt. Ich war noch nicht so weit, diese E-Mail zu schreiben.
Irgendwann summte mein Handy, gespannt sah ich darauf. Es war eine Nachricht von Tony. Hi, Ben. Lust auf Kino heute Abend?
Und wie ich Lust hatte, nichts kam mir gelegener. Ich freute mich über die Einladung. Ja! Was gibt es denn?
Wollte den neuen Actionstreifen sehen. Ist das was für dich?
Klar. Wann? Wo?
20h, Reutlingen. Kann dich mit dem Auto abholen.
Ja. Wer kommt noch?
Keiner.
Nachdenklich ließ ich mein Handy für einen Moment sinken, das wäre das erste Mal, dass Tony und ich nicht in größerer Truppe unterwegs wären.
Axel, Martin – haben sie keine Zeit?
Habe gar nicht gefragt. Hast du keine Lust zu zweit?
Doch, klar. Bis nachher.
Bis dann.
Er kam pünktlich um sieben. Zwanzig Minuten Autofahrt zu zweit. Für Tony sicher ungewohnt, wir konnten kein Wort miteinander wechseln. Tony erzählte dennoch etwas über das Studium, die Kommilitonen. Ich hörte zu und schwieg, bis ihm die Worte ausgingen. Dann sah er auf die Straße und ich blickte aus dem Fenster. »Machst du eine CD rein, Ben? Irgendetwas, worauf du Lust hast. Im Handschuhfach.«
Es war ihm zu still. Ich öffnete die Klappe, gespannt, was für einen Musikgeschmack er haben würde. Ein paar moderne Dinge, CDs von gerade aktuellen Songs und Bands, daneben klassische Musik. Ich grinste in mich rein. Ich fand Dvořáks Cellokonzert und fischte es heraus. Tony hatte es nicht gesehen. Ein erstaunter Blick, als die Musik das Auto füllte. Er lachte.
»Du magst auch klassische Musik? Witzig, ich denke immer, ich bin der Einzige.«
Es wurde ein netter Abend. Wir standen einen Moment an der Kasse, neuer Film, großer Ansturm. Nach Eroberung der Karten verschanzten wir uns mitsamt Popcorn und Cola auf den Kinosesseln und ließen uns von dem Actiondrama und den Effekten mitreißen. Nach dem im Prinzip vorprogrammierten Ende blieben wir noch einen Moment wie erschlagen sitzen, ließen uns vom Abspann und der Musik weiter berieseln, während die meisten schon den Saal verließen. Schließlich mussten auch wir aus unseren Sesseln hinaus in die kühle Herbstluft.
Tony sog sie tief ein.
»Gehen wir noch was trinken?«
Ich zuckte die Schultern. Mal sehen, wie es werden würde. Zu zweit, anders als mit drei oder vier Leuten, da fiel meine Schweigsamkeit nicht so auf. Ich hörte zu, oder auch nicht, und sie ließen mich in Ruhe. Zu zweit wäre es notgedrungen anders. Meine Hand fuhr suchend über die Hintertasche meiner Jeans. Ich wusste, dass es eine Macke von mir war, immer die Angst, Zettel und Stift vergessen zu haben und wirklich sprachlos zu sein. Wie oft hatte Hannah mich damit aufgezogen.
Tony lotste mich durch die Stadt, er schien sich auszukennen, wir landeten bei einem Mexikaner. Cocktails.
»Einen gönne ich mir, mehr nicht wegen der Fahrerei. Was nimmst du?«
Ich zeigte es ihm auf der Speisekarte. Tony bestellte für uns beide. Die Kellnerin verließ uns. Tony maß mich mit einem Blick.
Ich hoffte, dass er beginnen würde, etwas zu erzählen, für mich war es schwierig, den Anfang zu machen. Er tat mir den Gefallen. Fast verschwörerisch sah er mich an. »Ich muss dir was erzählen, Ben.« Ich sah ihn gespannt an.
Er begann von einem Mädchen zu berichten, sie war bei uns im Semester, eine hübsche Frau, Überfliegerin, ich lauschte seinen verträumten Erzählungen mit einem Lächeln. Er war verliebt und musste es loswerden. Ich war ein guter Zuhörer und konnte natürlich Geheimnisse für mich behalten, besser als die meisten. Tony hatte den Kinoabend ganz bewusst arrangiert, ich lächelte in mich hinein, wie schön, dass er mich zum Zuhören auserkoren hatte. Ich widmete ihm meine volle Aufmerksamkeit, lauschte seinen Erzählungen, bis er irgendwann fertig war.
»Mensch, Ben. Jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht. Und bei dir – gibt es was Neues?«
Unsere Cocktails waren schon fast geleert, als ich erstmals meinen Block zückte.
Ich habe die ganze Woche Wohnungen angeguckt, eine ätzender als die andere.
»Du willst umziehen? Warum?«
Hannah und ihr Freund Karl. Ich bin ihnen im Weg. Zumindest fühlt es sich für mich so an.
»Verstehe. Und jetzt suchst du eine neue Bleibe?«
Ja. Heute Morgen habe ich mir ein Zimmer in einer WG angesehen. Wenn das klappt, wäre es ein – ich suchte kurz nach dem richtigen Wort – Glückstreffer.
Tony las und schmunzelte.
»Erzähl, wo ist es? Wie viele Mitbewohner? Hast du alle schon kennengelernt?« Südstadt, bei mir um die Ecke – 5 – ja.
Wenn man immer schreiben muss, hilft Minimalismus sehr.
Tony grinste.
»Sind sie nett? Mädels? Jungs?«
Gemischt. 3 Mädels, 2 Jungs. Es war lustig, in der Anzeige hatte Lena eine Handynummer angegeben und wollte nur per SMS kontaktiert werden. Ich habe gar nicht so darüber nachgedacht. War ja praktisch für mich. Heute Morgen habe ich es verstanden.
Tony las und reichte mir den Block schweigend zum Weiterschreiben zurück.
Sie ist schwerhörig, fast taub. Dann gibt es da noch einen Gehörlosen, einen Musiker und Zwillinge, eine macht Musik, eine Medizin.
Tony sah mich nachdenklich an.
»Das klingt, als wäre es perfekt für dich, Ben. Interessante Konstellation. Kennst du eigentlich andere … Stumme oder Gehörlose?«
Nein.
»Warum nicht? Wäre es nicht … besser? Gleichgesinnte?«
Es hat sich nie ergeben.
»Aber jetzt. Das klingt spannend. Hast du schon zugesagt? Haben die Mitbewohner schon ein Signal gegeben?«
Sie haben spontan alle gesagt, dass sie mir das Zimmer gerne geben würden. Ich muss nur noch mit meinen Eltern sprechen.
»Wenn du ihnen davon so erzählst wie mir, können sie gar nicht nein sagen, Ben. Es klingt nach einer wunderbaren Möglichkeit für dich.«
Vielleicht hatte er recht. Er träumte meine Träume noch in seinen Worten ein wenig weiter, bis wir uns nach Hause begaben.
Es war schön, jemandem von der Besichtigung und den Eindrücken des Morgens erzählt zu haben. Als ich nach Hause kam, war es spät. Dennoch setzte ich mich an meinen Laptop und schrieb meinen Eltern eine Mail. Tonys Reaktion hatte mir Mut gemacht.
III
Meine Eltern sagten mir ihre finanzielle Unterstützung zu und auch Hannah ließ sich von meiner Begeisterung anstecken. Es war schon spät am Sonntag, als ich Lena die SMS schrieb.
Hallo, Lena. Ich würde gerne dein Angebot annehmen und das Zimmer mieten. Soll ich im Laufe der Woche vorbeikommen, damit wir die Details klären können? Viele Grüße Ben
Hallo, Ben. Wie wäre es mit morgen Nachmittag um 17 Uhr? Wir freuen uns hier alle auf dich. Lena
Ich sagte zu und radelte am nächsten Nachmittag vorbei. Als ich klingelte, war wieder dieses kurze Blitzen. Wahrscheinlich das Klingelsignal für Lena und Bennet?