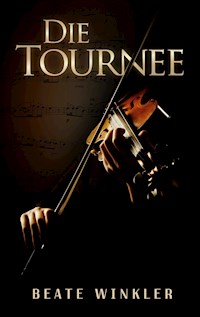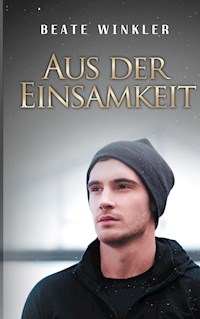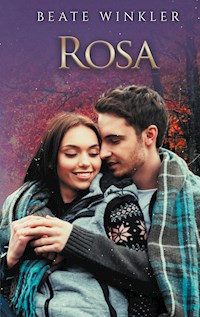Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Aus der Einsamkeit
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des Romans »Viersamkeit«: Vier junge Menschen führen ein Leben gemeinsam. Ein Leben, in dem jeder zwei Partner hat. Kathrin steht zwischen Andreas, der ihr Normalität und schöne Aktionen schenkt, und Tom, der ihr wirklich nahe ist. Für sie bleibt es ein ungewolltes Konstrukt. Fast scheint es eine Chance, als Tom ein Angebot für ein Forschungs-Semester in Boston bekommt und es nur antreten will, wenn Kathrin ihn begleitet. Sorgenvoll wegen ihrer motorischen Einschränkung und der Beziehung zu Andreas zögert Kathrin zuzustimmen. Letztlich ist es Andreas, der sie ermutigt. Es folgen sechs Monate im Ausland, fern von den Erinnerungen, die Tom immer wieder heimsuchen, und mit einer neuen Freiheit in der Zweisamkeit für Kathrin und Tom. Ein Besuch von Anja und Andreas in den USA wird zeigen, ob die Viererkonstellation weiterhin funktioniert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vier junge Menschen führen ein Leben gemeinsam. Ein Leben, in dem jeder zwei Partner hat. Kathrin steht zwischen Andreas, der ihr Normalität und schöne Aktionen schenkt, und Tom, der ihr wirklich nahe ist. Für sie bleibt es ein ungewolltes Konstrukt. Fast scheint es eine Chance, als Tom ein Angebot für ein Forschungs-Semester in Boston bekommt und es nur antreten will, wenn Kathrin ihn begleitet. Sorgenvoll wegen ihrer motorischen Einschränkung und der Beziehung zu Andreas zögert Kathrin zuzustimmen. Letztlich ist es Andreas, der sie ermutigt. Es folgen sechs Monate im Ausland, fern von den Erinnerungen, die Tom immer wieder heimsuchen, und mit einer neuen Freiheit in der Zweisamkeit für Kathrin und Tom. Ein Besuch von Anja und Andreas in den USA wird zeigen, ob die Viererkonstellation weiterhin funktioniert.
›Flucht in die Zweisamkeit‹ ist der zweite Band nach dem Buch ›Viersamkeit‹. Der dritte Titel ›Aus der Einsamkeit‹ komplettiert die Trilogie.
Beate Winkler, 1973 in Hamburg geboren, studierte Medizin in Lübeck. Ihre Weiterbildung zur Kinderonkologin absolvierte sie in Tübingen und Würzburg. Seit 2015 lebt sie mit ihren zwei Söhnen in ihrer Heimatstadt. Sie arbeitet weiterhin als Ärztin und schreibt in ihrer Freizeit. Nach der Trilogie ›Viersamkeit‹, ›Flucht in die Zweisamkeit‹ und ›Aus der Einsamkeit‹ veröffentlichte sie die Romane ›Der eigene Weg‹, ›Das Implantat‹ und ›Rosa‹.
Und derselbe Brunnen, aus dem euer Lachen aufsteigt,
war oft von euren Tränen erfüllt.
Khalil Gibran – Von der Freude und vom Leid
Inhaltsverzeichnis
Das neue Jahr
Kongress
Wohnen und Feiern
Umzug
Aufbruch
Boston
Gallaudet
Der Stick
Weihnachten in Boston
Das Spiel
Erste Liebe
Besuch
Abschied
Das neue Jahr
Guten Morgen, Tom. Ich bin schon solo. Könntest du Unterstützung brauchen? Kathrin
Seine Antwort kam prompt per Mail.
Hallo Kathrin. Ich bin noch in meinem Zimmer und muss eigentlich gleich in die Visite starten. Falls du wirklich kommen möchtest, warte ich auf dich. Tom
Ich hatte Herzklopfen, so sehr freute ich mich.
Ich brauche etwa eine halbe Stunde. Bis gleich. Kathrin
So schnell es irgendwie ging, versah ich mich mit Klamotten und Schienen und stieg ohne Frühstück ins Auto. Ich hatte so viel Spaß bei der Famulatur mit Tom gehabt, liebend gern opferte ich einen freien Vormittag, um ihm zu helfen. Nach einer halben Stunde stand ich vor seinem Zimmer. Er öffnete, sah mich mit einem langen Blick voll von Unsicherheit und verhaltener Freude an.
»Schön, dass du da bist. Lass uns gleich starten.«
Wir gingen langsam zur Station. Auf dem Flur trafen uns ein paar erstaunte Blicke. Tom schob mich ins Schwesternzimmer und begann zu gebärden.
»Heute habe ich Verstärkung mitgebracht. Das ist Kathrin, eine gute Freundin, so gut, dass sie sogar am Neujahrsmorgen für mich dolmetscht. Übrigens – frohes neues Jahr!«
Ich übersetzte. Es war komisch, über mich selbst dolmetschend zu reden, aber langsam gewöhnte ich es mir an, diese Situationen zu übersetzen, mechanisch, ohne viel über den eigentlichen Sinn der Worte nachzudenken.
Wir wurden freundlich, erleichtert, begrüßt. Es wurde zum Glück eine schnelle chirurgische Visite, ohne die endlosen Diskussionen wie bei den Internisten, die halbe Stunde schaffte ich stehend ganz gut. Tom ging in meinem Tempo zu den Patienten und aus den Zimmern heraus. Es gab eine neue Patientin, jung mit Verdacht auf einen Tumor, die noch ein MRT bekommen sollte.
»Kathrin, können wir nach dem MRT zusammen zu ihr gehen?«
»Kein Problem, ich habe Zeit.«
Noch während der Visite ging sie ins MRT. Als wir uns durch die Zimmer gearbeitet hatten, kam eine der Schwestern auf uns zu.
»So, jetzt setzt euch doch noch einen Moment zu uns an den Frühstückstisch, das müssen wir wohl wenigstens anbieten. Frau Wesel – Kathrin, vielen Dank für heute Morgen, das hat es für uns alle sehr viel leichter gemacht.«
Wir setzten uns zu den Schwestern. Tom schweigend, ich schnell in ein Gespräch verwickelt. Toms Chef stieß nach einer viertel Stunde dazu, erstaunt sah er mich an.
»Erstmal allen ein frohes neues Jahr. Ja, was machen Sie denn hier am Neujahrsmorgen, Frau Wesel? Haben Sie kein Zuhause? Nicht ausschlafen nach der Feierei?«
Tom übernahm: »Ich habe heute den Luxus einer privaten Dolmetscherin.«
Drever runzelte die Stirn, dann lachte er: »Das ist wunderbar. Da kommt mir noch eine Idee. Kommt doch mal mit, ihr zwei.«
Er war mit Tom per Du, ein guter Freund seines Vaters, kannte er ihn von klein auf. Wir begaben uns ins Arzt-Zimmer. Professor Drever ging schnellen Schrittes voraus, Tom blieb bei mir und wir gingen hinterher.
Als wir endlich ankamen, musterte er mich von oben bis unten, ein Lächeln umspielte seine Lippen.
»Setzen Sie sich, Frau Wesel.«
Ich nahm den freien Stuhl am Schreibtisch ihm gegenüber, Tom lehnte sich an die Fensterbank.
»Wenn ich euch zwei so sehe, kommt mir eine Idee. Es ist nicht vorher mit Tom abgesprochen, Frau Wesel…«
»Kathrin«, unterbrach ich.
»Also, Kathrin, noch besser. Tom hat berichtet, dass Sie sich sogar um ein gemeinsames Laborprojekt Gedanken machen?«
Ich nickte.
»Es geht mir um die Kongresse. Tom hat wertvolle Forschungsergebnisse. Bis jetzt habe ich sie immer auf den Kongressen vorgetragen. Tom meint, die Dolmetscherinnen können nicht genau genug übersetzen. Sie schaffen vielleicht noch den Vortrag, aber er hat Sorgen wegen der Fragen, dass die Damen Unsinn übersetzen und er schlecht dasteht. Also rühme ich mich seit Jahren mit seinen Daten. Wie wäre es, könnten Sie sich vielleicht vorstellen, für Tom einen Vortrag auf einem Kongress zu übersetzen?«
Ich war perplex, überfallen von der unerwarteten Frage. Ich sah zu Tom hoch. Auch in seinem Gesicht Verblüffung. Er besann sich zuerst.
»Ich hatte nie ein Problem damit, dass du meine Vorträge hältst. Das weißt du.«
Ich übersetzte.
»Ja, das weiß ich. Aber ich schmücke mich seit Jahren mit fremden Federn.«
»Mir reicht es, dass ich auf all diese Kongresse mitfahren und etwas lernen kann. Wer meine Daten vorträgt, ist mir egal. Ich muss mich nicht damit hervortun, ich stehe auf den Papers vorne.«
»Du weißt nicht, dass sie fragen, Tom. Die Kollegen haben mich immer wieder gefragt, wer denn dieser rätselhafte Tom Treppin sei. Den Namen deines Vaters kennen die älteren ja alle noch. Viele fragen, warum du nie vorträgst.«
»Du hast das nie erzählt. Was sagst du ihnen?«
»Ich winde mich herum.«
»Sagst du nicht die Wahrheit? Dass du den stummen Sohn deines ehemaligen, verunfallten Chefs eingestellt hast?«
Tom war hart, wütend. Ich warf ihm einen warnenden Blick zu. Er hatte großes Glück mit seinem Chef, der ihm diese Chance gab, in seiner Klinik zu arbeiten. Ich wusste, dass Tom den Mut seines Chefs würdigte und versuchte, so gut er konnte, der Situation gerecht zu werden, zu zeigen, dass er es wert war, hier zu arbeiten. Er zeigte es im OP und im Labor.
Sein Chef sah plötzlich müde aus, älter als er war.
»Nein, Tom, das habe ich noch nie gesagt.«
»Aber du hältst es für eine ›gute Idee‹, dass ich mich da vorne hinstelle, vor all die Leute, die ganzen Honorationen, und anfange zu gebärden. Gedolmetscht von Kathrin, die vielleicht nicht einmal in der Lage ist, den Vortragssaal zu erreichen?«
»Tom, hör auf. Ich möchte das nicht übersetzen.«
»Doch! Übersetze, das kannst du nicht machen!«
Er sah mich so flehentlich an, gefangen in seiner Wut, dass ich es doch übersetzte, originalgetreu, aber leise und zögerlich.
Professor Drever wandte sich mir zu: »Es tut mir leid, Kathrin, dass ich Sie in diese Situation, in diesen Streit, gebracht habe, das wollte ich nicht. Tom – ich wusste nicht, dass es so ein Problem für dich ist.«
Tom sah ihn lange an, dann begann er nochmal, diesmal langsamer, ruhiger.
»Denk mal an meinen Vater. Er hätte sich niemals durchgerungen, einen behinderten Arzt einzustellen. Er hat es gehasst, wenn ich gebärdet habe. Wenn ich auf Kongressen unter seinem Namen auftauche, gebärde, nicht spreche – das würde er nicht ertragen.«
Professor Drever warf ihm einen väterlichen, fast liebevollen Blick zu.
»Tom, er ist nicht mehr da, seit mehr als einem Jahrzehnt. Ich habe mich getraut, dich einzustellen. Nicht nur aus Mitleid, auch wenn du das immer geglaubt hast. Ich habe deine Doktorarbeit gesehen und deine Augen, als du im PJ im OP warst, wie wach du allen Operationen gefolgt bist, wie sinnvoll du von Anfang an die Haken gehalten hast, als hättest du damals schon die OP-Schritte gewusst. Du hast eine unglaubliche Begabung als Neurochirurg, Tom, du steckst die meisten hier in die Tasche, auch wenn einige es nicht wahrhaben wollen. Deshalb bist du in meiner Klinik tätig, weil du einer meiner besten Chirurgen bist, nicht weil es einmal deinen Vater gab. Mach dich frei davon. Gehe deinen eigenen Weg.«
Tom starrte ihn an. Es lag ein erwartungsvolles Schweigen in der Luft.
»Ich denke darüber nach. Ich möchte es in Ruhe mit Kathrin besprechen.«
Professor Drever verließ das Arzt-Zimmer. Wir bleiben zurück.
»So etwas passiert nur, wenn du da bist, Kathrin. Gucken wir die MRT Bilder von Frau Meier an.«
Er zeigte mir den großen Tumor, der für ihre Persönlichkeitsstörung und ihr phasenweise auffälliges Benehmen, verantwortlich war.
»Komm, gehen wir zu ihr. Hier ist es wirklich wichtig mit der Dolmetscherei. Die Kongresse…«
Wir gingen zu Frau Meier, sie war dreiundzwanzig, ihre Mutter war bei ihr. Ich stellte uns kurz vor. Tom begann.
»Frau Meier. Warum sind Sie in die Klinik gekommen?«
Ihre Mutter antwortete für sie: »Sabine hatte Kopfschmerzen, sie ist manchmal etwas … komisch«, sie nahm die Hand ihrer Tochter, »zum Beispiel lacht sie plötzlich grundlos. Sie sagt selbst, dass sie es nicht steuern kann, es passiert mit ihr. Dann die Augen, wir waren beim Augenarzt. Der hat etwas gesehen, was ihn beunruhigt hat und hat uns hergeschickt – an Sylvester. Ist es denn so schlimm?«
»Wie lange hat sie schon diese Symptome?«
»Höchstens ein paar Wochen.«
»Frau Meier, wie geht es Ihnen?«
Sie sah ihn an, auf seine gebärdenden Hände.
»Naja, es geht schon. Diese Kopfschmerzen sind anstrengend, manchmal habe ich mich morgens übergeben. Als wäre ich schwanger, aber das kann nicht sein. Ich habe nicht einmal einen Freund.«
»Was machen Sie beruflich?«
»Ich arbeite in einem Büro. Manchmal habe ich Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Bitte – können Sie aufhören, mich zu befragen und sagen, was das MRT gezeigt hat?«
»Ja. Das MRT zeigt einen Tumor in Ihrem Gehirn.«
Beide Frauen sahen uns mit schreckensgeweiteten Augen an. Die Patientin fasste sich zuerst: »Das glaube ich nicht, das kann nicht sein. So schlecht geht es mir gar nicht.«
Tom hatte den Ausdruck eines Bildes dabei.
»Wir sehen einen Tumor. Hier vorne. Das sind Ihre MRT Bilder.«
Fassungslos starrten sie auf das Bild. Die Mutter begann zu weinen.
»Und jetzt? Was machen wir? Was schlagen sie vor? Eine Operation?«
Tom nickte: »Ja, wir werden operieren, dann geht es Ihnen erstmal besser, die Kopfschmerzen sollten weg sein, die Sehstörungen auch. Wir müssen dann die histologische Untersuchung abwarten. Je nachdem was für ein Tumor es ist, gibt es noch eine Anschlusstherapie.«
»Anschlusstherapie? Was meinen Sie?«
»Bestrahlung, Chemotherapie.«
Tom leistete sich nur diese zwei Worte, schmückte es nicht aus, er umschrieb nichts.
»Und dann – werde ich wieder gesund, ja?«
Er maß sie mit einem langen Blick, sie hielt ihm stand, las darin und ließ die Schultern sinken.
»Das hängt von der Diagnose ab, die wissen wir erst zehn bis vierzehn Tage nach der OP. Dann erst können wir alles Weitere besprechen.«
Ein Fünkchen Hoffnung glomm in ihren Augen auf.
»Gut. Dann warten wir ab. Wann ist die Operation?«
»Morgen.«
Wir machten noch die OP-Aufklärung, nichts davon ging in die strapazierten Köpfe von Patientin und Mutter hinein, sie nickten alles ab und unterschrieben. Sie hatten keine Wahl. Wir ließen zwei verzweifelte Frauen zurück.
Tom lotste mich ins Arzt-Zimmer.
»Es ist immer wieder furchtbar.«
»Du glaubst, es ist ein Glioblastom, oder?«
Der häufige Hirntumor bei Erwachsenen, der für seine Bösartigkeit und seine schlechte Prognose bekannt war. Alles passte dazu, die Lokalisation, die kurze Anamnese…
»Ja.«
»Sie weiß jetzt schon, dass es schlecht um sie steht. Du hast es nicht verbergen können, Tom. Sie hat in deinem Blick gelesen.«
»Mein Privileg ist, es nicht auszusprechen. Vor der visuellen Kommunikation kann ich mich kaum schützen.«
In den nächsten Tagen half ich Tom morgens bei der Visite. Wir sprachen es nicht ab, ich tauchte einfach auf, wie er so oft abends bei mir in der Wohnung auftauchte. Jedes Mal öffnete er seine Zimmertür mit einem Blick voller Fragen und Dankbarkeit. Ich zog es durch, bis Mitte Januar seine Dolmetscherin wieder da war, schwänzte sogar die ersten zwei Vorlesungen. Anja schrieb jeden Morgen eine SMS, wo ich sei. Ich gab vor, auszuschlafen und sie wunderte sich. Aber was waren ein paar Vorlesungen, man konnte das alles auch nachlesen. Es war am letzten Morgen, als Tom mich schweigend begrüßte und wir nicht gleich auf die Station zusteuerten, sondern er mich kurz in sein Zimmer hineinzog.
»Kathrin, ich weiß nicht, wie ich mich bei dir bedanken kann …«
Es steckten noch viel mehr Sätze dahinter, aber er schwieg und sah mich an. Ich wusste, dass es ihm nicht gefiel, dass ich jeden Morgen um halb acht in seiner Klinik auftauchte, um ihm zu helfen. Er hätte sicher alles dafür gegeben, dass er diese Hilfe nicht bräuchte. Dass er es überhaupt zuließ, mich gewähren ließ, war Dankbarkeit genug.
»Trag mich einfach ein paar Mal die Treppe rauf, dann sind wir quitt.«
Ich hatte die rechte Krücke zur Seite gestellt und gebärdete, war erleichtert, als er grinste. Er kannte so gut meinen Unwillen, diese Form der Hilfe anzunehmen, annehmen zu müssen. Diese Abhängigkeit ertragen zu müssen, verletzte den Stolz. Mit diesen Visiten musste es sich für ihn ähnlich anfühlen.
»Wir müssen los, Herr Dr. Treppin. Sie werden erwartet.«
Noch ein schiefes Grinsen, dann machten wir uns an die Arbeit.
Ein paar Tage später hatten Tom und ich einen gemeinsamen Termin bei meinem Doktorvater, um die an Weihnachten entwickelte Projektidee zu besprechen. Ich hatte per E-Mail um einen Termin gebeten. Er hatte eine kurze Antwort geschickt.
Einen Termin bezüglich eines neuen Projekts – immer gerne. Mit Tom Treppin, kennen Sie sich?
Ich hatte ohne weitere Erklärungen bejaht.
Jetzt standen wir gemeinsam in seiner Tür. Professor Seibel sah auf, musterte uns und lächelte.
»Kommen Sie rein und nehmen Sie Platz.«
Tom ließ mir den Vortritt und wir nahmen alle an einem kleinen, runden Tisch Platz. Professor Seibel wandte sich an mich.
»Also, Frau Wesel, Sie hatten in Ihrer E-Mail von einer Idee bezüglich der Lymphompatienten geschrieben. Ich bin natürlich neugierig, aber bevor uns neuen Ideen widmen: Wie weit sind Sie mit Ihrer Arbeit?«
Ich berichtete, dass ich mit der Laborarbeit praktisch fertig sei und aktuell mit der Datenauswertung angefangen habe.
»Na, das ging ja schnell. Sie waren auch sehr fleißig, es werden sicher interessante Daten herauskommen. Wir müssen uns dann gemeinsam hinsetzen und mal überlegen, was wir davon auf einem Kongress vortragen können«, im Augenwinkel sah ich Tom grinsen, »und was wir verpapern. Aber jetzt zu Ihrer Idee.«
Ich begann die Idee zu schildern, berichtete, dass das Material schon vorläge. Tom hatte die ganze Zeit schweigend zugehört, eher ein Gespräch zwischen meinem Doktorvater und mir, als Professor Seibel anfing nachzufragen, genauere Details wissen wollte, schaltete Tom sich gebärdend ein und ich dolmetschte.
»Unsere Idee war…«
Professor Seibel guckte konsterniert auf Toms Gebärden, sah uns erstaunt an und lachte plötzlich auf.
»Na, das ist ja toll. Sie können Tom dolmetschen? Das hätten wir vor ein paar Jahren gut brauchen können.«
Tom lächelte auch, wartete, bis er dachte, wieder die fachliche Aufmerksamkeit von ihm zu haben, dann setzte er erneut an, schilderte die Literatur, den genauen Aufbau des Projekts. Ich merkte, wieviel Erfahrung er in diesen Dingen hatte, er hatte die gesamte Projektskizze schon im Kopf, konnte den Arbeitsaufwand, Kosten und Personalbedarf schätzen. Philosophierte darüber, was man potentiell aus den Daten in weiteren Untersuchungen machen könnte. Professor Seibel sah ihm fasziniert beim Gebärden zu, hörte aber auch mir genau zu, stellte ein paar Fragen. Fragend fasste er schließlich unseren Vorschlag zusammen.
»Also, für mich klingt das nach einer sehr guten Idee, reiflich überlegt. Bei Ihrem Fleiß, Kathrin, und mit Tom, seiner Erfahrung und seinem Biss an Ihrer Seite wird es sicher gelingen. Sie können sich an der Vorformulierung des Ethikantrags versuchen, dann gehen wir ihn gemeinsam durch. Parallel kann Treppin anfangen, Sie in die Methodik einzuarbeiten.«
Er maß uns noch mal mit einem intensiven Blick und schüttelte lächelnd den Kopf: »Na, Sie zwei scheinen ja das perfekte Gespann zu sein. Viel Erfolg mit der Idee.«
Damit waren wir entlassen. Dass wir ein gemeinsames Projekt starten wollten, wusste nach wenigen Tagen das ganze Labor. Ich freute mich auf die Zusammenarbeit mit Tom.
Die Wochen flogen dahin, Anja und ich im Lernstress vor den Klausuren am Ende des Semesters, auch Andreas eingespannt, Tom ohnehin, wie immer. Unsere von den Männern besprochene Wochenaufteilung klappte ganz gut. Andreas gehörte der Donnerstag und Sonntag, Tom auf jeden Fall der Freitag. Er ging häufig mit Anja Squash spielen oder joggen am Mittwoch, nicht selten kam er danach noch am späten Abend vorbei. Er schloss selbst die Wohnungstür auf, schlüpfte leise aus der Jeans und zu mir ins Bett. Jedes Mal freute ich mich über seinen warmen Körper neben mir. Ich schlief nie gut, wenn er nicht da war. Was hatte Andreas gesagt? Ich weiß, dass er immer bei dir ist, dass ihr unzertrennlich seid. Ich staunte über Andreas, der uns gewähren ließ, sehr wenig Präsenz und Gefühl von mir einforderte. Trotzdem, oder deswegen, hatten auch wir eine gute zu Zeit zu zweit. Wie er es ertrug, immer nur die zweite Wahl zu sein, ob er es spürte, wusste ich nicht.
In diesen ersten Wochen schien es tatsächlich zu funktionieren, ein Leben zu viert, vielleicht reicher als nur zwei und zwei. Wir diskutierten es nicht, wir lebten es einfach. Dazu gehörte auch die erneute Planung eines Skiurlaubs in den Semesterferien. Außerdem meldete ich mich für eine Famulatur in der Neurologie an. Ich hatte um einen Termin bei dem leitenden Oberarzt gebeten, der die Famulaturen verteilte, aber erstmal nichts von meiner Behinderung gesagt.
Am frühen Nachmittag betrat ich die Kopfklinik, wie vertraut sie mir inzwischen war … Diesmal wählte ich jedoch den rechten Flügel, in dem die Neurologie lag, nicht den linken der Neurochirurgen. Ich klopfte an die Tür von Herrn Dr. Mattheus, er kannte ihn vom Sehen aus den Besprechungen in der Neurochirurgie.
»Kommen Sie rein«, schallte es durch die geschlossene Tür.
Selbst eine Türklinke zu drücken und sich die Tür zu öffnen, ist etwas umständlicher mit zwei Krücken in den Händen. Ich sortierte, stand dann in der geöffneten Tür vor Herrn Dr. Mattheus. Er sah von seinem Schreibtisch auf, zuckte ein wenig zusammen und musterte mich kurz.
»Frau Wesel? Kommen Sie doch rein.«
Er kam auf mich zu, schloss die Tür hinter mir und wies auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch.
»Sie kommen wegen der Famulatur?«
Ich zögerte einen kurzen Moment, immer diese Aufregung, wenn ich Unbekannten gegenübertrat. Diese Frage, wie sie reagieren würden.
»Ja.«
Er war ein ruhiger Mensch, vielleicht Mitte fünfzig, Halbglatze, nicht besonders attraktiv, aber sympathisch, offen. Die Patienten schätzten ihn sicher. Unter seinem intensiven Blick fühlte ich mich selbst ein wenig, als wäre ich eine von ihnen.
»Sie haben in Ihrer E-Mail nichts von Ihrer«, wieder dieses kurze Zögern vor dem Wort, »Behinderung geschrieben.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wie kommen Sie klar auf Station? Ihre wievielte Famulatur wäre diese?«
»Die dritte, vorher war ich in der Onkologie und Neurochirurgie.«
Ein Erinnern, ein Erkennen flackerte in seinen Augen auf, jetzt wusste er wieder, wo er mich schon gesehen hatte. Ich blieb den Leuten oft mehr im Gedächtnis, als mir lieb war.
»Es geht eigentlich ganz gut. Ich bin nur immer ein wenig langsamer mit der Lauferei. Und das lange Stehen in der Visite fällt mir schwer.«
Jetzt war es raus, lieber gleich sagen. Die Neurologen waren bekannt für ausführliche fachliche Diskussionen vor den Patientenzimmern.
Er nickte: »Das kann ich mir vorstellen. Wie haben Sie es bei den Internisten geschafft? Bei wem waren Sie? Dr. Wunsch?«
»Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ehrlich gesagt, habe ich die Visiten im wahrsten Sinne des Wortes kaum durchgestanden. Dr. Wunsch hat das gesehen und mich irgendwann darauf angesprochen. Für mich war alles so neu, dass ich mich nicht getraut habe, es von meiner Seite aus zu sagen. Sie haben die Kurvenvisite an den Tisch verlegt, dann ging es besser. Ich kann nicht gut Patienten oder Proben irgendwohin bringen, brauche viel Zeit und Kraft auch für kurze Strecken«, ich erzählte, er war Neurologe, würde es verstehen. Wie gut sie einen ›Patienten‹ in ihren Reihen tolerieren könnten, würde sich zeigen, »Patienten aufnehmen, Anamnesen machen, Zugänge legen, untersuchen ist kein Problem. Ich mache das sehr gerne, auch die Schreibtischarbeit und Telefoniererei.«
Im Stillen musste ich an Toms Hindernisse im Klinikalltag denken. Es war gut, vorab die eigenen Schwierigkeiten besprechen zu können, es offensiv anzugehen.
»Na, das wird alles gehen, Frau Wesel, da bin ich sicher. Ich nehme Sie zu mir auf die Station. Aber sagen Sie mal Neurochirurgie – wie sind Sie denn darauf gekommen?«
»Über einen Freund.«
Er nickte, fragte nicht weiter.
»Darf ich Sie fragen, was Ihre Grunderkrankung ist?«
Ich wusste, dass in seinem Kopf die ganze Zeit schon die Differentialdiagnose-Maschinerie arbeitete.
»Autosomal dominante, nicht progrediente spinale Muskelatrophie. Mein Vater hat es auch.«
»Da haben Sie sich ja etwas ganz Seltenes ausgesucht. Entschuldigen Sie, war nicht böse gemeint.«
»Ist schon okay. Der große Vorteil daran ist der kleine Zusatz ›nicht progredient‹«
Er nickte.
Die Famulatur wurde interessant. Die Visite vom ersten Tag an am Tisch, stundenlange Diskussionen über Diagnose und Differentialdiagnose, ausführliche klinische und apparative Diagnostik. Mir fiel auf, wie viele der Methoden ich von mir selbst kannte – MRT, EEG, EMG. So viel Spaß mir das Denken in der Neurologie machte, durch die ausführlichen Diskussionen mit Tom war ich sehr gut in der topischen Zuordnung von Symptomen geworden, so sehr deprimierte es mich, wie wenig man oft tun konnte, man diagnostizierte und hatte kaum therapeutischen Möglichkeiten. Die Diagnosen oft ebenso schlimm wie in der Onkologie, nur auf den ersten Blick nicht so lebensbedrohlich, dafür vergesellschaftet mit dem jahrelangen Leid einer schweren Behinderung. Die Multiple Sklerose, eine häufige Diagnose, manchmal junge Patientinnen, denen es eigentlich gut ging, eine Spritze dreimal pro Woche und sie konnten ein fast normales Leben führen, aber immer in der Angst vor dem nächsten Schub, dass es schlimmer werden könnte. Auch Patienten, denen die Erkrankung Stück für Stück, schnell oder langsam, jede Fähigkeit nahm, sich zu bewegen, sich zu fühlen, sogar klar zu denken. Einige waren an den Rollstuhl gefesselt oder lagen nur noch im Bett. Die Verwandten hilflos an ihrer Seite, falls sie es überhaupt aushielten. Die Patienten, denen es besser ging als mir, betrachteten mich zum Teil mit der Geringschätzung des weniger Betroffenen, dieser Wettstreit zwischen Erkrankten, Behinderten – wen hat es schlimmer erwischt, im Vergleich zu dir bin ich zum Glück besser davongekommen. Die an den Rollstuhl Gefesselten betrachteten meine hilflosen Schritte voller Neid. Es war für mich schwierig, in diesem Bereich zu arbeiten, weil ich ständig Vergleichen ausgesetzt war, mich die Kollegen immer mit ihrem differentialdiagnostischen Blick betrachteten. Die Kollegin in der Neurophysiologie kannte mich sogar als Patientin, meinen Vater auch. Ich lernte Patienten kennen, die mir so ähnlich waren, mir ein solches Verständnis in ihren Blicken entgegenbrachten, dass ich es zum Teil kaum aushielt.
Eines Morgens auf meiner Blutentnahmerunde betrat ich das Zimmer eines jungen Mannes, etwa so alt wie ich selbst. Bis vor Kurzem hatte er ein normales Leben geführt, dann waren Lähmungen aufgetreten, erst an den Beinen, dann rasch aufsteigend zu den Armen und dem Oberkörper. Er lag seit wenigen Tagen bei uns, ans Bett gefesselt, nicht in der Lage einen Finger zu rühren, komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Viel allein, starrte er die weiße Decke an, bis nachmittags seine verzweifelte Mutter kam, an seinem Bett saß und weinte. Er hatte keine Kraft, nicht sich zu bewegen, kaum zum Atmen.
»Herr Meindel? Guten Morgen, ich muss Ihnen Blut abnehmen.«
Die Vorhänge waren schon offen, noch lag er in dem schummrigen Halbdunkel des Februarmorgens. Ich machte das Nachtischlicht an. Er drehte den Kopf in meine Richtung, die einzige Bewegung, derer er noch fähig war.
»Ja. Ich kann Ihnen leider nicht meinen Arm reichen.«
»Ist schon gut.«
Sein wacher Blick musterte mich, völlig klar, gefangen in einem Zustand eines fast komplett bewegungslosen Körpers. Ich nahm das Blut ab und war schon fast wieder aus dem Zimmer.
»Warten Sie…«
»Ja?«
»Sind Sie immer – so?«
Ich sah ihn erstaunt an: »Ja. Ist angeboren.«
»Ich nicht. Bis vor sechs Wochen war bei mir alles normal. Wenn Sie mich hier so sehen, können Sie sich das wahrscheinlich kaum vorstellen. Ich war allein in Heidelberg, Studium Biochemie, Basketballer.«
Ich stand, wie immer etwas wackelig, unten an seinem Bett.
»Können Sie sich einen Moment setzen? Haben Sie gerade Zeit?«
Hatte ich eigentlich nicht, aber ich brachte es nicht über das Herz, ihn jetzt allein zurück zu lassen, also setzte ich mich auf den Stuhl an seinem Bett, den sonst seine Mutter einnahm.
»Ich war ein solcher Idiot. Ich habe meine Gesundheit, meine Sportlichkeit, immer als selbstverständlich angesehen. Mich mit den anderen Sportlern über die Unsportlichen, die weniger Begabten lustig gemacht. Mein Leben gelebt, ohne viel darüber nachzudenken. Einen Rollstuhlfahrer habe ich vielleicht mal im Bus gesehen, mitleidig zugesehen, wie er sich rein und raus mühen musste. Nie habe ich gedacht, dass ich … Und jetzt liege ich hier und kann gar nichts mehr. Allein mit meinen kreisenden Gedanken, wenn ich die Decke anstarre, beschämt, wenn man mir sogar beim Pinkeln helfen muss. Es ist so entwürdigend. Es ist so langweilig. Meine Freunde haben sich nach wenigen Wochen alle zurückgezogen, sie haben Angst zu fragen, wie es mir geht, nicht mal eine SMS. Aber wahrscheinlich hätte ich es auch so gemacht, wenn es einen von Ihnen getroffen hätte. Meine Mutter ist die Einzige, die kommt, sie fühlt sich verpflichtet, den Dienst an ihrem Kind zu tun. Sie erträgt es kaum, mich so zu sehen. Aber sie kommt wenigstens.«
»Was machen Sie den ganzen Tag?«
»An die Decke starren. – Wäre ein Du für Sie okay? Können Sie einfach Michael sagen?«
Wieder dieser Name, natürlich wusste ich es aus den Krankenakten, trotzdem war es ein komisches Gefühl.
»Ja, Michael. Ich bin Kathrin. Was würdest du jetzt gerne tun?«
Er seufzte.
»Drippelnd übers Feld laufen, ein paar Körbe werfen.«
»Das meine ich nicht, was würde Spaß bringen, was dir jetzt möglich ist?«
Er warf mir einen langen Blick zu.
»Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, immer nur über alles, was ich gerade nicht kann … Es ist schön hier mit dir zu reden.«
»Denk weiter. Was noch?«
»Vielleicht einen guten Film gucken.«
»Welchen? Ich besorge ihn dir für heute Abend.«
Er lächelte: »Haben wir ein Date?«
»Wenn es dir guttut, es so zu nennen … Also, welchen Film?«
»Ich denke darüber nach. Geh arbeiten. Kommst du nachher vorbei? Dann weiß ich, welchen.«
Ich beendete meine Blutentnahmerunde in Gedanken und kam gerade noch pünktlich zur Visite.
Am frühen Nachmittag war ein wenig Leerlauf. Die Fernseher hatten DVD-Player. Michael hatte sich einen Actionfilm gewünscht. Ich machte mich auf zu Tom. Vielleicht wäre er in seinem Zimmer. Ich brauchte jemanden zum Reden. Als ich klopfte, öffnete er die Tür. Er lächelte, als er mich sah: »Ach, du bist es. Wie schön!«
»Hast du einen Moment Zeit?«
»Für dich immer. Komm rein, setz dich.«
Ich fiel auf den Ledersessel, den er aus dem Büro seines Vaters gerettet hatte und erzählte von Michael. Tom zuckte bei dem Namen kurz zusammen. Ich musste an sein erstes Geständnis damals denken, ausgelöst durch diesen Vornamen. Er hörte – sah – mir konzentriert zu, unterbrach nicht, ließ mich einfach erzählen.
»… es ist schlimm, ihn so zu sehen, Tom. Vor ein paar Wochen noch ein ganz normaler Mensch und jetzt geht gar nichts mehr. Er kann nicht einmal selbst essen oder auf die Toilette gehen. Wie hält er es bloß aus?«
Tom maß mich mit einem langen Blick.
»Die meisten können sich auch nicht vorstellen, wie wir es in unseren Körpern aushalten, damit leben, unseren Alltag bewältigen. Es bleibt einem ja nichts übrig, man muss es aushalten. Wer fragt einen schon? Soll ich dir diesen Film besorgen?«
Am Abend, nachdem wir mit der Station fertig waren, verabschiedete ich mich von dem Assistenzarzt.
»Sag mal, Kathrin. Wie gefällt es dir bei uns? Bringt es dir Spaß?« Die Famulatur war fast fertig, ich war schon in der letzten Woche.
»Spaß? Ich arbeite gerne mit euch zusammen, ich liebe diese Art, wie ihr alles durchdenkt und allein dadurch auf Diagnosen kommt. Immer eine sinnvoll eingesetzte Diagnostik. Ich mache gerne Anamnesen, nehme die Patienten auf und alles. Ihr nehmt wunderbar Rücksicht auf mich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, werde ich eher nicht anpeilen, Neurologie zu machen.«
Er war ehrlich erstaunt: »Wirklich? Ich hatte den Eindruck, der Job hier ist dir wie auf den Leib geschrieben. Es fällt dir leicht, die Patienten achten dich. Du machst es richtig gut hier, trotz…«
»Trotz meiner Behinderung? Vielleicht. Das Problem ist, dass ich mich häufig hier selbst wie die Patientin fühle. Ihr betrachtet mich und denkt über meine Diagnose nach, die Patienten messen sich in ihren Fähigkeiten und Defiziten mit mir. Ich kann sie zum Teil so gut verstehen, ihren Frust. Es kommt mir zu nah.«
»Vielleicht hast du recht. Nichts für ungut, Kathrin. Ich hätte mir dich hier so gut vorstellen können. Mach dir einen schönen Abend.«
»Ich gehe nochmal zu Michael Meindel. Habe ich ihm heute Morgen versprochen. Meinst du, er – wird wieder? Wird wieder gesund?«
»Wahrscheinlich hat er ein Guillain-Barré Syndrom. Es wird dauern, aber höchstwahrscheinlich zumindest wieder besser werden.«
Ich ging zu ihm, den Film zwischen Daumen und Krücke geklemmt.
»Hallo, Kathrin. du kommst wirklich? Ich habe es schon nicht mehr geglaubt. Hatte Angst, dass du mich vergessen hast.«
»Es ist erst sechs Uhr. Hier ist immer viel Arbeit.«
»Die Zeit ist auch anders für mich jetzt, alles ist eine Ewigkeit, sie vergeht einfach nicht, wenn man nur an die Decke starrt und seinen Gedanken hinterher hängt. Der einzige Rhythmus ist meine Mutter, die nachmittags kommt. Sie ist so verzweifelt, dass ich sie trösten muss. Und das Essen. Gefüttert werden, wenn man es genau nimmt.«
»Hast du schon zu Abend gegessen?«
»Nein. Ich habe auf mein Date gewartet.«
Das Essenstablett stand unangerührt auf dem Nachttisch.
»Was darf es denn sein? Du hast die Wahl zwischen Gummikäse und etwas das nach Aufschnitt aussieht. Graubrot oder Weißbrot? Tee?«
»Weißbrot und Gummikäse. Ist der Tee wenigstens schwarz? Haben sie das endlich begriffen, dass ich nicht der Typ für Hagebutte oder Kamille bin?«
»Du hast Glück, es ist schwarzer Tee.«
Er warf einen Blick auf Kanne und Tasse, zog eine Grimasse.
»Nimmst du diese Schnabeltasse? Sonst gibt es eine Sauerei.«
»Mache ich.«
Ich lehnte mich halbstehend an sein Bett, deponierte meine Krücken am Fußende und strich das Brot, zerteilte es in kleine Stückchen wie Tom es immer tat und begann Michael zu füttern.
»Tomate?«
Er nickte. »Welch köstliches Mahl. Gibst du mir von dem Tee?«
Ich hielt die Schnabeltasse an seine Lippen.
»Heiß?«
»Nein, geht. Mach dir doch ein Brot. Ich habe ohnehin nicht so viel Hunger, verbrauche ja wenige Kalorien bei dem Herumliegen hier.«
Ich machte mir ein Wurstbrot. Er beobachtete mich, als ich hineinbiss.
»Seit Längerem das erste Mal, dass ich wieder zusammen mit jemandem esse. Du, meinst du, ich werde wieder? Meinst du es kommt wieder in Ordnung? Oder – bleibe ich so?«
»Ich weiß nicht genau, Michael. Sie glauben, dass du ein Guillain-Barré-Syndrom hast.«
»Habe ich schon gehört, aber ich kann es nicht einmal googlen.«
Mit den Augen wies er auf den Laptop in seinem Nachtschrank.
»Meine Mutter checkt meine Mails für mich, auch nicht schön, aber geht eben nicht anders. Ich habe mich nicht getraut, sie zu bitten, die Diagnose einzugeben. Sie erträgt die Antwort nicht, wenn sie schlecht ist.«
»Warum fragst du nicht die Ärzte?«
»Sagen die einem jemals die Wahrheit?«
»Wenn du sie nicht fragst, gibst du ihnen keine Chance dazu.«
Langsam nickte er: »Da hast du recht.«
Ich wies auf seinen Laptop: »Soll ich ihn hochfahren?«
»Ja.«
Ich hievte mich auf den Stuhl hinüber, nahm seinen Laptop und versuchte ihn so zu halten, dass er auch etwas sehen konnte.
»Fahr das Bett ganz runter, dann geht es. Mein Passwort ist…«
Ich öffnete den Account.
»Willst du gleich googlen oder erst die Mails?«
»Gleich googlen. Mir schreibt ohnehin fast keiner mehr.«
Wir lasen Wikipedia und andere Medizinerseiten bezüglich der Diagnose durch. Er war erst sehr angespannt, wurde aber langsam ruhiger, als er über die häufig nicht so schlechte Prognose las. Er hatte eine Chance da wieder rauszukommen, vielleicht wäre nicht alles wie früher, aber wahrscheinlich sehr viel besser als jetzt. Ich sah, wie er aufatmete. Er wandte das Gesicht zur Wand, seine einzige Möglichkeit für Privatsphäre in meiner Anwesenheit.
»Ich fahre das Ding wieder runter, ja?«
Er nickte nur. Ich nahm seine Hand, wusste nicht, wieviel er dort spürte.
»Soll ich gehen? Magst du allein sein?«
Langsam wandte er sich mir wieder zu, das Gesicht tränenüberströmt, darunter ein Leuchten.
»Nein, bitte bleib. Entschuldige, ich bin nur so erleichtert.«
»Du hättest fragen sollen.«
»Ich hatte solche Angst vor der Antwort.«
»Darf ich?« Mit einem Taschentuch trocknete ich seine Tränen. Er musste grinsen.
»Der Taschentuchvorrat ist eigentlich für meine Mutter.«
»Sollen wir den Film gucken?«
»Ja. Wenn es dir zu viel Geballer, Tote und Blut sind, kann ich ihn sonst allein weiter gucken. Es ist kein Mädchenfilm, aber mir ist gerade sehr nach Action und – Bewegung.«
»Alles klar.«
Wir guckten den Film, die Guten, die Bösen, viel Kampf und Gemetzel. Wie so oft fand auch ich großen Gefallen an den sich anmutig bewegenden Körpern. Wir mussten den Ton leise stellen, um die achtzigjährigen Patienten in den Nebenzimmern nicht zu stören.
Es war vielleicht zehn Uhr, kurz vor Ende des Films, als Tom ins Zimmer kam. Lächelnd betrachtete er uns, wie wir fasziniert vor dem Fernseher hingen. Michael warf ihm nur einen kurzen fragenden Blick zu, dann widmete er sich wieder dem Film. Tom trat hinter meinen Stuhl, legte die Hände auf meine Schultern und sah schweigend das Ende mit an.
Wir sahen noch den gesamten Abspann, dann machte ich den Fernseher aus. Michael suchte meinen Blick.
»Das ist also dein eigentliches Date, oder? Danke, dass du mir trotzdem etwas von deiner Zeit geschenkt hast, Kathrin.«
»Das ist Tom – Michael. Tom hat netterweise den Film besorgt«, ich blickte hoch zu ihm, »hast du bis jetzt gearbeitet?«
»Ja, ich war noch im OP.«
Michael musterte uns – verwirrt.
»Ach so, sorry, Michael. Tom ist stumm, er hört aber ganz normal.«
Seine Beschreibung der Situation.
»Oh. Sprechen ist so in etwa das Einzige, was bei mir im Moment noch hinhaut. Also, auch danke an Sie, dass Sie mir Ihr Date ausgeliehen haben, das hat mir sehr gutgetan.«
Tom nickte.
»Wir gehen jetzt mal nach Hause, Michael. Wir sehen uns morgen.«
»Hoffentlich nicht nur zum Blutabnehmen.«
»Versprochen.«
Tom stellte Michael das Kopfende noch runter und löschte das Licht. Es war schwierig für mich im Dunkeln zu laufen. Tom nahm meine Krücken und ging mit mir.
Am letzten Tag meiner Famulatur musste ich Michael nochmal Blut abnehmen. Ich mühte mich mit einer Krücke in der einen und dem Blutentnahmetablett in der anderen ins Zimmer.
»Kathrin, komm mal her, schnell.«
Er war ganz aufgeregt. Bei mir ging es nicht schnell, ich mühte mich langsam um sein Bett, stellte die Blutentnahmesachen auf den Nachttisch und hockte mich auf die Bettkante, dann sah ich ihn an.
»Was ist, Michael?«
Er grinste: »Nimm mal meine rechte Hand.«
Ich nahm sie. Er erwiderte meinen Druck, nur ganz leicht, aber er konnte meine Hand tatsächlich etwas drücken. Er strahlte: »Kathrin, es wird besser! Die Medikamente schlagen an.«
Ich strich vorsichtig seine Hand, meine Reaktion nicht lebhaft genug für ihn.
»Was ist, Kathrin? Freust du dich nicht? Es wird wieder, ich werde wieder. Ich kämpfe mich durch, werde üben und üben und dann wird alles wieder gut.«
»Doch ich freue mich sehr, Michael. Ich bin sicher, dass du mit all deiner Energie üben wirst. Aber wenn es nicht wieder alles wird wie früher, hasse dich nicht dafür, okay? Versprichst du mir das?«
Ich sah ihn an. Ich wusste, dass ich unfair war. Er war so voller Hoffnung, voller Freude und ich nahm sie ihm. Ich kannte mich aus mit der Hoffnung, nach irgendwelchen Operationen, und den schweren Bruchlandungen, wenn doch nicht alles so gut wurde, wie sie versprochen hatten.
»Kathrin, du bist echt hart. Alle anderen hätten sich einfach gefreut, sich mit mir freuen zu können, in dieser ganzen Katastrophe.«
»Entschuldige, Michael. Ich wollte dich nicht verletzen, deine Freude nicht trüben.«
»Du hast Erfahrung in diesen Dingen? Mehr als dir lieb ist?«
Ich nickte.
Langsam fuhr er fort: »Auch wenn deine Worte jetzt hart sind, wahrscheinlich helfen sie mir, wenn es mal wieder nicht so läuft. Ich bemühe mich dann, an dich zu denken.«
»Meine Famulatur ist heute zu Ende.«
»Das passt ja, ich gehe nächste Woche in die Reha, zum Trainieren«, er lächelte etwas schief, »bleiben wir in Kontakt? Gibst du mir deine E-Mail-Adresse?«
»Gerne, Michael.«
Ich schrieb sie auf und legte sie auf seinen Nachttisch, dann nahm ich das Blut ab.
In die Tage dieser Famulatur fiel auch der Jahrestag von Toms und meinem ersten E-Mail-Kontakt. Nach dem schwierigen Weihnachtsgeschenk hatte ich lange überlegt, ob ich ihm etwas schenken sollte. Ich entschloss mich für Bilder. Als Erbgut meines Vaters konnte ich ganz passabel zeichnen. Ich widmete jedem unserer ersten zwölf Monate ein Bild. Zwei über Computer gebeugte Menschen im E-Mail-Verkehr. Schriftgespräche. Tom mit lachendem Gesicht auf Skiern. Wir eng umschlungen laufend. Übereinander gestapelt in meinem Rollstuhl. Beide lesend auf dem Sofa. Beim Schachspiel. Ein Frühstückstisch mit der Sondenkostflasche. Wir beide beim ZVK-Legen in der Klinik. Pipettieren im Labor. Wir beide im OP, ich an den Tisch geklammert. Das schönste Bild wurden wir beide in meiner Küche, im Fenster ein grauer regnerischer Tag, drinnen gemütlich, in unserer eigenen Welt, gebärdend, uns gegenseitig aufmerksam im Blick. Ich band die Zeichnungen zu einem Heft zusammen und schrieb als Titel »Für Tom - Unser erstes Jahr« darauf. Das genaue Datum des ersten Kontaktes hatte ich noch in meinem E-Mail-Account. Ob Tom wohl auch daran denken würde? Es war der elfte Februar gewesen, wenige Wochen vor meinem Geburtstag. Dieses Jahr fiel der Tag auf einen Freitag.
Ich kochte ein schönes, für Tom leichtes Essen. Er hatte sich in den letzten Wochen angestrengt, regelmäßig seine Sondenkost zu trinken, und wieder etwas zugenommen. Wenn er nicht so hungrig und gestresst war, gelang es ihm immer mehr auch normale Dinge zu essen.
Tom kam schon um sieben, früher als sonst üblich. Wie immer stand er vor meiner Tür, Jeans, Winterjacke, Fahrradhelm, ein wenig nass vom Schneeregen draußen, sein Blick, das leise Lächeln.
»Hallo, Kathrin.«
»Hi, Tom. Komm rein.«
Wir gingen in die Küche, ich spielte mit dem Teekocher herum, als er auf die Tischplatte klopfte, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Das tat er sonst nie. Er wartete immer, bis ich mich ihm von allein zuwandte. Mir wurde, obwohl wir uns ein Jahr kannten, erstmals bewusst, dass er keine Möglichkeit hatte, akustisch auf sich aufmerksam zu machen. Sonst kam er meist und berührte mich. Heute war es anders, er war aufgeregt.
»Setz dich mal, Kathrin. Weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist?«
Ich musste lachen.
»Du hast es also nicht vergessen?«
»Nein. Ich konnte gar nicht. Wart mal, ich habe etwas für dich.«
Er holte seinen Rucksack und zog ein Päckchen, wieder im DinA4-Format, heraus. Gespannt löste ich das Band, wickelte es aus. Wieder so ein Büchlein, professionell gebunden. Der Titel »Unser erstes Jahr«.
Ich konnte nicht schnell aufspringen und mein Geschenk holen, also blieb der gleiche Titel noch ein Geheimnis, während ich in dem Buch blätterte.
Es begann mit meiner allerersten E-Mail: Sehr geehrter Herr Dr. Treppin. Ich bin Studentin im fünften Semester und habe eine schwere Gehbehinderung … und seiner Antwort darauf: Liebe Frau Wesel. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Frau Bierhauf hat mir während meines Studiums tatsächlich immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ich schätze sie sehr. Was ist Ihre Sorge bezüglich der Famulatur? Können Sie etwas mehr zu sich erzählen?
Er hatte in diesem Heft all unsere schriftliche Kommunikation zusammengetragen, aus einem ganzen Jahr. Die E-Mails und unsere Papiergespräche.
»Hast du alle Blocks aufbewahrt, Tom?«
»Sicher. Neulich habe ich den einen sogar noch bei dir wieder gefunden und ihn heimlich entführt.«
Alle Texte waren abgetippt, mit verschiedenen Schrifttypen für ihn und mich, in diesem Buch enthalten. Die Schriftgespräche wurden über die Monate weniger. Die Mails blieben. Wieder einmal wusste ich nicht wirklich, was ich sagen sollte.
»Was für eine schöne Erinnerung, Tom.«
»Es muss ja irgendeinen Vorteil haben, die Schreiberei, gen Ende wird es immer weniger.«
»Das ist ja auch gut so. Komm mit ins Wohnzimmer, ich habe auch etwas für dich.«
Fragender Blick, dann gingen wir hinüber. Ich ließ mich auf das Sofa fallen, neben Tom und gab ihm mein Geschenk. Auch er packte vorsichtig, mit einer unendlichen Langsamkeit aus. Als er den Titel sah, grinste er mich an. Dann schlug er das Heft auf und vertiefte sich in meine Bilder. Eins nach dem anderen, in aller Ruhe, als wäre ich gar nicht da. Am längsten verharrte sein Blick auf meinem Lieblingsbild, dem ›Gebärdenbild‹. Er schlug die Mappe zu und sah mich schweigend an. Kein Wort, keine Geste, nur unsere Blicke, sie versanken ineinander. Dann strich er mir über die Wange, griff in meinen Nacken, meine Haare und versuchte sich mit einem Kuss. Vorsichtig trafen sich unsere Lippen, viel mehr nicht, aber schon viel besser als der Erste vor einigen Wochen.
Er legte seinen Arm um mich, ich lehnte mich in die Umarmung hinein.
»Eigentlich ist es verkehrt herum, Kathrin. Ich in Worten, du in Bildern …«
»Wir passen uns immer mehr aneinander an.«
»Und ich kann nicht malen.«
Wir mussten beide lachen. Tom legte das Mozart-Klarinettenkonzert ein und ich machte mich ans Kochen. Wir aßen ganz gemütlich von einem Teller, Tom nur einige Gabeln, aber besser als nichts. Dann gingen wir früh ins Bett.
Der Skiurlaub mit Anja und Andreas wurde schön, nicht so aufregend und prickelnd wie letztes Jahr. Wir kannten uns alle ein wenig besser und wählten eine ehrliche Zimmerverteilung, Anja und Andreas und Tom und ich. Tom hatte sogar die Autofahrt etwas gelassener nehmen können. Wir hatten Musik gehört, wir saßen zusammen auf der Rückbank. Wir führten Parallelgespräche, Anja und Andreas vorne in Lautsprache, Tom und ich hinten in unserer stillen Sprache.
»In diesem Urlaub hast du Geburtstag, Kathrin. Schon überlegt, was du machen möchtest?«
»Nein. Aber wenn ich an deinen Geburtstag in unserem Urlaub denke, bin ich wenigstens so fair, meinen zuzugeben.«
Er lächelte: »Naja, die Geheimhaltung klappt ja auch nur genau ein Jahr. Wenn du keine Pläne hast, werden wir uns etwas überlegen müssen.«
»Einen Wunsch habe ich doch.«
»Na?«
»Die Nacht mit dir.«
Zur Antwort nahm er meine Hand und streichelte sanft darüber.
»Andreas wird vielleicht enttäuscht sein.«
»Einen Wunsch wird man wohl haben dürfen, fädelst du das für mich ein?«
»Mit Vergnügen.«
Diesmal hatten wir uns gegen das Hotel und für eine Wohnung entschieden, es hieß einkaufen gehen und selbst Frühstück machen, gab uns aber auch die Flexibilität zu Hause zu kochen und war natürlich billiger. Andreas hatte wieder einen Verteilungsplan ausgeheckt und tatsächlich Tom meinen Geburtstag überlassen. Wie konnte er nur immer so bescheiden sein? Oder hatte er gar kein wirkliches Interesse an mir? Ich schob den Gedanken weg. Die Wohnung war schön, Erdgeschoss, keine Treppen. Die Dusche mal wieder ungeeignet, irgendwie musste es eben gehen für eine Woche. Sie gingen Skifahren, in wechselnden Besetzungen wie im Jahr zuvor, einer blieb immer bei mir zurück. Ein paar Mal versuchte ich sie halbherzig zu überreden, sich zu dritt einen Tag auf der Piste zu gönnen.
Einem Tag zu dritt sagten sie zu. Ich wollte lesen und ein wenig an meiner Doktorarbeit arbeiten. Eine Wohnung deutlich komfortabler als nur ein Hotelzimmer, man konnte sich wenigstens mal zwischendurch einen Tee machen. Schon gegen Mittag schloss jemand die Wohnungstür auf. Es musste Tom sein, der jemand rief kein ›Hallo‹ oder ähnliches.
Ich saß am Tisch und sah auf.
»Tom, schon zurück? Du fährst doch so gerne Ski. Ich hoffe, dich hat nicht das schlechte Gewissen zurückgeschickt? Oder bist du verletzt?«
Er ließ sich neben mich auf den Stuhl fallen, schwieg erstmal.
»Nein, nichts von dem, alles gut. Natürlich hatte ich Sehnsucht nach dir, aber vor allem hatte ich keine Lust, das fünfte Rad am Wagen zu sein.«
Ich warf ihm nur einen fragenden Blick zu.
»Sie reden die ganze Zeit, Kathrin. Über alles und nichts. Sie küssen sich auch ab, aber das ist mir eigentlich egal, nur dieses ständige Reden. Ich kann nicht mithalten, sitze stumm daneben. Was sie reden, interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe mich am späten Vormittag abgeseilt, bin ein paar schwierige Pisten allein runtergeheizt, dann hatte ich keine Lust mehr und bin mit dem Bus nach Hause. Wenn du dabei bist, fühlt es sich besser an. Ich weiß, dass ich auch dann nicht viel rede, aber ich weiß, dass ich es könnte, dass du mich übersetzen würdest. Oder wir führen eben unsere Parallelgespräche.«
»Hast du ihnen Bescheid gegeben?«
»Ja, ich habe eine SMS geschrieben, dass ich nicht mit essen komme, und sie nicht auf mich warten sollen.«
»Hunger? Wir könnten was kochen.«
Er guckte genervt: »Ja, Hunger, zu sehr, um etwas normales runterzubringen.«
»Dann trink doch erst was von dem Zeug«, so hieß Toms Sondenkost inzwischen in unserem Jargon, »und dann kochen wir etwas.«
»Puh, Kathrin, jetzt bin ich gerade dem Gequatsche entkommen, dann fängst du mit dem Essen an. Ich möchte eine Pause, lesen, was spielen, meinetwegen Mittagschlaf…«
»Such es dir aus. Es ist auch dein Urlaub.«
»Dann plädiere ich für einen Mittagschlaf, aber nur in Begleitung.«
»Geht klar.«
Wir schliefen dann doch nicht, sondern lagen auf unserem Bett herum, ich ohne Schienen, Tom nur im T-Shirt. Unsere Bücher und Laptops dabei. Ich sichtete meinen E-Mail-Account.
»Schau mal, Tom. Michael hat geschrieben.«
Er musste jetzt seit fast drei Wochen in der Reha-Klinik sein. Ich war gespannt zu lesen, wie es ihm ging.
Hallo Kathrin, wo immer du auch gerade bist, was immer du gerade machst. Ich dachte, ich lasse mal von mir hören. Stecke jetzt die dritte Woche in dieser Reha fest, sie geben sich viel Mühe mit mir und ich komme voran, viel langsamer als mir lieb ist. Aber Geduld war noch nie meine Stärke (meine Mutter grinst, sie schreibt die E-Mail und ich diktiere). Ich kann inzwischen einigermaßen meine Hände und Arme bewegen, die Feinmotorik ist noch eine Katastrophe, deshalb geht das Tippen nicht. Ich sitze im Rollstuhl, komme aber noch nicht gut mit dem Ding klar. Alles in mir wehrt sich, darin zu sitzen, aber immer noch besser als den ganzen Tag im Bett zu liegen. Meine Beine tun noch gar nicht das, was ich von ihnen will oder was sie normalerweise zu tun haben. Mich plagt die Ungeduld, dass es besser wird. Ich weiß, dass ich dankbar sein sollte, dass es überhaupt besser wird, aber im Moment sehe ich eher wieder das, was alles nicht geht. Ich versuche dann an dich zu denken und an deine Ermahnung, über das nachzudenken, was ich kann, nicht was ich nicht kann. Natürlich schleppe ich auch eine große Angst mit mir herum, dass nicht wieder alles gut wird. Aber aktuell geht es prinzipiell bergauf, die Richtung stimmt wenigstens. Viele Grüße auch an Tom, könntest du die Mail an ihn weiterleiten? Ich mag nicht hinter seinem Rücken mit dir schreiben. Viele Grüße, Michael
Tom und ich schrieben die Antwort gemeinsam.
Hallo Michael, ich brauche die E-Mail nicht an Tom weiterleiten. Er sitzt neben mir und wir lesen sie gemeinsam. Falls du ihm direkt schreiben willst, seine E-Mail-Adresse ist … Kathrin
Hi Michael, schön von dir zu hören. Wir dachten, dass, wenn wir deine Mail gemeinsam lesen, wir dir auch gemeinsam eine Antwort schicken können. Wie du es beschreibst, hast du riesige Fortschritte gemacht. Falls ich kurz als Arzt etwas dazu sagen darf: Wenn ich den Verlauf ansehe, hast du wahrscheinlich eine ziemlich günstige Prognose. Ich hoffe, das macht dir Mut, nicht Angst. Tom
Hi nochmal, Michael. Ich kann mir deine Ungeduld gut vorstellen. Ich konnte nach meinen Operationen (viel zu viele waren es in meinen Augen) immer wochenlang nicht laufen, musste den Rollstuhl hüten (auch mein Feind), bis ich wieder belasten, wieder neu üben durfte zu laufen. Mir hat auch immer alles viel zu lange gedauert. Naja, Kopf hoch. Du kannst stolz sein, was du schon wieder hinbekommst. Sollen wir dich vielleicht mal am Wochenende besuchen? Kathrin
Wir zwei weilen diese Woche mit Freunden im Skiurlaub, Sonne, Schnee, tolle Pisten, aber gerade habe ich mich dagegen entschieden und lungere mit Kathrin zusammen auf dem Bett herum und wir schreiben gemeinsame E-Mails. Auch eine neue Erfahrung. Mach’s gut. Wir versuchen, bei dir vorbei zu kommen. Wie lange geht deine Reha noch? Viele Grüße, Kathrin und Tom
Michaels Antwort kam naturgemäß nicht sofort, er brauchte ja jemanden zum Tippen. Am nächsten Tag, es war ein Tag mit Anja, war sie aber in meinem Postfach.
Hi Kathrin, diesmal doch nur für dich. Ich habe meine Mutter Tom Treppin googeln lassen. Ist er wirklich Neurochirurg? Wie macht er das, ohne zu sprechen? Manchmal habe ich so eine schreckliche Langeweile, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr kommt. Wie verbringst du den Skiurlaub? Eher nicht auf der Piste, oder? Michael
Hi Michael, nein, keine Piste für mich, traue mich kaum auf die Straße, weil es glatt ist. Aber die drei überreden mich immer wieder. Netterweise haben sie einen Plan ausgearbeitet, dass immer einer mit mir hier in der Wohnung bleibt. Ich kläre mit Tom, wann er Dienst hat, dann machen wir einen Termin für einen Besuch aus. Bis dahin können wir sehr gerne mailen. Vielleicht vertreibt es die Langeweile ein wenig. Was machen die Action Heroes? Kathrin
Es war eine komische Vorstellung, dass jemand am anderen Ende von Deutschland saß, noch bewegungsloser als ich.
Mein Geburtstag war der letzte Tag des Skiurlaubs. Sie weckten mich, nachdem sie wunderschön den Frühstückstisch gedeckt hatten, mit Kerze, Kuchen und allem Drum und Dran. Anja hatte Deko eingekauft. Sie schenkte mir eines ihrer Lieblingsbücher, Michael wieder Geigennoten.
»Schade, dass wir die Instrumente nicht dabeihaben. Die Musik fehlt in unseren Urlauben wirklich.«
»Dann müssten wir eben mal alle eine Woche Urlaub zu Hause verbringen.«
Tom sparte sein Geschenk auf, bis die anderen zwei weg waren, sie hinterfragten es nicht. Das dritte Päckchen im DinA4-Format.
»Tom, was hast du denn noch alles für Ideen? Zum Komponieren hast du doch keine Zeit gehabt, oder? Schon Weihnachten habe ich mich gefragt, wann du es eigentlich gemacht hast.«
»Nachts. Nein, es sind keine Noten. Mach es auf.«
Das Büchlein war erneut betitelt: ›Von mir‹, mehr nicht.
»Tom, was ist das?«
»Keine Bilder, ich kann nicht malen, weißt du ja. Sieh es dir an. Nimm dir Zeit.«
Ich begann erst zu blättern, dann doch von vorne zu lesen. Es war ein Tagebuch, sein Tagebuch. Es begann an dem Tag des Unfalls, dem Tag als er seine Eltern und seinen Zwillingbruder verloren hatte. Ich las ein paar Seiten, dann riss ich mich los.
»Tom, du hast nach dem Unfall Tagebuch geschrieben?«
»Ja, ich musste irgendwo hin mit mir, hatte keinen zum Reden, da habe ich eben angefangen zu schreiben.«
»Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich es lese, Tom. Es ist doch dein Tagebuch. Es geht niemanden etwas an.«
»Du wirst viel wieder erkennen, Kathrin. Ich habe es dir erzählt. Ich dachte, diese Seiten passen in die Reihe der Geständnisse, die ich dir gemacht habe. Die Idee hatte ich, als ich unsere Gesprächsabschriften gemacht habe. Ich hatte fast vergessen, wieviel du schon über mich weißt und mit welcher Intensität ich es dir um die Ohren gehauen habe. Da ist das Tagebuch fast der sanftere Part. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es liest. Es sind nur achtzig Seiten, irgendwann habe ich aufgehört zu schreiben.«
»Weil es dir besser ging?«
»Nicht wirklich. Lies.«
»Jetzt?«
»Warum nicht?«
»Und du?«
Er zuckte die Schultern.
»Sollen wir es gemeinsam lesen, Tom? Ich komme mir sonst komisch vor.«
»Ich kenne es auswendig. Ich habe es gerade erst abgetippt. Aber gut, wenn du willst …«
Wir legten uns zusammen auf den Bauch auf unser Bett und begannen in seinem über zehn Jahre alten Tagebuch zu lesen. Seine volle Gefühlswelt lag offen vor mir, alles, was er nie jemandem erzählt oder gezeigt hatte. Seine ganze Verzweiflung, die ganze Leere, die Kälte, das Alleinsein, das sich nicht ausdrücken können. Von seinen Problemen mit dem Essen kein Wort. Er beschrieb sogar ein Frühstück mit Brötchen … Wir benötigten vielleicht zwei Stunden für die Lektüre. Es stimmte, ich kannte einiges, aber lange nicht alles. Er hatte Sprachunterricht genommen und irgendwann verzweifelt aufgehört, weil einfach nichts ging. Er hatte aber auch Gebärdensprachkurse gegeben, Kontakt zu einer früheren gehörlosen Freundin gehabt. Einen guten Kumpel im Studium. Das Haus seiner Eltern war ausgeraubt worden mit dem Flügel, er war in eine Wohngemeinschaft gezogen. Von all dem hatte Tom nie etwas erzählt. Ich hatte diese Zeit nach dem Unfall, bis wir uns kennenlernten, als eine einzige Abfolge einsamer Tage gesehen, so hatte er es immer beschrieben. Aber natürlich hatte er gelebt, offenbar viel mehr, als er erzählt hatte. Ich schlug das Buch zu und drehte mich auf die Seite, um gebärden zu können.
»Tom, vielen Dank. Es zeigt mir dich anders, als ich erwartet habe. Du hast sehr viel noch nicht erzählt.«
»Einiges habe ich verdrängt.«
»Die schönen Sachen? Deinen Kumpel, die Freundin, den Gebärdensprachunterricht, die WG – wie ging es weiter? Ehrlich gesagt, klingst du am Ende des Buches ziemlich gut, als hättest du begonnen, deine Tragödie unter die Füße zu bekommen. Ein neues Leben begonnen, neue Kontakte geknüpft …«
Ich dachte an sein Alleinsein, diese Einsamkeit, Erstarrtheit und tiefe Verzweiflung, als wir uns kennengelernt hatten. Ich dachte an meinen Bruder Michael, der gesagt hatte, Tom sei heute ein anderer Mensch als der, den er damals gekannt hatte. Das Tagebuch las sich fast so, als wäre noch etwas passiert, das ihn dann endgültig umgeworfen hatte.
»Dein Tagebuch bricht plötzlich ab, Tom. Warum?«
Auch Tom lag auf der Seite, um mir zuzusehen. Er ließ sich auf den Rücken fallen und starrte an die Decke.
»Es ist noch etwas passiert. Das konnte ich nicht mehr aufschreiben. Es war der Grund aus der WG wieder auszuziehen, sie löste sich auf. Ich zog wieder in mein Elternhaus, das nach diesem Raubüberfall immer noch ganz durcheinander war. Ich begann es aufzuräumen, der Flügel tauchte sogar wieder auf. Nachdem … beschloss ich allein zu bleiben. Ich brachte den Leuten kein Glück.«
»Tom, was ist passiert?«
»Gaby, diese gehörlose Kommilitonin von mir, die nur sprach, keine Gebärde kannte, sich immer benahm, als könne sie normal sein, wenn sie sich nur genug anstrengte. Die Jan und mich verachtete, weil wir in unserer Behinderung, in unserer Sprache verharrten und uns aus ihrer Sicht keine Mühe machten, da raus zu kommen. Sie war immer so stark, so selbstbewusst, dass es häufig anstrengend war. Mit ihr kommunizierte ich schlechter als mit allen Normalos. Sie hatte keine Lust, meine Antworten zu lesen, bat mich immer wieder, die Worte doch zu formen, sie konnte so gut von den Lippen lesen. Sie verstand nicht, warum ich es nicht konnte. Ich mochte sie wahrscheinlich am wenigsten von allen in dieser ganzen verdammten WG und versuchte, sie zu meiden. Jan zeigte ihr regelmäßig die kalte Schulter, war genervt von ihrem Lippenlesengetue und dem sich Anbiedern an die Normalen, obwohl sie es selbst nicht war. Eigentlich war es ja ihre Sache, erstaunlich, dass sie überhaupt in dieser WG war.«
»Was ist mit ihr passiert, Tom?«
»Sie hat sich in ihrem Zimmer aufgehängt. Ich habe sie gefunden. Mit einem schrecklichen Abschiedsbrief, Beleg für ihre unglaubliche Einsamkeit, weil die Eltern ihr immer ›verboten‹ hatten, behindert zu sein. Sie war eine so gute Studentin, wäre sicher auch mit ihrer Behinderung eine gute Ärztin geworden. Was für eine Verschwendung. Die WG löste sich auf danach, ich habe zu keinem Kontakt gehalten. Ich bin zurück in mein Schneckenhaus, tiefer als je zuvor. Dann war ich so, wie du mich kennengelernt hast. Das mit dem Essen war gelogen in meinem Tagebuch, ich hatte einfach keine Lust, es richtig aufzuschreiben.«
Wir schwiegen einen Moment, dann machte er weiter.
»Eigentlich wollte ich dir nicht den Geburtstag verderben, Kathrin. Ich wollte dir diesen hoffnungsvolleren Tom schenken, habe mir so gewünscht, dass du ihn gekannt hättest. Ich hätte wissen müssen, dass es schiefgeht, dass du anfängst zu fragen. So wie immer, die Wahrheit aus mir heraus zu holen. Es tut mir leid.«
»Schon gut, Tom. Ich bin sehr froh, dass du mir dein Tagebuch zum Lesen gegeben hast. Übrigens – du kannst wirklich gut schreiben, weißt du das eigentlich?«
»Ich habe genug Gelegenheit, das Schreiben zu üben.«
»Wie war es, sie zu finden?«
»Schrecklich. Wir wollten eigentlich Abendessen. Bei ihr brauchte man ja nicht an die Tür klopfen, weil sie es nicht hören konnte. Ich öffnete die Tür, manchmal spürte sie den Luftzug und erschrak nicht so, als wenn man sie von hinten antippte. Sie hing an der Decke, am Lampenkabel. Das Gesicht tiefblau, die Augen hervorgequollen. Weißt du, sie war hübsch, blonde lange Haare, groß, schlank, sportlich. Ein bisschen so ein Typ wie Anja«, er unterbrach sich, »das wollte ich nicht sagen.«
»Der Brief?«
»Ich habe ihn bei mir zu Hause. Ich habe ihn mitgenommen und keinem gezeigt. Für die Eltern war es auch so schlimm genug.«
»Mit wem hast du darüber gesprochen? Mit Jan?«
»Nein. Wir haben nicht darüber geredet, wir waren alle voll von schlechtem Gewissen, dass wir mit ihr zusammengelebt haben und nicht bemerkt haben, wie schlecht es ihr ging. Ich hatte keine Lust, mit irgendjemanden darüber zu reden. Die anderen haben es vielleicht gemacht, ich weiß nicht. Ich habe meiner Tante eine Mail geschrieben, dass sie mich da rausholen müsste. Sie kam noch am selben Abend und ich bin mit zu ihr gefahren, in den Wochen danach haben wir das Haus wieder hergerichtet. Sie hat mich mindestens hundertmal gefragt, ob ich nicht zu ihr ziehen wolle. Ich habe abgelehnt, weil ich nicht ihre Familie auch noch mit hineinziehen wollte. Also blieb ich allein, das schien das Beste.«
»Wenn man keine Beziehungen hat, kann man auch keine Menschen verlieren? Ist es das, was du meinst?«
Er warf mir einen seiner langen Blicke zu, senkte ihn dann und gebärdete ein kleines ›Ja‹.
»Ehrlich gesagt, neben diesem Gefühl, allen um mich herum zu schaden, hatte ich auch Angst. Ihr Selbstmord hat mich fasziniert. Sie hatte mir vorher schon mit ihrer Sturheit und ihrem Mut imponiert, auch wenn uns die Sprache so trennte. Sie hatte durchgezogen, was ich versucht und nicht geschafft hatte. Es sah so leicht aus. Warum machte ich es nicht einfach auch? Einfach allem ein Ende setzen? Aber irgendwie konnte ich es nie.«
Ich sah ihn an, seine schönen Hände, die diese vollendeten Gebärden formten, das mir so lieb gewordene Gesicht, diese dunklen Augen…
»Tom, wie gut, dass du nie den Mut hattest…«
Er blickte mich an und brach in Tränen aus. Ich war fast erleichtert, dass er endlich weinen konnte. Ich nahm ihn in den Arm, er weinte sich an meiner Schulter aus. Leise und still, wie immer. Kein Laut, nur seine Tränen und die dünnen, zuckenden Schultern. Er hielt sich an mir fest wie noch nie. Dann schlief er ein, wie früher nach seinen Geständnissen.