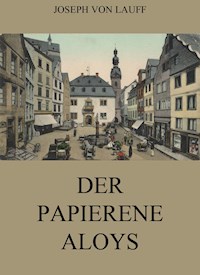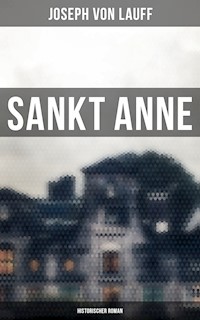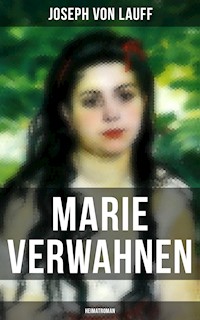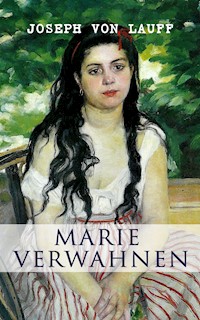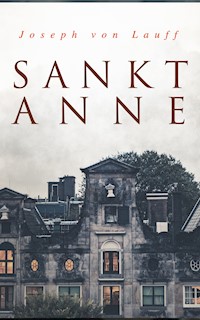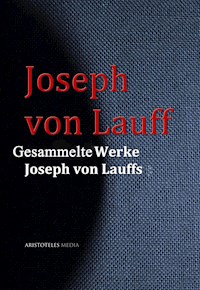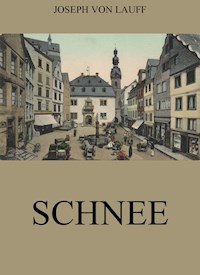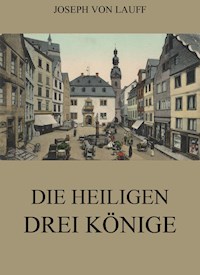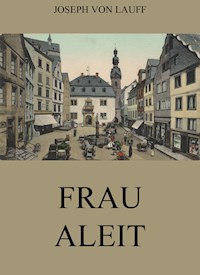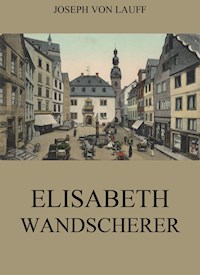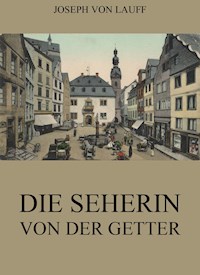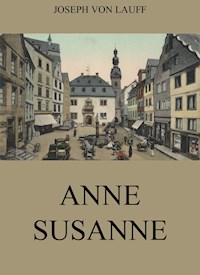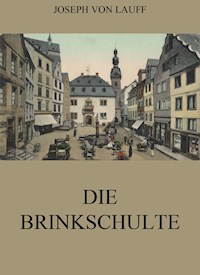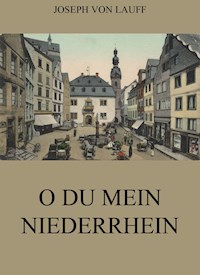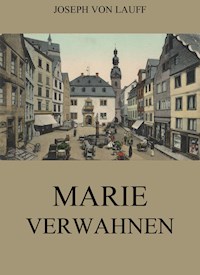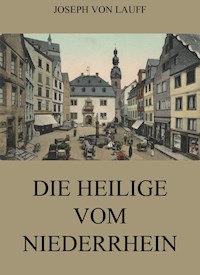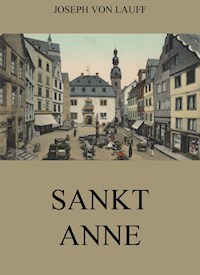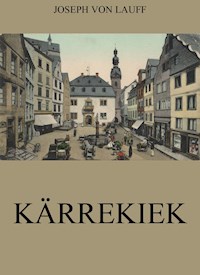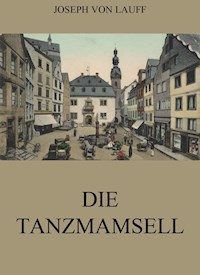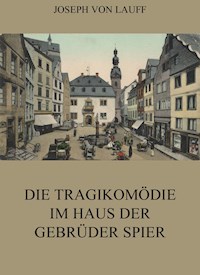
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eeine niederrheinische Familiengeschichte. Lauffs umfangreiches literarisches Werk besteht vorwiegend aus Romanen, Erzählungen und Theaterstücken. In seinen Prosawerken behandelt er meist Themen aus seiner niederrheinischen Heimat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Tragikomödie im Hause der Gebrüder Spier
Joseph von Lauff
Inhalt:
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Die Tragikomödie im Hause der Gebrüder Spier
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Letztes Kapitel
Die Tragikomödie im Hause der Gebrüder Spier, J. von Lauff
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638832
www.jazzybee-verlag.de
Joseph von Lauff – Biografie und Bibliografie
Dichter, geb. 16. Nov. 1855 in Köln als Sohn eines Juristen, besuchte die Schule in Kalkar und Münster, wo er das Abiturientenexamen bestand, trat 1877 als Artillerist in die Armee ein, wurde 1878 zum Leutnant, 1890 zum Hauptmann befördert und wirkte, einer persönlichen Aufforderung des Kaisers folgend, 1898–1903 als Dramaturg am königlichen Theater in Wiesbaden, wo er noch jetzt lebt; gleichzeitig wurde ihm der Charakter eines Majors verliehen. L. begann seine schriftstellerische Tätigkeit mit den epischen Dichtungen: »Jan van Calker, ein Malerlied vom Niederrhein« (Köln 1887, 3. Aufl. 1892) und »Der Helfensteiner, ein Sang aus dem Bauernkriege« (das. 1889, 3. Aufl. 1896), denen später folgten: »Die Overstolzin« (das. 1891, 5. Aufl. 1900); »Klaus Störtebecker«, ein Norderlied (das. 1893, 3. Aufl. 1895), »Herodias« (illustriert von O. Eckmann, das. 1897, 2. Aufl. 1898), »Advent«, drei Weihnachtsgeschichten (das. 1898, 4. Aufl. 1901), »Die Geißlerin«, epische Dichtung (das. 1900, 4. Aufl. 1902); er schrieb fernerhin die Romane: »Die Hexe«, eine Regensburger Geschichte (das. 1892, 6. Aufl. 1900), »Regina coeli. Eine Geschichte aus dem Abfall der Niederlande« (das. 1894, 2 Bde.; 7. Aufl. 1904), »Die Hauptmannsfrau«, ein Totentanz (das. 1895, 8. Aufl. 1903), »Der Mönch von Sankt Sebald«, eine Nürnberger Geschichte aus der Reformationszeit (das. 1896, 5. Aufl. 1899), »Im Rosenhag«, eine Stadtgeschichte aus dem alten Köln (das. 1898, 4. Aufl. 1899), »Kärrekiek« (das. 1902, 8. Aufl. 1903), »Marie Verwahnen« (das., 1.–6. Aufl. 1903), »Pittje Pittjewitt« (Berl. 1903) sowie die Lieder »Lauf ins Land« (Köln 1897, 4. Aufl. 1902). Als Dramatiker trat er zuerst hervor mit dem Trauerspiel »Inez de Castro« (Köln 1894, 3. Aufl. 1895). Von einer Hohenzollern-Tetralogie sind bisher erschienen und wiederholt ausgeführt »Der Burggraf« (Köln 1897, 6. Aufl. 1900) und »Der Eisenzahn« (das. 1899); ihnen sollen »Der Große Kurfürst« und »Friedrich der Große« folgen. Lauffs neueste Dramen sind das Nachtstück »Rüschhaus«, das vaterländische Spiel »Vorwärts« (beide das. 1900) und das nach dem Roman »Kärrekiek« verfaßte Trauerspiel »Der Heerohme« (das. 1902, 2. Aufl. 1903). Während L. in seinen Romanen echtes Volksleben des Niederrheins poetisch festhält und in seinen epischen und lyrischen Dichtungen trotz wortreicher Diktion ein starkes Talent verrät, greift er in seinen Dramen, namentlich in den höfisch beeinflußten Hohenzollern-Stücken, oft zu unkünstlerischen Mitteln und erweckte entschiedenen Widerspruch. Vgl. A. Schroeter, Joseph L., ein literarisches Zeitbild (Wiesbad. 1899); B. Sturm, Joseph L. (Wien 1903).
Die Tragikomödie im Hause der Gebrüder Spier
»O, eine edle Himmelsgabe ist Das Licht des Auges ...«
Seinem verehrten Dr. Heinz Göring in Dankbarkeit und Freundschaft
Erstes Kapitel
Es beginnt und endet mit einer Geschichte, die eigentlich nicht zu dieser Geschichte gehört, aber doch vergnüglich zu lesen sein dürfte, weil sie in medias res führt.
Häufig begegnete er mir, wenigstens zweimal am Tage, des Morgens und dann wieder am Abend.
Er war ein langaufgeschossener, steifleinener Mann mit einem glattrasierten Entenschnabelgesicht und abstehenden Ohren.
Sein Gehabe erinnerte an längst verklungene Zeiten. Er trug schwarzes Gewand, darüber eine Samtschaube mit Zobelverbrämung. Eine schwere Ehrenkette mit güldenem Pfennig hing ihm tief auf der Brust.
Sein Gang war gravitätisch, streng zeremoniell, kühl und abweisend. Er sah weder rechts noch links, weder zu Boden noch gen Himmel, sondern allzeit stur-geradeaus. Die Umwelt interessierte ihn nicht. Die Menschen, die ihm begegneten, schienen für ihn nicht vorhanden zu sein. Er kam wie ein Schatten und ging wie ein Schatten, und was das Seltsamste war: in der ringgeschmückten Hand führte er eine braunglasierte Bunzlauer Kanne mit sich, der ein warmer Duft nach aromatischem Kaffee entströmte.
Jedesmal, wenn ich ihn sah, trat er über die Schwelle meines Hauses, stieg langsam die Treppe hinauf, muffelte etwas Unverständliches zwischen den blutleeren Lippen, um spurlos in dem blauen Zimmer zu verschwinden, woselbst ich meine Manuskripte, Zeichnungen, Bücher und ähnliche Dinge aufbewahrte.
So ging das Wochen und Monde hindurch, ohne daß es mir gelang, der rätselhaften Erscheinung näher zu treten.
Eines Tages jedoch sprach ich ihn an und fragte ihn mit einer gewissen Beklemmung: »Um Verzeihung: mein Heim scheint Ihnen ein tieferes Interesse abzuzwingen. Würden Sie daher wohl die Freundlichkeit haben, mir Ihren werten Namen ...«
Ich kam nicht weiter, denn der also Angeredete packte, ohne viel Federlesens zu machen, seinen gedunsenen Kopf, drehte ihn um die eigene Achse und ließ ihn dann mit dem Knacken eines Eulenschnabels wieder in seine frühere Lage zurückschnellen.
»Wie Sie wollen, mein Herr. Meine Gepflogenheiten bewegen sich stets in den ortsüblichen Gebräuchen. Ich verstatte jedem Menschen gerne, mich danach zu fragen.«
Dabei schwenkte er die Bunzlauer Kaffeekanne, runzelte die Brauen und rollte die Augen, daß die Pupillen sich hinter die Lider zurückzogen
»Dann dürfte ich bitten ...«
»Achtung, mein Herr! Ich bin der Majordom Bucardo des Tyrannen von Bassano, Vicenza, Verona, Palma, Trient und Treviso.«
»Was?!« rief ich aus, »also der Majordom des Tyrannen Ezzelino, der die natürliche Tochter des großen Kaisers, die schöne Selvaggia, zur Frau hatte?!«
»Wundert Sie das?« fragte er mit häßlichem Grinsen.
»Keineswegs,« erwiderte ich, um doch etwas zu sagen, obgleich mir der Verstand aus den Fugen gedrückt wurde. »Nur möchte ich wissen ...«
»Ich verstehe Sie vollkommen,« sagte er ruhig. »Das Geschlecht, so der ungläubige Thomas erzeugte, ist bis auf unsere Tage gekommen. Sie möchten für meine Behauptung gern einen Kronzeugen haben. So hören Sie denn: es ist der Schweizer Conrad Ferdinand Meyer, der ›Die Hochzeit des Mönchs‹, diese furchtbare Geschichte, verfaßte.«
»So!« erwiderte ich etwas erleichtert, wenn auch noch immer von einer grenzenlosen Erregung ergriffen.
Ich kam mir vor wie ein verschüchterter Candidatus reverendi ministerii, dem ein brutaler Patronatsherr gebot, seine erste Predigt zu halten.
Der Bunzlauer Topf apothekerte stärker. Er wurde zu einem Lebewesen, zu einem duftenden Moloch, der die Narben und Spezereien Arabiens über mich ausströmte, und diesen duftenden Moloch hielt mir der Fremde entgegen, klappte die Augen auf und zu, ließ den entsetzlichen Kopf sich wieder um die eigene Achse drehen, daß es in allen Halswirbeln knisterte, und sagte: »In diesem güldenen Gefäß birgt sich der geheimnisvolle Trank, der für Ihre Herzallerliebste bestimmt ist. Mein Herr und Gebieter, der Tyrann von Bassano, Vicenza, Verona, Padua, Trient und Treviso, gab mir Befehl, ihn tagtäglich zu ihr in das blaue Zimmer zu tragen, damit sie sich an Leib und Seele verjünge. Er meint es gut mit Ihnen und Ihrer Geliebten.«
»Christus! so kennen Sie mich?«
Es wurde dunkel um mich. Nur der grauenhafte Majordom stand vor mir, als wäre er von einem Astrallicht umbüschelt, und aus diesem Astrallicht tönte eine gnätschige Stimme: »Warum sollte ich nicht? Mein Herr, ich kenne Sie schon Jahre um Jahre. Meine Erinnerungen ähneln scharfen Rasiermessern. Sie zerteilen ein fliegendes Härchen. Ich täusche mich niemals! Sinne ich darüber nach, so sind es wenigstens Hunderte von Jahren gewesen, daß ich die Ehre hatte, Ihre werte Bekanntschaft zu machen. Sie sind der Mönch Astorre aus dem Hause der Vicedomini zu Padua.«
»Woher wissen Sie das?« fragte ich, bleich vor Entsetzen.
Er beschrieb mit dem kalkigen Zeigefinger der rechten Hand eine große Kreislinie und stieß dann mit eben diesem kalkigen Zeigefinger wie mit einem Degen mitten ins Zentrum, gewissermaßen, um seinen Worten den gehörigen Nachdruck zu geben.
»Nichts leichter als dieses! Es ist wiederum der Schweizer Conrad Ferdinand Meyer, der ›Die Hochzeit des Mönchs‹, diese furchtbare Geschichte, verfaßte.«
Mir graute.
»Und woher weiß Conrad Ferdinand Meyer ...?«
Er nahm mir den weiteren Satz von den Lippen.
»Von dem göttlichen Dante.«
»Und Dante ...?«
»Entnahm sie einer ehrwürdigen Grabstätte, dessen Stein die Inschrift enthielt: Hic jacet monachus Astorre cum uxore Antiope. Sepeliebat Azollinus,oder auf deutsch gesetzet: Hier schlummert der Mönch Astorre neben seiner Gattin Antiope. Ezzelino begrub sie.«
Damit ließ der Majordom wiederum die grauenhaften Halswirbel knacken, verdrehte die Augen und sagte: »Hiermit hat meine Mission ihr beschauliches Ende gefunden. Meine Zeit ist bemessen, oder glaubst du, ich hätte Muße genug, Flöhe zu fangen oder gleich dem seligen Karl Arnold Kortum das Leben, die Meinungen und Taten von Hieronymus Jobs, dem Kandidaten, zu schreiben? Ich denke nicht dran. Von nun an wirst du meine Rolle vertreten und deiner Geliebten den köstlichen Mokka kredenzen, im Sinne meines Gebieters, des Tyrannen von Bassano, Vicenza, Verona, Padua, Trient und Treviso, aber nur löffelchensweise, immer nur löffelchensweise, damit sie sich verjünge an Leib und Seele und schön werde wie eine Istar zu Arbela, eine Astarte zu Ninive, eine Aschtoret zu Karthago, eine Derketo zu Askalon, eine Atargatis zu Hierapolis, eine Melitta zu Babylon und eine Venus zu Paphos, schön wie die Aristokratinnen im alten Rom, die während der Dämmerstunden die via sacra belebten. Sie muß werden wie die, die ihr Heil im Schatten der Akropolis suchen und ihre Sehnsucht in den Tempeln von Baalbek austräumen ... wenn nicht, soll es dir ergehen wie dem heiligen Dionysius Areopagita, der gezwungen wurde, mit dem abgehauenen Kopf in der Hand von Paris nach St. Denis zu pilgern. Verstanden?!«
Gleichzeitig überreichte er mir die Bunzlauer Kaffeekanne, von der er behauptet hatte, sie sei gülden gewesen, und verflüchtete sich in Nebel und Schwaden ... und ich mitten dazwischen, in diesen ziehenden Dämpfen, in diesem Chaos, in dieser Wirrnis ohne Licht und Planetenfeuer, und das geworden, was mir Ezzelino geboten zu werden: Astorre, der Mönch, aus dem begüterten Hause der Vicedomini zu Padua ... und sehe hohe Kastelle und stolze Granden und eine Hochzeit mit Masken ...
Ich bin also wirklich Astorre, der Mönch, der Abtrünnige, untreu den Ordensregeln und seinen Gelübden ... und sehe die Brenta fließen ... und darin meinen Bruder Umberto mit seinem Weibe, der schönen und herben Diana Pizzaguerra, versinken. Aber das Weib bleibt dem Leben erhalten. Weh' mir! ich werde genötigt, die Witwe meines Bruders zu freien. Ich will nicht und kann nicht, denn ich liebe bereits die stille, schmale, feinbrüstige Antiope aus dem Hause Canossa und bin willens, mit ihr Amarella oder Amare, das paduanische Hochzeitsgebäck, zu verzehren.
Ich breite die Arme.
Sie weilt in dem blauen Zimmer, woselbst ich meine Manuskripte, meine Zeichnungen, Bücher und ähnliche Dinge bewahre.
Mit dem mir aufgezwungenen Behälter eile ich in die trauliche Stube, wo nette Schildereien an den Wänden hängen, ein preziöses Stutzührchen tickert, fünfundzwanzig Geranienstöcke in Reihe blühen und ein schwarzgewichstes Kanonenöfchen, das leider auf dem Kopf steht, niedliche Funkensplitterchen über die sauberen Dielen verknistert.
»Antiope, Geliebte!«
Da sitzt sie in einer Laube von Damaszenerrosen und verzehrt portugiesische Krachmandeln, die mir so groß wie Kokosnüsse erscheinen.
Die abgelösten Schalen fallen hart und schwer gleich Kieselsteinen zu Boden.
Ein vernachlässigtes, aber vornehmes Gewand umhüllt ihre Glieder.
Was Glieder?! Knochen, nur Knochen und Brüste, die Schrotbeuteln ähneln! Christus, mein Heiland! denn was ich da sehe, ist ihre Mutter, die honette Madonna Olympia aus dem Hause Canossa, die Conrad Ferdinand Meyer und sein Gewährsmann, der göttliche Dante, hochbejahrt und wahnsinnig machten.
Wo bin ich? Was bedeuten die Gitarren und Harfen? Das blaue Zimmer belebt sich, wird flackerhell, mit unzähligen Sternen durchkrustet. Granden und Masken erscheinen.
»Nur heran mit der Bunzlauer Kanne,« tönt die Stimme des unsichtbaren Majordomus durch das Harfen und Quinkelieren hindurch, »nur immer tapfer gelöffelt, und sie wird wieder schön und schmal und feinbrüstig werden – deine Geliebte!«
Ich folge dem eisernen Befehl mit der Gewissenhaftigkeit einer Präzisionsmaschine.
Heureka! ich habe Erfolg. Das vornehme, aber vernachlässigte Gewand nimmt seinen verblichenen Glanz wieder auf, duftet nach Veilchen, wie sie duften am Comer See und an den sanften Ufern der Brenta, füllt sich mit Rosen und Schnee, wird durchsichtig, klingend und singend wie ein Gespinst aus schimmernden Glasfäden. Ich sehe alles verklärt, gleichsam durch eine opalisierende Myrrhenscheibe. An Stelle des entsetzlichen Weibes erblicke ich die Jugend wie nicht mehr zu finden. Bläuliche Perlenschnüre umwinden das Weiß ihres Nackens. Ihre Augen leuchten gleich Irisblumen, die an dem See Genezareth ihren ganzen Zauber entfalten. Sie öffnet die Lippen, sie redet: »Ich habe mein Hemd ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder besudeln? Der Feigenbaum hat seine Früchte angesetzt, und die Turteltaube läßt sich hören in unserm Lande. O, küsse mich mit dem Kuß deines Mundes!«
Der ihr löffelchensweise eingeflößte Trank tut Wunder bei Wunder.
Ich stehe auf dem Kopf.
Auch die schöne Antiope aus dem Hause Canossa macht Anstalten, sich häuptlings zu stellen und auf den Händen zu gehen.
Die Musik verstärkt sich. Die Sarabande ertönt. Dazwischen läßt sich ein Walzer von Johann Strauß und eine feurige Polka Mazurka vernehmen. Als wäre Mischka an der Theiß lebendig geworden, so klingt es:
»Wo auf sommerfrohen Hängen Die Tokayertraube lacht, Reiten lustig mit Gesängen Die Husaren durch die Nacht.«
Neue Masken erscheinen, und unter diesen lachenden Masken: Diana Pizzaguerra, das Weib meines ertrunkenen Bruders, das herbe Weib, das ich heiraten sollte, als Artemis verkleidet, mit Köcher und Bogen, im brandroten Haar die abgezirkelte bleiche Sichel des Mondes.
Ezzelino ist bei ihr, der Tyrann von Bassano, Vicenza, Verona, Padua, Trient und Treviso.
»Ha!« schreit sie auf, als sie der Antiope ansichtig wird. »Da sitzt ja das Weib, das ich suche, da sitzt es lästerlich und unkeusch neben Astorre Vicedomini: die Astarte zu Ninive, die Melitta zu Babylon, die Venus von Paphos. Warte, du Vettel! ich werde dir das paduanische Hochzeitsgebäck zu kosten verstatten!« reißt einen Pfeil aus dem Köcher und stößt die silberne Waffe in das Herz der feinbrüstigen Geliebten.
Ein heißer Blutstrom geht über mich fort.
»Tod, Hölle, Mord und Seligkeit ...!«
Ich will mich auf Diana Pizzaguerra werfen, sie würgen, erdrosseln ... da purzelt mir selber der Kopf von den Schultern, springt auf und davon, zieht einen roten Faden hinter sich her, rast dem Ausgang und der Marmortreppe zu, trudelt und stolpert von Stufe zu Stufe, von Estrade zu Estrade, während die Granden und Masken in ein schallendes Gelächter ausbrechen und der bleiche Tyrann die ewig denkwürdigen Worte prägt: »Die Geschichte ist aus. Hic jacet Astorre cum uxore Antiope. Sepeliebat Azzolinus, oder auf deutsch gesetzet: Hier schlummert der Mönch Astorre neben seiner Gattin Antiope. Ezzelino begrub sie.«
»Jesus, Maria und Joseph, wo bin ich?! Ihr vierzehn Nothelfer und ihr Heiligen Gottes, steht mir bei in dieser Stunde der Prüfung, des Grauens und Entsetzens!«
Mit einem Schrei wache ich auf. Ein freundlicher, gütiger, allbefreiender Morgen sieht lächelnd durch die weißen Gardinen.
Die Lampe brennt noch, schwelt und verlöscht mit einem näselnden Seufzer.
Neben mir ruht ein aufgeschlagenes Buch. Es ist ›Die Hochzeit des Mönchs‹, diese furchtbare Geschichte, die der ehrenwerte Schweiger Conrad Ferdinand Meyer verfaßte.
Draußen säuseln die Blütenbäume, schlagen die Finken.
Mir ist so, als hätte ich aus einer Blutschale getrunken.
»Fort mit diesem roten Gefäß, fort mit allem, was meine Seele und meine Traumwelt bedrängte!«
Ich reiße mir den Astorre Vicedomini vom Leibe, setze mir den Kopf wieder auf und verweise die Geliebte und den Tyrannen von Padua, die Diana Pizzaguerra und den grauenhaften Majordom in ihre Gräber und Grüfte.
Alle folgen, werden zu Schemen, wandern still ihres Weges. Nur Bucardo dreht noch einmal seinen gedunsenen Kopf um die eigene Achse und läßt ihn dann mit dem Knacken eines Eulenschnabels wieder in seine frühere Lage zurückschnellen. Hierauf verschwindet auch er mit seiner Bunzlauer Kanne.
Immer stärker säuseln die Blütenbäume, immer fröhlicher schlagen die Finken.
Ich will Licht um mich haben, andere Gestalten und andere Bilder.
Jugend, o Jugend! Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit ...!
Dort steht mein Schreibtisch. Blütenweißes Papier ist gerichtet. Ich setze mich nieder und reihe Zeile an Zeile. Es geht mir leicht von der Hand ... und so schreibe ich denn eine frohe und lustige Geschichte: ›Die Tragikomödie im Hause der Gebrüder Spier‹. Folgt mir in meine niederrheinische Heimat, in das Land meiner Jugend. Es wird euch nicht reuen.
So hört denn und wisset. Es war einmal ...
Zweites Kapitel
Von einer kleinen niederrheinischen Stadt und einer hochbetagten Linde, die aussah wie eine burgundische Prinzessin. Was sie alles gesehen und erlebte von Anno dazumalen, wo sie noch jung war und die schöne Herzogin Mechthild, unter Flöten- und Viola di Gamba-Begleitung, einen getragenen Schleifer mit dem vielehrsamen Bräuer- und Schöffenmeister Jodokus ter Linden zu Rathaus tanzete, bis zum heutigen Tage, wo der Verfasser dieses und der Herr Sigismund Mendel ihren wohligen Duft einatmeten.
Flieder und Goldregen waren abgeblüht, aber die Nachtigall sang noch am alten Wallgraben, und sie sang Tränen, Kantilenen, Seufzer, Stimmen der Liebe, die sie wie leuchtende Perlen über eine Seidenschnur streifte.
Ihr heißes Herz war voller Andacht und Weihe.
Ebenso erging es der hochbetagten Linde, die mitten auf dem Marktplatz der kleinen niederrheinischen Stadt ihre stattlichen Äste verzweigte. Sie sang nicht, aber sie säuselte, wobei sie heimelig dachte: »Jetzt ist deine Stunde gekommen,« und siehe: sie schmückte sich über und über mit rahmweißen Spitzen und Schleiern wie eine burgundische Prinzessin zur Zeit der schönen Maria, als diese mit dem Erzherzog Max ihre Hochzeit beging und die Glocken von Brabant und Flandern ihr den Willekomm sangen. Ach, wie sie grünte und blühte! und da stießen sich die Leute an, steckten die Köpfe zusammen und sahen mit Scheu und Wohlgefallen auf das Wunder der Wunder.
»Heelmoi!« sagte Juffer Petronell van der Grinten, die dem stattlichen Baum schräg gegenüber einem Manufakturwarenhandel vorstand und gerade dabei war, ein delikates Korinthenbrötchen in ein Schälchen mit Kaffee zu tauchen.
Dieselbe Ansicht mochte auch der Schuster Kogeleboom haben, denn er knarzte ein kräftiges »Pumpös!« durch die Zähne und sagte damit alles, was seine Seele bewegte.
Mit dem kleinen Wörtchen ›pumpös‹ verkörperte und verquickte er die höchsten Spitzen seiner Gefühle und Anschauungen. ›Pumpös‹ waren für ihn die Einrichtungen der christkatholischen Kirche, die Leber- und Blutwürste eines gemetzelten Schweines, das glatte Wegputzen der Eckbauern beim Ewaldi-Kegeln, die Zeremonien bei einem Leichenbegängnis erster Klasse und, last not least, die frischen Reitermanöver des Generals Friedrich Wilhelm von Seydlitz, der jetzt, in Stein gehauen, neben der blühenden Linde paradierte, den Mantel gerafft, den Pallasch gefaustet und das feurige Soldatenauge gen Westen gerichtet.
Ach! und da drüben ... da stand der Herr Ladendiener Nöllecke Baumann auf der Türschwelle seiner Firma, fingerte sich durch die eingeschmutzte Haartolle, ließ bei dieser Gelegenheit seinen Siegelring im warmen Sonnenlicht aufleuchten und legte den Kopf auf die Seite.
»Magnifik!« sagte er leise und dennoch so deutlich, daß alle es hören mußten, die sich in seiner Nähe befanden.
Herr Nöllecke Baumann deuchte sich höher und feiner als seine ehrenwerten Mitbürger. Das konnte man ihm auch keineswegs verdenken, war er doch auf der humanistischen Leiter bis zur Quarta gestiegen, hatte die Welt gesehen und im heitern Brüssel zwei ganze, volle, ausgewachsene Monate bei einem dortigen Delikatess'- und Vorkosthändler konditioniert, schien also wohlberechtigt, einen stolzeren Bildungsgang als seine simplen Brüder in der engern Heimat in Anspruch zu nehmen. Kein Wunder somit, daß er außer einigen kleinen, graziösen, allerliebsten belgischen Flegeleien auch das imponierende ›Magnifik‹ und den ersten Vers der Marseillaise ›Allons, enfants de la patrie‹ in seine Geburtsstadt und die des Reitergenerals Friedrich Wilhelm von Seydlitz verpflanzte, denn Nöllecke Baumann wäre kein richtiggehender, entschlossener und energischer Deutscher gewesen, hätte er nicht die Tugend seines Volkes gehabt, alles Fremdländische, auch das dümmste und dämlichste, vollgültiger auszumünzen und in Kurs zu setzen als die Sitten, Gebräuche und Einrichtungen des eigenen Landes. Ja, der Ladendiener Nöllecke Baumann wußte, was sich gehörte und was er der deutschen Nation schuldete, und so stand er denn da, fingerte sich durch die eingeschmalzte Haartolle, ließ seinen Siegelring im warmen Sonnenlicht leuchten und drehte ein langgezogenes, belgisches und imponierendes ›Magnifik‹ über die Lippen. Nur zu selbstverständlich, denn die prächtige Linde, die aus ihrem flandrischen Klöppelwerk eine verschwenderische Fülle von levantinischen Aromen über die kleine Stadt, die benachbarten Wälle und Wiesen hinwölkte, verdiente diesen begeisterten Ausruf auch im reichlichsten Maße. Welche Stadt in den Kreisen Rees, Kleve und Geldern konnte sich rühmen, ein solch stattliches Lebewesen innerhalb ihrer Mauern zu bergen? Keine. Welches pflanzliche Geschöpf hatte schon so viel des Erhabenen, des Ruhmreichen, des Heitern und Traurigen, des Stolzen und des Bedrückten gesehen wie dieser Baum aller Bäume? Keines. Alles und jedes an ihm war gut und löblich und forderte heraus, mit preislichem Lautenschlagen besungen zu werden.
Schon viele Jahrhunderte waren über ihn fortgerauscht. Denn eine alte, ehrwürdige Chronik besagte: »Im Jahre des Herrn, da man zählte nach Christe Geburt 1490 und am Tage Oculi, dem Tage also, wo gemeiniglich die Vögel mit den langen Gesichtern heimwärts streben und in unfern Quergestellen, Holzungen und Waldblößen mit gesenkten Stechern zu pfuitzen beginnen, da geschah es zum Wohlbelieben und zur Freude einer aufatmenden Menschheit, daß unser erlauchter Herr und Gebieter, der Herzog von Kleve Johann II., mit seiner hohen Gemahlin Mechthild, die ihm als Morgengabe die halbe Grafschaft Katzenellenbogen zugebracht hatte, unser Weichbild beehrte, um sich in solenner Art huldigen und feiern zu lassen. Das Wüllenamt zog ihm mit Bungen und Posaunen entgegen, desgleichen die Fraternität des heiligen Antonius, die Wappensticker und Siegelschneider, die Patronatsherren der Crispinus- und Crispinianusgesellschaft und andere mehr, und vom Hof op gen Born aus, unter dem Namen Burginatium vielbekannt und gepriesen, woselbst die VI. Legion ( legio VI. victrix, quam comitata fuit ala equitum) in altersgrauen Zeiten stationiert war, läuteten ihm und seiner schönen Gefährtin fünfundzwanzig vollgemessene Kartaunensalven einen ehrerbietig-feierlichen Gruß zu. Am Abend desselben Tages war Tafel zu Rathaus. An dreißig gespreiteten Tischen ließen sich die Geladenen nieder. Als Traktationen wurden verzehrt: 2 Ochsen, 6 Kälber, 11 Spanferkel und 16 Hammel, die man deliziös aufgeschmort hatte, des ferneren: 75 Kapaunen und Enten und eine Fülle sonstigen Geflügels aus dem fürstlichen Reichswald, nicht zu gedenken des edlen Rheinsalms, den man schwimmen ließ im Wein von Rauenthal und in köstlichem Pfälzer. Cantores würzeten das Mahl mit dem getragenen Liede vom ›Löffeln‹. Hierauf tanzete die hohe Frau unter Flöten- und Viola di Gamba-Begleitung einen langsamen und getragenen Schleifer mit dem vielehrsamen Brauer und Schöffenmeister Jodokus ter Linden, der hierüber so stolz und hoffärtig, aber auch so elend und tiefsinnig wurde, daß er bis zu seinem gottwohlgefälligen Ableben allen Ernstes wähnte, seine Tänzerin, also die fürnehme Mechthild, des Herzogs erlauchte Gemahlin, zweimal guter Hoffnung gemacht zu haben. Früh am Morgen des nun folgenden Tages begannen wieder die Bungen und Posaunen zu rufen und die Geschütze von den Wällen zu lärmen, denn die herzogliche Gnaden hatten befohlen, zum ewigen Angedenken eine junge Linde inmitten des Marktes zu pflanzen. Und also geschah es unter Glockengeläut, dem Vivatrufen des zugeströmten Volkes und dem freundlichen Wehen der Banner und Fahnen, die von allen Giebeln der umstehenden Häuser ein gar artiges Spiel trieben. Unter solchen Solennitäten marschierte man auf, salutierte man und hieß man die Aufgebotenen sich ordnen, als da waren: gefürstete Grafen und Barone, Junker und Würdenträger des Festes, Ratsherren und Neuner, und war alles von bunten Fahnen und schönen Frauen getempert. Und als sich nun das Bäumchen frei in die Lüfte erhob, das Wurzelwerk sich auch sorglich in dem Erdboden verzweigte, trat plötzlich der schon besagte wohlehrsame Bräuer und Schöffenmeister Herr Jodokus ter Linden, strahlenden Gesichtes und versonnenen Geistes, auf die etwas bleiche Herzogin zu, machte ihr einen devoten Baselemanes und sagte mit glücklichen Äugelchen: »Na, Mechthild, wollen wir mal so 'nen ›Kleinen‹ um die Linde riskieren?« worüber groß Aufsehen entstand, solches aber behoben wurde, da die freundliche Fürstin lächelnd abwinkte und meinte: »Jetzt nit, mein lieber Jodokus. So etwas ist nit alle Tage zu haben und wird nur auf dem städtischen Hause exekutieret. Ihr müßt Euch gedulden. Übers Jahr aber komme ich wieder, da mag es geschehen. Hilft mir Gott dazu, will ich's Ihm doppelt wiedergeben,« und war damit die etwas heikle und gefährliche Sache geschlichtet, denn der Herzog hatte bereits seinen Hatschieren gewinkt und zu wiederholten Malen mit den schwarzen Eisenkacheln gerasselt. So schmunzelte er denn und sagte zu seiner Guardia: »Wie das Mensch ist, so ist auch das Maß,« und ließ ihn gewähren. Herr Jodokus ter Linden jedoch ging beseligt nach Hause und freute sich des kommenden Jahres, wo er aufs neue befohlen werden sollte, mit der hohen Frau einen langsamen und getragenen Schleifer zu tanzen. »Dann sollen's Drillinge werden,« äußerte er sich des öfteren in seinem sinnigen Zustand und ist auch darüber eines glücklichen Todes und des unwandelbaren Glaubens verstorben, in seiner Person das Weiterblühen der klevischen Herzöge gefördert zu haben. Das Wort aber: »Na, Mechthild, wollen wir mal so 'nen ›Kleinen‹ um die Linde riskieren,« ist von Stund an beim Volk im Schwange geblieben.«
So die Chronik.
Der eingesenkte Baum aber wurde mit den Jahren größer und größer, immer höher und freier, und die Winde spielten mit seiner dichten Krone, harften darin wie mit Zauberhänden, und die Vögel der Lüfte kamen und sangen in seinen Zweigen von Leid und Freude, von Sehnsucht und Auferstehung, und war der Lieder, des Jubilierens und des Blühens kein Ende. Und was sah und hörte die ehrwürdige Linde während ihres langfristigen Lebens nicht alles! Sie sah die alten Meister der Schnitzerschule und die von der Sankt Lukas-Gilde in Kalkar, so unter anderen: den gefeierten Derick Boegert, der den Annen-Altar baute, Jan Joest, den Illuminierer der Tafeln, Ewert von Monster, Kersken Ringenberg und den gewaltigen Heinrich Douvermann, so die sieben Schmerzen Maria verkörperte, wie sie in den Abendlanden kein Bildner geschaffen. Sie hörte die spanischen Trommeln durch die Stadt rasseln, vernahm die kroatischen Sackpfeifen unter Graf Isolan und sah Blut und Brand, Pestilenz und Hungersnot und betrübte, armselige Zeiten ... und sie sah den Reitergeneral Friedrich Wilhelm von Seydlitz ... und auch den Schreiber dieses ... und den Herrn Notarius Baptist Napoleon Jean Pierre Lenz ... und die beiden Gebrüder Spier, Elias und Maier, die in niederrheinischem Vieh und Landesprodukten machten, die Bundeslade, Moses und die Propheten verehrten und einmal in der Woche einen opulenten Sauerbraten mit Rosinensauce verspeisten ... und sie sah deren Kommis und Nevö, den Herrn Sigismund Mendel, den schönen Sigismund Mendel, der die Hauptkommissionen der Firma unter sich hatte, das Kontobuch führte und bei seiner Arbeit immer Zimtborke kaute, um einen angenehmen und wohlriechenden Atem zu haben.
Sigismund stand in hohem Ansehen in der ganzen Gemeinde, bei Christenmenschen und Judenmenschen. Jeder kannte ihn, jeder liebte ihn, denn er war gefällig und gütig, aufmerksam und zuvorkommend, und weil er eine angenehme Stimme besaß, bei vorkommenden Gelegenheiten sogar in der Synagoge als Sänger fungierte, hielten die Bürger der kleinen Stadt es für angemessen und zeitgemäß, ihm einen gebührlichen Titel beizulegen, um doch ihrerseits etwas zu tun, ihm ihre Wertschätzung zu zollen, und das führten sie auch tapfer und sinnfällig aus und nannten ihn – ›Piepmösch‹.
Drittes Kapitel
Was die am Niederrhein unter ›Piepmösch‹ verstehen. Das Verhältnis Sigismunds, genannt Piepmösch, zu den Gebrüdern Elias und Maier Spier. Die Charaktereigentümlichkeiten dieses einflußreichen Jünglings, und warum er in wichtiger Mission mit dem Schimmelpferdchen nach Kranenburg mußte, währenddessen sich Herr Maier des laulichen Sommerabends und der blühenden Linde erfreute.
Piepmösch ...?! ich höre immer nur Piepmösch!
Wo in aller Welt ist überhaupt so ein Ehrentitel, so eine Bezeichnung zu finden?
Piepmösch ...?!
Was deutet es an, und wie ist dieses Wort zu erklären?
Kann ein Schriftgelehrter darüber Auskunft geben?
Nein.
Einer, der die Quadratur des Zirkels belegte?
Apage!
Ein Forscher, ein Sinnierer, ein Etymologe?
Auch die nicht.
Piepmösch ...?!
Um des lieben Himmels und der Barmherzigkeit wegen! wer dürfte denn in der Lage sein, dem geheimnisvollen Dunkel, dieser ägyptischen Finsternis, ein Kerzlein aufzustecken, um es leuchten zu lassen wie ein stilles, großes, allbefreiendes Licht von einem hohen und heiligen Berge herunter?! und siehe: ein ernster Zeigefinger erscheint und deutet in nebelige Fernen, in das Land, wo die Wasser träger und langsamer fließen, immense Wiesen und Weiden sich ins Unermeßliche strecken, die Windmühlen mit ihren weißen Segeltüchern schlappen, die Menschen mit respektabeln Gesichtern einhergehen, Edamer Käse essen und abends, wenn eine leichte Sommerbrise von den Deichen herüberweht, vor den Haustüren sitzen und ihre langen Tonpfeifen rauchen. Und siehe: der ernste Zeigefinger wird immer ernster und feierlicher und deutet immer nachdrücklicher in die nebelige Ferne, als wenn er damit sagen wolle: »Fraget dort an, bei den Menschen mit den respektabeln Gesichtern, die in laulichen Dämmerstunden vor den Haustüren sitzen und sich an ihrem ›Herman Oldenkott en Zoonen‹ gütlich tun. Ja, fraget nur, fraget nur an! Es sind gute und willige Kostgänger des Herrn. Sie werden nicht ermangeln, euch die Lösung des Rätsels zu bringen, und das Licht wird in die Finsternis dringen wie ein stilles, großes, allbefreiendes Licht von einem hohen und heiligen Berge herunter.«
So der Zeigefinger, und die Menschen mit den respektabeln Gesichtern lassen ihre Gesichter noch viel respektabeler werden, schicken bläuliche Knasterwölkchen in das Dunkelwerden hinaus und sagen: »Mynheer, was vor den Fuhrmannskneipen den spärlichen Häcksel aufliest, an den frischgebackenen Pferdeäppeln herumpickert, sich balgt und schilpt und priestert – das nennen wir ›Piepmösch‹. Mynheer, und was auf den Telegraphendrähten sitzt, sich dreht und wendet und über die heißen, gelben Kornfelder immerzu singt: Wie, wie hab' ich die lieb! und was am Wallgraben schlägt, zwischen den alten Pappel- und Erlenstrünken, so des Abends herum, wenn der Himmel wie blauer Kattun aussieht und der liebe Herr seine lichten Sternchen hineinstickt – Mynheer, das nennen wir ebenfalls ›Piepmösch‹. Mynheer, und weil nun Sigismund Mendel ...« und dann schweigen sie und lächeln, wie die Kundigen lächeln, die an den ewigen Tischen der Wahrheit essen, denn sie haben das ihre getan, des Rätsels Lösung gegeben ... und wir sind wissend geworden.
Ja, Sigismund Mendel, der schöne Sigismund Mendel, der Kommis und Nevö der Gebrüder Spier, in Firma Elias und Maier, war ein Sänger von Gottes Gnaden. Er sang wie die Vögel des Waldes und wie die des Feldes, er sang in der Synagoge, im Freien, zu Hause, bald in der Fistel, ähnlich den Verschnittenen in der Sixtinischen Kapelle und im hohen Sankt Peter, bald tremulierend, in den fetten und getragenen Gutturallauten seines eigenen Volkes. Nicht dieses allein. Abgesehen davon, daß er über eine einschmeichelnde Stimme verfügte, die inneren und auswärtigen Angelegenheiten des Hauses besorgte, das Kontobuch führte und mit künstlerischem Schwung die Laubhütte austapezierte – Sigismund zählte zu den belesenen Jünglingen. Er hatte, um es auf französisch zu sagen, beaucoup de lecture. Das Hohe Lied Salomonis konnte er auswendig, ebenso einzelne Reime des großen Joseph den Zaddik. Auch mit den Schriften Heines, des Poeten aus der Bolkerstraße in Düsseldorf, war er innigst befreundet. Am besten lagen ihm die kleinen, kapriziösen, schmutzigen Teufeleien dieses ›Einzigen‹, und wenn er dessen ›Apollogott‹ rezitierte, übertraf er sich selber. Dabei verdrehte er die Äugelchen in dem appetitlichen Lämmelgesicht, zwirbelte sein Kinnbärtchen und lächelte süßlich, edel und liebreich. Ach, und wie trug er den Abgesang dieses Poems vor! Schlicht und einfach, aber überwältigend. Hört seine Verse! In der singenden Sprachweise der Haggada-Beter kommt es ihm von den etwas gewulsteten Lippen:
»Aus dem Amsterdamer Spielhuis Zog er jüngst etwelche Dirnen, Und mit diesen Musen zieht er Jetzt herum als ein Apollo. Eine Dicke ist darunter, Die vorzüglich quiekt und grünzelt; Ob dem großen Lorbeerkopfputz Nennt man sie die grüne Sau.«
Und er wiederholte: »Nennt man sie die grüne Sau.«
Die Strophe verdämmerte, zerging, zerfaserte, während er noch hinter ihr hersah wie hinter einer singenden Lerche, die sich allmählich im ewigen Blau des Himmels verflüchtigte.
Dabei war er ein stilles Gemüt, ein wohlwollender und zuvorkommender Mensch, mit einem kleinen, honetten, putzigen Einschlag ins Schwerenötertum hinein, der ihn bei allen Damen seiner näheren und weiteren Bekanntschaft angenehm und begehrenswert machte.
Die Piepmösch wurde geliebt.
Sie hatte schon manche Herzen gebrochen.
Wo Sigismund erschien, kribbelte es dem weiblichen Geschlecht bis in die Zehenspitzen hinein.
Deborchen Vieth hatte eine tiefe Neigung für ihn, desgleichen Mordje Süßkind, seine Herzallerliebste, die sich immer wie eine Pfauhenne zierte und schön war und tanzen konnte gleich den Töchtern Jeruschalajims und gerne die Worte hersagte: »Und Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm eine Pauke in ihre Hand und alle Weiber folgten ihr nach mit Pauken am Reigen.« Selbst die brave und genügsame Ehefrau des Beschneiders Herz Cohn hätte fast eine große Dummheit um seinetwillen begangen, wäre Sigismund nicht der veritabelste Joseph von Ägypten gewesen.