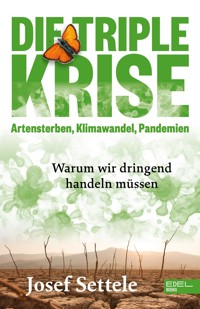
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Welt hat nicht nur ein Corona-Problem. Die Gefahren durch Artensterben und Klimawandel sind nach wie vor mindestens ebenso groß - und haben die gleichen Ursachen. Der renommierte Umweltforscher und Agrarökologe Josef Settele analysiert die Gründe und Folgen dieser dreifachen Krise. Er erläutert sie vor allem anhand der Insekten, deren Gefährdung beispielhaft für die der gesamten Artenvielfalt steht. Die Auslöser - eine unkontrollierte Ausbeutung der Natur, immer intensivere Landnutzung und wachsende Verstädterung, sowie ungebremste Abholzungen – sind zugleich wesentliche Ursachen für den Ausbruch von Pandemien. Der Klimawandel verstärkt diese Entwicklung und seine Auswirkungen nochmal dramatisch, die drei Komponenten der Triple-Krise befeuern sich gegenseitig. Setteles Ansatz für Wege aus der Krise ist ein umfassender, von der lokalen bis zur globalen Ebene. Ein Weiter-wie-bisher ist für ihn keine Option, sein dringender Aufruf: Nur wenn wir die Natur gemeinsam schützen, schützen wir uns auch selbst!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für Doris und Sam
INHALT
1.Ein düsterer Ausblick in die Zukunft?
2.Ein Planet wird ausgenommen
2.1.Das Problem ist der Mensch
Gefahr für die Ozeane und den Permafrost
Ein Paradies vor dem Kollaps
Biologie vs. Biologie
2.2.Wäre doch die Riesenbiene keine Ausnahme!
Die Ankunft der Europäer und ihre Folgen
Du sollst keinen Götterbaum neben mir haben
2.3.Insektenschwund ist eine Tatsache
Biomasse ist nicht gleich Biomasse
Wenn der Betonfladen den Tod bringt
2.4.Pandemien
Geben und Nehmen halten sich nicht mehr die Waage
Die Gefahr, die aus der Wärme kommt
Umweltschutz ist Gesundheitsschutz
3.Faszination Insekten
3.1.Expeditionen im Allgäu
Ein Hausmeister hinterfragt das Insektensterben
3.2.Von Insekten lernen
Erstaunliche Alleskönner
Überlebenskünstler unter Druck
3.3.Mensch und Insekt – eine Beziehungsgeschichte
4.Insekten als Dreh- und Angelpunkt im Ökosystem
4.1.Bestäubung ist Leben
Warum Einstein recht gehabt haben könnte
Ökodienstleister ohne Lohn
4.2.Vögel verschwinden, (auch) weil Insekten verschwinden
Fressen und gefressen werden
4.3.To Bee or not to Bee
Nicht die Honig-, sondern die Wildbienen sind gefährdet
4.4.Naturschutzmanagement gegen den Bläulings-Blues
Tödliche Mähtermine
5.Der Klimawandel
Und wie schaut es am anderen Ende der Welt aus?
Der Teufelskreis aller Teufelskreise
Erst sintflutartige Regenfälle, dann Heuschreckenplage
Die Geschichte von Eis und Feuer
Das Brodeln im Kühlschrank der Erde
Das zweite große Waldsterben
Insekten als Fieberthermometer des Planeten
6.Alles hängt mit allem zusammen
6.1.Pestizide sind tödliche Chemiekeulen
Der Tod kommt über Umwege
Die Keule schlägt zurück
6.2.Es grünt so grün in der Agrarwirtschaft
Warum extensiv genutzte Weidelandschaften wichtig sind
Bodenständiger Klimaschutz
Von grünen Wüsten und Wut-Bauern
Hat gar Bayer recht?
Nicht Fleisch an sich – der Massenkonsum ist schädlich
6.3.Vorsicht, Licht!
Gefangene des Lichts
6.4.Die Invasion der blinden Passagiere
Der Schub des Kolumbus
Im Militärjet auf den Balkan
Von Superkolonien und Gen-Waffen
6.5.Welchen Einfluss hat die Windkraft?
7.Bevor der letzte Schmetterling stirbt – ein Appell
Doch, es kommt auf jeden Einzelnen an
Nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe
ALARM wird zu Recht großgeschrieben – Schüler für den Klimaschutz gewinnen
Klimaampel für den Weg in die Zukunft
Danksagung
Kapitel 1
EIN DÜSTERER AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT?
Beginnen wir mit einer Zeitreise und stellen wir uns Deutschland im Jahr 2040 vor:
Seit Fleisch im Labor gezüchtet wird, ist es im Supermarkt wieder so preiswert, wie es zuletzt 2020 war. Obst hingegen, selbst einheimisches, ist ebenso wie Kaffee eine unerschwingliche Luxusware. Viele Kinder kennen Äpfel und Kirschen nur noch aus dem Internet. Denn alle Versuche, die Obstbäume mit Drohnen zu bestäuben, sind bisher gescheitert. Weil Maschinen nicht präzise genug sind, landen die wertvollen Pollen überall, nur viel zu selten da, wo sie ihre lebenspendende Kraft entfalten können. Blüten werden daher von Menschenhand bestäubt, eine Arbeit, die den Preis für Obst rund um den Erdball in schwindelerregende Höhen treibt. Die natürlichen Helfer, die diesen Job bisher kostenlos verrichtet haben, indem sie die Pollen fliegend und krabbelnd von Blüte zu Blüte brachten, sind verschwunden oder in weiten Teilen der Welt stark dezimiert: Gemeint sind die Bienen und andere Bestäuber.
Spaziergänge, Joggen und Radeln durch Waldeinsamkeit gehören im Jahr 2040 der Vergangenheit an. Nur noch wenige ausgewiesene Areale sind der Öffentlichkeit zugänglich. Der größte Teil der Waldbestände ist gesperrt: Die Gefahr, sich ein Virus einzufangen oder von einem herabstürzenden Astgerippe erschlagen zu werden, ist zu groß. Die massenhafte Vermehrung der Borkenkäfer und invasive Arten haben den Wald in unseren Breitengraden in ein geisterhaftes Trümmerfeld verwandelt. Auch die Angst vor der gefährlichen Riesenzecke (Hyalomma) und dem Nilflughund (Rousettus aegyptiacus) macht den Wald zur No-go-Area. Riesenzecke wie Nilflughund, irgendwann aus Afrika eingeschleppt, sind aufgrund des zunehmend tropischen Klimas in Mitteleuropa heimisch geworden. Die blutsaugende Hyalomma verbreitet das gefährliche Krim-Kongo-Fieber, gegen das nach jahrelanger Forschung immerhin ein Impfstoff gefunden werden konnte. Die Nilflughunde wiederum werden systematisch gejagt, seit man weiß, dass das Corona-Virus, das 2038 die Große Pandemie auslöste, von diesem Fledertier auf den Menschen übergesprungen ist. Weltweit sind bereits mehr als 40 Millionen Menschen gestorben, allein in Deutschland über 200.000 – obwohl die Bundesrepublik ihr Schutzkonzept gegen Pandemien nach der Corona-Krise 2020 grundlegend überarbeitet und Jahr für Jahr Millionen für Impfstoffe ausgegeben hat, um gewappnet zu sein. Aber gegen COVID-38 – benannt nach dem Jahr des ersten Auftretens – ist bisher kein geeignetes Serum gefunden worden.
Der Wald stinkt, denn Insekten, die natürlichen Entsorger und Totengräber verendeter Rehe, Wildschweine und anderer Waldbewohner, gibt es so gut wie keine mehr. Millionen von Jahren sorgten sie für den biologischen Abbau von Tierleichen und die Rückführung der organischen Substanzen in den Kreislauf der Natur. Durch das Verschwinden der Insekten dauert der Verwesungsvorgang nun quälend lange, sodass Menschen in Schutzanzügen regelmäßig das Unterholz nach Kadavern durchkämmen, um sie zu entsorgen.
Und still ist es im Wald, kein Vogelzwitschern und -trillern ist zu hören, denn auch Singvögel sind aus den Wäldern mehr oder weniger verschwunden. Sie haben ihre angestammten Lebensräume verlassen und sich an das Leben in den Städten angepasst. Freilich war dies nur einigen flexibleren Arten möglich. Im Wald ist die wichtigste Nahrungsquelle der Vögel versiegt: Insekten.
Stopp, cut!
Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen zum Auftakt meines Buches dieses – ziemlich unwissenschaftliche – Horrorszenario zumute. Ich verstehe mich als seriösen Forscher und neige schon von Berufs wegen mehr zur wunderbaren Farbenvielfalt, wie wir sie von Schmetterlingen kennen, als zum Schwarzmalen. Ich versichere Ihnen: So schlimm wie oben beschrieben wird es nicht kommen. Der von mir ersonnene Worstcase wird schon deshalb nicht Realität werden, weil Tiere seit Millionen von Jahren beweisen, dass sie extrem anpassungsfähig sind – weit mehr als wir Menschen. Allen voran die Insekten, mit denen ich mich zeit meines Forscher- und auch sonstigen Lebens befasse. Insekten lernten zum Beispiel als erste Bewohner des blauen Planeten Erde das Fliegen, um vor ihren Fressfeinden schneller flüchten zu können.
Ich könnte es auch mit anderen Worten sagen: Wenn das letzte Insekt stirbt, werden wir Menschen selbst längst nicht mehr existieren.
Dass ich es trotzdem wage, hier anfangs über die wissenschaftlichen Stränge zu schlagen, hat einen guten Grund. Mein Buch soll ein Weckruf sein, die Artenvielfalt, insbesondere die der Insekten, zu erhalten. Ich habe oben einige potenzielle Folgen von Klimawandel, Artensterben und Zoonosen – Infektionskrankheiten, die Mensch und Tier gleichermaßen treffen – bewusst überspitzt dargestellt, damit Sie einen ungefähren Einblick in das Drama erhalten, dem die Menschheit sich gefährlich nähern könnte, wenn wir diese drei fatalen Entwicklungen, die ich die Triple-Krise nenne, nicht stoppen. Noch scheint das möglich. Allerdings ist es nicht fünf, sondern eher drei oder zwei vor zwölf. Das klingt dramatisch, und genau so meine ich es auch. Nur wir Menschen sind in der Lage, den großen Zeiger der Uhr zurückzudrehen oder anzuhalten, damit er nicht auf die Zwölf springt.
Die Natur verschwindet in ungeahntem Tempo. Wir zerstören die Basis unseres Wohlstands, unserer Volkswirtschaften, unsere Lebensgrundlage. Der Mensch beutet Ressourcen wider besseres Wissen immer ungehemmter aus, ohne das Morgen, geschweige denn das Übermorgen zu bedenken. Drei Viertel der Naturräume auf den fünf Kontinenten sind bereits gestört oder vernichtet. 85 Prozent der Feuchtgebiete sind von negativen Eingriffen betroffen – Tendenz steigend. Knapp ein Viertel der Landfläche der Erde ist ökologisch am Ende und kann nicht mehr genutzt werden. Zwischen 1980 und 2015 wurden weit mehr als 132 Millionen Hektar tropischer Regenwald abgeholzt – Tendenz steigend. Zwei Drittel der Ozeane sind wegen massiver Eingriffe des Menschen nicht mehr intakt – Tendenz steigend. Landwirtschaft und wilde Natur rücken immer enger zusammen. Dadurch – und weil die Vielfalt der Arten abnimmt – schwinden die Pufferzonen, die bisher als natürliche Barrieren Viren davon abhielten, vom Tier zum Menschen überzuspringen. Je mehr wir den Lebensraum wilder Tiere und Pflanzen zerstören, unsere Städte und ihre Einzugsgebiete wie Krebsgeschwüre ungezügelt in die Landschaft wuchern lassen und den Luftverkehr immer weiter ausbauen, desto einfacher wird es für ein Virus, uns global in lähmende Angst zu versetzen.
Besonders fatal ist die Schnelligkeit dieser Entwicklungen, dies ist in der Millionen Jahre zählenden Historie unseres Planeten einmalig. Die Erde erlebt gerade den Beginn des sechsten großen Artensterbens ihrer Geschichte. Von den schätzungsweise acht Millionen Tier- und Pflanzenarten, die heute noch die Erde bevölkern, sind rund eine Million in der nächsten und näheren Zukunft vom Aussterben bedroht. Im Mai 2019 legte der Weltbiodiversitätsrat (IPBES), ein zwischenstaatliches Gremium, das die Politik zur biologischen Vielfalt und zu Ökosystemleistungen berät, seinen globalen Bericht vor. Dessen Erstellung durfte ich gemeinsam mit Sandra Díaz aus Argentinien und Eduardo Brondízio aus den USA leiten. Darin heißt es: »Die globale Rate des Artensterbens ist mindestens um den Faktor zehn bis hundert Mal höher als im Durchschnitt der vergangenen zehn Millionen Jahre, und sie wächst.«
Die Weltnaturschutzunion IUCN (International Union for Conservation of Nature), die für die globalen Roten Listen verantwortlich zeichnet, hat 2020 mehr als 112.000 Tierarten als gefährdet eingestuft, von denen etwa 32.000 unmittelbar vor dem Ende stehen. Nur ein Jahr zuvor lauteten die Zahlen 100.000 und 28.000. Trotz aller Bemühungen in vielen Ländern der Welt, durch Umwelt- und Naturschutz die Wende zu schaffen, hat sich das Tempo leider weiter verschärft.
Der Schwund der Insekten, den viele Menschen im eigenen Alltag wahrnehmen, ist eine Tragödie für die Menschheit. Die Windschutzscheibe ist zum berühmt-berüchtigten Sinnbild dafür geworden. Wer noch vor zwanzig Jahren mit dem Auto von Schwerin nach Augsburg gefahren ist, dessen Frontscheibe war danach von toten Insekten übersät. Und heute? Ein paar Flecken. Ab und an sorgen Mücken- oder Schwammspinner-Plagen für Schlagzeilen. Es handelt sich jedoch um temporäre und regionale Erscheinungen, mitnichten sind sie Indizien einer Trendumkehr.
Weltweit angelegte, langfristige Untersuchungen existieren zwar nicht, ebenso wenig Rote Listen für die große Mehrzahl von Insektengruppen, aus denen Angaben zum Anteil global vom Aussterben bedrohter Arten zu entnehmen wären. Allerdings haben Wissenschaftler in aller Welt handfeste Indizien und auch glasklare Beweise vorgelegt, die den epochalen Schwund von Hummeln, Faltern, Käfern, Bienen und Co. auf allen Kontinenten belegen.
Ihr Abgang bedroht das gesamte ökologische Gefüge unseres Planeten. Insekten bilden einen zentralen Baustein im Naturkreislauf, und da sie mir mit Abstand am besten vertraut sind, konzentriere ich mich in meinem Buch auf sie. Insekten bilden den Mittelpunkt vieler natürlicher Vorgänge an Land. Ohne sie geht in der Tierwelt nichts – und in der Welt der Menschen (viel) weniger. Von ihnen ernähren sich rund um den Erdball Vögel, Reptilien, Amphibien und kleine Säuger, die wiederum von anderen Tieren gefressen werden. Das Verschwinden der Bestäuber wie Hummeln und Bienen wäre eine Katastrophe in der Katastrophe. Faktisch kommt kein Ökosystem ohne Insekten aus.
Weltweit bestäuben Insekten fast 90 Prozent aller Blüten- und 75 Prozent aller wichtigen Nutzpflanzen. Diese drei Viertel stehen für rund ein Drittel der Produktion von Nahrungsmitteln. Es gibt Szenarien, die für sehr abhängige Pflanzen, wie zum Beispiel Mandeln, von Ernteverlusten um 90 Prozent ausgehen, sollten für sie keine Bestäuber mehr existieren. Aus dem Bericht des Weltbiodiversitätsrats geht hervor: Der globale Wert der Bestäubung für die Ernteerträge schlägt – die Zahl variiert je nach Berechnungsmethode – mit 235 bis 577 Milliarden US-Dollar zu Buche. Pro Jahr, wohlgemerkt, schenken Insekten den Menschen Milliardenbeträge. Und was machen wir? Lauter Dinge, mit denen sie nicht klarkommen: Pestizide, Gülle, künstliches Licht und Erderwärmung. Nicht nur die Lebensmittelproduktion hängt übrigens von Insekten ab, sondern auch die Herstellung von Fasern, Medikamenten, Biokraftstoffen und Baumaterialien.
Allein mit Geld ist der riesige Nutzen von Insekten, allen voran Bestäubern, ohnehin nicht zu bemessen. Erhalt von Natur rein monetär auszudrücken, wird der Sache nicht gerecht. Rechnen müssen wir trotzdem: Wie viele Einschnitte in die Artenvielfalt können wir uns noch leisten, bevor es uns selbst als Spezies an den Kragen geht? Für uns sind nicht die Arten per se wichtig, sondern dass die (Öko-)Systeme funktionieren. Was ihr Ausfall bedeutet, lässt sich heute schon im chinesischen Sichuan besichtigen, wo menschliche Bestäuber tatsächlich manuell Pollen verteilen, weil der massive Einsatz von Pestiziden die dafür eigentlich zuständigen Insekten extrem dezimiert hat.
Im Frühling 2018 machte ein Supermarkt in Hannover Ernst und nahm alle Produkte aus dem Angebot, die es ohne Bestäubung nicht gäbe: Äpfel, Kaffee, Schokolade, Orangen- und Multivitaminsaft, Fruchtjoghurt, Marmelade, Fertiggerichte, Tiefkühlpizza, Eissorten, Kosmetika, getrocknete Früchte und Kleidung auf Baumwollbasis – ca. 60 Prozent des Sortiments. »Biene weg, Regal leer« hieß die Aktion. Selbst Gummibärchen standen nicht mehr zum Verkauf, denn sie sind mit Bienenwachs überzogen, damit sie nicht zusammenpappen.
Sie sehen also, mein anfänglich entworfenes Horrorszenario hat einen sehr realen Kern. Berechnungen, die nicht nur zwanzig Jahre, sondern ein komplettes Jahrhundert vorhersagen, halte ich für schwierig bis unmöglich. Wir wissen nicht, wie sich das Klima entwickelt, wann, wie schnell und in welchem Umfang der Mensch die Erderwärmung stoppen kann – vom »Ob« gar nicht zu reden. Dies hängt maßgeblich von den politischen Entscheidungsträgern ab, leider zunehmend auch davon, wie viel Gehör die Wissenschaft in Zukunft (noch) findet oder ob sie weiter unter die Räder unschöner gesellschaftlicher Entwicklungen gerät, wie es in der Corona-Krise geschehen ist, als plötzlich Befunde von Wissenschaftlern, die lediglich Momentaufnahmen waren und auch nur sein können, zu »Meinungen« und »Gegenmeinungen« umgedeutet worden sind. Werden wissenschaftliche Befunde von der Politik ignoriert, weil sie nicht zur eigenen Agenda passen, kann dies brandgefährlich sein. Der Umstand, dass mittlerweile selbst Präsidenten mächtiger Industriestaaten unberechenbar geworden sind, setzt hinter langfristige Prognosen ein umso größeres Fragezeichen. Die Kündigung des Pariser Klimaabkommens durch die USA unter der Führung von Donald Trump war im November 2019 ein Rückschlag, mit dem selbst Pessimisten nicht gerechnet haben. Die Vereinbarung der 195 Staaten hat das Ziel, die globale Erderwärmung bis 2100 auf weniger als 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das wäre sehr schwierig zu schaffen gewesen, wenn das von Trump ausgerufene »America first« Leitmotiv der US-Regierung Bestand gehabt hätte. Denn die Vereinigten Staaten sind – nach China – der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen.
Fakt ist: Der Klimawandel betrifft die ganze Welt und kann nur global gestoppt werden. Wir wissen, dass er sowohl beim Artensterben insgesamt als auch beim Insektenrückgang im Besonderen eine wesentliche Rolle spielt. Wie stark und ob er »nur« mit- oder gar hauptverantwortlich ist, wissen wir bislang nicht – und das dürfte auch von Art zu Art sehr verschieden sein. Sicher ist aber: Durch die Erderwärmung geht vielen Tieren der angestammte Lebensraum verloren. Insekten sind besonders heftig davon betroffen. Das Tyndall Centre for Climate Change Research, ein zur Jahrtausendwende gegründeter Forschungsverbund von Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern vor allem britischer Universitäten zur Klimaforschung, legte Berechnungen dazu vor. Diese ergaben, dass 49 Prozent – sprich: die Hälfte – aller Käfer, Hummeln, Schmetterlinge, Bienen, Läuse und Käfer ihre bisherigen Habitate verlieren, wenn die globale Erwärmung um 3,2 Grad Celsius höher als im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter liegt, was den Experten beim Scheitern des Pariser Abkommens als möglich erschien. Läge der Wert bei 2 Grad Celsius, wären es 18 Prozent. Im Falle von 1,5 Grad Celsius würden »nur« 6 Prozent der Insekten ihren gewohnten Lebensraum einbüßen. Das muss nicht heißen, dass die betroffenen Arten aussterben. Es könnte sein, dass sie sich wieder woanders ansiedeln. Aber klar ist auch, dass ihre Überlebenschancen dann erheblich sinken.
Mir liegt es fern, ein Überlebensrecht für Insekten nur deshalb einzufordern, weil sie uns Menschen nützen. Aber das tun sie ganz zweifelsfrei, ich hoffe schon deshalb auf Vernunft. Denn ohne all die krabbelnden, summenden und fliegenden Sechsfüßler ist nicht vorstellbar, die Balance dieses Planeten zu wahren. Wenn die letzte Fliege am Leimfilm zappelt, die letzte Feuerwanze zertreten ist, werden zwar alle Träume von Entomophobikern wahr. Die Menschheit wird allerdings schnell merken: Ohne Insekten gibt es auch uns selbst bald nicht mehr. Insektenschutz ist Selbstschutz. Und Umweltschutz ist Gesundheitsschutz.
Kapitel 2
EIN PLANET WIRD AUSGENOMMEN
2.1. DAS PROBLEM IST DER MENSCH
Der Lockdown in der Corona-Zeit brachte – neben all der Angst, dem Leid und dem Tod – auch ein Gefühl davon, wie die Welt sein könnte, wenn es mehr Stillstand gäbe und die Menschheit weniger verbrauchen, produzieren und reisen würde. Heruntergefahrene Fabriken, minimaler Flugbetrieb und leere Autobahnen sorgten für eine erhebliche Reduzierung von Abgasen und Lärm. Der Smog über China verschwand, Strände und andere touristische Hotspots waren menschenleer, das Wasser in den Kanälen Venedigs zeigte sich glasklar, im Bosporus tummelten sich wieder Delfine, und in die menschenleeren Straßen von Paris wagten sich Rehe.
Der Mensch trat den Rückzug an, die Natur kam zum Vorschein: Die Welt könnte so schön sein. Dann geschah der Wandel auch noch wunderbar friedlich, er lenkte von den schrecklichen Bildern aus den Krankenhäusern in Italien, Spanien, Südamerika und den USA ab. Die Momentaufnahmen stillten die offenbar weit verbreitete Sehnsucht nach intakter Natur, Ruhe, Achtsamkeit, Rückbesinnung, Einfachheit und Bescheidenheit. Sie standen stellvertretend für eine Welt, von der viele auch jenseits von Corona träumen. Die Natur schlug hier nicht wie in den Kinodystopien knallhart zu, sie zahlte der Menschheit ihren rücksichtslosen Umgang mit Tieren und Pflanzen nicht heim, sondern eroberte sich sanft und freundlich verlorenes Terrain zurück.
Die fantastischen Bilder von smogfreien Himmeln, blauen Lagunen, Delfinen und Rehen vermittelten die Illusion, als ließe sich die Umweltzerstörung der vergangenen Jahrzehnte ganz schnell revidieren, als genügten wenige Wochen, um die Triple-Krise und ihre Gefahren zu bannen.
Wer so simpel denkt, irrt gewaltig. Für mich ist die Corona-Pandemie ein unüberhörbares Signal an die Menschheit. Wer es noch immer nicht begriffen hat: Es ist langfristiges globales Handeln nötig, um die Uhr anzuhalten oder entscheidend zurückzudrehen. So wie der Klimawandel und die fortschreitende Ausrottung vieler Tier- und Pflanzenarten ist die Corona-Krise direkte Folge unseres Handelns. Solange die globalen Finanz-, Wirtschafts- und Handelssysteme dem Paradigma des maximalen Gewinns »um fast jeden Preis« folgen und die Zerstörung der Umwelt dabei als akzeptablen Kollateralschaden in Kauf nehmen, wird sich die Triple-Krise weiter verschärfen. Deshalb finde ich es richtig und wichtig, dass viele junge Leute – wie die von Fridays for Future – sagen: Wir wollen etwas grundlegend ändern.
Dabei bin ich kein Anhänger apokalyptischer Weltuntergangsprognosen und niemand, der Wirtschaftswachstum generell verteufelt und radikale ökologische Maximalforderungen stellt. Ökonomie an sich ist aus meiner Sicht nichts Schlimmes – wir leben alle von ihr: sowohl der Staat als auch die Unternehmen, deren Eigentümer und Mitarbeiter und mithin deren Kinder, schließlich die Rentner. Produktion, Dienstleistungen und Handel bescheren uns Wohlstand. Ohne Landwirtschaft und ihre Akteure haben wir nichts zu essen. Es muss um das »Wie« gehen. Notwendig ist ein fairer Interessens- und Lastenausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie, für den ich – auch in diesem Buch – eindringlich werbe. Auch gegen Konsum habe ich prinzipiell nichts. Ich bin überhaupt kein Freund der Selbstkasteiung, werde weiterhin täglich duschen, mit Freunden Würstchen grillen und zu Konferenzen in Übersee fliegen, statt zu segeln. Wir alle müssen Nahrung zu uns nehmen, möchten uns einen guten Wein gönnen oder ein schickes neues Rennrad, privat oder beruflich in ferne Länder reisen, ins Restaurant oder Kino gehen und das nicht nackt, sondern in Kleidung, die erst einmal hergestellt werden muss. Entscheidend sind Maß und Übermaß des Verbrauchs. Hier ist Umdenken notwendig.
Denn es scheint: Wir konsumieren uns zu Tode. Doch der Schein trügt. Die Natur wird die Menschheit von ganz allein am »Tod durch Konsum« hindern, weil sie uns, wenn wir weitermachen wie bisher, keine Ressourcen mehr in dem Umfang bieten kann, wie wir es heute gewohnt sind. Kriegen wir nicht von allein die berühmte Kurve, werden wir Menschen eines Tages zur Reduzierung des Konsums gezwungen. Auf Dauer wird die Erde den Ansturm auf ihre Schätze an Land und in den Ozeanen nicht verkraften. Daran besteht schon heute kein Zweifel mehr. Die Erderwärmung, das Artensterben – für mich insbesondere der Verlust an Insekten – sowie die Zoonosen, zu denen die Krankheit COVID-19 zählt, sind keine singulären Ereignisse. Sie bedingen und beschleunigen sich wechselwirkend. Um die Triple-Krise in den Griff zu kriegen, bleibt uns ein Zeitfenster von wenigen Jahrzehnten. Die Weichen müssen aber jetzt gestellt werden.
Angestellte von Volkswagen, Peugeot, Fiat oder General Motors kämen nicht auf die Idee, die Produktionsanlagen ihres Unternehmens zu zertrümmern und damit ihre Lebensgrundlage zu zerstören – aber die Ökosysteme macht der Mensch bedenkenlos platt. Jedes Jahr schenkt uns die Natur rund 60 Milliarden Tonnen erneuerbare und nicht erneuerbare Ressourcen. Die Gaben spielen die entscheidende Rolle bei der Versorgung mit Nahrungs- und Futtermitteln, Energie und Medikamenten, von Trinkwasser ganz zu schweigen. Mehr als zwei Milliarden Menschen heizen und kochen fast ausschließlich mit Brennholz. Schätzungsweise vier Milliarden sind im Krankheitsfall hauptsächlich auf natürliche Arzneimittel angewiesen. Wer nun vorrangig an indigene Völker oder sehr arme Nationen denkt, ist auf dem Holzweg: Rund 70 Prozent der Medikamente gegen Krebs kommen direkt aus der Natur oder sind von ihr inspiriert.
Das hindert uns Menschen nicht daran, die Erde schlecht zu behandeln. Wir sehen sie als unerschöpfliches Ersatzteillager unserer Bedürfnisse und riesige Müllhalde unseres Konsums. Ungebremste Abholzung, Unmengen klimaschädlicher Treibhausgase, Vernichtung von (Regen-)Wald und anderen Ökosystemen, Monokulturen, viel zu hoher Einsatz von Pestiziden, synthetischem Dünger und anderen Chemiekeulen in der Agrar- und Forstwirtschaft, Überfischung der Meere, Ausbreitung von Stadtgebieten, zu viel künstliches Licht – auf all diese Entwicklungen gehe ich noch detailliert in diesem Buch ein – zerstören unseren Planeten und machen ganz nebenbei den Weg dafür frei, dass immer mehr Krankheitserreger von der Tier- auf die Menschenwelt übergreifen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass schon jetzt mehr als 70 Prozent aller neu auftretenden Krankheiten, von denen Menschen betroffen sind, ihren Ursprung in wilden oder domestizierten Tieren haben.
»Noch immer ist nicht nur die Corona-Pandemie das größte Problem, sondern der Klimawandel, der Verlust an Artenvielfalt, all die Schäden, die wir Menschen und vor allem wir Europäer durch Übermaß der Natur antun«, fasste Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Triple-Krise Ende April 2020 in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel exakt zusammen. Es ist höchste Zeit zur Umkehr. Denn klar ist: So wie bisher können wir die Natur nicht weiter ausbeuten. Über Jahrhunderte hinweg gelang es, Mensch, Fauna und Flora in einem ökologischen Gleichgewicht zu halten. Durch Eingriffe und Fehlentwicklungen – mal akut, dann wieder chronisch – ist dieses Gleichgewicht nun global in Gefahr und vielerorts schon irreparabel zerstört. Die Zeit des rücksichtslosen Raubbaus nach dem Motto »Nach uns die Sintflut« muss ein Ende haben. Zumal die – um in der Symbolik zu bleiben – Wassermassen längst ins Rollen gekommen sind.
Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen einige der schlimmsten Zahlen bei der Lektüre meines Buches nicht ersparen, um Ihnen das Ausmaß der Triple-Krise verständlich zu machen. Mehr als 80 Prozent des globalen Abwassers werden Jahr für Jahr unbehandelt in Gullys, Böden, Flüsse oder gleich ins Meer geschüttet. 300 bis 400 Millionen Tonnen Schwermetalle, Lösungsmittel, andere giftige Substanzen und Abfälle aus Industrieanlagen und der Landwirtschaft gelangen in Gewässer. Düngemittel und Pestizide zerstören zunehmend Uferregionen: Auf der Erde gibt es rund 400 Küstengebiete, die aufgrund von Sauerstoffmangel zu Todeszonen geworden sind. Sie erstrecken sich über 245.000 Quadratkilometer – beinahe die Größe des US-Bundesstaates Oregon.
GEFAHR FÜR DIE OZEANE UND DEN PERMAFROST
Nach uns die Müllflut: Jährlich gelangen rund 10 Millionen Tonnen Plastikabfall in die Weltmeere, der sich als Folge von UV-Strahlung und Abrieb in winzige Teile, sogenanntes Mikroplastik, zersetzt. Ändert sich nichts daran, wird nach seriösen Berechnungen 2050 mehr Plastik in den Ozeanen schwimmen als Fische. Jedes Jahr fallen Hunderttausende Seevögel und Zehntausende Meeressäuger dem Plastikwahnsinn zum Opfer. Sie sterben einen qualvollen Tod: Entweder die Tiere verheddern sich in Rückständen des Abfalls, oder Plastik landet in ihren Mägen.
Von 1970 bis 2000 verloren die Seegraswiesen pro Jahrzehnt mehr als 10 Prozent ihrer Fläche. Korallenriffe gehören zu den schönsten und artenreichsten Ökosystemen unseres Planeten. Ihr Zustand ist erbärmlich. In den vergangenen 150 Jahren haben sich ihre Flächen halbiert. Die traurige Wahrheit lautet: Für die Korallen kommt jede Rettung zu spät, sie können nicht neu belebt werden. Wenn sich die Erde in den kommenden Jahrzehnten um nur 2 Grad Celsius erwärmt, überlebt lediglich ein Prozent der derzeitigen Bestände.
Meeresbiologen von der Dalhousie University im kanadischen Halifax mussten nach einem weltweiten Feldversuch traurige Bilanz ziehen. An 371 Korallenriffen in den Hoheitsgewässern von 58 Ländern stellten sie mit Ködern versehene Kameras auf. An knapp einem Fünftel der küstennahen Untersuchungsgebiete (19 Prozent) beziehungsweise 63 Prozent aller Videostationen war kein einziger Hai mehr zu beobachten. In 34 Ländern unterschritt die Zahl der gesichteten Tiere den erwarteten Wert um mehr als die Hälfte.
Forschungsleiter Aaron MacNeil sprach von einer »Verwüstung« der Populationen und von einem »funktionalen Aussterben« der Riffhaie, weil sie in den Gebieten, wo sie nicht mehr vorkommen, keine Rolle mehr für das Ökosystem spielen. Haie werden nicht umsonst die »Regulatoren der Ozeane« genannt oder – etwas poetischer – »Wölfe der Meere«. In Millionen Jahren haben sie sehr effiziente Überlebensstrategien entwickelt und fressen je nach Art kranke Tiere oder kleinere Raubfische. Wir wissen von einem Phänomen, das zunächst paradox wirkt: je weniger Riffhaie, desto geringer die Zahl der pflanzenfressenden Fische. Aber die Erklärung ist einfach: Wenn weniger Haie auf Jagd gehen, können sich kleinere Raubfische ausbreiten, deren Beute farbenfrohe Papageifische und andere Pflanzenfresser sind, die für das ökologische Gleichgewicht des Riffs sorgen, indem sie es sauber halten.
Generell machten die Wissenschaftler um MacNeil Überfischung für die Entwicklung verantwortlich. Dort, wo es besonders schlimm war, konnte das Verschwinden der Tiere auch auf unmittelbare menschliche Einflüsse zurückgeführt werden. Genannt werden in der Studie »Größe und Nähe des nächstgelegenen Marktes, eine schlechte Regierungsführung und die Bevölkerungsdichte«. Die Untersuchung zeigte gleichzeitig, dass sich die Hai-Population in solchen Riffen stabiler hielt, in denen Schutzmaßnahmen ergriffen wurden wie Ausweisung von Hai-Arealen, Fangbeschränkungen und das Verbot oder der Verzicht auf Kiemennetze und Langleinen. Das heißt, der Mensch zeichnet für die Zerstörung der Naturräume verantwortlich. Er ist aber – und nicht zuletzt hat uns das die erzwungene Corona-Auszeit gelehrt – auch in der Lage, negative Entwicklungen zu stoppen oder gar zurückzudrehen.
Die Zerstörung von Küsten und Korallenriffen hat »das Risiko für das Leben und das Eigentum durch Überflutung und Wirbelstürme für 100 bis 300 Millionen Menschen erhöht, die innerhalb der Zonen von Jahrhundertfluten leben«, so steht es im globalen Zustandsbericht, den der Weltbiodiversitätsrat im Frühjahr 2019 vorgelegt hat. Offiziell heißt die Einrichtung Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), auf Deutsch etwa: Zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und Leistungen des Ökosystems. Wobei die »Leistungen« ebenjene Geschenke der Natur sind, um die sich dieses Buch dreht. In dem Bericht ging es darum, herauszuarbeiten, welche Optionen Entscheidungsträger haben, um das Artensterben zu verringern bzw. den Trend umzukehren und dafür zu sorgen, dass die Systeme (weiterhin) funktionieren. Hier schreibt also Wissenschaft nicht vor, was gemacht werden muss, sondern zeigt auf, welche Handlungen von politischen und anderen Entscheidungsträgern zu welchem Ergebnis führen.
Neben der argentinischen Ökologin Sandra Díaz und dem brasilianischen Anthropologen Eduardo S. Brondízio gehöre ich zu den drei Vorsitzenden des IPBES-Berichtes und sage Ihnen, die Erstellung der 1700 Seiten umfassenden Bestandsaufnahme war echte Kärrnerarbeit. Beinahe 500 Forschende aus 50 Ländern waren als Autorinnen und Autoren involviert. Über drei Jahre hinweg befassten wir uns mit gefühlt Hunderttausend wissenschaftlichen und politischen Publikationen, aus denen unter dem Strich rund 15.000 als relevant ausgewählt, bewertet, verdichtet und in Zusammenhang gebracht wurden. In einem abschließenden Prozess diskutierten wir ungefähr 20.000 mehr oder weniger konstruktiv-kritische Kommentare aus Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zu diversen Versionen unserer Texte, bevor sämtliche Formulierungen standen, mit denen alle leben konnten – für die Boulevardpresse hätte der Vorgang ein Freudenfest sein können. 36 Monate lang hätte sie Woche für Woche diesen »Wissenschaftsstreit« ausschlachten können. Aber leider sind der Artenschutz und der Klimawandel nur eine Randerscheinung in ihrer Berichterstattung.
Zurück zum Ernst der Lage: Seit 1980 haben sich die Treibhausgasemissionen verdoppelt. Die Durchschnittstemperatur ist weltweit um mindestens 0,7 Grad Celsius gestiegen. Rund ein Viertel der klimaschädlichen Abgase resultieren aus Abholzung, der Produktion von Nutzpflanzen und Düngung. Selbst für das »Ewige Eis« an Nord- und Südpol scheint die Ewigkeitsgarantie abgelaufen zu sein. Es schmilzt. In der Antarktis schrumpft es momentan sechsmal so schnell wie in den 1980er-Jahren. Auch in der Arktis steigen die Durchschnittstemperaturen. Weil kaltes Meerwasser stärker denn je versauert, geraten an Nord- und Südpol mit die empfindlichsten Ökosysteme der Erde in akute Gefahr.
Rund ein Viertel der Landfläche der Nordhalbkugel ist von Permafrost bedeckt, von dem man in der Wissenschaft spricht, wenn der Boden mindestens zwei Jahre nonstop gefroren ist. Die meisten Böden sind allerdings schon ein wenig länger tiefgefroren: Sie entstanden bei der letzten Eiszeit, die vor ungefähr 115.000 Jahren einsetzte und vor nahezu 12.000 Jahren zu Ende ging. Permafrost kann einige Meter bis zu eineinhalb Kilometer tief ins Erdreich gehen. Im Sommer taut die obere Schicht des Bodens – und nur die – auf, bevor sie im Winter wieder zu Eis wird. Durch die Erderwärmung werden die sommerlichen Phasen immer länger, weshalb der Permafrost in tieferen Ebenen ebenfalls auftaut.
In jüngerer Vergangenheit ist die mittlere Lufttemperatur der Arktis fast doppelt so stark angestiegen wie die Temperatur im globalen Mittel. Nach Berechnungen des Alfred-Wegener-Instituts, das zur Helmholtz-Gemeinschaft gehört, hat sich der Permafrost zwischen 2007 und 2016 um 0,29 Grad Celsius erwärmt. Der Dauerfrostboden enthält weltweit zwischen 1300 und 1600 Gigatonnen Kohlenstoff, der in fossilen Pflanzen- und Tierresten gebunden ist. Zum Vergleich: In der gesamten Atmosphäre sind es rund 800 Gigatonnen Kohlenstoff. Eine Gigatonne entspricht einer Milliarde Tonnen. Ist der Boden an der Oberfläche zu lange eisfrei, wird er durchlässig, weshalb Wärme in tiefere Schichten gelangt und die Klimakiller Kohlendioxid, Methan und Lachgas freisetzt, was zur weiteren Erhöhung der globalen Temperatur führt. Dieser Entwicklung fällt weiterer Permafrost zum Opfer.
Das ist nur einer der Teufelskreise, von denen – ich kann es Ihnen leider nicht ersparen – in diesem Buch immer wieder die Rede sein wird.
Viele Zusammenhänge und Wechselwirkungen in der Natur geben der Wissenschaft Rätsel auf. Wir haben noch immer keine Ahnung, was sich alles in Wäldern oder im Meer bewegt und wächst, welche Prozesse dort vor sich gehen und wie sie sich gegenseitig und wechselwirkend bedingen. In den Ozeanen finden Forscher – aufs Jahr umgerechnet – jeden Tag vier neue Arten. Trotzdem sind noch Hunderttausende Fische, Krebse, Quallen und anderes schwimmendes Getier vor allem in der Tiefsee unentdeckt. Der Klimawandel wartet aber nicht auf Forschungsergebnisse, sondern schlägt schon heute erbarmungslos zu. Nach aktuellen Berechnungen wird er – je nach Anstieg der Temperaturen – bis Ende des Jahrhunderts die Fischmengen in den Ozeanen um 3 bis 25 Prozent schwinden lassen. Außerdem flüchten Fischpopulationen aus den Tropen in Richtung Pole. Niemand weiß, ob die Tiere in anderen Gewässern überleben, ob dadurch die Artenvielfalt in den Polarmeeren zunimmt und wie das empfindliche Ökosystem auf die »Neulinge« reagiert.
Vor Zehntausenden Jahren waren weite Teile der Landfläche der Erde mit Wald bewachsen. Heute beträgt die baumbestandene Fläche gerade noch etwas mehr als zwei Drittel des geschätzten Niveaus der vorindustriellen Zeit. Während in Mitteleuropa die Wälder schon vor Hunderten von Jahren auf großen Flächen gerodet wurden, setzte die Zerstörung der Wälder in den meisten Gebieten unseres Globus aber erst richtig ab Beginn der 1980er-Jahre ein. Etliche Millionen Hektar Wald wurden gerodet, um auf den Arealen landwirtschaftliche Nutzflächen zu schaffen. Zwischen 1990 und 2015 wurden 290 Millionen Hektar Naturwälder vernichtet, denen lediglich 110 Millionen Hektar wiederaufgeforsteter Wald entgegenstanden – unter dem Strich ein Verlust von 180 Millionen Hektar. Zum Vergleich: Die Mongolei ist etwas mehr als 156 Millionen Hektar groß.
Falls sich die Weltbevölkerung wie prognostiziert bis 2050 um rund 1,2 auf dann neun Milliarden Menschen gleichsam mit der Lebenserwartung erhöht, wird die Nachfrage nach Lebensmitteln drastisch zunehmen. Schon jetzt sind mehr als ein Drittel der weltweiten Landfläche und nahezu drei Viertel der Süßwasserressourcen für den Anbau von Pflanzen oder die Viehzucht reserviert. Die Produktion von Nutzpflanzen hat sich innerhalb der vergangenen fünfzig Jahre verdreifacht. In der Zeit ist der Einsatz von Stickstoffdünger auf das Zehnfache angestiegen. Landwirte schwangen jahrzehntelang Chemiekeulen gegen Schädlinge und »Unkraut«, was wesentlich zum Rückgang von Insekten beigetragen hat.





























