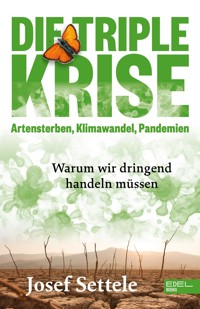18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Alle heimischen außeralpinen Tagfalter und Widderchen bestimmen Sie sicher mit diesem Standardwerk – diese 4. Auflage jetzt komplett überarbeitet und erweitert durch 22 Arten Widderchen. Die Schmetterlinge werden mit Fotos von Ei, Raupe und Falter vorgestellt. Anhand von Verbreitungskarten und Grafiken zum Lebenszyklus erfahren Sie auf einen Blick, wo und wann jede Art zu finden ist. Dazu gibt es Informationen über Lebensweise, Vorkommen, Nahrungspflanzen, Gefährdung und Schutz. Extra: Fototafeln zeigen die Ober- und Unterseite aller Schmetterlinge lebensgroß und im direkten Vergleich. So finden Sie die eindeutigen Unterscheidungsmerkmale zuverlässig. DER Naturführer zu tagaktiven Schmetterlingen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Josef Settele, Roland Steiner, Rolf Reinhardt, Reinart Feldmann, Gabriel Hermann, Martin Musche, Elisabeth Kühn, Gunnar Brehm
SCHMETTERLINGE
Die Tagfalter und Widderchen Deutschlands
4., erweiterte und vollständig überarbeitete Auflage870 Farbfotos
Inhalt
Vorwort zur 4. Auflage
Einführung
Merkmale
Lebensweise und Lebensraum
Verbreitung
Lebenszyklus
Tagfalter-Generationen
Schmetterlinge beobachten
Warum sind so viele Schmetterlinge gefährdet?
Falter-Monitoring
Zur Benutzung des Buches
Porträts der Arten
Bildtafeln – alle Arten im Vergleich
Dickkopffalter
Dickkopffalter
Ritterfalter
Ritterfalter
Weißlinge
Weißlinge
Bläulinge
Bläulinge
Würfelfalter
Würfelfalter
Edelfalter
Edelfalter
Augenfalter
Augenfalter
Widderchen
Widderchen
Glossar
Die wichtigsten Raupennahrungspflanzen
Literatur
Zitierte Arbeiten und weiterführende Literatur
Angaben zu den Roten Listen
Dank
Bildquellen
Impressum
Vorwort zur 4. Auflage
Die Zunahme von Wetterextremen, sommerlichen Dürren und Wassermangel sind allgegenwärtige Zeichen des menschengemachten Klimawandels. Eine Folge der Erwärmung ist auch das immer zeitigere Auftreten von Insektenarten im Jahr. So fliegen viele der in Deutschland heimischen Tagfalter eine, zwei oder drei Wochen früher als noch 2015 in der 3. Auflage dieses Buches angegeben. Nicht nur aus diesem Grund war die Zeit für eine Neubearbeitung gekommen.
Immer wieder war der Wunsch an uns herangetragen worden, doch auch die Widderchen, wissenschaftlich „Zygaenidae“, in das Buch aufzunehmen. Sie bilden eine markante Gruppe, die eigentlich zu den „Nachtfaltern“ zählt. Da die Tiere aber tagaktiv und einige Arten auch regelmäßig anzutreffen sind und sie zudem bei artenschutzfachlichen Begutachtungen eine mitunter wichtige Rolle spielen, war es naheliegend, sie nun mit vorzustellen.
Neben den genannten Änderungen in den Flugzeiten – und entsprechenden Verschiebungen beim Auftreten von Ei, Raupe und Puppe – ändern sich auch die Verbreitungsareale der Arten sowie ihre Einstufungen in den Roten Listen Deutschlands und der einzelnen Bundesländer. Schließlich sind wissenschaftliche und deutsche Namen einiger Arten im Ergebnis molekulargenetischer Untersuchungen oder neuer taxonomischer Bewertungen revidiert worden. Die Fülle an Informationen zu Biologie und Habitaten der einzelnen Arten sowie zu den Unterscheidungsmerkmalen, die das Buch liefert, befinden sich nun wieder auf dem aktuellen Stand des Wissens.
Das Interesse an Schmetterlingen ist ungebrochen, auch wegen ihrer Rolle in Ökosystemen, wo sie – die Nachtfalter deutlich mehr als die Tagfalter – als Bestäuber fungieren. Dies führt dazu, dass sie gemeinsam mit Wild- und Honigbienen sowie Schwebfliegen in Deutschland und Europa Teil des Monitorings von Bestäubern sind. Hinzu kommt die bedeutende Rolle der Schmetterlinge in Nahrungsnetzen, in denen insbesondere ihre Entwicklungsstadien einer Vielzahl an Arten als Nahrungsquelle dienen.
Seit 2005 werden in Deutschland im Rahmen des Tagfalter-Monitorings regelmäßig Schmetterlinge gezählt. Weil sie hervorragende Bioindikatoren sind, ermöglicht die Analyse der Bestandsentwicklung der Falterarten im Land Rückschlüsse auf den Zustand der Insekten-Biodiversität insgesamt. Viele der Freiwilligen, die mit ihrem unermüdlichen Engagement zum Erfolg dieses Citizen-Science-Projekts beitragen, haben bei ihren oft wöchentlichen Begehungen „Die Tagfalter Deutschlands“ in der Tasche. Basierend auf Lob und Kritik der Leser und Nutzerinnen haben wir uns bemüht, das Buch noch praxistauglicher zu machen, damit es auch weiterhin als Nachschlagewerk, Bestimmungshilfe oder einfach als Einstieg in die Welt der Schmetterlinge gute Dienste leisten kann. Wir danken allen, die durch Hinweise und Anmerkungen zur weiteren Verbesserung beigetragen haben.
Halle, Filderstadt, Mittweida, Leipzig, Jena im November 2024
Einführung
In Deutschland leben etwa 3700 Schmetterlingsarten. Der ganz überwiegende Teil davon sind „Nachtfalter“; die Tagfalter machen nur ca. 180 Arten aus (die Zahl kann je nach Einstufung der Etablierung der Art variieren). Davon wiederum sind in Deutschland 28 Arten nur in den alpinen Regionen nahe der südlichen Landesgrenze zu finden. Sie sind im Buch nicht berücksichtigt, weil sie dieses für die große Mehrheit der Nutzenden unübersichtlicher gemacht hätten. Neu aufgenommen sind hingegen 22 außerhalb der Alpen vorkommende Widderchenarten. Dieser Naturführer liefert also Grundwissen zu allen außeralpin verbreiteten Tagfaltern und Widderchen Deutschlands und ermöglicht deren einfache Bestimmung – eine Grundlage für jede intensivere Beschäftigung mit dieser Insektengruppe. Leserinnen und Lesern, die sich speziell mit den Tagfaltern des Alpenraumes beschäftigen wollen, sei hiermit Stettmer et al. (2022) wärmstens empfohlen. Eine hervorragende Übersicht der Nachtfalter bieten Steiner et al. (2014).
Die Flügel der Schmetterlinge sind mit Schuppen und Haaren besetzt. Nahaufnahme des Flügels eines Natterwurz-Perlmutterfalters (Seite 120).
Merkmale
Die Tagfalter unterscheiden sich von den Nachtfaltern dadurch, dass bei ersteren die Spitzen der Antennen immer keulenförmig verdickt sind. Die Antennen von Nachtfaltern hingegen laufen immer spitz aus (s. Umschlaginnenseite). Eine Zwischenstellung nehmen die Widderchen ein, deren Antennenspitzen ebenfalls verdickt sind, obwohl sie taxonomisch zu den Nachtfaltern zählen. Aufgrund ihrer charakteristischen Färbung ist ihre Zuordnung aber stets eindeutig. Die wichtigsten anatomischen Merkmale der Tagfalter sind auf der vorderen Umschlaginnenseite dargestellt. Die meisten Tagfalter in Deutschland lassen sich anhand der Flügelzeichnung gut unterscheiden. Bei Tieren, die man im Freiland nicht eindeutig bestimmen kann, empfiehlt es sich, immer Fotos von Ober- und Unterseite zu machen und sie Fachleuten vorzulegen oder in ein geeignetes Internetforum hochzuladen (z. B. www.lepiforum.de). Eine neue Möglichkeit der Bestimmung mithilfe des Handys bietet die App des Tagfalter-Monitorings.
Farbpigmente in den Schuppen erzeugen die bunten Muster auf den Flügeln. Manche Schuppen sind farblos und hohl und lassen durch Lichtbrechung einen Schillereffekt entstehen, so bei heimischen Schillerfaltern oder noch viel prachtvoller bei südamerikanischen Morpho-Faltern. Eine besondere Differenzierung stellen Duftschuppen dar, die Pheromone absondern. Sie finden sich auf den Vorderflügeln der Männchen einiger Arten zusammengefasst in Duftschuppenflecken (beispielsweise beim Kaisermantel, Seite 108). Im Laufe der relativ kurzen Flugzeiten verlieren die Falter einen Teil ihrer Schuppen. Die Flügelzeichnung wird blass und undeutlich, die Flügelkanten sind ausgefranst; man spricht dann von „abgeflogenen“ Tieren. Da die Begriffe Schmetterlinge und Falter beide Gruppen umfassen, ist es zweckmäßig, von Tag- und Nachtfaltern zu sprechen, wenn man differenzieren will. Zu beachten ist, dass es auch tagaktive Nachtfalter gibt. Neben den Widderchen sind das über 300 Vertreter anderer Familien (inkl. Gammaeule, vieler Spanner-Arten, Taubenschwänzchen). Hier sei zur Vertiefung das sehr gute Werk von Ulrich (2018) empfohlen.
Lebensweise und Lebensraum
Fast alle einheimischen Tagfalter und sämtliche Widderchen leben als Raupe von pflanzlicher Nahrung. Das Spektrum der befressenen Pflanzenarten ist recht breit, es reicht von Gräsern über krautige Pflanzen bis zu den Blättern von Sträuchern und Bäumen. Nicht befressen werden Algen, Moose, Flechten, Farne, Pilze und abgestorbenes Pflanzenmaterial, wovon sich einige Nachtfalterarten ernähren.
Wirts- und Nektarpflanzen
Die verschiedenen Tagfaltergruppen bevorzugen meist bestimmte Pflanzenfamilien. So leben beispielsweise viele Bläulingsraupen an Schmetterlingsblütlern, die meisten Weißlingsraupen hingegen an Kreuzblütlern und alle Augenfalter an Gräsern. Die einzelnen Arten können sehr wählerisch sein und im Extremfall nur eine einzige Pflanzenart als Nahrung annehmen. So lebt die Raupe des Landkärtchens ausschließlich von Brennnesseln, die des Kreuzdorn-Zipfelfalters mag nur Kreuzdornblätter. Man nennt solche Arten „monophag“. Andere Arten nutzen nur eine kleine Auswahl von verwandten Pflanzenarten (sie sind „oligophag“), während wieder andere ein breites Nahrungspflanzenspektrum aufnehmen können und dann als „polyphag“ bezeichnet werden.
Ein Weibchen des Kreuzdorn-Zipfelfalters bei der Eiablage an Kreuzdorn, der einzigen Nahrungspflanze der Raupen (Seite 76).
Im Allgemeinen ist die Bindung der Falter an Nektar spendende Blütenpflanzen nicht so eng wie die der Raupen an ihre Wirtspflanzen. Manche Falter besuchen bevorzugt gelbe Blüten, andere violette; manche Blüten werden von Faltern kaum beachtet, andere dagegen wirken wie ein Magnet. Zu letzteren gehören beispielsweise Distel- und Kratz distel-Arten sowie der Sommerflieder (Buddleja), aber auch Klee-Arten und weitere Schmetterlingsblütler.
Neben Blüten werden manche Falter von austretenden Baumsäften oder gärenden oder faulenden Früchten – in Gärten Fallobst – angezogen und saugen an diesen; hierzu zählen unter anderem Admiral, Trauermantel und C-Falter. Auch auf Tierkadavern und Kot findet man gelegentlich Falter. An feuchten Wegstellen sitzen manchmal regelrechte Schmetterlingsversammlungen, die Mineralien und Flüssigkeit aufnehmen (das sogenannte „Mud Puddling“). Zu diesen zählen viele Bläulingsarten, einige Dickkopffalter, Weißlinge und Augenfalter. Schillerfalter sind meist keine Blütenbesucher, aber auch sie saugen vormittags an Pfützen auf feuchten Waldwegen. Aus stark riechendem Käse kann man sogar Köder für Schillerfalter und Eisvögel herstellen. Auch menschlicher Schweiß lockt verschiedene Falter an, darunter Admiral, Landkärtchen und Schillerfalter.
Die Jungraupe des Schwalbenschwanzes (S. 48) tarnt sich, indem sie Vogelkot nachahmt.
Lebensraumbindung
Viele der Tagfalter in Deutschland sind an bestimmte Lebensräume gebunden. So kommt der Hochmoor-Gelbling außerhalb der Alpen nur in Hoch- und Übergangsmooren vor, der Fetthennen-Bläuling nur in offenen Felsfluren von Flusslandschaften und der Randring-Perlmutterfalter nur in kühlen, meist staunassen Wiesenknöterichfluren. Einige Arten siedeln in sehr verschiedenen Lebensräumen, manchmal auch regional unterschiedlich. Der Storchschnabel-Bläuling bewohnt einerseits nasse Mädesüßfluren, wo die Raupe an Sumpf-Storchschnabel frisst, andererseits mesophile wie auch warm-trockene Säume mit Wiesen- bzw. Blut-Storchschnabel als Wirtspflanzen. Ähnlich ist es beim Goldenen Scheckenfalter: Auf Feuchtwiesen lebt die Raupe v. a. an Teufelsabbiss, in anderen Regionen auf Trockenrasen an Tauben-Skabiose.
Vor allem wandernde Falter zeigen sich an keinen bestimmten Lebensraum gebunden – man kann sie beinahe überall antreffen. Lebensfeindlich für nahezu alle Arten sind jedoch Hochleistungsäcker mit Raps-, Mais- oder sonstigen Monokulturen ohne Brachen oder Randstreifen. Das Gleiche gilt für Wiesenflächen, die mit Gülle oder Biogas-Gärresten überdüngt werden, und auch für junge, dicht stehende Forstkulturen im Stangenholzalter. Wenn solche Flächen das Landschaftsbild bestimmen, fehlen wichtige Indikatoren für ökologisch intakte Biotope, wie Tagfalter und Widderchen.
Schutz vor Feinden
In Anpassung an ihren Lebensraum sind bei den Tagfaltern wie überall im Tierreich Mechanismen entwickelt, durch die sie sich vor Fressfeinden schützen. Eine Strategie ist es, sich von Pflanzen zu ernähren, die giftig sind oder eine abstoßende Wirkung auf Räuber haben. So vertrauen die Raupen mancher Weißlingsarten darauf, nicht gefressen zu werden, weil der Kohl, von dem sie sich ernähren, viel Senföle enthält. Offensichtlich profitieren auch die erwachsenen Falter davon, denn Kohl-Weißlinge werden nicht von Hornissen angegriffen.
Andere Raupen tarnen sich, indem sie aussehen wie Vogelkot auf einem Blatt, zum Beispiel die frühen Raupenstadien von Schwalbenschwanz oder Großem Eisvogel. Die Tarnung der Raupen besteht in den meisten anderen Fällen darin, in Form, Farbe oder Zeichnung mit dem Untergrund, in der Regel der Nahrungspflanze, zu verschmelzen.
Viele Bläulingsraupen scheiden aus speziellen Drüsen ein Sekret aus, das von Ameisen aufgenommen wird. Im Gegenzug verteidigen die Ameisen diese Raupen. Dass die Raupen der meisten Augenfalter erst nachts fressen, dient wahrscheinlich genauso dem Schutz vor tagaktiven Fressfeinden und Parasitoiden.
Verbreitung
Die Verbreitung der Schmetterlinge auf der Erde entspricht ungefähr der Ausdehnung der Pflanzenwelt. Das heißt, fast überall, wo es Pflanzen gibt, kommen auch Falter vor. Sie bevorzugen Sonne, Wärme und eine mannigfaltige, blumenreiche Vegetation. Deshalb ist die weitaus höchste Artenvielfalt in den tropischen und subtropischen Gebieten zu finden. Hohe Artenzahlen weisen auch die warmen und alpinen Gegenden der gemäßigten Zone auf, mehr als in den sehr heißen Ländern. Nördlich des 60. Breitengrades nimmt die Anzahl der Schmetterlingsarten schnell ab (Kudrna et al. 2011).
Die Raupe des Nierenfleck-Zipfelfalters (Seite 72) gibt ein zuckerhaltiges Sekret ab, das von Ameisen aufgenommen wird. Diese „beschützen“ die Raupe im Gegenzug.
Der Pelargonien-Bläuling Cacyreus marshalliButler, 1898 ist ein Einwanderer aus Südafrika, der neuerdings auch bei uns wiederholt auftritt.
Großer Wander-Bläuling Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Langschwänziger Bläuling Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Unterschiede in Deutschland
In Deutschland besteht ein deutliches Süd-Nord-Gefälle in der Artenvielfalt der Tagfalter. Auch ohne den Alpenanteil kommen in Bayern und Baden-Württemberg wesentlich mehr Arten vor als in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern. Viele der wärmeliebenden Arten leben nur im südlichen Deutschland, wo auch ihre Wirtspflanzen in der Regel weiter verbreitet sind.
So hat der Segelfalter seine nördliche Verbreitungsgrenze südlich von Berlin – nur Einzeltiere findet man gelegentlich auch weiter nördlich. Andere Arten, insbesondere solche, deren Heimat kontinental geprägte Klimagebiete sind, erreichen in Ost- oder Nordostdeutschland ihre Verbreitungsgrenze, zum Beispiel der Grünliche Perlmutterfalter. Manchmal können Arten die Gebiete im Randbereich ihrer Verbreitungsareale nicht dauerhaft besiedeln und treten nur einige Jahre auf, um dann wieder aus Deutschland zu verschwinden, so z. B. der Östliche Große Fuchs, der 2004 und in den Folgejahren in Norddeutschland und den Niederlanden verstärkt auftrat (und sich nun lokal in Niedersachsen wohl etabliert hat). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind einige Arten nach Schleswig-Holstein und Mecklenburg vorgedrungen, deren vorherige Verbreitungsgrenze südlicher lag: Schachbrett, Waldbrettspiel, Kleines Ochsenauge und Landkärtchen. Auch von Nordosten nach Süden und Westen gibt es Ausbreitungen: Gold-Dickkopffalter, Spiegelfleck-Dickkopffalter und auch der Vogelwicken-Bläuling haben in der Vergangenheit weite Teile Deutschlands erobert. Der Große Feuerfalter dringt von Südwestdeutschland in Richtung Osten vor und in Ostdeutschland von Norden nach Süden. Auf der anderen Seite gibt es leider zahlreiche gut dokumentierte Beispiele von Arten, die sich auf dem Rückzug befinden. Extrembeispiele sind das Wald-Wiesenvögelchen, der Braune Eichen-Zipfelfalter, die meisten Erebien-Arten, der Mittlere Perlmutterfalter oder der Goldene Scheckenfalter. Die Verbreitungen der einzelnen Arten in Deutschland sind detailliert in Reinhardt et al. (2020) dargestellt (fortan zitiert als Tagfalter-Atlas Deutschland – TAD).
Seltene Gäste
Es gibt etwa zehn Tagfalterarten, die in Deutschland unregelmäßig und nur vereinzelt beobachtet werden. Dabei handelt es sich um verschleppte Exemplare oder sogenannte Irrgäste. Erwähnenswert ist der Pelargonien-Bläuling, der sich derzeit von Spanien und Italien aus in Südeuropa ausbreitet und bereits in Deutschland und auf den Britischen Inseln gesichtet wurde. Aus seiner ursprünglichen Heimat Südafrika wurde er vermutlich durch importierte Geranien- bzw. Pelargonien-Topfpflanzen verbreitet; dies sind die Wirtspflanzen der Raupen. Auch Leptotes pirithous und vor allem der Wanderbläuling Lampides boeticus sind in zunehmendem Maße zu beobachten. Die Zeit wird zeigen, ob und wo sich diese Arten etablieren können. Eine andere Art ist der in Südosteuropa und Asien weitverbreitete Östliche Gelbling (Colias erate) (Seite 52), der schon Ungarn, Österreich und die Slowakei erobert hat und seit 2000 unregelmäßig in östlichen Landesteilen auftrat. Überwinterungen konnten für diese Art in Deutschland bislang nicht nachgewiesen werden.
Mittlerweile wird hingegen der Admiral als heimisch angesehen. Im Gegensatz zu früheren Zeiten dürfte die Mehrzahl der im Sommer zu beobachtenden Tiere von erfolgreichen Überwinterern abstammen. Früher hat es sich wohl vor allem um Zuwanderer aus dem Süden gehandelt. Heute überleben selbst Eier und Jungraupen der Art milde mitteleuropäische Winter.
Lebenszyklus
Im Gegensatz zu den sogenannten hemimetabolen Insekten, bei denen die Larven den erwachsenen Tieren schrittweise immer ähnlicher werden (z. B. die Heuschrecken), sind die Schmetterlinge holometabol. Das bedeutet, dass bei der Entwicklung vom Ei über mehrere Larven(=Raupen)stadien zur Puppe und dann zum erwachsenen Falter eine völlige Umorganisation der Körperstruktur stattfindet.
Die Entwicklung eines Tagfalters am Beispiel des Segelfalters: Ein frisch gelegtes Ei.
Nach einigen Tagen färbt sich das Ei rötlich braun.
Nach etwa 20 Tagen beginnt die Raupe zu schlüpfen.
Nach dem Schlupf frisst die Raupe des Segelfalters die Eihülle bis auf einen am Blatt haftenden Rest, den sogenannten „Eiboden“.
Die schwärzliche Jungraupe (L1) häutet sich erstmalig und wird so zur grünen L2.
Die L3 ist grün mit feinen gelben Punktreihen.
Die „fertige“ Raupe, die L5, trägt gelegentlich ein bräunlich rotes Muster auf dem Rücken.
Kurz vor der Verpuppung verfärbt sich die L5 der nachfolgend überwinternden Puppe leuchtend gelb und begibt sich auf die Wanderung auf der Suche nach einem geeigneten Verpuppungsort, während die L5 der Sommergeneration grün bleibt.
Rechte Seite, von links oben nach links unten: Oben: Die Raupe hat einen geeigneten Ort für die Verpuppung gefunden und beginnt, sich dort anzuspinnen. Mitte: Die verpuppungsreife Raupe hat sich mit einem Gürtelfaden angehängt und häutet sich noch einmal: Hier ist die sogenannte Präpuppenhaut schon vom Kopfvorsprung abgestreift. Unten: Die Puppe ist fertig ausgehärtet.
Rechts oben: Soeben hat der Segelfalter die Puppenhülle verlassen.
Rechts unten: Die Flügel des Falters brauchen einige Zeit, um sich vollständig zu entfalten.
Der „fertige“ Segelfalter mit entfalteten Flügeln.
Die befruchteten Falter-Weibchen legen ihre Eier normalerweise an den Pflanzen ab, an denen später die Raupen fressen. Einige Arten lassen die Eier auch mehr oder weniger gezielt ins Gras fallen oder heften sie irgendwo in der Nähe der Raupenpflanzen an. Die Eier werden einzeln abgelegt oder gruppenweise in sogenannten „Eispiegeln“. Meist haben die Eier eine für die betreffende Artengruppe spezifische Form, und auch in ihrer Feinstruktur zeigen sie oft artspezifische Merkmale.
Nach meist ein bis zwei Wochen schlüpft aus dem Ei die Jungraupe, die sogenannte L1 (1. Larvenstadium). Wenn ihre Haut zu eng wird, muss die Raupe sich häuten, um weiter wachsen zu können – die daraus entstehende Raupe ist die L2. In der Regel ist nach vier Häutungen mit der L5 das letzte Entwicklungsstadium der Raupe erreicht. Bis hierhin dauert die Entwicklung etwa vier bis sechs Wochen – bei Arten, die in einem Raupenstadium überwintern, entsprechend länger. Nach einer letzten Häutung wandelt sich die Raupe zur Puppe. Solange die Puppenhaut noch weich ist, sind die Tiere sehr empfindlich. Wenn in dieser Phase der nötige Platz fehlt oder Störungen auftreten, kann es zu Deformationen und Missbildungen beim späteren Falter kommen.
Einen leicht abweichenden Entwicklungszyklus finden wir bei den Widderchen. Sie haben in der Regel acht Raupenstadien und überwintern als junge bis halberwachsene Raupe (oft im L4-Stadium), die erst danach wieder Nahrung aufnimmt. Zum Ende ihrer Entwicklung fertigt die Widderchenraupe einen Kokon, in welchem dann die Verpuppung erfolgt. Bei einigen Rotwidderchen kommt relativ häufig eine mehrfache Überwinterung der Raupe vor.
Man unterscheidet Gürtel- und Stürzpuppen, die sich irgendwo anheften, von solchen, die in der Streuschicht am Boden liegen, manchmal verborgen in einem Kokon oder einem Gespinst (die Widderchen oft an Grashalmen oder anderen senkrechten Strukturen des Lebensraumes). Die Puppen von Weißlingen und Ritterfaltern befestigen sich in mehr oder weniger aufrechter Position mit ihrem Hinterende an Pflanzenstängeln oder Ähnlichem und spinnen zusätzlich einen Haltefaden um ihre Körpermitte – daher der Name Gürtelpuppe. Die Puppen der Edelfalter sind Stürzpuppen, die kopfunter hängend befestigt sind. Bei Apollofaltern und auch einigen Augenfaltern und Bläulingen liegen die Puppen mehr oder weniger gut verborgen am Boden. Nach der Puppenruhe, während der die inneren Organe von der Raupenfunktion in die Funktion des Falters umgebaut werden, schlüpfen die Falter. Die Flügel der frisch geschlüpften Falter sind noch nicht entfaltet und schlaff. Erst wenn Körperflüssigkeit in die Adern gepumpt wird, vergrößert sich die Flügelfläche bis zum Endzustand. Es dauert mitunter einige Stunden, bis die Flügel ausgehärtet sind und die Falter davonfliegen können. In dieser Zeit sind die Tiere recht hilflos und Fressfeinden stark ausgesetzt. Die Lebensspanne der Falter beträgt in der Regel einige Tage bis wenige Monate. Die Einzeltiere mancher Arten leben mitunter nur zwei bis drei Tage lang, während Zitronenfalter bis zu einem Jahr alt werden können.
Tagfalter-Generationen
In Zonen mit gleichmäßigem Klima läuft der beschriebene Lebenszyklus ununterbrochen ab, es wird eine Generation nach der anderen hervorgebracht. Höhere Temperaturen beschleunigen, niedrige Temperaturen verzögern die Entwicklung. In unseren gemäßigten Breiten können die wechselwarmen Organismen die unwirtlichen Zeiten nur in einem widerstandsfähigen Stadium überstehen oder indem sie in wärmere Gebiete ausweichen. Die Arten der letztgenannten Gruppe werden als Wanderfalter bezeichnet.
Wanderfalter
Der international wohl bekannteste Wanderfalter ist der Monarch. Jedes Jahr im Herbst fliegen massenhaft Exemplare aus den nördlichen Vereinigten Staaten und Kanada nach Süden. Obwohl so zahlreiche Tiere unterwegs sind, hat es viele Jahre gedauert, bis das Rätsel des Ziels dieser Wanderungen gelöst wurde. Das Winterquartier des Monarchs befindet sich in den mexikanischen Bergen in etwa 3000 m Höhe. Hier versammeln sich die Falter zu zig Millionen und bedecken die Bäume und den Boden. Im Frühjahr fliegen dieselben Tiere wieder zurück in die Ausgangsgebiete. Dabei legen sie mühelos 3000 km und mehr zurück. Gelegentlich verschlägt es einzelne Monarch-Falter auf das europäische Festland. Sie stammen von den Kanaren. In Bezug auf die zurückgelegten Strecken können sich Wanderfalter also durchaus mit manchen Zugvögeln messen. Auch der in Deutschland häufig zu findende Distelfalter vollbringt beeindruckende Flugleistungen. Distelfalter wandern jedes Frühjahr von Süden kommend bei uns ein und vermehren sich in zwei bis drei Generationen. Wird die Populationsdichte zu hoch oder wird durch andere Faktoren Wanderbereitschaft ausgelöst, fliegen große Schwärme in Gebiete mit zu erwartendem besserem Klima, also z. B. von Deutschland aus im Spätsommer bis nach Afrika. Dort durchlaufen sie ebenfalls mehrere Generationen, bevor im Folgejahr die Nachkommen wieder bei uns einfliegen. Distelfalter fliegen auf ihren Wanderungen in großen Höhen und mit hohen Geschwindigkeiten und überqueren dabei Hochgebirge offenbar genauso problemlos wie die Sahara.
Eine Stürzpuppe, hier vom Flockenblumen-Scheckenfalter (Seite 134).
Die Puppe des Ockerbindigen Samtfalters (Seite 166) liegt verborgen in der Bodenstreu.
Überwinterung
Die meisten Schmetterlinge jedoch überwintern bei uns je nach Art als Ei, Raupe, Puppe oder Falter. Zitronenfalter, Kleiner und Großer Fuchs, C-Falter, Trauermantel und Tagpfauenauge – inzwischen auch der Admiral – überdauern unseren Winter als Falter. Daher sind sie stets die ersten Frühlingsboten und fliegen manchmal schon, während noch Schnee liegt. Die Überwinterungsstrategien der übrigen Arten sind zeitlich auf die Entwicklung von Knospen, Blüten und Blättern der Raupennahrungspflanze abgestimmt. Gut angepasst an die Bedingungen in unseren Breiten sind die Arten, bei denen abnehmende Tageslängen das Signal für eine vollständige Winterruhe, die Diapause, geben. Andere Arten reduzieren nur ihre Aktivitäten in Abhängigkeit von den fallenden Temperaturen.
Einige Falterarten überwintern als Raupe: Hier die vollkommen von einer Eisschicht umgebene, aber durchaus lebende Raupe des Großen Schillerfalters (Seite 144).
Sonderfall Landkärtchen
Interessant sind die Entwicklungsabläufe beim Landkärtchen. Die Art überwintert als Puppe. Ab Mitte April schlüpft aus ihr der oberseits orange-schwarz gefleckte Falter; diese Frühjahrsform wird levana genannt. Aus den im Mai gelegten Eiern entwickeln sich Raupen, die sich bis Ende Juni verpuppen und aus denen ab Anfang Juli die Falter der zweiten Generation schlüpfen. Diese sind völlig anders gefärbt und gezeichnet: Die Grundfarbe der Flügeloberseiten ist schwarz mit einer weißen Binde (Sommerform prorsa). Das unterschiedliche Aussehen der beiden Generationen hatte den Naturforscher Linné veranlasst, zwei getrennte Arten zu beschreiben. Erst über 100 Jahre später erkannte man, dass es sich in Wirklichkeit um zwei Erscheinungsformen einer Art handelt. Zwischen beiden Farbvarianten gibt es auch Übergänge, in denen die dunkle Sommerform einen mehr oder weniger großen Anteil an orangen Schuppen ausbilden kann. Diese als porima bezeichnete Form entsteht durch verlängerte Puppenruhe, beispielsweise infolge kühler, regnerischer Witterung. Nach warmen Frühjahren und Frühsommern schlüpfen die Falter der Sommergeneration bereits so früh, dass es eine dritte Generation gibt, wenn die Temperaturen auch weiterhin hoch bleiben.
Das Landkärtchen sieht in der ersten Generation (Foto) ganz anders aus als in der zweiten (Seite 130).
An diesem Beispiel wird deutlich, wie verschiedene Umweltfaktoren die Lebenszyklen und Generationsfolgen der Schmetterlinge steuern und variieren.
Schmetterlinge beobachten
Das Sammeln von Belegexemplaren ist heute nur noch in begrenztem Umfang für wissenschaftliche Zwecke gestattet. Man darf aber nicht vergessen, dass Sammlungen die zentrale Quelle unseres Wissens zur Entwicklung von Falterbeständen sind. Diese Bedeutung dürfte ihnen auch in der Zukunft noch zukommen – beispielsweise für die Analyse von Ausbreitung und Fragmentierung durch molekulargenetische Methoden.
Heute finden Schmetterlingsbegeisterte ihr Vergnügen verstärkt darin, zu beobachten, aufzuzeichnen und zu fotografieren. Schnell lernt man dabei, Färbungs- und Zeichnungsvarianten innerhalb der einzelnen Arten zu registrieren. Eine entsprechende Fotodokumentation kann durchaus wissenschaftlich interessante Ergebnisse liefern. Um eine Art zu identifizieren, reichen häufig schon mehrere Bilder verschiedener Ansichten (Ober-, Unterseite) des Falters, die man dann im Zweifel in Internetforen von Fachleuten nachbestimmen lassen kann (z. B. www.lepiforum.de). Für eine eindeutige Identifikation unverzichtbar ist jedoch die Entnahme von Exemplaren bei denjenigen Arten, die äußerlich nicht bestimmbar sind (Seite 20 – für die Entnahme einzelner Tiere ist in Deutschland in der Regel eine Genehmigung durch die zuständige Naturschutzbehörde erforderlich).
Schmetterlinge sind fast überall
Tagfalter begegnen uns in verschiedensten Lebensräumen, selbst auf Blumenrabatten im Zentrum von Großstädten. Viele Falterarten lieben das Offenland und baumfreie Plätze im Wald. Sie kommen auf Wiesen, Weiden, Magerrasen, Schneisen, Lichtungen oder auch auf Feldern vor. Bevorzugte Flugplätze sind dabei Flächen mit einer vielfältigen, blumenreichen Flora.
Manche Tagfalter sind recht standorttreu. Männliche Falter einiger Arten besetzen bestimmte Revierplätze, das heißt, dieselben Individuen können über Tage oder sogar Wochen hinweg an denselben Stellen gefunden werden, so z. B. das Waldbrettspiel. Andere Arten dieser Gruppe, wie der Schwalbenschwanz, haben einen hohen Raumbedarf und fliegen weit umher; folglich trifft man sie meist nur einzeln an. Viele heimische Tagfalter fliegen bevorzugt an Wald-, Feld- und Gewässerrändern, an mit Büschen durchsetzten Hängen oder Tallagen sowie anderen reich strukturierten Geländeabschnitten. Dabei vertreiben die Männchen von ihren Sitzwarten aus arteigene Konkurrenten und selbst andere Arten, während sie auf vorbeifliegende Weibchen warten. Über Bergkuppen, Hügeln und exponierten Bauwerken kann man Schwalbenschwänze und Segelfalter beim sogenannten „Hilltopping“ beobachten: Die männlichen Falter führen Balzflüge aus und versuchen dabei, jeweils die attraktivsten Plätze zu besetzen, wo sich dann auch die Weibchen einfinden. Ähnliche Funktion haben für Waldarten herausragende Bäume („Treetopping“). Viele Tagfalter (z. B. Schillerfalter, Eisvögel, Großer Fuchs, Samtfalter-Arten) leben entlang breiter Forstwege, in Schneisen und auf Lichtungen. In dicht geschlossene Hochwälder dringen dagegen nur wenige Arten vor; so etwa das Waldbrettspiel, das regelmäßig sogar in lichtarmen Fichtenmonokulturen zu finden ist.
Warum sind so viele Schmetterlinge gefährdet?
Um Schmetterlinge effizient schützen zu können, müssen ihre Biologie und ihre ökologischen Ansprüche sehr gut bekannt sein. Obwohl schon unzählige Untersuchungen durchgeführt wurden, gibt es in Detailfragen immer noch erhebliche Kenntnislücken. Es ist klar, dass streng an einen Lebensraum gebundene Arten mit dessen Veränderung bzw. Vernichtung unmittelbar bedroht sind. Vielfach werden aber auch Arten, die über Jahrzehnte als häufig und in ihren Ansprüchen als unspezifisch galten, plötzlich seltener oder verschwinden aus Gebietsteilen, ohne dass es bemerkt wurde und vielfach auch ohne dass die Ursachen erklärt werden könnten.
Arten mit sehr kompliziertem Lebenszyklus wie der Dunkle und der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling sind besonderen Gefährdungsfaktoren ausgesetzt. Die Raupen dieser beiden Arten sind monophag und kommen demnach ausschließlich dort vor, wo ihre Wirtspflanze, der Große Wiesenknopf, wächst. Die Weibchen legen ihre Eier an die Blütenköpfe noch unreifer Pflanzen. Damit sich die Pflanzen entwickeln können und die Weibchen zur Eiablage geeignete Blütenköpfe vorfinden und später, damit sich die Raupen entwickeln können, ist die Mahd entsprechender Wiesen in der Zeit von Mitte Juni bis Anfang September sehr kritisch. Die Pflanzen sind gleichzeitig auch Nektarquelle und Rendezvousplatz für die Falter. Die Jungraupen fressen die Wiesenknopf-Blüten und verlassen im vierten Stadium die Pflanze. Am Boden werden sie von bestimmten Ameisen „adoptiert“, das heißt in deren Nester getragen. Es müssen also auch geeignete Lebensbedingungen für die Ameisen gegeben sein. Fatale Folgen haben auch lang andauernde Überschwemmungen von Flussniederungen, wenn dadurch die Ameisenbaue zerstört werden. In den Nestern leben die Bläulingsraupen entweder räuberisch von der Ameisenbrut oder sie werden von den Ameisen mit Nahrung versorgt. Der Ameisenstaat kann die Verluste nur verkraften, wenn er optimal entwickelt ist. Die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge überwintern im Ameisennest, verpuppen sich im Juni und verlassen es im Juli als Falter. Dieses Beispiel macht deutlich, wie stark unterschiedliche Bewirtschaftungsmaßnahmen darüber entscheiden, ob der komplexe Entwicklungszyklus einer Art ablaufen kann oder nicht.
Nutzungsaufgabe und -intensivierung
Neben ganz offensichtlichen Ursachen für die Beeinträchtigung der Fauna allgemein, wie Flächenversiegelung und Verkehrswegebau, sind für den Rückgang der heimischen Schmetterlinge heute zwei Hauptgefährdungsfaktoren zu nennen. Zum einen die Aufgabe habitatbildender Landnutzungen (düngungsfreie Beweidung, Nieder- und Mittelwald, Streunutzung, bäuerlicher Materialabbau etc.) und zum anderen die immer noch anhaltende Intensivierungstendenz im mittleren Grünland durch Düngung, Aufbringen von Biogas-Gärresten und häufigere Mahd. Auch in renaturierten Tagebauen und aufgegebenen Truppenübungsplätzen gehen wertvolle Habitate verloren. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist – mit besonders schlimmen Auswirkungen für Tagfalter – die flächendeckende Abschaffung von Kahlschlägen im Rahmen des sogenannten naturnahen Waldbaus dazugekommen. Bei neuen Landnutzungen, wie z. B. durch Photovoltaik-Anlagen (PV), kommt es bezüglich der Auswirkungen entscheidend darauf an, welche Flächen dafür in Anspruch genommen werden. Magergrünland, Extremstandorte von Abbaugebieten oder militärische Konversionsflächen verlieren ihre Faltervielfalt durch das Aufstellen von PV-Paneelen, weil diese essenzielle Larvalhabitate überschatten. Stark gedüngte Äcker oder Wiesen können durch PV-Anlagen dagegen aufgewertet werden, wenn in den Randbereichen breite, gut besonnte Magerstandorte entwickelt und gepflegt werden, so z. B. durch Oberbodenabtrag, Magerwieseneinsaat und extensive Beweidung.
Schmetterlinge als Indikatoren
Tagfalter und Widderchen haben eine ganze Reihe Eigenschaften, die sie als Indikatoren für Umweltveränderungen wertvoll machen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sie als wechselwarme Organismen mit kurzen Generationszeiten sehr rasch auf Klimaveränderungen reagieren. Man hat Veränderungen des jahreszeitlichen Lebenszyklus, der Verbreitungsgebiete und der Populationsdynamik beobachtet, die z. B. durch aktuelle klimatische Veränderungen erklärt werden können.
Klima- und Landschaftswandel
Wissenschaftliche Modelle wie auch konkrete Beobachtungen zeigen, dass in Abhängigkeit von den jeweils zugrunde gelegten bzw. vorhandenen Ausprägungen des Klimawandels viele europäische Tagfalterarten große Teile ihres nutzbaren Klimaraumes verlieren. Der „Community Temperature Index“ beispielsweise zeigt temperaturbedingte Veränderungen von Tagfaltergemeinschaften an. Dieser Index kann sowohl auf regionaler als auch europäischer Skala als Klimawandelindikator verwendet werden. Auch durch Landnutzung verursachte Veränderungen, wie z. B. die Zerstückelung oder die oben genannte unterlassene Pflege von Lebensräumen, beeinflussen die Populationen stark. Der „European Grassland Butterfly Indicator“ weist einen kontinuierlichen europaweiten Rückgang der Tagfalterarten des Grünlandes innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte nach. Das Tagfalter-Monitoring (s. u.) kann eine sehr gute Basis für die Entwicklung solcher Indikatoren liefern.
Falter-Monitoring
In vielen europäischen Ländern gibt es mittlerweile sogenannte Monitoring-Programme zur Langzeiterfassung der Falterbestände. In ganz Europa notieren Freiwillige entlang festgelegter Strecken (sog. Transekte), welche Schmetterlinge sie sehen und wie viele von jeder Art. Da Falter als wichtige Indikatoren der Biodiversität gelten, können die gewonnenen Ergebnisse auch über andere Artengruppen Aufschluss geben. In Großbritannien wird bereits seit 1976, in den Niederlanden seit 1990 kontinuierlich gezählt und europaweit finden die Daten Verwendung im praktischen Naturschutz und der ökologischen Forschung wie auch bei Fachbehörden und politischen Instanzen. Nicht nur regionale und nationale Trends von Arten und Artengruppen können mithilfe der Aufzeichnungen beobachtet werden. Dank der weitgehend einheitlichen Erfassungsmethode werden Veränderungen der Falterbestände auf europäischer Ebene feststellbar (siehe vorhergehenden Abschnitt zu Indikatoren).
Tagfalter-Monitoring in Deutschland (TMD)
In Deutschland begann das bundesweite Tagfalter-Monitoring im Jahr 2005 unter wissenschaftlicher Leitung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung – UFZ und in Kooperation mit der Gesellschaft für Schmetterlingsschutz e. V. (GfS). Seitdem werden regelmäßig Daten gesammelt, und zwar zu den vermeintlich häufigen ebenso wie zu den seltenen und gefährdeten Arten. Sowohl die ehrenamtlich tätigen Transektzähler als auch die Regionalkoordinatoren – das sind Fachleute, die den Zählern aus ihrer Umgebung Hilfestellungen geben – leisten mit ihrem Engagement einen unschätzbaren Beitrag für das Erkennen und Bewerten des Zustands der Biodiversität.
Jeder kann mithelfen
Die Erfassungsmethode und die nötigen Artenkenntnisse sind auch für Anfänger relativ einfach zu erlernen. In langsamem Spaziertempo werden das ausgewählte Transekt abgeschritten und alle Falter registriert, die je 2,50 m links und rechts dieser Strecke zu sehen sind. Die (optimalerweise) wöchentlichen Begehungen beginnen in der Regel im März oder April und enden im September oder Oktober. Bestehen Unsicherheiten bei der Bestimmung, empfiehlt es sich, Fotos zu machen und diese über www.lepiforum.de fachkundigen Kolleginnen und Kollegen „virtuell“ vorzulegen. Alternativ kann man Fotos oder andere Belege auch der Regionalkoordination oder an [email protected] übermitteln. Die erfassten Daten können über die Webseite www.tagfalter-monitoring.de online eingegeben werden. Natürlich ist auch die Weiterleitung in Papierform an die zentrale Koordination des TMD möglich.
Wichtiger Hinweis: In Deutschland ist zum Fang wildlebender Arten eine Ausnahmegenehmigung nach § 43, Abs. 8 Bundesnaturschutzgesetz erforderlich sowie ggf. eine zusätzliche Genehmigung für das Verlassen der Wege in Naturschutzgebieten. Auch die Aufzucht gefundener Falter-Eier zwecks Artbestimmung ist für besonders und streng geschützte Arten generell genehmigungspflichtig. Die Genehmigungen erteilen die Landschafts- und Naturschutzbehörden.
Ergebnisse des TMD
Am Beispiel von drei Arten möchten wir zeigen, wie unterschiedlich sich die Populationen von Tagfaltern entwickeln können. Da die Größe der Populationen von Jahr zu Jahr sehr schwanken kann, sind Aussagen zu ihrer Entwicklung erst nach längeren Zeiträumen möglich. Die Daten des TMD geben uns mittlerweile die Möglichkeit, verlässliche Trendanalysen für einzelne Arten zu erstellen. Im TMD-Jahresbericht für 2021 wurden Trends ausgewählter häufiger Arten für den Zeitraum von 2006 bis 2021 veröffentlicht. Ein Rückgang lässt sich z. B. für den Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus) aufzeigen. Diese weit verbreitete Offenland-Art zeigt seit Beginn des Projektes einen konstanten Rückgang. Anders sieht es beim ebenfalls weit verbreiteten Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni) aus, dessen Bestand sich positiv entwickelt hat. Ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit langer Zeiträume in der Datenerfassung liefert der C-Falter (Polygonia c-album), dessen Populationen in den Jahren 2006 bis 2012 stark zurückgingen. 2017 hatte die Art jedoch ein sehr gutes Jahr, sodass über den Zeitraum von 2006 bis 2021 kein eindeutiger Trend zu erkennen ist. Hier wird sich erst in den folgenden Jahren zeigen, wie sich die Bestände langfristig entwickeln.
Mitmachen
Das Tagfalter-Monitoring ist ein System, das auf der freiwilligen Arbeit vieler Amateure und Fachleute basiert. Es wird nun schon seit 2005 durchgeführt und seither wurden in Deutschland auf mehr als 1500 Transekten (siehe innerer Umschlag hinten) regelmäßig Tagfalter und Widderchen sowie tagaktive Nachtfalter gezählt. Weitere Freiwillige sind jederzeit herzlich willkommen, damit das Projekt dem Anspruch gerecht werden kann, möglichst flächendeckend die Situation der Schmetterlinge wiederzugeben. Alle notwendigen Informationen zum Mitmachen finden sich auf www.tagfalter-monitoring.de oder können beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ angefordert werden (Anschrift: Tagfalter-Monitoring Deutschland – TMD, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Theodor-Lieser-Str. 4, 06120 Halle).
Tagfalter-Atlas Deutschland (TAD)
Die Ergebnisse aus dem TMD können zusammen mit weiteren Erfassungen zur aktuellen Verbreitung der Tagfalter in Deutschland genutzt werden, um ein genaueres Bild zu zeichnen. Die Kenntnis der Verbreitung der einzelnen Arten bildet die Grundlage zur Berechnung des Gefährdungsgrades in den Roten Listen gefährdeter Tagfalter der Länder und Deutschlands. War er in der letzten Auflage des vorliegenden Werkes noch angekündigt, liegt der TAD inzwischen in gedruckter Buchform vor (Reinhardt et al. 2020). Die darin enthaltenen Verbreitungskarten bilden hier nun für alle Arten die Grundlage für die Darstellung der Vorkommen in den Bundesländern.
Doch ist ein solcher Atlas stets nur ein Zwischenprodukt und die Datenbank wird unter der Schirmherrschaft der GfS (Gesellschaft für Schmetterlingsschutz) und des UFZ (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung) in Halle weiter gepflegt und stets aktualisiert, sodass wir in der Lage sein werden, über viele weitere Jahre Trends zu analysieren und zu berichten.