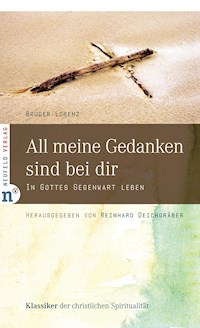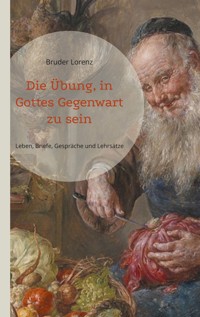
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die kleine Schrift über den spirituellen Weg des Karmeliterbruders Lorenz von der Auferstehung, der im 17. Jh. in Paris lebte, ist ein kleines Juwel christlicher Weisheit. Bruder Lorenz empfiehlt die einfache und doch sehr anspruchsvolle Übung, sich Gottes Gegenwart ständig bewusst zu sein und in diesem Bewusstsein zu leben (und wenn die Zeit kommt, auch zu sterben). Er tat dies ganz praktisch in seinem Alltag als Koch und später als Schuster (Sandalenmacher) des Klosters. Abbé de Beaufort sagte er einmal: "Für mich unterscheidet sich die Zeit des Handelns nicht von der Zeit des Gebetes, und im Lärm und Getöse meiner Küche, während mehrere Personen zusammen nach ebenso vielen verschiedenen Dingen rufen, besitze ich Gott in so großer Ruhe wie auf den Knien vor dem Allerheiligsten Sakrament. Manchmal wird mein Glaube sogar so klar, dass ich fast glaube, ihn verloren zu haben. Die Schatten, die unsere Sicht gewöhnlich verschleiern, scheinen zu fliehen, und es beginnt der Tag zu dämmern, der ohne Wolken und ohne Ende sein soll, der herrliche Tag des kommenden Lebens." Für ihn unterschieden sich die Gebetszeiten nicht mehr von den Zeiten, die er in der umtriebigen Küche verbrachte. Alltag und spirituelles Leben waren für ihn eins geworden. Ebenso näherte er sich in seiner kompromisslosen Übung dem, was die christliche Mystik die "Unio Mystica" nennt, die Vereinigung oder Einheitserfahrung mit Gott. Sein direkter Ansatz ist heute so praktisch wie damals. Das Quellenmaterial über Bruder Lorenz ist spärlich. Die Herausgeberin und Übersetzerin Gabriele Ebert hat daraus eine Biografie zusammengestellt und die Texte aus alten englischen Ausgaben übertragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
Zum Leben von Bruder Lorenz
Der Charakter von Bruder Lorenz als seine Lehre
Gespräche mit Bruder Lorenz
Einleitung
Erstes Gespräch
Zweites Gespräch
Drittes Gespräch
Viertes Gespräch
Briefe von Bruder Lorenz
Einleitung
Erster Brief
Zweiter Brief
Dritter Brief
Vierter Brief
Fünfter Brief
Sechster Brief
Siebter Brief
Achter Brief
Neunter Brief
Zehnter Brief
Elfter Brief
Zwölfter Brief
Dreizehnter Brief
Vierzehnter Brief
Fünfzehnter Brief
Die spirituellen Maximen (Lehrsätze) von Bruder Lorenz
Einleitung
Die spirituellen Maximen
Über die nötige Praxis, um ein spirituelles Leben zu erlangen
Wie wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten müssen
Die Einheit der Seele mit Gott
Über die Gegenwart Gottes
Mittel zur Erlangung der Gegenwart Gottes
Von den Vorteilen der Gegenwart Gottes
Gesammelte Gedanken von Bruder Lorenz
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die kleine Schrift über den spirituellen Weg des Karmeliterbruders Lorenz von der Auferstehung, der im 17. Jh. in Paris lebte, ist ein kleines Juwel christlicher Weisheit.
Bruder Lorenz empfiehlt die einfache und doch sehr anspruchsvolle Übung, sich Gottes Gegenwart ständig bewusst zu sein und in diesem Bewusstsein zu leben (und wenn die Zeit kommt, auch zu sterben). Er tat dies ganz praktisch in seinem Alltag als Koch und später als Schuster (Sandalenmacher) des Klosters.
Abbé de Beaufort sagte er einmal: „Für mich unterscheidet sich die Zeit des Handelns nicht von der Zeit des Gebetes, und im Lärm und Getöse meiner Küche, während mehrere Personen zusammen nach ebenso vielen verschiedenen Dingen rufen, besitze ich Gott in so großer Ruhe wie auf den Knien vor dem Allerheiligsten Sakrament. Manchmal wird mein Glaube sogar so klar, dass ich fast glaube, ihn verloren zu haben. Die Schatten, die unsere Sicht gewöhnlich verschleiern, scheinen zu fliehen, und es beginnt der Tag zu dämmern, der ohne Wolken und ohne Ende sein soll, der herrliche Tag des kommenden Lebens.“
Für ihn unterschieden sich die Gebetszeiten nicht mehr von den Zeiten, die er in der umtriebigen Küche verbrachte. Alltag und spirituelles Leben waren für ihn eins geworden. Ebenso näherte er sich in seiner kompromisslosen Übung dem, was die christliche Mystik die „Unio Mystica“ nennt, die Vereinigung oder Einheitserfahrung mit Gott. Sein direkter Ansatz ist heute so praktisch wie damals.
Das Quellenmaterial über Bruder Lorenz ist spärlich. Für die von mir erstellte Biografie habe ich die im Literaturverzeichnis angegebenen Bücher verwendet, für die Gespräche und Briefe: Brother Lawrence: The Practice of the Presence of God, Fleming H. Revell Company New York and London, 1895 und für die Maximen, die Biografie von Abbé de Beaufort (Der Charakter von Bruder Lorenz) sowie die Gesammelten Gedanken: The Spiritual Maxims of Brother Lawrence, London, H.R. Allenson, 1907, sie aber teils in eine etwas modernere Sprache übertragen.1
Ich denke, die kleine Schrift spricht für sich selbst, und hoffe, dass sie für den Leser/die Leserin eine wertvolle Hilfe ist.
In der Osterzeit 2023
Gabriele Ebert
1 Die Übersetzung der Schriften von Bruder Lorenz in dem Büchlein „All meine Gedanken sind bei dir“ (s. Literaturverzeichnis) fußt im Gegensatz dazu auf der alten deutschen Übersetzung von Gerhard Tersteegen. Die Briefe haben dort eine andere Anordnung, und es sind 16 anstatt 15. Auch gibt es weitere kleine Unterschiede.
Zum Leben von Bruder Lorenz
Bruder Lorenz, aus einem von Fleming Revell Co. veröffentlichen Buch, 1900
Bruder Lorenz wurde 1614 (manche Quellen geben auch 1611) als Nicholas Herman in Herimenil in der Nähe von Lunéville, Lothringen, einem Herzogtum im Nordosten Frankreichs, geboren. Über sein vorklösterliches Leben ist nicht viel bekannt. Er stammte aus ärmlichen Verhältnissen, und seine Eltern Dominic und Louise waren vermutlich Bauern. Von ihnen lernte er die christlichen Grundlagen, und wir wissen, dass er lesen und schreiben konnte.
Damals wütete der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648) in Zentraleuropa. 1632 wurde Lothringen von Frankreich besetzt, und Herzog Karl IV. warb Truppen an, um seine Gebiete zurückzuerobern. Vielleicht trat Nicholas aus Eifer in seine Armee ein, vielleicht aber auch einfach aus Armut und weil es ihm an anderen Möglichkeiten fehlte.
Abgesehen von einigen wenigen disziplinierten professionellen Einheiten bestanden die meisten Militärkontingente dieser Zeit aus schwer bewaffneten Schlägern, die nicht bezahlt wurden, sondern sich auf Kosten der Zivilbevölkerung durchschlagen mussten. Der erbitterte Hass zwischen protestantischen und katholischen Fraktionen führte zu wechselnden Allianzen kleiner Einheiten, die untereinander Koalitionen schlossen und wieder lösten. Zu der Zeit, als Nicholas diente, kämpften in Lothringen sechs verschiedene Armeen, die sich gegenseitig und die Zivilbevölkerung bekämpften. Es war normal, dass marodierende Heere Dörfer plünderten, Zivilisten ermordeten und ihre Gefangenen erschossen oder erstachen.
1635 kämpfte Nicholas bei Rambervillers, nicht weit von seinem Heimatdorf entfernt. Er wurde von deutschen Truppen gefangen genommen und geriet in den Verdacht, ein Spion zu sein. Sie drohten sogar, ihn zu hängen. Er antwortete furchtlos, dass er nicht das sei, was sie dächten. Durch seinen Mut beeindruckt, ließen die Soldaten ihn schließlich frei. Er kehrte zu seiner Truppe zurück und wurde bei dem Angriff von Rambervillers durch die Schweden verwundet. Fortan hinkte er. Daraufhin wurde er aus der Armee entlassen. Er sprach nie über die Schrecken, die er erlebt hatte, aber die Auswirkungen blieben ihm für den Rest seines Lebens erhalten.
Er schilderte seine spirituelle Erfahrung, die er im Alter von achtzehn Jahren gemacht hatte und die er als seine „Bekehrung“ bezeichnete. Als er im Winter einen kahlen, geisterhaft wirkenden Baum sah, der seiner Blätter und aller Lebenszeichen beraubt war, dachte er darüber nach, dass Gott den Baum im zeitigen Frühjahr wieder zum Leben erwecken würde, mit einer Fülle von Blättern und Früchten. Dies war für ihn wie eine Offenbarung.
Nach einer Zeit der Rekonvaleszenz im Haus seiner Eltern suchte Nicholas nach geistiger Erfüllung in der Einsamkeit des Einsiedlerlebens, gab es aber schließlich wieder auf. Anschließend trat er in Paris in die Dienste von William de Fieubet, dem Schatzmeister des Königs von Frankreich. Nicholas diente ihm als Lakai und beschrieb sich selbstironisch als „ein sehr ungeschickter Kerl, der alles kaputt machte“.
Als sein Dienst als Lakai endete, war er fest entschlossen, in die Fußstapfen seines Onkels, eines Karmeliten, zu treten. Mitte Juni 1640, im Alter von sechsundzwanzig Jahren, trat er als Laienbruder in das Kloster der unbeschuhten Karmeliten in der Rue Vaugirard in Paris (heute das Institute Catholique) ein und blieb dort bis zu seinem Lebensende. Trotz seiner Unbeholfenheit und seines Mangels an praktischen Fähigkeiten fügte er sich gut in die Gemeinschaft ein.
Die ehemalige Karmeliterkirche St. Josef in der Rue Vaugirard in Paris, Wikimedia Commons, Foto: G. Freihalter, 2012
Durch sein tugendhaftes Handeln gewann er die Achtung aller. Sein Novizenmeister prüfte seine Berufung, indem er ihm verschiedene unangenehme Aufgaben übertrug. Das entmutigte den jungen Ordensbruder jedoch nicht. Einmal kam ein Bruder zu ihm und erzählte, dass sie darüber sprachen, ihn aus dem Kloster zu entlassen, worauf er antwortete: „Ich bin in den Händen Gottes, und Er kann mit mir machen, was Ihm gefällt. Ich handle nicht aus Respekt vor den Menschen. Und wenn ich Gott hier nicht dienen kann, dann tue ich es anderswo.“
Am 14. August 1642 beendete er sein Noviziat, legte seine feierlichen Gelübde ab und erhielt den Ordensnamen Bruder Lorenz von der Auferstehung (Fray Laurent de la Résurrection). Die ersten fünfzehn Jahre arbeitete er als Koch für die Gemeinschaft. Obwohl er eine Abneigung gegen Küchenarbeit hatte, wie er selbst betonte, akzeptierte er sie gern aus Liebe zu Gott. Da die Ordensgemeinschaft auf bis zu hundert Mitglieder anwuchs, war die Küche ein sehr geschäftiger Arbeitsplatz. Als sich seine „Ischisasgicht“, die sich aus der Kriegswunde entwickelt hatte, verschlimmerte und er immer mehr hinkte, wurde ihm von seinen Vorgesetzten eine leichtere Aufgabe zuwiesen, bei der er sitzen konnte, nämlich die des Sandalenmachers in der eigenen Klosterwerkstatt. Doch auch später half er noch hin und wieder in der Küche aus.
Er betätigte sich zudem als Weineinkäufer für das Kloster, was ihn 1665 zu einer langen Reise in die Auvergne führte. Ein Jahr später unternahm er aus demselben Grund eine lange Flussfahrt nach Bourgogne, die für ihn sehr beschwerlich war, weil dieser arme Bruder, „der an einem Bein verkrüppelt war, sich auf dem Boot nur fortbewegen konnte, indem er sich über die Fässer rollte“. So hatte er Gelegenheit, auch außerhalb des Klosters Kontakte zu knüpfen. Zudem kamen Arbeiter ins Kloster, Bettler an die Tür und Besucher ins Besucherzimmer und in die Kirche.
Allmählich wuchs der Einfluss des bescheidenen Laienbruders. Auch viele Gelehrte, Ordensleute und Kirchenmänner schätzten ihn, und natürlich auch seine eigenen Mitbrüder.
Was sein spirituelles Leben betraf, berichtete Bruder Lorenz davon, dass er jahrelang an einer seelischen Dunkelheit gelitten und geglaubt habe, für immer verdammt zu sein. Andererseits machte er die beseligende Erfahrung Gottes und fürchtete, sich selbst zu betrügen. In seinem starken inneren Konflikt wusste er nicht mehr, was er tun sollte. Oft ging er zu einem einsamen Ort in der Nähe der Vorratskammer, wo es ein Bild mit dem an einen Pfosten gefesselten Christus gab. Dort weinte er, schüttete Gott sein Herz aus und bat Ihn, ihn umkommen zu lassen, weil er seine ganze Hoffnung in Ihn gesetzt hatte und nur Ihm gefallen wolle. So sehr er auch betete, seine Ängste und Qualen vergrößerten sich nur, sodass er schließlich wie gelähmt war. Eines Tages überließ er sich schließlich völlig Gott und war bereit, diese Pein für alle Ewigkeit zu erleiden, wenn es Gott gefiele. Von diesem Augenblick an wurde die Nacht für ihn zum Tag. Seine Ängste und Leiden waren verschwunden.
Bruder Lorenz berichtete, wie er schließlich zu der ihm eigenen Methode der Übung der Gegenwart Gottes kam: „Im ersten Jahr beschäftigte ich mich während der für die Andacht vorgesehenen Zeit gewöhnlich mit Gedanken über den Tod, das Gericht, die Hölle, den Himmel und meine Sünden.“ Aber er fühlte sich mit dieser diskursiven, einengenden Methode nicht wohl. Gab es nicht einen direkteren Weg, um Gott zu finden, jenseits dessen, was wir über Ihn denken können? Da machte er eine Entdeckung oder Erfahrung, die fortan sein Leben prägen sollte – er entdeckte die Übung der Gegenwart Gottes. Außerhalb der offiziellen Gebetszeiten bemühte er sich, seinen Blick direkt auf Gott als Freund, als ein Wesen, das im eigenen Innern gegenwärtig ist, zu richten. Er erzählt: „Den Rest des Tages und sogar während meiner Arbeit widmete ich mich sorgfältig der Gegenwart Gottes, den ich immer in meiner Nähe, oft sogar in der Tiefe meines Herzens betrachtete, was mir eine hohe Wertschätzung für Gott einbrachte.“
Unser Bruder, der mit konkreten Arbeiten und praktischen Lösungen vertraut war, wandte seine direkte und einfache Methode schließlich auch bei den offiziellen Gebetsstunden an: „Ich tat dasselbe unmerklich auch während meiner Gebete, was mir große Freude und großen Trost bereitete.“
Im Laufe der Jahre wurde es für Bruder Lorenz zur Gewohnheit, „immer bei Gott zu sein und nichts zu tun, nichts zu sagen und nichts zu denken, was Ihm missfallen könnte“. Aber lassen wir uns nicht täuschen: Seine so einfache und klare Methode setzt viel feste Entschlossenheit voraus. In einem Brief gesteht er, dass „der Anfang sehr schwierig ist“. Man wird „glauben, dass es verlorene Zeit ist“, man wird Widerwillen empfinden. Wenn man jedoch mit Sanftmut an der „inneren Rückkehr zu Gott“ festhält, wenn man treu bleibt, „diesen kleinen inneren Blick auf Ihn“ zu erneuern, wird man „bald die Auswirkungen sehen“. Er beschloss, die Liebe zu allem, was nicht Gott war, abzulehnen. Er entdeckte, dass er zu jeder Zeit beten konnte. Sogar wenn er die Suppe würzte oder Kartoffeln schälte, machte er seine Aufgaben zu einem integralen Bestandteil seines Gebets, indem er seine „methodenlose Methode“ anwandte.
Als sanftmütiger Mann mit fröhlichem Geist mied Bruder Lorenz die Aufmerksamkeit und das Rampenlicht, da er wusste, dass Ablenkung von außen „alles verdirbt“. Er war mit einer klaren und sachlichen Sprache gesegnet und verfasste Ratschläge, die anderen halfen, seinem Weg zu folgen. Abbé Joseph de Beaufort erinnerte sich, dass „Lorenz offen war, Vertrauen erweckte und einem das Gefühl gab, man könne ihm alles sagen ... Sobald man sein raues Äußeres hinter sich gelassen hatte, entdeckte man eine ungewöhnliche Weisheit, eine Freiheit, die für den gewöhnlichen Laienbruder unerreichbar war.“
Bruder Lorenz war nicht ungelehrt. Er sprach von Büchern, die er gelesen hatte, und er hatte oft Gelegenheit, viele gute Predigten zu hören. Im Refektorium wurden Schriften wie die von Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz und anderen Lehrern des Ordens und des Christentums vorgelesen.
Die Laienbrüder standen in der Klosterhierarchie an unterster Stelle. Selbst die Novizen, die Kleriker wurden, standen über ihnen. Meist nahmen sie nicht am Chorgebet teil, sondern verrichteten stattdessen eine gewisse Anzahl von „Vater unser“. Morgens ministrierten sie bei den Messen der Priestermönche. Wenn ihre Pflichten es ihnen nicht erlaubten, konnten sie vormittags und nachmittags auch nicht ihr jeweils einstündiges privates Gebet verrichten, wie es der Karmeliterorden vorsieht, sondern mussten es zu anderen Zeiten, oft nachts tun. Das alles spielte für Bruder Lorenz, der die Gegenwart Gottes in der Küche oder in der Sandalenwerkstatt ebenso erfuhr wie in der Kirche, keine Rolle.
Mit den Jahren wurden seine Schmerzen stärker. Die „Ischiasgicht“ plagte ihn fünfundzwanzig Jahre lang und entwickelte sich schließlich zu einem Geschwür am Bein. In den letzten Jahren seines Lebens war er dreimal krank. Als er sich beim ersten Mal erholte, sagte er zu seinem Arzt: „Herr Doktor, Ihre Mittel haben zu gut für mich gewirkt. Sie haben mein Glück nur verzögert.“ Er wartete sehnsüchtig auf die endgültige Begegnung mit seinem Herrn.
Interessant ist auch folgender Vorfall: Als bei seiner letzten Krankheit sein Bett hergerichtet wurde, hörte er einen seiner Mönchsfreunde sagen: „Es ist für dich, Bruder Lorenz. Es ist Zeit, zu gehen.“ Er antwortete: „Das stimmt. Das ist mein Totenbett, aber jemand, der es nicht erwartet, wird mir direkt folgen.“ Und tatsächlich geschah, was er vorhergesagt hatte. Obwohl sein Mitbruder völlig gesund war, wurde er am nächsten Tag krank und starb am gleichen Tag, an dem Bruder Lorenz beerdigt wurde. Er wurde einige Tage später im gleichen Grab beigesetzt wie Bruder Lorenz.
Bruder Lorenz hatte auch mehreren Personen vier oder fünf Monate vor seinem Tod vorhergesagt, dass er sterben würde, bevor der Februar zu Ende sei. Seinen letzten Brief vom 6. Februar beendete er mit den Worten: „Ich hoffe, Ihn in ein paar Tagen zu sehen.“ Bruder Lorenz, der bis zuletzt bei klarem Verstand war, starb am 12. Februar 1691 um neun Uhr morgens im Alter von siebenundsiebzig Jahren friedlich bei vollem Bewusstsein.