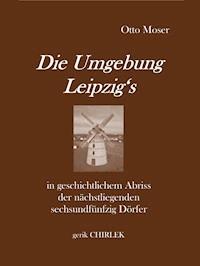
Die Umgebung Leipzig's in geschichtlichem Abriss der nächstliegenden sechsundfünfzig Dörfer E-Book
Otto Moser
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Leipzig - Auf historischen Spuren
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
= Digitale Neufassung für eBook-Reader = "...Vorliegendes Werk enthält die Geschichte und Beschreibung von 56 im Umkreise Leipzigs gelegenen Dörfern, und man kann mir glauben, dass auch ich bei dessen Herausgabe nicht wenig Mühe dransetzen musste. Es gehörte viel Fleiß und Ausdauer dazu das spärlich vorhandene Material aufzufinden, zu sichten und zusammen zu stellen, umso größer ist deshalb auch meine Befriedigung, dass es mir gelang die zur Aufgabe gestellte Vollendung einer um meine Vaterstadt geschlungenen lokalgeschichtlichen Kette, in der kein einziges Glied fehlt, glücklich zu lösen. Möge jeder Freund der Geschichte jeder gebildete Bewohner Leipzigs und der Nachbarorte das Werkchen freundlich aufnehmen." (Moser)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Umgebung Leipzig's in geschichtlichem Abriss der nächstliegenden sechsundfünfzig Dörfer
Technische Anmerkungen
Vorwort.
Kleinzschocher.
Großzschocher mit Windorf.
Die Lauer mit Knautkleeberg.
Gautzsch.
Zöbigker.
Knauthain.
Der Thonberg und die alte Funkenburg.
Stötteritz.
Schleußig.
Connewitz.
Raschwitz.
Gaschwitz.
Lindenau.
Gohlis.
Schönau.
Plagwitz.
Leutzsch.
Pfaffendorf.
Störmthal.
Probsthaida mit Thösen.
Dölitz und Lößnig.
Wachau.
Markkleeberg.
Zweinaundorf.
Die Kohlgärtendörfer Reudnitz, Anger und Crottendorf.
Abtnaundorf.
Schönefeld.
Die Theklakirche und ihre Dörfer.
Plaußig.
Portitz und Grasdorf.
Holzhausen und Zuckelhausen.
Eutritzsch.
Breitenfeld mit Lindenthal.
Möckern.
Wahren.
Lützschena.
Die Abteidörfer.
Eythra.
Machern.
Nachtrag.
Digitale Neufassungen
Impressum
Die Umgebung Leipzig's in geschichtlichem Abriss der nächstliegenden sechsundfünfzig Dörfer
dargestellt von Otto Moser
-
Leipzig, M. G. Priber.
1868
Digitale Neufassung des altdeutschen Originals
von Gerik Chirlek
Reihe: Leipzig - Auf historischen Spuren / Band 4
Technische Anmerkungen
Die vorliegende digitale Neufassung des altdeutschen Originals erfolgte im Hinblick auf eine möglichst komfortable Verwendbarkeit auf eBook Readern. Dabei wurde versucht, den Schreibstil des Verfassers möglichst unverändert zu übernehmen, um den Sprachgebrauch der damaligen Zeit zu erhalten.
Vorwort.
Es hat seit Jahrhunderten niemals an Schriftstellern gefehlt, welche sich die Herausgabe von Städtechroniken angelegen sein ließen. An historische Ortsbeschreibungen von Dörfern wagte man sich selten. Der Mangel an geschichtlichem Material und wo es solches gab, mancherlei argwöhnische Bedenklichkeiten der kleinen Herren, welche aus Unverstand jedem Forscher die Türen ihrer Archive verschlossen hielten, machte die Herausgabe einer Dorfchronik zur schwierigen Aufgabe. Beklagenswert war dagegen wieder die Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit, womit andere Herren ihre Archive der Vernichtung preisgaben, besonders nachdem man die Patrimonialgerichtsbarkeit aufgehoben hatte. In unserer Umgebung gibt es kaum noch einige Rittergutsarchive. Die Pfarrarchive enthalten auch wenig Material, indem, ganz im Gegensatze zu jetzt, die alten Pastoren ihre Kirchenbücher größtenteils mit unverzeihlicher Lässigkeit führten, worüber ich manches unglaubliche Beispiel anführen könnte. Ortsgeschichtliche Erinnerungen im Pfarrarchive niederzulegen fiel selten einem Geistlichen ein. Umso rühmlichere Erwähnung verdienen daher zwei Pastoren unserer Nachbarschaft, welche sich um die Geschichte ihrer Pfarrdörfer und deren Nachbarorte große Verdienste erworben haben. Sie waren Johann Falkenhagen Pastor in Knauthain, der dieses Amt von 1665 bis 1693 versah und einen Band Annalen hinterließ und Mag. Heinrich Engelbert Schwartze, von 1733 bis 1768 Pfarrer in Großzschocher, welcher eine historische Nachlese zu denen Geschichten der Stadt Leipzig schrieb, von der nur zu bedauern ist, dass er sie nicht fortgesetzt hat. Eine Landchronik zu schreiben war früher, wie auch jetzt noch eine überaus mühevolle Arbeit.
Vorliegendes Werk enthält die Geschichte und Beschreibung von 56 im Umkreise Leipzigs gelegenen Dörfern, und man kann mir glauben, dass auch ich bei dessen Herausgabe nicht wenig Mühe dransetzen musste. Es gehörte viel Fleiß und Ausdauer dazu das spärlich vorhandene Material aufzufinden, zu sichten und zusammen zu stellen, umso größer ist deshalb auch meine Befriedigung, dass es mir gelang die zur Aufgabe gestellte Vollendung einer um meine Vaterstadt geschlungenen lokalgeschichtlichen Kette, in der kein einziges Glied fehlt, glücklich zu lösen. Möge jeder Freund der Geschichte jeder gebildete Bewohner Leipzigs und der Nachbarorte das Werkchen freundlich aufnehmen.
Leipzig, am 1. August 1868.
Der Verfasser.
Kleinzschocher.
Kleinzschocher ist ein altes Dorf und hat nach Namen und Lage zu urteilen, vielleicht in frühesten Zeiten mit dem eine Viertelstunde entlegenen Großzschocher in Verbindung gestanden, doch lässt sich dies durch Mangel an urkundlichen Nachrichten nirgends nachweisen. Eine Feuersbrunst, welche am 26. August 1703 sechsundzwanzig Häuser und Güter, einen Teil des Edelhofes, nebst Pfarre und Schule in Asche legte, hat alle Dokumente vernichtet und die früheste Geschichte des Ortes in nicht zu erhellendes Dunkel gehüllt. Die ältesten Nachrichten erstrecken sich nicht über die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts hinaus. Damals, vielleicht auch schon früher, besaßen Kleinzschocher, Plagwitz und Großmiltitz die Herren von Hahn. Bei einer Renovation der Kirche im Jahre 1744 fand man einen sehr alten Leichenstein mit der Inschrift „Nicol Hahn“ und 1630 wird Otto von Hahn als Besitzer von Kleinzschocher und Plagwitz genannt, dessen Witwe, Anna Elisabeth, noch 1664 hier wohnte. Von der Familie von Hahn kam Kleinzschocher an Carl von Dieskau, der außerdem noch Knauthain, Zschepplin, Trebsen und Lochau besaß und 1667 zu Zschepplin starb. Von ihm erbte es sein älterer Bruder der Vizeoberhofrichter Geißler von Dieskau und als dieser kinderlos mit Tode abging Heinrich von Dieskau. Dessen Sohn und Erbe, Gebhard von Dieskau, starb 22 Jahre alt am 24. Mai 1683 und kann man sein hübsches Epitaphium noch in der Kirche sehen. Gebhards Bruder, der Kammerherr Hildebrand von Dieskau hinterließ seine Güter 1739 dem einzigen Sohne Carl Heinrich, dessen Ehe reich mit Töchtern gesegnet war, ohne dass er einen Sohn erzielte. Zu großer Töchtersegen ist eine verhängnisvolle Gabe, dies erfuhr auch Carl Heinrich von Dieskau. Er war Kammerherr, Kreishauptmann und Kreissteuereinnehmer, und der letzte Herr seines Namens auf Kleinzschocher. Nach seinem Tode erkaufte das Gut sein Schwager, der Kreishauptmann Major von Trebra auf Zangenberg, welcher es noch bei Lebzeiten dem Fabrikherrn August Kelz in Colditz überließ. Schon nach einigen Jahren kam Kleinzschocher von diesem an den Kammerherrn und Hauptmann Ernst von Griesheim auf Oberthau. In seinem Alter zog er sich zurück und verkaufte das Gut an die Kaufleute Schröter und Hildebrand in Leipzig. Letzterer, der dasselbe später allein besaß, veräußerte es kurz vor seinem 1812 erfolgten Ableben an den Kaufmann Johann David Förster, der 1827 mit Tode abging. David Försters erinnert sich noch mancher alte Einwohner mit hoher Verehrung. Er hat zur Verschönerung und Verbesserung des Gutes viel getan. Als Freund der Natur schuf er das nahe gelegene Hölzchen, wo sich früher eine Fasanerie befand, in einen Park um, und erbaute ausgedehnte Gewächshäuser, wodurch die Rittergutsgärtnerei bald zu großem Rufe gelangte. Er starb 1827 und das Gut kam an seinen Sohn, Gustav Förster. Sein Nachfolger in dessen Besitze, der Buchhändler Baron von Tauchnitz, erstand Zschocher sub hasta. Derselbe hat das Herrenhaus in großartigem Stile umbauen lassen. Das ziemlich unscheinbare Schlösschen, welches zur Zeit der Herren von Hahn erbaut worden sein mag und häufig Reparaturen und Veränderungen erlitt, ist zu einem stolzen Rittersitz umgewandelt worden, hoch überragt von einem gotischen Turme, welcher vielleicht dem Ganzen zur besseren Zierde dienen würde, wenn er nicht in eine hohe schiefergedeckte Spitze auslief, sondern gleich einer altertümlichen Warte, oben flach und mit Zinnen eingefasst wäre. Durch den kostbaren Umbau ist Kleinzschocher einer der schönsten Rittersitze des Königreichs geworden.
Das Dorf war früher eins der größten im Leipziger Kreise, steht jedoch zurzeit, wo die näher an Leipzig liegenden Ortschaften mit wahrhaft fabelhafter Schnelligkeit zu nie geahnter Größe herangewachsen sind, gegen mehrere derselben weit zurück. Das noch vor wenigen Jahren so bescheidene Dörfchen Plagwitz, hat jetzt mit Zschocher fast gleiche Seelenzahl. Am 3. Dezember 1864 zählte jenes 1.736, dieses 1.755 Einwohner. Eine Volkszählung im Jahre 1840 ergab 561 Seelen. Im Jahre 1740 hatte Kleinzschocher 52 Güter und Häuser mit Nachbarrecht und nebst Ziegelei, Schäferei und Hirtenhaus 38 eingebaute Häuser. Darunter befand sich auch der alte, an der Straße nach Kleinzschocher gelegene Gasthof, welcher im Jahre 1849 den seltsamen Namen „Zum Reichsverweser“ erhielt, nachdem er seit mindestens zweihundert Jahren der „Graue Wolf“ geheißen hatte. Ältere Leute werden sich noch des verwitterten Wirtshausschildes über der Haustür erinnern, welches das Bild eines Wolfes mit einer kaum lesbaren Inschrift darstellte. Diese lautete: „Hier ist der graue Wolf, ihr Gäste kehret ein, der Wirt wird gar kein Wolf, vielmehr recht billig sein.“ Das Schild hatte bei einer Reparatur des Gasthofes im Jahre 1742 der damalige Wirt Gottfried Schumann anbringen lassen. Früher gehörte der Gasthof zum Rittergute und kam erst vor etwa dreißig Jahren durch Verkauf von diesem ab. Der Graue Wolf war bis vor wenigen Jahrzehnten einer der beliebtesten Vergnügungsorte der Leipziger Spaziergänger und noch mancher alte Gast desselben wird sich der Mutter Bogen erinnern, der eben so dicken als derben und lustigen Wirtin, und der Karpfenschmäuse und Schlachtfeste, welche Haus und Garten mit Besuchern füllten. Die Restauration zur Terrasse entstand durch Protektion des Kommandanten der Leipziger Jägergarnison, dessen hier im Rekrutenkantonnement liegenden Mannschaften das Bier zu ermäßigtem Preise abzulassen der Wirt des Gasthofes sich geweigert hatte, worauf der spätere Terrassenwirt, welcher dies zu tun versprach, auf Verwendung des erwähnten Offiziers die längst gewünschte Schankkonzession erhielt.
Der Name Zschocher wird von dem slawischen Worte Choho, das heißt „wessen Berg?“ abgeleitet und es lässt sich die Erklärung wohl hören, dass der Slawenstrom, welcher seinen Zug durch die Aue nahm um sich hier anzusiedeln, daselbst schon Niederlassungen vorfand und mit deren Bewohnern in Streit geriet, der dadurch beendigt wurde, dass man ihnen die Anhöhe zur Bebauung überließ. Den schriftlichen Glauben nahmen die hier ansässigen Slaven erst spät und nach langem Widerstande an. Darüber klagte noch Bischof Ditmar von Merseburg und dessen Nachfolger, Bischof Wigbert, predigte 1015 das Evangelium in slawischer Sprache.
Eine der ältesten Nachrichten über Kleinzschocher gedenkt der hiesigen Brotbäcker, welche im Jahre 1621 bei einer durch den Eigennutz der Leipziger Bäcker hervorgerufenen Brotnot das Recht erlangten, Brote auf den Leipziger Markt bringen zu dürfen. Zehn Jahre später, wo Tilly von beiden Zschochern und Lindenau aus, Leipzig berannte, wurde der Ort schrecklich mitgenommen und überhaupt während des Dreißigjährigen Krieges von Schweden und Kaiserlichen oft plündernd heimgesucht und endlich in Asche gelegt. Entsetzlich wie nirgend in der Nachbarschaft herrschte 1680 hier eine pestartige Krankheit. Da bei dem Brande der Pfarre im Jahre 1703, die Kirchenbücher verloren gingen, müssen wir der Tradition glauben, welche sagt, dass ein Viertel der Bevölkerung hingerafft wurde. Die Leute flüchteten in den Wald und bauten sich daselbst Hütten; aber auch dorthin kam der fürchterliche Gast und trieb sie wieder ins Dorf zurück. Auf dem Kirchenboden liegen noch heute die Trümmer des Wagens, welcher zur Fortschaffung der Pestleichen diente. Im Siebenjährigen Kriege wurde Zschocher durch die Preußen seckiert und in den Oktobertagen des Jahres 1813 war die ganze Bevölkerung vor den Plünderungen und Misshandlungen der Franzosen, in den Wald geflohen. Sie fanden bei ihrer Heimkehr die Häuser vollständig ausgeräumt und besaßen buchstäblich nichts als was sie auf dem Leibe trugen. Die Folge war Hungersnot und Krankheiten, welche eine Menge Menschen, das Kirchenbuch gibt deren 62 an, ins Grab stürzten. Im Jahre 1842 brannte die Brennerei des Ritterguts nieder.
Die Kirche zu Kleinzschocher ist nach einem kleinen Teil, auf welchem 1688 der Turm erbaut wurde, zu schließen, ein uraltes Gebäude und war vermutlich ursprünglich nur eine Kapelle. Sie hat viele Umbauten und Reparaturen erfahren, die bedeutendsten 1744 und in neuester Zeit. Die Glocken sind im Anfange dieses Jahrhunderts gegossen worden. Der erste protestantische Pfarrer hieß Johannes Werk. Er hat bis jetzt 17 Nachfolger gehabt. Eingepfarrt sind Plagwitz und Schleußig, Filial ist Großmiltitz. Im Jahre 1830 wurde hier ein neues Pfarrhaus gebaut, welches 3.750 Taler kostete, und in demselben Jahre durch Kollekte auch eine neue Turmuhr angeschafft. Das bei Plagwitz gelegene Pfarrholz trieb man 1833 ab und steht dem jedesmaligen Pfarrer der Zinsengenuss des daraus gewonnenen Kapitals zu. Ein zweites Schulhaus erbaute man 1837 für 900 Taler. Der neue hinter dem Dorfe angelegte Gottesacker wurde am 5. Dezember 1835 eingeweiht. Am 31. Oktober 1842 gründete der damalige Pfarrer, Magister Reinhardt, hier einen Zweigverein der Gustav-Adolf-Stiftung, welchem sogleich 491 Mitglieder beitraten.
Der schon erwähnte Gasthof zum „Grauen Wolf“ ist öfters der Schauplatz wilder Schlägereien gewesen, wobei Menschenleben zu Grunde gingen. So wurde am 8. Juli 1577 Hieronymus Kollmann daselbst durch Wolf Büchnern erstochen, ein Schicksal, welches am 5. Juli 1687 auch einen Fleischergesellen aus Leipzig betraf. Ein Schneidergesell, welcher 1669 des Schäfers Sohn aus Mutwillen erschossen hatte, stellte den Fall als kolorierten casum fortuitum dar und entging in Folge dessen der Lebensstrafe. Mittwochs nach Pfingsten 1555 ermordete hinter dem Dorfe auf der Straße Lorenz Groschner, ein Fleischer von hier, den Kärrner Hans Mankolt und entwich durch die Flucht. Des Fleischer Roberts Eheweib, die aus Verzweiflung wegen Abgangs der Nahrung sich in einem Tümpel ertränkt hatte, ließ man durch den Scharfrichterknecht auf dem Schindanger einscharren. Die Rudolphin, eines Perückenmachers aus Leipzig ungeratene Tochter, ist 1739 des Nachts unter freiem Himmel auf der Dorfstraße, weil sie trotz ihres flehentlichen Bittens niemand bei sich hat aufnehmen wollen vor Frost und Hunger jämmerlich gestorben. –
Als Kuriosum sei hinzugefügt, dass in der alten, an der Straße vorm Dorfe gelegenen Schmiede, welche 1679 niederbrannte und von Georg Prößdorf wiederaufgebaut wurde, im Jahre 1736 ein Kalb zur Welt kam, dass zwei Köpfe hatte. Alt und Jung, Gelehrte und Ungelehrte, strömten herbei, das Wundertier zu sehen. Die Scharfrichterknechte nahmen das Kalb als ihr Eigentum in Anspruch und nachdem die allgemeine Neugierde etwas befriedigt war und ihnen die Taschen gefüllt hatte, verkauften sie die Missgeburt an die medizinische Fakultät.
Großzschocher mit Windorf.
Eins der größten und wohlhabendsten Dörfer unserer Umgebung, Großzschocher, bildet mit dem angrenzenden Windorf ein Ganzes und war schon im 12. Jahrhundert ein so bedeutender Ort, dass es urkundlich villa Schochere genannt wird. Es ist slawischen Ursprungs, während Windorf von Deutschen gegründet wurde. Windorf gehörte bis zum Jahre 1361 der Familie von Karras, deren letzter Erbherr auf Windorf Hermann von Karras war. Das Rittergut daselbst dessen Gebäude und namentlich das altertümliche Schloss, erst 1683 durch Feuer zerstört wurden, erkaufte nach Herrmann von Karras Tode Otto Pflugk, dessen Bruder, Dam Pflugk, bereits 1349 Großzschocher von einem Ritter von Krolewitz an sich gebracht hatte. Die Krolewitze waren schon im 12. Jahrhundert auf Großzschocher erbgesessen. Seit der Vereinigung beider Rittersitze durch genannten Otto Pflugk haben Großzschocher und Windorf stets gleiche Besitzer, Gerichte, Kirche und Schule behalten. – Otto Pflugk starb 1394 und ihm folgte Nikel Pflugk, dessen Sohn außer Großzschocher und Windorf durch Vergleich mit seinem Vetter Nikol auf Knauthein 1462 auch Pötzschkau, Möckern und Gohlis erhielt. Hans Pflugk, sein Nachfolger, lebte bis 1490 und besaß durch Heirat und Erbfälle außer genannten Gütern auch Pomsen, Seifarthshain, Fuchshain, Albertsdorf, Lausen und Göhrenz. Als er 1520 starb, teilten das Erbe vier Söhne, von denen Hans Zschocher und Gohlis erhielt. Mit dieser Teilung sank der Glanz der Familie. Benno Pflugk musste seine Güter 1592 seinem Schwiegersohn, Carl von Dieskau, abtreten, der bis 1620 lebte. Ihm folgten Carl Simon von Dieskau bis 1654, und diesem Otto und Hieronymus von Dieskau. Ersterer starb 1682 unvermählt und Letzterer 1692. Er hinterließ acht Kinder, von welchen noch 1742 zwei greise Töchter in Zschocher auf einem kleinen Bauerngütchen ihr Leben fristeten. Die Rittergüter waren schon 1692 in Besitz des Kammerherrn von Ponikau auf Pomsen übergegangen. Derselbe starb 1720 und sein Sohn, der Stiftshauptmann Johann Christoph von Ponikau 1728. Letzterem statteten 1726 auf hiesigem Schloss der König August und Prinz Eugen von Savoyen einen Besuch ab. Mit dessen Sohne, dem Kammerjunker Johann Friedrich von Ponikau, ging in Großzschocher das dritte altberühmte Rittergeschlecht zu Grunde. Der Kammerjunker fiel am 14. Juni 1735 in seinem Garten in den hochangeschwollenen Fluss und ertrank. Seine Erben überließen Großzschocher bald darauf dem Kreisamtmann Blümner, von welchem es an dessen Sohn, den Leipziger Ratsherrn Oberhofgerichtsrat Dr. Heinrich Blümner, gelangte. Dieser starb 1839 kinderlos und hinterließ seine Besitzungen zwei Nichten, deren eine mit dem sächsischen Minister Paul von Falkenstein verheiratet ist. Ihr gehört Großzschocher mit Windorf und das noch weit wertvollere Rittergut Frohburg. – Des Oberhofgerichtsrat Blümners Andenken erhalten zwei bedeutende Legate, eins von 3.000 Talern den Armen und das andere von 2.000 Talern der Kirche vermacht.
Großzschocher ist in Verbindung mit Windorf eins der stärksten Güter Sachsens, denn beide zusammen enthalten ein Areal von 709 Ackern Feld, Holz und Wiesen. Früher gehörte auch die Mühle zum Gute, bis sie 1568 Gregor Seiler erwarb, von dessen Sohne sie Hans Schau, die Heusinger, Balthasar Breitschuh und die Kabische an sich brachten. Die Mühle wurde 1706 von Grund aus neu aufgebaut. Das leider in nicht eben ansprechendem Stile restaurierte Schloss ist die uralte von den Krolewitzen besessene und von einem der ersten Pflugke umgebaute Burg. Sie hatte noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts Wallgräben und eine Zugbrücke, war jedoch ziemlich verfallen. Der Kammerherr von Ponikau ließ das Schloss 1734 etwas in Stand setzen. Auch die Pächterwohnung, die Brauerei und die Wirtschaftsgebäude wurden damals teils restauriert, teils neu gebaut. Jetzt zeichnet sich das Rittergut durch neue stattliche Gebäude und großartige Bewirtschaftung aus. Von 1712 bis 1714 hatten das Gut zwei Bauern, Wehle und Leurig, in Pacht, nach ihnen der Müller Breitschuh und die Bauern Leurig und Nitsche bis 1718, dann Nitsche allein bis 1729, nach ihm Lehmann bis 1736 und Weiske bis 1745. Von 1705 bis 1712 war Pächter der Rittergüter Großzschocher mit Windorf Friedrich von Lottiz.
Ein gleich ehrwürdiger Bau wie das Schloss ist die uralte Kirche deren Turm und Chor mindestens aus dem dreizehnten Jahrhundert herrühren. An Altertümern ist in ihr mit Ausnahme einiger steinernen Epitaphien, leider nichts mehr vorhanden, dagegen die Sakristei ein sehenswertes Meisterwerk von Festigkeit, in welches schon mehrmals verwegene, mit den besten Werkzeugen versehene Diebe vergeblich einzubringen versuchten. Die vier Glocken, welche ein schönes Geläute bilden, wurden 1685, 1600 und eine, mit den Namen der Evangelisten in Mönchsschrift, vor der Reformationszeit gegossen. Wegen Anwuchses der Gemeinde wurde die Kirche 1713 um neun Ellen verlängert und kostete der Bau 1.468 Taler 15 Gr. 5 Pf. Der silberne Abendmahlskelch mit der Umschrift: „Docto in defesso et intrepido fidei evangelicae defenscori“, ist ein Vermächtnis des verstorbenen Oberhofgerichtsrats Blümner, welchen dieser für seine auf dem Landtag des Jahres 1827 gezeigte tapfere Verteidigung der Rechte der evangelischen Kirche von dem Fürsten Schönburg-Waldenburg als Geschenk empfing. – Auch eine Schlosskapelle war einst vorhanden. Im Jahr 1406 erhielt „der gestrenge und erbare Erre Nikkel Pflugk, Ritter“, wie es in der Urkunde heißt, vom Kloster Sankt Thomas zu Leipzig, und mit Bewilligung des Zschocherschen Pfarrers Dobertobe Erlaubnis, im Bereiche der Burg eine Kapelle zu bauen und einen Kaplan zu halten, welcher zugleich verpflichtet war, dem Ritter alle notwendigen Schreibereien zu besorgen. Dafür gab der Ritter dem Kloster 15 Schock Meißner Groschen und Dobertobe wurde auf 7 Scheffel Getreide, von vier Bauergütern in Lausen zu erheben, als Entschädigung angewiesen. Kapelle und Kapläne sind längst spurlos verschwunden, doch erinnern an sie noch viele alte, von den Letzteren geschriebene Zinsregister und Gerichtsbücher. Johann von Eßlingen war 1444, und Heinrich Dietze 1536 – dieser wahrscheinlich der letzte – Burgpfaffe. – Da im Jahre 1591 durch Nachlässigkeit der Frau des Pastors Prosch beim Flachsrösten ein großes Feuer ausbrach, wobei die Kirchenbücher verbrannten, sind die Namen der ersten protestantischen Pfarrer verloren gegangen. Im Jahre 1560 begleitete das Pfarramt Michael Rotter, der bis jetzt 15 Nachfolger hatte. Die Pfarre ist eine der einträglichsten des Königreichs Sachsen, weniger durch die Stolgebühren, als vielmehr durch das starke Areal an Feld und Wiesen. Das Patronatsrecht über die Kirche stand dem Landesherrn zu, eine Beeinträchtigung des Gutsherrn, welche nachweislich zuerst im Jahre 1598 bei Berufung des Pastors Paul Böhme auf ausdrücklichen Befehl des Kurfürsten stattfand. Bei jeder Neuwahl eines Pfarrers, welche der Landesherr durch das Oberconsistorium in Dresden ausüben ließ, legten die Gutsherren dagegen Protest ein, doch stets ohne Erfolg. Vergeblich boten sie mehrmals für Erlangung des Patronatsrechts bedeutende Summen; nur dem Kammerherrn von Ponikau wurde es, jedoch wohl bloß auf Lebenszeit, abgetreten, denn nach seinem Tode fanden die Pfarrwahlen wieder durch das Oberconsistorium statt, welches bei Widerspruch sogleich des Landesherrn Jura Episcopalia in Anwendung brachte. Es scheint, als ob die Entziehung eines Rechts, welches jederzeit den Rittergutsbesitzern als wichtigstes Privilegium galt, von Carl von Dieskau, der Großzschocher von 1586 bis 1620 innehatte und mit des letzten hiesigen Herrn von Pflugks Tochter Sabine verheiratet war, verschuldet worden sei. Als nämlich im Jahre 1592 der Calvinismus große Unruhen im Lande erzeugte, kam auch Carl von Dieskau in Verdacht, demselben zu huldigen, wodurch er am kurfürstlichen Hofe sowohl als auch bei der Stiftsregierung in Merseburg großen Anstoß erregte, und sich vielen Anfeindungen ausgesetzt sah. – Dies mag die Ursache der Entziehung des Patronatsrechtes gewesen sein.
Die Bevölkerung in Großzschocher und Windorf betrug im Jahre 1744 in 99 Nachbarhäusern und 41 eingebauten Häusern 700 Seelen, 1834 dagegen waren deren 1.077 und 1864 am Jahresschlusse 1.797 vorhanden. Im Jahre 1744 hatte Großzschocher drei Gast- und Schenkhäuser und Windorf eine Schenke. Von Handwerkern fanden sich hier 2 Maurermeister, 1 Zimmermeister, 6 nur in Leipzig arbeitende Zimmergesellen, 3 Hufschmiede, 1 Leineweber, 1 Schlosser, 1 Sattler, 8 Schneider, 5 Schuster und 1 Strumpfwirker. – 14 hiesige Nachbarn mussten von gewissen Wiesen an das Rittergut 129 Hühner und Geldzinsen entrichten. Weil sie die Gräben um besagte Wiesen zu heben und zu erhalten hatten, hießen sie seit undenklichen Zeiten mit Genehmigung der Herrschaft, die Herren von Graben. Sie errichteten im Jahre 1639, gleich einer besonderen Geschlechtsordnung, unter einander besondere Societätsregeln, die 1687 mit Vorwissen des Gerichtsherrn Benno von Dieskau revidiert und erneut wurden. Der von 1733 bis 1767 hier amtierende Pastor Schwartze sagt von den Bewohnern Großzschochers und Windorfs, dass sie ihre Worte und Redensarten ordentlich setzten, wohl prononcierten und rechte Feinde von übelklingendem bäurischen Dialekte wären. So ist auch die bäurische Kleidertracht bei uns längst abgeschafft, und durchgehends ein ordentlicher, bürgerlicher Habit beim männlichen und weiblichen Geschlecht eingeführt, ja es macht ein Aufsehen und Verwundern, wenn man einen langröckigen Stift-Zeitzischen, oder plump- und pluderhosigen Altenburger, welche hart an uns liegen, zu Gesicht bekommt.
Unter merkwürdigen Ereignissen, Großzschocher mit Windorf betroffen, steht obenan eine unheimliche Totengräbergeschichte im Jahre 1582. Die hiesigen Totengräber hatten nämlich ein giftiges Pulver zugerichtet, das sie samt Weibern, Kindern, Schwiegersöhnen und Schwiegertöchtern den Leuten beibrachten und dadurch ein großes Sterben erzeugten. Da man ihnen oft die Pflege der Erkrankten übertrug, legten sie diese noch lebend in den Sarg und brachten sie schleunigst zu Grabe. Ein Handwerksbursche, der im Dorfe einwanderte, als man eben seine Braut begraben wollte, und diese trotz der Weigerung der Totengräber noch einmal zu sehen verlangte, riss mit Gewalt den Sarg auf und fand seine Liebste darin mit gebundenen Händen und einem Knebel im Mund noch lebend. Sie soll wieder gesund und bald darauf ihres Retters Weib geworden sein. Am 28. Oktober wurden die Totengräber mit Weibern, Kindern und all‘ ihrem Gesippe auf der Höhe bei der Sandgrube mit glühenden Zangen gerissen und lebendig verbrannt. Da auch in Leipzig und anderen Orten derartige Totengräberstückchen vorkamen, so wurde zur Vermeidung derselben verordnet, dass hinfüro das Begräbnis der Leichen von den Nachbarn verrichtet werden sollte. – Am 13. September 1635 schlugen im Gasthof, dessen Wirt, Tobias Pänisch, im dreißigjährigen Kriege als Trompeter bei den kursächsischen Reitern gestanden hatte und deshalb sein erkauftes Gasthaus „zum Trompeter“ schildete – bei einer wilden Schlägerei zwei Burschen den kurfürstlichen Reuter Martin Brodbeck, dass er auf der Stelle tot blieb. Einer der Täter, Caspar Jestewitz, entfloh und ist nie wiedergesehen worden, der andere, Gregor Fischer, wurde in Markkleeberg verhaftet, stellte Kaution und starb gleich darauf eines plötzlichen Todes. – Georg Junghans, ein Schneider, wurde 1730 in Folge verschiedener Diebstähle nach ausgestandener Tortur bei der Sandgrube an einen neuen Galgen aufgehängt. – Christoph Kögel, ein Fischer und Musikus, hatte am 1. Osterfeiertag 1735 beim Trunke eine Lästerung wider den Heiland ausgestoßen, weshalb er zwar aus Rücksicht auf seinen bisherigen christlichen Lebenswandel mit der Todesstrafe verschont, jedoch mit Staupenschlägen auf ewig des Landes verwiesen werden sollte. Ein Gnadengesuch seiner Angehörigen milderte das Urteil auf lebenslängliche Zuchthausstrafe mit vorhergehender Reichung des sogenannten Willkommens, das heißt einer unmenschlichen Abprügelung. Er kam später wieder auf freien Fuß. – Georg Schwärze erstach 1678 den Knecht Martin Adelmann beim Trunke mit dem Brotmesser und salvierte sich durch die Flucht. In der Schenke zu Windorf wurde am Sonntag Lätare 1718 ein Musketier durch einen Reuter mit dem Degen durchstochen und als dieser flüchtete, verfolgte ihn der Verwundete, bis er tot zusammenstürzte. Am 31. Dezember 1640 riss ein Schwein ein kleines Kind aus der Wiege und fraß es auf. Im nahen Holze fand man am 15. Juni 1599 einen ermordeten jungen Menschen nackt mit vielen Hieben und Stichen in Kopf und Leib, dem die rechte Hand abgehauen war. Im Jahre 1807 wurde der Brotbäcker Kaiser in Großzschocher wegen Ermordung einer Frau in Leipzig die seine Kundin war, bei der Sandgrube enthauptet. Daniel Eigenwillig, welcher aus Halle nach Großzschocher gezogen war, legte hier fünfmal Feuer an und hatte geschworen, nicht eher zu ruhen, bis der ganze Ort in Asche läge. Er wurde verhaftet und zum Feuertode verurteilt, verhungerte sich jedoch im Gefängnisse und starb am 31. Januar 1831, wenige Tage vor seiner auf Enthauptung gemilderten Hinrichtung. – Im dreißigjährigen Kriege haben die Generäle Tilly, Holk, Banner und Torstensohn hier unmenschlich gehaust und 1706 ließen die Soldaten Karl's XII. den Leuten kaum das nackte Leben. Der Siebenjährige Krieg traf Großzschocher und Windorf ebenfalls hart. Im Napoleonischen Kriege wechselten hier gefräßige, rohe Russen mit brutalen übermütigen Franzosen ab und in den Oktobertagen des Jahres 1813 wurde das Dorf drei Tage lang abwechselnd genommen und verloren, doch litt es nicht durch Feuer. Nervenfieber, Viehseuche und starke Steuern bildeten die Nachwehen. – Bekannt ist, dass der im Gefecht bei Kitzen verwundete Theodor Körner in Großzschocher ein Versteck bei der noch jetzt lebenden Witwe Häußer fand und von hier heimlich nach Leipzig geflüchtet wurde. Große Feuersbrünste fanden in den Jahren 1571, 1591, 1675, 1683 und 1725 statt. – Leider könnte das Verzeichnis schwerer Übeltaten, Unglücksfälle und Heimsuchungen noch weiter ausgedehnt werden. – Das Recht, Brot nach Leipzig zu verkaufen, besitzen die hiesigen Bäcker seit 1621. – Bemerkenswert ist noch, dass die Frau des hiesigen Schulmeisters Holbe, welcher 1731 sein Amt antrat, nicht nur als Schreibkünstlerin, sondern auch als Dichterin einen weit verbreiteten Ruf genoss.
Die Lauer mit Knautkleeberg.
Am Wege von Gautzsch nach Knauthain, in der reizenden Aue, wo die üppigsten Wiesen und Felder mit den schönsten Waldungen abwechseln und die wohltätigen Mühen eines weiteren Ausflugs sich so reichlich lohnen, erheben sich die stattlichen Gebäude des Schlosses Lauer. Früher herrschte der Glaube, dasselbe sei ein der heiligen Laura gewidmetes Kloster gewesen und ich habe diese dem Volksmunde entsprungene Sage sogar als historische Tatsache in einem mehr teuren als wertvollen sächsischen lokalgeschichtlichen Bilderwerke wiedergefunden. Dies war jedoch nie der Fall. Der Name Lauer rührt von der, vor alten Zeiten tief in Wald und Sumpf versteckten Lage des Schlosses her und Lauer ist stets ein Edelhof gewesen, zu welchem das Dorf Knautkleeberg gehörte. Der Name dieses Dorfes verrät seine ältesten Besitzer, das Geschlecht der Knaute, welches im 13. und 14. Jahrhunderte gleich den Viztumen, Pflugken und Schönbergs für eine der mächtigsten Adelsfamilien gehalten wurde, und auch Knauthain und Knautnaundorf besaß.
Wahrscheinlich gleichzeitig mit Knauthain, also im 15. Jahrhundert, kam die Lauer an die Familie von Pflugk. Nickel Pflugk, der Eiserne genannt, ein Sohn Hans Pflugks auf Großzschocher, war der erste Besitzer. Sein Nachfolger Andreas Pflugk starb 1543. Er hinterließ zwei Söhne, von welchen der ältere, Damian, in kaiserliche Dienste trat und sich in Böhmen ankaufte. Valentin aber Knauthain und Lauer an einen seiner Schwiegersöhne, Wolf von Schönberg, vererbte. Von diesem kamen beide Güter an Otto von Dieskau, der 1626 mit Tode abging und Lauer seinem jüngeren Sohne Hans hinterließ. Dieser starb 1642 kinderlos und sein Erbe, Heinrich von Dieskau, trat Lauer seinem Sohne Otto Friedrich ab. Derselbe war ein außerordentlich frommer Herr, welcher jeden Montag den benachbarten Pastoren in Lauer offene Tafel gab, und sich mit ihnen auf alle Art und Weise zu erbauen suchte. Seinen eigenen Pfarrer und Beichtvater, den Magister Heinze in Gautzsch, überhäufte er mit Geschenken. Er versorgte dessen Küche und Keller mit allen Bedürfnissen, kleidete die Familie und schenkte dem geistlichen Herrn sogar seinen eigenen Bräutigamswagen. Der Tod dieses frommen Gutsherrn erfolgte am 14. Februar 1717. Sein Schwiegersohn, der Geheimrat von Ponickau, welcher Lauer erbte, starb 1721 und seine Witwe überließ 1727 das Gut ihrem Sohne, dem Major Otto Friedrich von Ponickau und ihrem Schwiegersohn, dem Kammerherrn Eckhardt von Wobbeser, jedem zur Hälfte. Nach zwei Jahren schon verkauften beide die Lauer nebst Zubehör der Gemahlin des Reichsgrafen Ernst Christoph von Manteuffel, von welchem das Gut in Besitz des Dr. Glafey und bald darauf an die in raschem Aufblühen begriffene Familie von Hohenthal gelangte. Wie zur Zeit der Pflugke und der ersten Dieskaus sind seit dieser Zeit Knauthain und Lauer stets vereinigt geblieben.
Vor nicht langer Zeit hat das alte Schloss Lauer einem stattlichen Neubau weichen müssen. Umgeben von sumpfigen Gräben lugte die altersgraue Burg mit ihren bis zur Hälfte abgetragenen beiden Türmen ganz ihrem Namen entsprechend zwischen verwildertem Gebüsch hervor und über dem düsteren Tore, nach welchem vor Zeiten eine Zugbrücke geführt, erblickte man das Pflugk‘sche Wappen mit der Jahreszahl 1552. Letztere so wie die Jahreszahl 1648 über der Haustür, bezog sich jedoch wohl nur auf eine Renovation, denn der Bau verriet ein weit höheres Altertum. Man zeigte hier früher allerhand Antiquitäten, doch weiß ich nicht, ob sie mit in den Neubau übersiedelt worden sind. Die Bewohnerschaft des Schlosses besteht aus dem Wirtschaftspersonal und den Familien des herrschaftlichen Revierförsters und des Zieglers. Am Schlusse des Jahres 1864 waren dies 31 Personen. Die zum Gute gehörige Ziegelei liegt nahe bei Gautzsch. Vor anderthalbhundert Jahren war das hier gebraute Bier sehr gesucht und auf dem Dorfe Knautkleeberg lastete der hiesige Bierzwang. Damals wurden zur Bestellung des Feldes 4 Pflüge und 8 Ackerpferde gehalten. – Ein altes Übel, welches auf der Lauer lastet, sind die Überschwemmungen, welche nicht nur Felder und Wiesen bedrohen, sondern auch oft den Edelhof gefährdet haben. So wurde im März 1744 nach einem rasch eingetretenen Tauwetter, welches die ganze Aue unter Wasser setzte, die Brücke des Schlosses fortgerissen und musste die Verbindung mit der Außenwelt nicht ohne große Gefahr durch Kähne unterhalten werden. – Lauer ist nach Gautzsch und Knautkleeberg nach Knauthain eingepfarrt.
Das Dorf Knautkleeberg, welches 1743 aus einer Mühle, einer Schenke und 48 Häusern mit 276 Einwohnern bestand, zählte 1834 in 55 Häusern 319, dagegen 1842 nur 301 Bewohner. Am Schlusse des Jahres 1864 war die Bevölkerung auf 341 Köpfe angewachsen. Merkwürdig ist, dass in Knautkleeberg, als einem nicht stark bevölkerten Dorfe unverhältnismäßig viele Verbrechen und Unglücksfälle vorgekommen sind. So wurde 1599 Prisca Fischer, die Witwe eines Anspänners, welche ein Liebesverhältnis mit ihrem Stiefsohn unterhalten und das aus diesem Verhältnis hervorgegangene Kind nicht nur hilflos liegen lassen, sondern auch in einen Riss der Scheunenwand versteckt, all wo es tot gefunden worden, nach an ihr vollzogener Tortur zum Wassertode verdammt. Die Leipziger Schöppen erkannten, dass sie wegen des begangenen Kindesmordes samt einem Hund, Hahne, einer Katze und einer Schlange statt eines Affen in einen Sack gesteckt und ersäuft oder wenn die Gelegenheit des Wassers nicht vorhanden, mit dem Rade vom Leben zum Tode gestraft werden sollte. Auf eingelegte Vorbitte wurde das Urteil auf Enthauptung gemildert und die Exekution am 15. November vollzogen. Die Inquisitionskosten betrugen 34 Gulden, 11 Gr., 6 Pf., welche meistens dem Vermögen der armen Sünderin entnommen wurden. Den Rest mussten die Gemeinden des Gerichtssprengels erfüllen. – Am 3. Februar 1679 kam Adam Espenhain betrunken aus der Schenke nach Hause und prügelte seinen bei ihm wohnenden Bruder, einen Mann von 89 Jahren so unmenschlich, dass er bald darauf starb. Der Täter floh, wurde jedoch wiedererlangt und zu ewiger Landesverweisung und Erstattung der Kosten verurteilt. Schließlich ließ sich der Gerichtsherr gefallen, dass die Strafe in eine Geldbuße von 60 Gulden umgewandelt wurde, doch musste Espenhain zur Vermeidung des Ärgernisses die Gerichte, unter welchen die Tat geschehen, vermeiden. Nachdem der Schlosser Niclas Marlow in der Stube des Verwalters zu Lauer bei einem Diebstahl betroffen und verhaftet worden war, wurde er zum Strange verurteilt, diese Strafe jedoch in Landesverweisung mit Staupenschlag umgewandelt. Weil aber das Gericht befürchtete, Marlow könnte sich einer Diebesbande anschließen und dieser als Schlosser gefährliche Dienste leisten, berichtete man den Handel nach Dresden, von wo der Befehl zurückkam den Verbrecher dorthin zu schicken, wo er auf dem Festungsbau eingeschmiedet werden sollte. Voller Verzweiflung wurde Marlow am 22. Febr. 1738 dorthin abgeführt. Ein Bürger aus Bürgel, Heinrich Rönnert bat 1681 eine Witwe um Nachtquartier, und wurde am nächsten Morgen tot auf dem Stroh liegend gefunden. Wie sich herausstellte, war er ein Landesverwiesener, der seine Frau hatte mit Gift vergeben wollen. Am 4. März 1691 ertrank Margarethe Meister, als sie von Kleeberg nach Lauer überfahren wollte, und der Kahn umschlug, und hatte ein gleiches Schicksal am 2. März 1699 Peter Regel, der samt seinem Pferd ertrank. Von vielen anderen Unglücksfällen sei nur noch der Feuersbrunst am 10. Mai 1713 gedacht, wobei zwölf Güter niederbrannten, und zwei junge Mädchen, Christine Feustel und ihre aus Knauthain zum Besuche anwesende Freundin Catharine Triller in den Flammen umkamen.





























