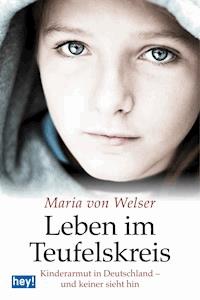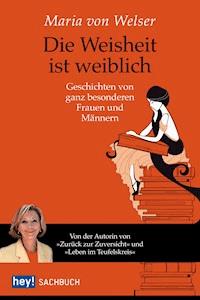17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Eine junge Reporterin, die 70er Jahre und die Wahrheit zwischen den Zeilen München, 1968: Die 21-jährige Alice ergattert ein Volontariat bei einem Münchner Lokalblatt. In der Redaktion lernt Alice das journalistische Schreiben von der Pike auf. Aber in einer Zeit, in der Sexismus Alltag ist, hat Alice es nicht leicht. Die Lage spitzt sich zu, als die junge Redakteurin und alleinerziehende Mutter an einen cholerischen Chef gerät, der seine Untergebenen drangsaliert. Doch je rauer das Arbeitsklima wird, umso mehr vertieft sich der Zusammenhalt unter den wenigen Frauen im Ressort. Alice arbeitet sich weiter nach oben – bis sie es mit der Reportage über die Frau eines Politikers zu tun bekommt, die sich kurz darauf das Leben nimmt. Ihr tragisches Schicksal lässt Alice keine Ruhe. Sie will einer Frau, die ein Leben lang zum Verstummen gebracht wurde, endlich eine Stimme geben, um jeden Preis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Unbestechliche
Die Autoren
Maria von Welser wurde 1988 als Gründerin, Redakteurin und Moderatorin des ersten Frauenjournals im deutschen Fernsehen „ML Mona Lisa“ bekannt. Für ihre Kriegsberichterstattung war sie unter anderem in Tschetschenien, Kroatien, im Gaza-Streifen und in Indien. Im Jahr 1996 erhielt sie für ihre ungeschminkte Berichterstattung über Frauen weltweit das Bundesverdienstkreuz. Von Welser ist seit 1993 Mitglied des Deutschen Komitees für UNICEF und war von 2013 bis 2017 Vizepräsidentin des DAB.
Waltraud Horbas lebt in Grafing bei München. Sie studierte Deutsche Literatur, Komparatistik und Spanisch und arbeitet als Redakteurin, Übersetzerin und Autorin. 2019 absolvierte sie den Masterstudiengang Literarische Übersetzung aus dem Englischen.
Das Buch
Eine junge Reporterin, die 70er Jahre und die Wahrheit zwischen den Zeilen
München, 1968: Die 21-jährige Alice ergattert ein Volontariat bei einem Münchner Lokalblatt. In der Redaktion lernt Alice das journalistische Schreiben von der Pike auf. Aber in einer Zeit, in der Sexismus Alltag ist, hat Alice es nicht leicht. Die Lage spitzt sich zu, als die junge Redakteurin und alleinerziehende Mutter an einen cholerischen Chef gerät, der seine Untergebenen drangsaliert. Doch je rauer das Arbeitsklima wird, umso mehr vertieft sich der Zusammenhalt unter den wenigen Frauen im Ressort. Alice arbeitet sich weiter nach oben – bis sie es mit der Reportage über die Frau eines Politikers zu tun bekommt, die sich kurz darauf das Leben nimmt. Ihr tragisches Schicksal lässt Alice keine Ruhe. Sie will einer Frau, die ein Leben lang zum Verstummen gebracht wurde, endlich eine Stimme geben, um jeden Preis.
Maria von Welser und Waltraud Horbas
Die Unbestechliche
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2023 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagmotive: © Leonardo Baldini / Arcangel
Autorinnenfotos: © Max Arens (von Welser); © Ulrich Schneider (Horbas)
E-Book-Konvertierung powered by pepyrus.
ISBN 978-3-8437-3061-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autoren / Das Buch
Titelseite
Impressum
Teil 1 | Miesbach 1968–1970 Studentenunruhen, Pandemien und Kalter Krieg
Schlagzeilen
Kapitel 1 Das Mädchen im Schnee
Kapitel 2 Zimt und Asche
Kapitel 3 Jagen und Sammeln
Kapitel 4 Osterunruhen
Kapitel 5 Eine Welt der Gegensätze
Kapitel 6 In einem Atemzug
Kapitel 7
Julia
oder Können Hackbraten Ehen retten?
Kapitel 8 Schritte auf dem Mond
Teil 2 | München 1971–1973 Ölkrise, Terror und gesellschaftlicher Wandel
Schlagzeilen
Kapitel 9 Die Spiegelwelt: Von Panthern, Schnabeltieren und Zwiebelfischen
Kapitel 10 Das Interview
Kapitel 11 Winterspiele in Sapporo
Kapitel 12 Die Herzkönigin
Kapitel 13 Außer Kontrolle
Kapitel 14 Im Taubenschlag
Kapitel 15 Schachfieber
Kapitel 16 Der Elfte Tag
Kapitel 17 Brutus erwacht
Kapitel 18 Der König ist tot – es lebe der König!
Teil 3 | Von Murnau nach München 1974–1977 Arbeitskampf, Deutscher Herbst und Boatpeople
Schlagzeilen
Kapitel 19 Schattendasein
Kapitel 20 Der Verrat
Kapitel 21 Die Blicke der anderen
Kapitel 22 Das Interview
Kapitel 23 Die Recherche
Kapitel 24 Vertraute Fremde
Epilog
Anhang
Was ist Dichtung; und was ist Wahrheit?
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Teil 1 | Miesbach 1968–1970 Studentenunruhen, Pandemien und Kalter Krieg
Teil 1 | Miesbach 1968–1970 Studentenunruhen, Pandemien und Kalter Krieg
Droht ein Bürgerkrieg? Berlin im Ausnahmezustand.
Straßenschlachten prägen das österliche Straßenbild: Nach dem Attentat auf Studentenführer Rudi Dutschke sehen die Demonstranten die Boulevardpresse in der Verantwortung. Wochenlange Stimmungsmache und Schlagzeilen wie »Man darf nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei und ihren Wasserwerfern überlassen« sorgen für erhitzte Gemüter. Mit dem Ruf »Springer, Mörder« marschieren Tausende am 11. April 68 in Richtung Axel-Springer-Verlag.
Ost-West-Verhältnis
Freie Fahrt nach Berlin. Endlich kommt das Berliner Viermächteabkommen der Alliierten zur Unterzeichnung. Eine der wichtigsten Errungenschaften für Deutschland besteht in der dauerhaften Sicherung Westberlins. Die UdSSR verpflichtet sich, wichtige Transitwege offen zu halten – eine Erleichterung für Berlin-Reisende und den Güterverkehr.
Ausläufer der Kaltfront erreichen den Sport.
Zum ersten Mal treten bei den Olympischen Winterspielen in Grenoble zwei deutsche Mannschaften an – wenn auch unter neutraler Fahne. Einzig die zwei »Kellers« holen Gold für die BRD: Franz Keller in der Nordischen Kombination und Erhard Keller im Eisschnelllauf.
Mit der Atemschutzmaske ins Büro?
München im Dezember 1969: Es begann relativ harmlos, mit einer Erkältung nach dem Skiwochenende. Kurz darauf liegt Fritz B. mit hohem Fieber im Bett. Mittlerweile hat ein aus Asien stammendes Virus – die »Hongkong-Grippe« – auch Bayern erreicht. Als erste Maßnahme zur Entlastung der Münchner Krankenhäuser werden die Weihnachtsferien in diesem Jahr um eine Woche verlängert. Die Behörden sind dennoch zuversichtlich, dass die Infektionswelle bis zum Frühjahr abflachen wird. Bis dahin allerdings werden Antibiotika knapp, Menschen sitzen mit Masken in Großraumbüros, und die Verunsicherung in der Bevölkerung ist spürbar – zu Recht, denn die Lage bleibt angespannt.
Was gibt’s Neues?
Zwei Organisationen mit ambitionierten Zielen werden gegründet – Greenpeace und Ärzte ohne Grenzen.
Ende des Vietnamkriegs rückt näher.
Die USA kommen nicht zur Ruhe. Die Lage in Vietnam treibt viele Amerikaner zu zunehmend gewalttätigen Demonstrationen auf die Straße. Der hohe Blutzoll auf amerikanischer Seite, aber auch aufseiten der Zivilbevölkerung Vietnams wirkt auf immer größere Teile der Öffentlichkeit verstörend.
US-Präsident Nixon beschließt, 100 000 Soldaten aus dem Kriegsgebiet abzuziehen – zeichnet sich Hoffnung auf Frieden ab?
Kurioses.
Mit einem Papyrusboot hat der Norweger Thor Heyerdahl den Atlantik überquert. Die abenteuerliche Reise führte von Marokko über Amerika in die Karibik. Der leidenschaftliche Hobby-Anthropologe ist überzeugt, dass schon vor Kolumbus kultureller Austausch und Handel zwischen Ägypten und dem amerikanischen Kontinent stattfanden – wie realistisch diese These ist, versuchte er mit seiner gewagten Schiffskonstruktion unter Lebensgefahr zu beweisen.
Kapitel 1 Das Mädchen im Schnee
Februar 1968
»Ah-bâ!«, sagte Elena und blickte gebannt in die Schlucht, die sich unter ihren Füßen auftat. Sie schwebten in etwa hundert Metern Höhe in trügerischer Schwerelosigkeit in der Luft.
»Ja«, erwiderte Alice, »geht mir genauso; ich kann’s kaum erwarten.« In einträchtigem Schweigen beobachteten die beiden für einen Moment die glitzernde, weiße, scheinbar grenzenlose Weite, die sie von allen Seiten umgab. Es war ein prachtvoller Morgen Ende Februar.
»Bah, më?«
Alice sah auf die Uhr. »Nein, nein, wir sind gut in der Zeit«, widersprach sie und kontrollierte dann die Außenbedingungen. Luftdruck: rapide abnehmend, dem Druck in ihren Ohren nach zu schließen. Windrichtung Südost, Windstärke etwa drei, wenn sie das leise Schaukeln der Gondel richtig deutete. Niederschlag null Komma null.
Elena schmiegte sich enger an sie. Sie wirkte glücklich, und Alice fragte sich, ob sie imstande war, sich an die letzte, zwei Wochen zurückliegende Gondelfahrt zu erinnern. Konnte sie voraussehen, was gleich kommen würde? Hatte sie bereits so etwas wie ein Erinnerungsvermögen? Ja, da war sich Alice sicher, allen Expertenmeinungen zum Trotz.
Als Elena auf die Welt gekommen war, war Alice zunächst verstört gewesen über ihre eigene Reaktion auf das Baby. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass dieses Wesen, dessen Bewegungen ihr über Monate so vertraut geworden waren, ein völlig fremdes Gesicht haben könnte. Als man ihr das frisch gewaschene und gewickelte Kind in die Arme gedrückt hatte und sie sich zum ersten Mal staunend in die Augen sahen, war sie verblüfft gewesen über den uralten Ausdruck in den Augen der Neugeborenen. Als hätte Elena eine äonenlange Reise aus einem anderen Sternensystem zurückgelegt, um zu ihr zu kommen. Ohne zu blinzeln, hatten sie sich angeblickt, und Alice war überwältigt von einem Gefühl unendlicher Weisheit, Ferne und Fremdheit. Dann, über Wochen, hatte sie sich mit ihrem Kind vertraut gemacht. Gerne hätte sie jemanden gefragt, ob ihre Reaktion normal war. Ob diese ganzen Berichte über frischgebackene Mütter und ihre sofortige, bedingungslose Bindung an ihr Kind bedeuteten, dass die anderen logen. Oder ob mit ihr etwas nicht stimmte, wenn die Annäherung an dieses rätselhafte Wesen mit seinem spärlichen Haarwuchs und den riesigen Augen so langsam, umsichtig und durchaus auch ein wenig kritisch erfolgte.
Es wäre schön gewesen, einen Menschen zu haben, dem man eine derartige Frage hätte laut stellen können. Aber das ging nicht, so viel war Alice klar. Daher regelte sie es so, wie sie es schon ihr ganzes Leben lang getan hatte; sie machte diese tiefer gehenden Gedanken und Sorgen mit sich allein aus. Beziehungsweise allein mit Elena. Und nach einem Monat intensiven Kennenlernens ohne Fremdeinmischung hatte sich die vorsichtige Annäherung tatsächlich zu einer innigen Freundschaft ausgewachsen.
»Es wird Zeit«, sagte Alice aufgeräumt und griff nach der Strickmütze, die sie ihrer neun Monate alten Tochter für die Dauer der Gondelfahrt abgenommen hatte. Sanft strich sie über den zarten Flaum, dann setzte sie ihr die leuchtend rote Strickmütze mit Bommel auf und band eine Doppelschleife unter dem Kinn. Als Nächstes kamen die festen, wasserabweisenden Fäustlinge und schließlich ein Baumwolltuch, das sie dem Kind bis fast über die Nase hochzog.
»A-båh«, kam es gedämpft aus dem Schal.
»Ich weiß, dass das für den Moment noch zu warm ist. Aber wart nur ab, bis wir starten. Dann bist du froh über den ganzen Kram!«
Sie setzte Elena in die Kraxe, machte einen letzten Sicherheitscheck und schulterte das Kind. Die Bergstation kam in Sicht; der spannende Moment rückte näher. Sie waren erst zweimal hier oben gewesen, und Alice hatte noch keine Routine darin, mit Kraxe auf dem Rücken und Skiern und Stöcken in den Händen passgenau aus der Gondel zu springen.
»Nicht schon wieder!«, seufzte Sepp Beslmüller, als er sah, wer sich da in der Gondel näherte. Es schlug gerade mal acht Uhr an einem Montag, und eigentlich war um diese Uhrzeit so gut wie niemand unterwegs. Es war reines Glück, dass er die Passagiere überhaupt bemerkt hatte. Er griff nach den Schaltern und brachte die gesamte Seilbahn für ein paar Sekunden länger zum Halten, bis die junge Mutter, die eigentlich selbst noch so aussah, als hätte sie hin und wieder ein saftiges Donnerwetter nötig, es aus der Gondel geschafft hatte. Dann verließ er das Wärterhäuschen und ging zu Mutter und Kind hinüber. Alice sah ihm entgegen. Blonder Pferdeschwanz, Sommersprossen um die Nase und Augen, die vor Vorfreude und Übermut nur so strahlten. Ihm schien, es musste gestern gewesen sein, dass er sie zusammengestaucht hatte, weil sie als Elfjährige mit dem Ski am Gondelausstieg hängen geblieben war und den ganzen Betrieb zum Stillstand gebracht hatte.
»Muss das denn sein?«, fragte er, nahm Alice aber die Kraxe ab und hielt sie, während sich die junge Frau die Skier anschnallte.
»Jetzt fang nicht schon wieder an! Vor zwei Wochen sind wir auch gut runtergekommen, oder etwa nicht? Wie lange kennst du mich jetzt? Ich komm hier hoch, seit ich fünf bin. Warum machst du dir jetzt auf einmal Sorgen?«
»Weil du ein Kind auf dem Buckel hast bei der Abfahrt, vielleicht?«, sagte er hitzig. Alice verdrehte leicht die Augen, während sie eine sichere Position quer zum Hang einnahm, um nicht loszurutschen, die Skibrille aufsetzte und dann die Hände in Richtung Kraxe ausstreckte. »Mich hat es noch nie ernsthaft hingeschmissen, und jetzt bin ich sowieso doppelt vorsichtig, wenn ich Elena dabeihabe.«
»Dein Wort in Gottes Ohr«, sagte Sepp Beslmüller, nahm die Kraxe auf und half ihr, die Arme durch die Riemen zu schlängeln.
»Wenn’s dich beruhigt, dann rufst du eben bei der Talstation an, dass sie nach mir Ausschau halten. In einer halben Stunde bin ich unten.«
»So weit kommt’s noch mit den Extrawürschten!«, brummte er.
»Na, dann halt nicht. Bis zum nächsten Mal. Und trotzdem danke!«, sagte Alice, und ohne Atem zu holen, ohne auch nur für den Bruchteil einer Sekunde zu zögern, stieß sie sich ab und tauchte hinab ins Tal. Innerhalb von Sekunden zerstob sie zu einer Gischt aus Pulverschnee, wurde eins mit einer Wolke aus Abertausenden winzigster, funkelnder Kristallpartikel.
»Jiiiihhh«, krähte Elena.
»Der Herrgott steh uns bei«, murmelte der Sepp. Dann wandte er sich in Richtung Telefon, um unten im Tal anzurufen. Man musste sein Auge einfach auf alles haben; lieber einmal zu viel telefoniert als zu wenig hier oben in den Bergen.
Sepp Beslmüller hätte Alice vermutlich gar nicht wiedererkannt, als sie nur zwei Stunden später eilig die Redaktion des Lokalblatts betrat. Nachdem sie Elena bei Julia abgegeben hatte, einer jungen Italienerin, die sie wochentags betreute, hatte sie eine erstaunliche Verwandlung vollzogen: Die Haare waren hochgesteckt, sie war dezent geschminkt und trug einen dunkelgrauen Rock mittlerer Länge und eine blaue Bluse mit Perlmuttknöpfen, aber ohne weiteren Schnickschnack – eine Aufmachung, die sie für sich gerne ihre Guerilla-Tarnkleidung nannte, weil sie manchmal das Gefühl hatte, farblich mit dem Mobiliar der Redaktion zu verschmelzen.
Als sie nach einigen Irrungen und Wirrungen schließlich die Volontariatsstelle bei der Zeitung ergattert hatte, war ihr schnell klar geworden, dass sie sich auf einer Gratwanderung befand. Sie schritt durch einen Nebel aus Vorbehalten, ihr Geschlecht, Alter und Können betreffend. Und so bestanden ihre Kleidung und Aufmachung aus mehr als nur äußeren Schichten aus Stoff und Farbe. Es war der Versuch einer wortlosen Stellungnahme, um auf die ausgesprochenen und unausgesprochenen Vorbehalte zu antworten: Zu jung und damit unzuverlässig … Sie ist Reporterin? Im Ernst? … Und verheiratet soll sie auch noch sein!? Wer versorgt eigentlich ihr Kind, während sie sich herumtreibt?
Obwohl sie daher ihre Aufmachung schon am Abend zuvor bis ins Detail geplant hatte, um sie dann an einem Montagmorgen um halb zehn in Minutenschnelle umzusetzen, konnte sie nicht verhindern, dass trotz ihrer soliden Maskerade der letzte Nachhall eines Wirbelwinds aus Eiskristallen durch ihr Inneres tobte. Im Geiste war sie noch in die perfekten Schwünge einer Tiefschneeabfahrt versunken.
»Morgen!«, sagte sie, eine Spur zu gut gelaunt für Herrn Albrecht, der sie nur mit stummem Vorwurf im Gesicht ansah.
»Wo waren Sie denn?«, fragte er. »Es ist …« Er sah auf die Wanduhr. »… gleich zehn!«
Alice unterdrückte jedes äußere Anzeichen aufsteigenden Ärgers und sagte stattdessen freundlich: »Ich hab gestern die Sonntagsschicht gemacht und durfte deshalb heute später anfangen, das war doch abgesprochen. Erinnern Sie sich nicht mehr?«
»Ah. Na gut. Ausnahmsweise«, sagte ihr Chef, noch immer übellaunig.
Alice sah sich in den leeren Redaktionsräumen um. »Wo sind denn die anderen?«
»Der Zeißler hat sich krankgemeldet, und der Maier führt ein Interview.«
»Ah«, sagte Alice und fragte sich, ob ihr Chef vielleicht gar keine schlechte Laune, sondern einfach nur Sorge hatte, dass zu viel Arbeit an ihm hängen bleiben könnte. Er war ein leicht übergewichtiger Mann in den frühen Sechzigern, dessen sanft hervorquellende Augen mit ihrem vorwurfsvollen Blick an eine französische Bulldogge erinnerten. Wichtige Außeneinsätze übernahm er gerne selbst, aber nicht bei Regen oder Schneetreiben, das wusste jeder in der Redaktion.
Sie dachte gerade über eine passende Bemerkung nach, die seine Laune vielleicht bessern könnte, als das Telefon klingelte. Der Albrecht ging ran. »Ja?« Er lauschte. Alice konnte sein Gesicht nicht sehen, weil er mit dem Rücken zu ihr stand, doch sie bemerkte, wie seine Körperhaltung starrer und der Griff um den Telefonhörer fester wurde.
»Wo?«, fragte er nur und nahm einen Stift zur Hand. Schrieb wortlos die Adresse auf.
»Danke«, sagte er dann und legte auf.
Ihr Chef wandte sich zu ihr um, schien aber glatt durch sie hindurchzustarren. Und obwohl sich Alice mittlerweile an eine gewisse Unsichtbarkeit in der Redaktion gewöhnt hatte, war sein Gesichtsausdruck doch ein wenig unheimlich. Der Moment dauerte nicht länger als eine, vielleicht zwei Sekunden, dann sagte er: »Wir haben eine Leiche.«
»Ähm … Was?«, fragte Alice.
»Eine Leiche. Ein Mordfall, scheint’s. Rede ich so undeutlich?«
»Nein. Jetzt nicht mehr«, sagte Alice, nahm sich aber rasch zusammen. Es war nicht der richtige Moment für Querelen, sie war noch in der Probezeit. Und anscheinend erwartete ihr Chef gerade von ihr, dass sie seine Gedanken lesen oder doch zumindest auf wundersame Weise erraten konnte.
»Soll ich hinfahren?«, fragte sie versuchsweise, mit wenig Hoffnung. Das würde er sicher nicht der unerfahrenen Volontärin überlassen. »Oder wollen Sie lieber selbst …?«
»Nein, fahren Sie ruhig. Ich hab hier noch genug zu erledigen, und Sie brauchen eh die Erfahrung. Wird Ihnen guttun. Geben Sie Gas, die Leiche ist gerade erst gefunden worden. Alles noch unangetastet. Das war der Oberwachtmeister Groetz; er ist mir was schuldig, deshalb hat er uns gleich Bescheid gegeben.« Damit drückte er ihr den Zettel mit dem genauen Fundort in die Hand. »Ein paar Fotos brauchen wir auch. Nehmen S’ die Kamera vom Zeißler mit, aber …« Er hielt inne, zögernd. Ganz offensichtlich wollte er etwas sagen und war auf der Suche nach den richtigen Worten. Doch die Zeit drängte. »Aber dezent, wenn ich bitten darf. Verstehen Sie? Keine Nahaufnahmen und dergleichen«, sagte er schließlich nur.
»Dezent. Verstehe.« Alice griff sich die Kamera, und schon war sie zur Tür hinaus. Jede Minute zählte, vor allem das hatte sie verstanden.
Als sie mit ihrem signalroten VW Käfer die Stelle erreichte, wo die Landstraße die Mangfallbrücke der A8 unterquerte, hatte sich der Himmel wieder zugezogen und hing tief und bleiern über der weißen Landschaft. Der Schnee hier war von anderer Beschaffenheit als hoch oben auf dem Berg. Es war zivilisierter Schnee: matschig, graubraun und viel zu nass. Vollgesogen von der Feuchtigkeit des Tals kroch er in die Stiefel, durchdrang die Strümpfe und arbeitete sich langsam, aber hartnäckig die Beine hinauf.
Mit einem schnellen Rundblick erfasste Alice ihre Umgebung. Die Mangfallbrücke, hoch über ihren Köpfen. Zwei Polizeiautos, ein Rettungswagen. Vier Beamte, die vereinzelte Gaffer auf Abstand hielten, drei weitere Polizisten dicht am Straßenrand, dort, wo die weiße Winterlandschaft langsam überging in Faulschnee, braun gefärbt vom Sprühregen der vorüberfahrenden Autos.
Alice griff nach ihren Handschuhen, legte sie aber nach kurzem Zögern wieder beiseite und nahm stattdessen Block und Bleistift vom Beifahrersitz. Klamme Finger gehörten im Winter bei Außeneinsätzen zwangsläufig dazu, wie sie mittlerweile hatte feststellen müssen; schnelles Schreiben und Handschuhe schlossen sich gegenseitig aus. Sie wickelte stattdessen ihren Schal fester um den Hals, hängte sich die Kamera um und stieg aus.
Biestig war der Wind hier, er wehte feuchtkalt von den nahe gelegenen Berggipfeln herab. Es war das Erste, was ihr auffiel: das Zerren des Windes, das Rauschen der Autobahn über ihren Köpfen, die unruhige Bewegung – ein brutaler Gegensatz zu der glitzernden Reglosigkeit der weißen Wildnis, die sie nur wenige Stunden zuvor auf Skiern durchquert hatte. Sie griff nach der Kamera und schoss ein Foto. Ein erster Überblick aus sicherer Distanz konnte nicht schaden.
Als sie näher kam, blickte Polizeioberwachtmeister Hans Groetz auf. Seine Miene verfinsterte sich beim Anblick der jungen Frau sichtlich. »Alice …«, sagte er. »Dich haben die losgeschickt?«
»Ja«, sagte sie, ein wenig verwundert über die barsche Begrüßung. »Was dagegen?«
Er zögerte, noch immer mit grimmigem Gesicht, und schien auf etwas Unsichtbarem, Übelschmeckendem herumzukauen. »Nein«, erwiderte er dann nur.
»Gut.« Sie packte ihren Stift und Notizblock fester. »Du hast angerufen. Hast du gleich Zeit für ein paar Fragen, oder passt’s gerade nicht? Soll ich warten?«
»Passt schon. Leg los, aber mach es kurz.«
Alice nickte und versuchte, über die Schulter des Polizeioberwachtmeisters zu spähen – was sinnlos war, denn er überragte sie deutlich. »Hans«, sagte sie dann, mit leichter Ungeduld in der Stimme. »Wenn du einen Schritt zur Seite machst und ich den Tatort selber sehen kann, sparen wir uns einiges an Zeit und Fragen. Meinst du nicht?«
»Ich glaube nicht, dass du dir das antun willst.« Der Groetz schien nicht gerade zugänglicher zu werden.
»Lass das mal meine Sorge sein. Ich kann so was ganz gut selbst entscheiden; und es ist mein Job«, erklärte sie, nun mit offener Ungeduld. Auch das hatte sie in den letzten paar Wochen gelernt: In bestimmten Augenblicken war es wichtig, der Stimme, wenn sie einem zu entgleiten drohte, ausreichend Festigkeit und Substanz zu geben, um ihr Gegenüber zu überzeugen. »Also, bringen wir’s hinter uns.«
Der Groetz zauderte noch immer, aber dann zuckte er schließlich mit den Achseln, machte einen Schritt beiseite und gab den Blick frei auf den toten Körper.
Einen Moment lang, der sich in Alice’ Wahrnehmung in die Unendlichkeit ausdehnte, war es sehr still. Selbst der Wind schien den Atem anzuhalten. Als sie wieder sprach, hatte sie ihre Stimme zwar im Griff, konnte aber das eigenartige Gefühl nicht loswerden, sie würde hinter einer Glasscheibe zu dem Polizisten sprechen.
»Wie alt ist sie, was meinst du?«
»Achtzehn, vielleicht zwanzig.«
»Und wie …?«
Der Groetz behielt sie im Blick. Ganz offensichtlich war er in Sorge, dass er es neben einer Mädchenleiche gleich noch mit einer etwa gleichaltrigen, ohnmächtigen Reporterin zu tun bekommen würde. Es wäre ein bisschen viel gewesen für einen Montagmorgen.
»Erstochen. Sieben Einstiche«, sagte er nur, und Alice nickte. Als sie ihre Stimme wieder unter Kontrolle zu haben glaubte, machte sie weiter. »Ich sehe kein Blut.«
»Sie wurde nicht hier umgebracht, sondern irgendwo anders. Man hat ihre Leiche die Brücke runtergeworfen. Als wär sie ein Sack Müll.«
Alice hatte sich Notizen gemacht. Beim Klang seiner Stimme sah sie wieder auf und blickte Groetz ins Gesicht. Plötzlich hätte sie ihn absurderweise gerne getröstet, wusste aber nicht wie.
»Das macht es ziemlich schwer, den Täter zu finden. So praktisch ohne Spuren. Richtig?«, sagte sie schließlich.
»Kann man wohl sagen.«
»Wer war sie, was meinst du? Habt ihr irgendeine Ahnung … wahrscheinlich nicht, weil …« Sie verhaspelte sich und fand plötzlich nicht mehr die richtigen Worte. Weil man an einem nackten Körper schlecht die Identität ermitteln kann? Sie wurde sich wieder ihrer klammen Finger und der wachsenden Kälte bewusst. Der Wind war stärker geworden, er wehte direkt von der Rotwand herunter ins Tal.
»Ich geh davon aus, es war eine Prostituierte«, sagte Groetz, ging aber nicht näher darauf ein, warum er das dachte. Und Alice brachte es nicht über sich nachzufragen.
Stattdessen sagte sie: »Danke. Gibt es noch was, das ich wissen sollte?«
Groetz schüttelte den Kopf. »Mehr haben wir leider auch nicht. Mach deine Bilder und pack noch eine Personenbeschreibung in deine Meldung, vielleicht liest es ja wer und erkennt sie auf den Polizeifotos. Ich schick dir nachher gleich noch eine Aufnahme vom Gesicht rüber, sobald ich sie habe.«
Alice nickte, steckte den Block weg und zückte die Kamera. Dann hielt sie inne, den Blick auf den Körper des toten Mädchens gerichtet, der ihr so verletzlich vorkam. Allein gelassen. Absurderweise konnte sie das Gefühl nicht abschütteln, dass der jungen Frau entsetzlich kalt sein musste. »Warum … deckt ihr sie nicht zu?«, fragte sie leise.
Der Polizist bewegte unbehaglich die Füße. Sie beide schienen das Gleiche zu fühlen und zu denken. »Ich würd ja gern. Zefix, das würd ich wirklich gern. Aber wir müssen noch die Spuren sichern.«
Alice nickte und legte ihm die Hand auf die Schulter. Lang genug, dass er es wahrnahm, aber nicht so lange, dass er es als offene Geste des Mitgefühls deuten würde. Mittlerweile hatte sie bereits die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Männer damit umgehen konnten, wenn man Mitgefühl mit ihnen hatte.
Sie bewegte die klammen Finger, durch die mittlerweile gar kein Blut mehr zu fließen schien, und packte dann die Kamera fester. Noch immer sah sie den reglosen Körper an, jetzt aber abschätzend, die Gefühle an den Rand des Bewusstseins gedrängt.
Mach ein paar Fotos. Aber dezent … Wie macht man ein dezentes Foto von einer nackten, toten jungen Frau? Überhaupt nicht, erkannte Alice plötzlich, und die Erkenntnis war wie eine Befreiung. Sie ging in die Knie, direkt vor dem Mädchen, und fotografierte die reglose Hand, Handfläche nach oben. Finger, die sich weiß vom Faulschnee am Straßenrand abhoben. Eine leicht geöffnete Hand, als wäre sie im Begriff gewesen, sich zu entfalten, und dann in Bewegungslosigkeit erstarrt.
Ihr Blick wanderte nach oben. Sie hob die Kamera und fotografierte, aus der Perspektive von ganz unten, den bleiernen Himmel und die Autobahnbrücke über ihnen, auf der sich der Verkehr unablässig bewegte, unbeeindruckt von dem Geschehen in der Tiefe.
Kapitel 2 Zimt und Asche
Eine Nachkriegs-Kindheit
Wer der erwachsenen Alice in den Siebzigerjahren eine Zigarette anbot, sah sich manchmal mit der lapidaren Antwort konfrontiert: »Danke, aber ich hab mit dem Rauchen aufgehört, als ich fünf war.« Und einmal abgesehen von der provokativen Absicht hinter dieser Aussage skizzierte sie nicht nur treffend das Spannungsfeld einer Nachkriegskindheit, sie war auch noch wahr. Als Kind bestand ihr Alltag aus einem Wechselbad zwischen bürgerlichen Zwängen und kompletter Verwilderung – oder, in eine Sprache der Sinne übersetzt, einer Mischung aus warmem Apfelstrudel und kalter Asche.
Neuhaus am Schliersee, Landkreis Miesbach in Oberbayern, Ende der Vierzigerjahre. Der Zweite Weltkrieg hatte seine Klauen in die Landschaft, in die Seelen und Körper der Menschen gegraben. Doch obwohl die Spuren der Gewalt allgegenwärtig schienen, hatten die Erwachsenen in ihrer Not beschlossen, die Bombenkrater und Kriegsruinen großräumig auszublenden. Wer nicht tot, verschollen oder in Gefangenschaft war, konzentrierte sich aufs Überleben.
Alice kam im Winter 1946/47 zur Welt, der im kollektiven Gedächtnis als »Hungerwinter« haften bleiben sollte. Ein eiskalter Hauch wehte durch das zerstörte Land, und die extremen Temperaturen brachten neben dem schwarzen Hunger auch noch den weißen Tod. In Europa starben nach Kriegsende noch einmal etwa zwei Millionen Menschen an Hunger oder Kälte. Wirtschaft und Industrie waren am Boden, die Handelswege zerstört, und die Lage schien so verzweifelt, dass Erzbischof Josef Frings in einer denkwürdigen Predigt zur Silvesternacht grünes Licht für den Mundraub gab. Kurz darauf war ein neues Wort geboren, wenn es um das Organisieren von Lebensmitteln und Kohle in Zeiten der Not ging. Man stahl nicht, man ging »fringsen«.
Vor allem in den Großstädten wurde gehungert. In den Dörfern, in unmittelbarer Nachbarschaft von Bauern und Jägern, lebte es sich leichter. Die Städter strömten mit ihrem Familiensilber und anderen Schätzen aufs Land, um sie bei den Bauern gegen einen Liter Milch oder ein paar Eier einzutauschen. Flüchtlinge aus dem Osten, evakuierte Kinder, Schutz suchende Städter – alle kamen und hatten Hunger … Gegen Kriegsende schien der Landkreis Miesbach aus allen Nähten zu platzen, Wohnraum und Nahrungsmittel wurden knapp.
Die Kinder blieben in diesen ersten Jahren meist sich selbst überlassen. Auch Alice und ihr größerer Bruder Simon durchstreiften im Sommer mit den Buben vom Nachbarhof barfüßig die Gegend, ohne von Erwachsenen behelligt zu werden. Meist waren sie auf der Suche nach Altmetall, das sie für ein paar Groschen beim Eisenhändler verkauften. Und diese wertvollen Münzen wurden noch am gleichen Tag am Kiosk in süße Währung umgesetzt, in Brause und leuchtend rote Kirschlollis.
In diesen ersten Jahren fiel es Alice daher gar nicht weiter auf, dass bestimmte Dinge in ihrer Familie anders liefen als bei den Nachbarn; sie alle waren es von klein auf gewohnt, alleine zurechtzukommen. Während aber zu Beginn der Fünfzigerjahre andere Familien den Überlebensmodus langsam umstellten auf eine pastellfarbene Inszenierung neuer Häuslichkeit, gab es im Hause Fälker noch immer niemanden, der ein Auge auf die Kinder gehabt hätte.
Eine kleine Änderung erfolgte in dem Augenblick, als sich die fünfjährige Alice einen rostigen Nagel tief in die nackte Fußsohle trat. Nur durch das beherzte Eingreifen der Nachbarin – einer handfesten Bäuerin, die den Nagel unter viel Geschrei herauszog, ihren Fuß mit einer Paste aus Sauerrahm und Roggenmehl bestrich und ihn dann fest mit altem Leinen umwickelte – wurde das Schlimmste verhindert. Die Bauern waren schon immer mehr hinterher gewesen bei derartigen Verletzungen; im Gegensatz zu den lebensfernen Städtern hatten sie zu Recht einen Heidenrespekt vor Blutvergiftungen und Wundstarrkrampf, denn das Barfußlaufen und -arbeiten war für sie seit Generationen gelebter Alltag.
Daraufhin nahm die Bäuerin die Eltern ins Gebet.
Es kann doch wohl ned sein, schimpfte sie, dass die Tochter des einzigen Arztes weit und breit an einer Blutvergiftung stirbt, nur weil der Herr Vater zu beschäftigt ist und die Mutter immer erst im Dunkeln nach Haus geschlichen kommt.
Sie hatte nicht unrecht mit ihren Vorhaltungen; Doktor Fälker hatte als einer der wenigen Mediziner im Landkreis Miesbach alle Hände voll zu tun. Trotzdem bekamen die Kinder den Vater noch öfter zu Gesicht als die Mutter, die im Begriff war, sich als Herausgeberin eines Münchner Modejournals einen Namen zu machen. Die Großstadt lag über eine Stunde Zugfahrt entfernt, und entsprechend spät kam sie wochentags nach Hause. Meist schliefen die Kinder schon, wenn die Tür leise geöffnet wurde und kaum hörbar wieder ins Schloss fiel. Anfangs, als Alice alles als gegeben hingenommen hatte, was um sie herum geschah, hatte es sie nicht verletzt, nicht bewusst wenigstens, dass sie praktisch unsichtbar war für ihre Mutter. Mit fünf Jahren ist die Welt eben, wie sie ist. Später allerdings verspürte sie einen wachsenden Groll auf die Mutter, der ihre Karriere wichtiger schien als die eigenen Kinder – bis sie, noch einige Jahre später, mit einer traurigen Wahrheit konfrontiert wurde. Manchmal deutet man das Verhalten selbst der vertrautesten Mitmenschen falsch. Ihre Mutter hatte viele Jahre einen verbissenen Kampf um ihre finanzielle Unabhängigkeit und ihren Stolz geführt, ohne dass Alice oder Simon etwas davon geahnt hätten.
Als Folge des Nagel-Vorfalls bei der Jüngsten und um ein endgültiges Verwildern der Kinder zu verhindern, wurde neben der Putzkraft eine richtige Haushälterin angeschafft. Sie sollte kochen, den Haushalt regeln und nebenher ein Auge auf die Kinder haben: akute Verletzungen versorgen, allzu schlimme Fehltritte verhindern und was eben noch so anfiel.
Diese Haushälterin, von allen nur Resi genannt, war der eigentliche Grund, warum sich Alice in der seltsamen Lage befand, das Laster des Rauchens im Alter von fünf Jahren hinter sich zu lassen. Resi war eine resolute Frau um die fünfzig, die Haare zu einem braungrauen Dutt ordentlich hochgesteckt, mit bunter Blümchenschürze, fleischigen Armen und runden Hüften. Die Kinder mochten sie, und das nicht nur, weil sie göttlich backen und kochen konnte. Alice liebte Resi für ihre Berechenbarkeit und unerschütterlich gute Laune. In ihren Arbeitspausen setzte sich die Haushälterin an den Küchentisch, steckte sich eine filterlose Lucky Strike an und lehnte sich mit einem behaglichen Seufzer zurück. »Es geht doch nichts über eine Zigarette nach dem Mittagessen«, sagte sie laut, zu niemandem im Besonderen. Sie wähnte sich allein in der Küche. Irgendwann fiel ihr auf, dass sie aufmerksam von Alice beobachtet wurde, die unter der Spüle saß. Das ist schon ein komisches kleines Butzerl, dachte sie bei sich. Sie lächelte und klopfte einladend auf ihren Oberschenkel. Alice kam zögernd herüber, und Resi nahm sie auf den Schoß.
Von da an wurde es zu einem Ritual, dass das Mädchen der Haushälterin in ihrer Pause Gesellschaft leistete. Wann genau die Sache mit dem Rauchen anfing, hätte keine der beiden hinterher so genau sagen können. Vielleicht wurden Haushälterin und Kind einfach etwas übermütig, denn eines Tages bat die Kleine um einen Zug von der Zigarette, und Resi reichte ihr lachend die Kippe.
»Den Rauch nicht in die Lunge ziehen, nur paffen, Herzerl«, sagte sie, und zu ihrem Erstaunen kam Alice der Aufforderung nach und paffte vorsichtig und konzentriert. Die Haushälterin beobachtete sie verblüfft und dachte dann bei sich, dass die Kleine wirklich unfassbar niedlich aussah mit ihren blonden Locken, dem runden Gesichtchen und rosa Wangen, wie sie da so ernst an der Lucky Strike zog und den Rauch umsichtig wieder auspustete. Sie wirkte nicht so, als wollte sie die Erwachsene imitieren. Eher machte sie den Eindruck, als müsste sie einfach allen Dingen auf den Grund gehen. Aber wer wusste schon, was im Kopf dieser seltsamen Kleinen vor sich ging. Gedankenverloren strich sie über Alice’ Haare. Komisch, wie federleicht und flaumig die sich anfühlten. Fast wie bei einem Baby; eigentlich viel zu zart für eine Fünfjährige, zumal das Kind ansonsten braun gebrannt und robust war. Vielleicht könnte sie ihr mal Zöpfe flechten, das sollte gut sein für den Haarwuchs.
»Lecker«, sagte Alice, doch insgeheim fand sie, sie habe selten im Leben etwas Grauenhafteres geschmeckt. Aber der Geschmack von grauer Asche wurde wettgemacht durch das Gefühl warmer, weicher Arme, die sie umfassten und sicher hielten. Alice fühlte sich wie im Himmel. Wolkenverhangen und ohne Weitsicht, aber glücklich.
Die Mittagszweisamkeit dauerte einige Wochen an, bis eines Tages ihr Vater unerwartet in die Küche kam. Hastig nahm Resi dem Kind die Kippe aus der Hand und wurde ein bisschen rot.
»Alice, komm mal rüber ins Wohnzimmer«, sagte ihr Vater nur und verließ die Küche wieder. Als sie verwundert den Salon betrat, sah sie, wie ihr Erzeuger ein wenig aufgebracht auf und ab marschierte. Sie wartete ab; er schien noch nach den richtigen Worten zu suchen. Schließlich sagte er: »Ich will nicht, dass du rauchst. Hast du verstanden? Lass dich nicht mehr dabei erwischen.«
Alice betrachtete ihn aufmerksam. »Und warum nicht?«, fragte sie schließlich.
Die Frage brachte den Vater noch mehr aus dem Konzept, und er blieb abrupt stehen. »Willst du frech werden?«
»Nein!«, sagte Alice, die sich immer mehr wunderte. »Ich will nur wissen, warum. Die Resi macht’s doch auch.«
»Weil … weil Rauchen ungesund ist. Für Kinder ist es nachgerade gefährlich.«
Natürlich war das gelogen. In Wahrheit fand er Frauen, die rauchten, einfach etwas gewöhnlich und den Anblick seiner Jüngsten mit einem Glimmstängel zwischen den Fingern schlicht verstörend, aber das war zu kompliziert als Erklärung für eine Fünfjährige.
Alice nickte gehorsam. Insgeheim verspürte sie eine gewisse Erleichterung, dass sie in Zukunft aufs Rauchen verzichten durfte. Doch der Gedanke, nicht mehr auf dem Schoß der Resi sitzen zu können, zerriss ihr schier das Herz. Diese Angst sollte sich allerdings als unbegründet erweisen. Am nächsten Tag, als Alice nach dem Mittagessen und Abwasch in die Küche kam und zögerte, sagte Resi nur: »Was ist?«, und klopfte auffordernd auf ihren Oberschenkel, und dem Mädchen fiel ein Stein vom Herzen.
An dem Tag durfte sie Resi in der Küche helfen und Äpfel schneiden. Es war Freitag – Apfelstrudeltag. Resis Strudel war legendär; mithilfe geheimer Schwarzmarktquellen schaffte sie es an den Freitagen, die gesamte Nachbarschaft in eine unwiderstehliche Zimtwolke zu hüllen. Niemandem gelang eine so ausgewogene Balance zwischen knusprigem Teig und saftiger Füllung, und so bestanden Alice’ früheste Kindheitserinnerungen aus einem eigenartigen, bittersüßen Kontrast zwischen Zimt und Zigarettenrauch.
In den Fünfzigerjahren fanden sich die Spuren der Gewalt nicht nur in der Landschaft, auch die Sprache hatte ihre Verletzungen davongetragen. Auf einmal gab es wieder weiße Flecken auf der Landkarte der Sprache, mit Orten und Flussläufen, die so taten, als gäbe es sie nicht. Bis Alice gelernt hatte, die Schwingungen, die die Sätze begleiteten, und das Ungesagte zwischen den Wörtern richtig zu deuten, handelte sie sich regelmäßig Ärger ein. Wie beispielsweise in dem Moment, als die Fünfjährige während der sonntäglichen Kaffeerunde von den Hocheders gefragt wurde, was sie denn später mal werden wolle.
»Sturmführer, wie dein Onkel, Herr Hocheder«, antwortete Alice nach reiflicher Überlegung. Eigentlich wollte sie ihm nur eine Freude machen; immer, wenn die Hocheders von dem ehemaligen Beruf des Onkels redeten, wurden ihre Stimmen eine Spur leiser und zugleich deutlich gewichtiger. Sturmführer musste etwas wirklich Besonderes sein, dachte Alice – und das war es ja auch. Sie liebte den Wind, vor allem, wenn er weich und warm von Süden her wehte. Es war eine spontane Idee gewesen, aber in dem Moment, als sie es aussprach, wusste sie, dass sie später tatsächlich gern mit dem Wind arbeiten würde. Es war einer der sinnvollsten Berufe, die sie sich vorstellen konnte. Denn dass ein ausgewachsener Sturm Anleitung und Kontrolle brauchte, erschien ihr nur logisch.
Sie konnte sich die betretene Stille und das Erdbeben, das folgte, also nicht recht erklären. Das änderte sich kurz darauf, als ihre Eltern beschlossen, sie aus reinem Eigeninteresse mit einem gewissen Grundverständnis in Sachen Vergangenheit auszustatten, um derartige Fallgruben in Zukunft zu vermeiden.
Daher erteilte ihr die Mutter an den darauffolgenden vier Samstagvormittagen Unterricht in jüngster Geschichte. Da sie überraschend gut erzählen konnte, wie Alice bei der Gelegenheit zum ersten Mal feststellte, und die Ereignisse der Nazizeit plastisch zu schildern wusste, sollten sich diese Unterrichtsstunden tief in ihre Seele einprägen. Es dauerte eine ganze Weile, bis die nächtlichen Albträume wieder aufhörten. Aber die Bilder und Geschichten sollten sie ein Leben lang begleiten.
Danach hatte sie zwar verstanden, dass Sturmführer doch kein erstrebenswerter Beruf war. Was sie in ihrer kindlichen Logik aber nicht begriff: Warum waren Erwachsene nicht genauer? Warum sahen sie nicht, wie schwierig es war, Dinge, Gefühle, Zusammenhänge zu erkennen, wenn die Wörter nicht genau das beschrieben, was sie bezeichnen sollten? Mit der Zeit fand sie heraus, dass es Wörter gab, die präzise, und andere, die nur scheinbar präzise waren und in einem unbewachten Moment auf einmal etwas ganz anderes bedeuteten als gedacht. Alice begann nachzufragen, mit einer Beharrlichkeit, die regelmäßig mehr Ärger verursachte, als die halb kriminellen Streiche ihres Bruders jemals hätten provozieren können.
Doch dann bekam sie Hilfe von unerwarteter Seite.
Nach und nach erkannte sie, dass alle nur möglichen Erklärungen über das Wie und Warum in der Welt, die von den Erwachsenen nicht so leicht zu bekommen waren, in Form eines unscheinbaren, raschelnden, grau schimmernden Papiers daherkamen, das noch leicht nach Druckerschwärze roch. Auch ihr Vater schien diese Ansammlung schwer faltbaren Altpapiers zu schätzen; zumindest war es den Kindern verboten, seine Morgenzeitung auch nur anzufassen. Wehe, sie brachten die Seiten durcheinander, sagte er streng.
Also begann Alice, sich unauffällig, aber mit gewohnter Beharrlichkeit in die Nachrichtenwelt ihres Vaters zu schleusen. Als Erstes kletterte sie behutsam auf seinen Schoß, während er in die Lektüre versunken war. Sie bemühte sich, die umständlich großen Blätter nicht zum Erzittern zu bringen und sich so leicht wie möglich zu machen, damit ihm das zusätzliche Gewicht gar nicht auffiel. Das Glück kam ihr zu Hilfe: Am Vortag hatte Peter Müller, deutscher Boxer und Kölsches Original, im Kampf um die Meisterschaft den Ringrichter mit einem rechten Haken ausgeknockt und dann den Gegner weiter mit den Fäusten bearbeitet. Ihr Vater war außer sich.
»Ich fass es nicht! Das verstößt doch nun wirklich gegen alle Regeln, die’s beim Boxen gibt«, rief er, an niemanden im Besonderen gerichtet.
»Ach, es gibt Regeln beim Boxen?«, fragte Alice, während sie sich ganz still hielt auf dem Schoß ihres Vaters.
»Natürlich gibt es Regeln! Was glaubst denn du? Sonst könnten wir’s ja gleich beim Raufen in der Gosse belassen. Es ist eine Frage der Ehre, des Anstands. Wer den Ringrichter nicht respektiert, hat im Ring nichts verloren!«
»Und wer am Boden liegt, wird nicht getreten?«, hakte Alice interessiert nach. Auf dem Gebiet hatte sie zufällig einige Erfahrung. Der Junge vom Nachbarhof und sie keilten sich regelmäßig. Pauli war zwar ein Jahr älter als sie, aber recht klein geraten. Deshalb waren sie in etwa gleich stark. Er war ihr bester, ihr einziger Freund. Allerdings gab es niemanden, der sie mehr auf die Palme bringen konnte, daher zog Pauli häufig den Kürzeren. Aber es stimmte schon, wenn sie ihn erst einmal niedergerungen hatte, verbot es der Anstand, weiter auf ihn einzudreschen. Das wusste sie instinktiv.
»Finde ich gut«, sagte sie daher.
»Schön, dass du das gut findest«, brummte ihr Vater, der schon wieder in die Lektüre vertieft war. Doch sein Bart zitterte noch leicht.
»Und dafür ist der Ringrichter da? Der passt auf, dass man nicht weiter draufhaut?« Noch immer hatte sie die Stimme nicht erhoben, sondern sprach so vorhersehbar wie möglich.
Und er antwortete, fast ohne zu merken, dass er antwortete. Es dauerte keine drei Wochenenden, und er hatte sich so an seine Lektüregesellschaft gewöhnt, dass er sie tatsächlich vermisst hätte, wäre Alice lieber spielen gegangen. Aber sie dachte ohnehin nicht daran. Diese Mischung aus Kaffeegeruch, Pfeifenrauch, Morgensonne im Salon und dem Rascheln des Papiers, das Ticken der Uhr … und die stillen und konzentrierten Bewegungen des Vaters beim Umblättern. Sachte stellte sie ihre Fragen, leise, ruhig, und nicht zu viele auf einmal, um ihn nicht zu überfordern: Was ist das für ein Buchstabe? Wie spricht man dieses Wort hier aus? Wie schreibt man Boxen?
Natürlich bezahlte sie einen Preis für diese Momente der Nähe; aber im Leben gibt es ja nur selten etwas umsonst. Ihrem Bruder war diese neue Sonntagszweisamkeit ein echter Dorn im Auge, deshalb jagte er sie ab zwölf Uhr mittags regelmäßig durchs ganze Haus. Glücklicherweise war sie nicht nur flinker als er, sondern auch kleiner. Das rettete ihr immer wieder das Fell. Meist kletterte sie auf den Biedermeier-Schrank im Salon und kam damit außer Reichweite seiner kneifenden Finger.
Selten hatte sie ihn so streitsüchtig erlebt. Noch nicht einmal die Tatsache, dass sie bei diesen Zankereien regelmäßig Ärger mit den Eltern bekamen, schien etwas an Simons Laune ändern zu können. Erst am Nachmittag wurde es meist wieder besser, wenn sie in geteiltem Leid in ihre gebügelten und gestärkten Sachen schlüpften und sich am helllichten Tag kämmen und erneut waschen mussten. Dann galt es, den Kaffeebesuch oder die Gäste zum Abendessen mit Gedichten oder kleinen Musikstücken zu unterhalten, Alice auf der Flöte, ihr Bruder mit der Geige. Sie fanden beide, dass ihre Stücke mehr nach Katzenmusik denn nach Mozart klangen; und den leeren Mienen der Zuhörer nach zu schließen, ging es dem Besuch genauso.
Die Not schweißte sie in diesen Momenten zusammen: Oft geschah es schließlich nicht, dass das strenge Auge der Mutter über sie wachte. Sie waren in der Hinsicht also nicht richtig in Übung. Alice kontrollierte die widerspenstigen Haare ihres Bruders, während er die Schleife ihres Kleidchens hinten zuband und sie auf Flecken und Knitterfalten überprüfte. In diesen Momenten, wenn die Mutter anfing, Ansprüche zu stellen, sehnten sich beide zu ihrer eigenen Überraschung wieder nach den Werktagen, wenn sie zwar allein gelassen, aber wenigstens frei waren von lästigen Verpflichtungen wie Schleifenbinden und Faltenglätten. Sonntagnachmittag, das war gleichbedeutend mit Langeweile, mit muffiger Stubenluft, während sich der Rest der Woche bei jedem Wetter im Freien abspielte.
Die Zeitungs-Sonntage mit ihrem Vater hatten noch eine weitere Nebenwirkung: Mit sechs Jahren, kurz vor ihrer Einschulung, konnte Alice bereits fließend lesen. Da sie nicht davon ausging, dass das Entziffern dieser Hieroglyphen etwas Besonderes war, sprach sie nicht darüber, sodass ihre Umwelt noch nicht einmal bemerkte, wie sich ihr ein Fenster zur Außenwelt öffnete, das Sechsjährigen normalerweise verschlossen blieb.
Als kleines Kind war Alice nie außerhalb des Landkreises Miesbach gewesen. Erst an ihrem achten Geburtstag nahm die Mutter sie zum ersten Mal mit in die Großstadt, in den Modeverlag, in dem sie arbeitete. Doch bis zu diesem Tag, an dem sie sich von dem Anblick der breiten Einkaufspassagen mit ihren erleuchteten, vorweihnachtlichen Schaufenstern, den turmhohen Häusern, dem Wirbeln und Strömen des Verkehrs überwältigen ließ, bildeten die Zeitungen ihren einzigen Kontakt zur Welt außerhalb des Landkreises.
Sobald ihr Vater werktags nach seinem hastig eingenommenen Frühstück die noch hastiger überflogene Tageszeitung wieder gefaltet und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht hatte, vertiefte sich Alice heimlich und verbotenerweise ins Weltgeschehen, das vom Lokalteil ihres Anzeigers bis zu den fernen Gipfeln des Himalaya reichte.
Vor den staunenden Augen der Sechsjährigen, Achtjährigen, Zwölfjährigen entfaltete sich die Welt. Nach und nach zeigten ihr die Berichte und Artikel, wo es Muster gab, die sich wiederholten, sie erklärten ihr die Verletzungen, die Schuld, die Scham, die noch immer die deutsche Gesellschaft der Nachkriegszeit durchzogen. Alice lernte unbewusst, die Krankheitszeichen zu erkennen, die die Sprache ihrer Umwelt durchsetzten. Auf ähnliche Weise, wie ihr Vater einen geschärften Sinn für die Gebrechen des menschlichen Körpers hatte, hörte sie die leisen Zwischentöne, das Ungesagte, das sich manchmal so erschreckend zwischen den Wörtern auftat.
Und ohne dass ihre Eltern etwas davon ahnten, wusste sie im Alter von zwölf Jahren bereits, wie es im Hochgebirge am fernen Hindukusch aussah, während sie noch an einer Hand abzählen konnte, wie oft sie die Münchner Großstadt mit eigenen Augen gesehen hatte.
Kapitel 3 Jagen und Sammeln
Frühling 1968
Eis, das in der Sonne gleißte. Schneefelder, oberhalb der Baumgrenze durchsetzt von Schluchten und Flächen aus grauem Geröll. Darunter lagen lose verstreut Polster aus Grün in unterschiedlichen Schattierungen. Fichten, Tannen, Kiefern. Sonnenflecken und Wolkenschatten, die in rasender Geschwindigkeit über die zerklüfteten Hänge zogen. Alice’ Blick wanderte wieder nach oben, dorthin, wo die schneebedeckten Gipfel der Berge nahtlos mit einem weißen, unbestimmten Himmel verschmolzen. Im Geiste suchte sie sich einen Weg zwischen Geröll- und Schneefeldern hindurch und kletterte gämsengleich über die Gebirgshänge.
Dann schwenkte der orangefarbene Arm eines Baukrans durch ihr Blickfeld und holte sie unvermittelt an ihren Bürotisch zurück. Alice seufzte, riss den Blick vom Fenster los und trank einen Schluck von ihrem kalt gewordenen Kaffee.
Landkreis Miesbach, April 1968. Hier im Schatten der Berge war vom Frühling noch nicht viel zu spüren. Unmittelbar vor Ostern überzog noch einmal eine leichte Schneedecke die Landschaft, nachdem der Februar mit einer ganzen Reihe von Föhntagen für warme Temperaturen gesorgt und den Himmel in klar abgegrenzte Streifen aus Türkis und Gelb zersplittert hatte.
Sie legte die Finger auf die Tastatur ihrer Schreibmaschine. Hinter ihr waren die Geräusche des Redaktionsalltags zu hören, die Alice mittlerweile im Schlaf zuordnen konnte. Auch ohne sich umzudrehen, wusste sie, was gerade geschah. Die leise gereizten Stimmen von Zeißler und Maier, dann das Spitzen eines Bleistifts Härtegrad 9H.
Zeißler in Aktion.
Alice hatte sich wiederholt gefragt, wie ein Mann mit so resignierten, trübbraunen Augen einen derartigen Biss entwickeln konnte, wenn es ums Redigieren von Beiträgen ging. Alles, was bis 12 Uhr in einem großen Umschlag zum Bahnhof gebracht und nach München in die Hauptredaktion geschickt werden sollte, wanderte erst über seinen Schreibtisch. Nicht, weil er Maier übergeordnet gewesen wäre; eigentlich leitete Albrecht die Miesbacher Redaktion. Aber Zeißler war einfach der Beste, wenn es um den Feinschliff ging. Gefürchtet war seine Angewohnheit, vor jedem Einsatz mit nervenzerreißender Sorgfalt seinen Bleistift zu spitzen. Ein Geräusch, das dem Rest der Belegschaft einen Schauer über den Rücken ragte. Alice hatte selbst Albrecht schon zusammenzucken sehen. Deshalb wurde Hans Zeißler hinter seinem Rücken »Der Bleistift« genannt, in einer Mischung aus Gereiztheit und Dankbarkeit. Alice hätte sich nur gewünscht, dass er ihr die Korrekturen in ihren Beiträgen auch erklären würde. Eigentlich war er ihr ausbildender Redakteur und für die Volontäre zuständig, aber bisher hatte er diesen Umstand schlicht ignoriert.
Jetzt kam Maier aus Zeißlers Büro, mit leicht geröteten Ohren. Ihn hatte Alice bei sich »Den schönen Maier« getauft, weil er ein fein gemeißeltes Profil hatte, das in seiner glatten Perfektion an eine griechische Statue erinnerte. Unterhalb der Oberfläche schien es wenig Tiefgang zu geben, aber unfreundlich war er nicht zu ihr. Nur hin und wieder widmete er der neuen Volontärin einen auffordernden Blick, ohne deutlicher zu werden, wozu er sie eigentlich aufforderte. Nach einem aufschlussreichen Plausch mit der Sekretärin vergrößerte sie allerdings ihren Sicherheitsradius um einen weiteren Meter, wenn sie mit ihm zu tun hatte.
Alice schielte kurz zu ihm hinüber, dann beugte sie sich über ihre Schreibmaschine und konzentrierte sich. Bis Mittag musste sie einen Beitrag zur Kindergarteneröffnung in Rottach-Egern fertig haben und ein Interview mit der Leiterin in den Artikel einarbeiten, in einer abwechslungsreichen Mischung aus direkten und indirekten Zitaten. Eine Einleitung sollte da auch noch stehen und den Leser dazu verführen, weiterlesen zu wollen. »Aber nicht zu viel verraten. Das merken Sie dann schon, wie’s geht«, hatte Albrecht gesagt …
Sie seufzte. Warum nur hatte sie das Gefühl, seit Wochen auf der Stelle zu treten?
Aus dem Büro ertönte die Stimme des Bleistifts: »Maier, kommen Sie noch mal schnell rüber, bitte?«
Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst, lautete der Rat der Roten Königin in Alice hinter den Spiegeln.1
Die Miesbacher Alice hatte nie wirklich begriffen, was die Königin mit dieser Behauptung eigentlich sagen wollte. Aber das ging ihr an mehreren Stellen so bei der Lektüre, weshalb sie immer eine leise Gereiztheit verspürt hatte, wenn dieses seltsame Kindermärchen mit ihrer Namensvetterin ihren Lebensweg kreuzte. Als sie zehn war, hatte sie sich beide Bände – die im Wunderland und hinter den Spiegeln spielten – in der Bücherei ausgeliehen und sich in die Geschichte vertieft, unbeeindruckt von Pauli, der zwar noch immer ihr bester Kumpel war, aber trotzdem kein Problem damit hatte, sie damit zu hänseln. Hätte man sie um eine Zusammenfassung und Stellungnahme gebeten, wäre sie damals ungefähr so ausgefallen: eine Geschichte mit einer Titelheldin, die bescheuert genug war, in ein Kaninchenloch zu kriechen, um erst endlos zu fallen und anschließend durch eine Welt mit verrückten Hutmachern, Grinsekatzen und anderen launischen Figuren zu irren auf der Suche nach dem Ausgang. Bewertung: ein Punkt von zehn; muss man nicht gelesen haben. Der Umstand, dass in dieser paradoxen Welt die Regeln und Gesetze der Wirklichkeit nicht galten, die Alice während ihrer frühen Kindheitsjahre so mühsam hatte erlernen müssen, machte sie nervös. Sie mochte keine Gedankenspiele, und es irritierte sie, wenn sie es mit einem Text zu tun bekam, den sie nicht verstand. Nicht so, wie sie Zeitungsmeldungen verstand, die einen nachvollziehbaren Aufbau und eine klare Aussage hatten.
Erst im Hier und Jetzt, während sie versuchte, als junge Volontärin, Ehefrau und Mutter ihren Platz in der Welt zu finden und zu behaupten, dämmerte ihr zum ersten Mal, dass eine auf den ersten Blick paradoxe Aussage eine wichtige Wahrheit enthalten konnte.
So schnell rennen, wie du kannst, um am gleichen Fleck zu bleiben …
… und gegen dieses wachsende Gefühl der Unzulänglichkeit anzukämpfen, weil es nie genug war. Sie schien nicht nur nicht vorwärtszukommen, es kostete sie alle Kraft und Konzentration, auch nur die Gegenwart zu bewältigen, egal, wie schnell sie rannte.
Gründonnerstag. Als sie einen Tag später gegen halb sechs die Redaktionsräume betrat, war sie tief in Gedanken versunken. Der Leiter vom Bauamt hatte da ein paar interessante Neuigkeiten durchsickern lassen, als sie ihn auf der Straße getroffen hatte … Die Frage war nur, ob sie die wirklich weitergeben sollte. Würde es Ärger geben? Und lohnte sich der Ärger? Andererseits, zum Teufel! Er musste doch wissen, dass er mit einer Reporterin sprach. Nein, musste er nicht … Die Leute vergaßen das tatsächlich überraschenderweise immer wieder, wenn sie mit ihr redeten. Dafür schien sie ihnen wohl einfach zu jung. Sie war so mit ihren Grübeleien beschäftigt, dass ihr im ersten Moment die seltsame Stimmung im Raum gar nicht auffiel. Irgendwann blickte sie auf, weil sie bemerkte, dass das Radio auf voller Lautstärke lief, und sah sich um.
Nur der Bleistift war da, die anderen beiden Kollegen hatten sich auf den Weg gemacht zu einem Termin beim Bürgermeister. Es war ohnehin schon spät. Plötzlich wurde sie sich der Stimme des Reporters im Radio sehr bewusst. Eine aufgeregte Stimme, unterlegt von Schreien und Stimmengewirr im Hintergrund. Sie sah zu Zeißler hinüber, der reglos stand und das Radio anstarrte. Dann hob er den Kopf und sah die Volontärin an, und Alice zuckte zusammen. Sie hatte diesen mittelalten Mann mit langer, ausdrucksvoller Nasenspitze, der nur im Notfall redete, bisher als ziemlich resigniert eingeschätzt. Schwermütig und niemand, der groß Gefühlsregungen zeigte, von seinem ironischen Grundton und der redaktionellen Sorgfalt einmal abgesehen.
Bis jetzt.
Seit Wochen wartete sie darauf, endlich von ihrem ausbildenden Redakteur überhaupt wahrgenommen zu werden. Aber dieser Ausdruck in seiner Miene … Er wirkte aufgewühlt. Zornig. Hastig überlegte sie, ob sie irgendetwas falsch gemacht hatte, als er ohne weitere Einleitung sagte: »Rudi Dutschke wurde angeschossen. Sie wissen nicht, ob er überlebt.«
Alice schwieg einen Moment, während die Neuigkeit langsam tiefer drang und sich in ihrem Geist mit früheren Informationen zu einem zusammenhängenden Netz verknüpfte. »Ich verstehe«, sagte sie dann.
»Gar nichts verstehen Sie!«, erwiderte er heftig und wandte sich um. Im nächsten Moment war er auf der Toilette verschwunden und tauchte für eine ganze Weile nicht mehr auf. Alice ließ sich auf ihren Bürostuhl sinken und lauschte dem Radiobericht. Sie war so konzentriert auf die Stimme des Sprechers, dass sie nicht nur vergaß, ihren Bericht für Albrecht fertig zu schreiben – der Grund, weswegen sie eigentlich noch einmal in die Redaktion gekommen war. Sie vergaß sogar, ihren Mantel auszuziehen.
Natürlich hatte sie die Nachrichten aus den Großstädten verfolgt, auch wenn das Lokalblatt mehr als nur ein paar Hundert Kilometer von den Ereignissen in Berlin entfernt schien; es war nicht nur eine räumliche, sondern auch zeitliche Distanz. Die Alpenregion hinkte der Gegenwart hinterher, und noch schwappten die Wogen des studentischen Aufruhrs im Miesbacher Landkreis lediglich in kleinen Wellen an die Ufer des Tegernsees. Dennoch, es waren unruhige Zeiten, das war selbst hier spürbar. Sie fragte sich, worauf sie da zusteuerten. Was würde das Attentat auf den Studentenführer Dutschke innerhalb der Bewegung auslösen?
Als Zeißler eine Viertelstunde später wieder herauskam, blickte sie auf und musterte ihn aufmerksam. Sie verstand tatsächlich nicht. Nicht, was die Ereignisse in Berlin anging, sondern diese zornige Reaktion des Redakteurs.
»Er lebt«, sagte sie.
»Ich hab’s gehört. Das Radio läuft ja laut genug.«
»Herr Zeißler, können Sie mir sagen, was hier eigentlich los ist?«, fragte sie behutsam, ging hinüber und drehte das Radio leiser.
»Wer Terror produziert, muss Härte in Kauf nehmen«, erwiderte er düster und ließ sich auf den Stuhl an seinem Schreibtisch fallen. Es war das erste Mal, dass Alice Hans Zeißler zornig erlebte. Dabei fiel ihr auf, dass er deutlich langsamer und bedächtiger sprach, wenn er wütend wurde. Als müsste sich die Wut erst durch eine Mauer aus Resignation nach draußen arbeiten. Deshalb bemerkten viele Leute gar nicht, dass er überhaupt zornig war.