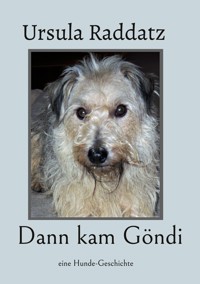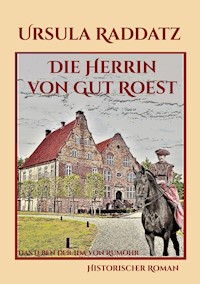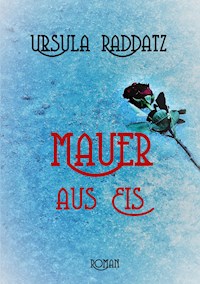Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eine Familie zwischen Kappeln und Berlin
- Sprache: Deutsch
«Ein Stapel ungelesener Briefe» ist die Fortsetzung des vorigen Romans «Fremd sind mir Stadt und Land» an und beginnt dort, wo der Letzte endete. Es ist 1890, Wilhelmine, Friederikes Tochter läuft in der Nacht zu ihrem 19. Geburtstag davon. Die Eltern, vor allem die Mutter, bleiben ratlos zurück, verstehen nicht, was das Mädchen davon treibt. Wilhelmine, nennt sich bald Wilma, kommt in Berlin bei ihrer Tante und Kusine unter. Sie glaubt, hier, in der Großstadt, ihre Schulbildung zu erweitern, was in Kappeln nicht möglich war. Schnell muss sie feststellen, dass auch hier Mädchen und Frauen harte Grenzen gesetzt sind. Während in Kappeln die Mutter verzweifelte Briefe an ihre Tochter schreibt, die ungelesen und unbeantwortet bleiben, stellt sich Wilma in Berlin dem Glanz und Elend der Jahrhundertwende. Namhafte Persönlichkeiten begleiten sie dabei, sie schaut hinter die Fassaden, kommt mit starken Frauen in Berührung, die für die Ärmsten der Armen kämpfen und lernt bald die Liebe kennen. Die Mutter schreibt weiterhin Briefe, ohne Hoffnung darauf, dass ihr Kind sich meldet. Wird Wilma ihr irgendwann antworten? Werden die beiden eines Tages zusammenfinden und wie verändert die große Stadt Berlin eine junge Frau, die aus der Beschaulichkeit der Kleinstadt geflohen ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 725
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchbeschreibung:
«Ein Stapel ungelesener Briefe» ist die Fortsetzung des vorigen Romans «Fremd sind mir Stadt und Land» an und beginnt dort, wo der Letzte endete.
Es ist 1890, Wilhelmine, Tochter von Wilhelm und Friederike Schulze, läuft in der Nacht zu ihrem 19. Geburtstag davon. Die Eltern, vor allem die Mutter, bleiben ratlos zurück, verstehen nicht, was das Mädchen davon treibt.
Wilhelmine, nennt sich bald Wilma, kommt in Berlin bei ihrer Tante und Kusine unter. Sie glaubt, hier, in der Großstadt, ihre Schulbildung zu erweitern, was in Kappeln nicht möglich war. Schnell muss sie feststellen, dass auch hier Mädchen und Frauen harte Grenzen gesetzt sind.
Während in Kappeln die Mutter verzweifelte Briefe an ihre Tochter schreibt, die ungelesen und unbeantwortet bleiben, stellt sich Wilma in Berlin dem Glanz und Elend der Jahrhundertwende. Namhafte Persönlichkeiten begleiten sie dabei, sie schaut aber auch hinter die Fassaden, kommt mit starken Frauen in Berührung, die für die Ärmsten der Armen kämpfen und lernt auch bald die Liebe kennen.
Die Mutter schreibt weiter Briefe, lange ohne Hoffnung darauf, dass ihr Kind sich meldet. Wird Wilma ihr irgendwann antworten? Werden die beiden eines Tages zusammenfinden und wie verändert die große Stadt Berlin eine junge Frau, die aus der Beschaulichkeit der Kleinstadt geflohen ist?
Lesen Sie selbst, fiebern Sie mit, wenn wieder einmal ein Brief unterwegs ist, von Kappeln nach Berlin....wird auch er ungelesen bleiben?
Personenregister :
Fiktive Personen:
Hauptpersonen :
Wilhelmine/ Wilma Schulze, Tochter – geb.18.01.1871 in Kappeln
Friederike Schulze , Mutter – geb.28.02.1851 in Berlin
Familie:
Wilhelm Schulze , Vater – geb. 05.09. 1844 in Danzig
Otto Schulze, Großvater – ehem. Lehrer, Ostpreuße
Marie Schulze, Großmutter – geb. Zameitat Ostpreußin
Annemarie Clementi, Tante, Schwester von Wilhelm Schulze, Witwe von
Joachim Clementi, Onkel und Vater von Leila, verst. 09.01.1871 im Krieg
Leila (Elisabeth) Clementi, Kusine geb. 09.01.1871 in Berlin
Carl Meurer, Archäologe, Wilmas Lebensgefährte 30.06. 1865 in Potsdam
Alexander, Wilmas Sohn
Andere:
Jan Paulsen, Kinder- und Jugendfreund – geb. 01.07.1867 in Kappeln
Meta Paulsen, Jans Mutter und Freundin von Friederike geb. 28.02.1851
Henriette Polzin, genannt «die rote Jette», Freundin von Wilma
Ottilie Meister, genannt «Otti», Freundin von Wilma
Auguste Mehn, Dienstmädchen bei Annemarie, geb. 1876 in Brandenburg
Janne, eigentl. Johanna, Dienstmädchen bei Friederike Schulze
Annchen, Dienstmädchen , Nachfolgerin von Janne
Ramon Santi, junger Schauspieler am Schauspielhaus in Berlin
Richard von Dahlen, Wilmas unzuverlässiger Freund
Walter Dernau, Alexanders Klassenlehrer und Wilmas Freund
Hermine Kollborn, Friederikes Ersatztochter
Reale Personen:
In Berlin:
Wilhelm II. deutscher Kaiser und König von Preußen (1859–1941)
Wilhelm Bode, Leiter des neuen Museums in Berlin- später Bode-Museum
August Aschinger, Inhab. Stehbierhallen, geb. 08.04.1862, + 28.01.1911
Max Liebermann, Maler und Leiter der «Berliner Sezession»
Martha Liebermann, seine Ehefrau
Robert Koldewey, Archäologe, Babylons Entdecker, 1855-1925
Max von Oppenheim, Archäologe, Orientalist, 1860-1946
Ludwig Borchardt, Ägyptologe, fand die Büste der Nofretete, 1863-1938
Friedrich Delitzsch, Direktor der vorderasiatischen Abteilung im Museum
Clara Zetkin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin, 1857-1933
Rosa Luxemburg, deutsch-poln. sozialistische Politikerin, 1871-1919
Helene Lange, Politikerin, Pädagogin und Frauenrechtlerin, 1848-1930
In Kappeln:
Dr. Otto Spliedt, Hausarzt der Familien Schulze + Paulsen, 1836-1901
Dr. Gustav Spliedt, Sohn und Nachfolger, ebenf. Hausarzt, 1877-1955
Carl Eduard Claussen, Rechtsanwalt, Fabrikbesitzer, 1819-1905
Kanzleirat Wilhelm Seehusen, 1833-1917 Stifter des Altenheimes
Jacob Moser, Kaufmann, Stifter, Ehrenbürger, 1839-1922
Emanuel Lorentzen, Holzkaufmann, schwedischer Vizekonsul,1875-1960
Friedrich Hadenfeld, Betreiber der Mühle Amanda von 1900-1934
Theodor Ancker, gründete 1869 eine Ziegelei in Kappeln
Bürgermeister von Kappeln:
Bgm. Kausch, 1890-1893
Bgm. Plevka, 1893-1905
Bgm. Schreck, 1905-1917
So ist das Leben
und so muss man es nehmen,
tapfer, unverzagt und lächelnd -
trotz alledem
Zitat von Rosa Luxemburg (1870 - 1919),
Deutsche sozialistische Politikerin polnischer Herkunft,
Mitbegründerin der KPD
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel: Kappeln, 18. Januar 1890
2. Kapitel: Unterwegs nach Berlin, 18. Januar 1890
3. Kapitel: Kappeln, 18. Januar 1890
4. Kapitel: Berlin, Ende Januar 1890
5. Kapitel: Kappeln, Ende März 1890
6. Kapitel: Berlin, Ende März 1890
7. Kapitel: Kappeln, Anfang April 1890
8. Kapitel: Berlin, im Herbst 1890
9. Kapitel: Kappeln, im Dezember 1890
10. Kapitel: Berlin, im April 1891
11. Kapitel: Kappeln, Ostern 1891
12. Kapitel: Berlin, im Januar 1892
13. Kapitel: Kappeln, im Januar 1892
14. Kapitel: Berlin, im Juli 1894
15. Kapitel: Kappeln, im Juli 1894
16. Kapitel: Berlin, Ende Juli 1894
17. Kapitel: Kappeln, im August 1894
18. Kapitel: Berlin, Mitte Februar 1895
19. Kapitel: Kappeln, Ostern 1895
20. Kapitel: Berlin, zum Jahresende 1895
21. Kapitel: Kappeln, im Sommer 1896
22. Kapitel: Berlin, im Februar 1897
23. Kapitel: Kappeln, Pfingsten 1898
24. Kapitel: Berlin, im August 1898
25. Kapitel: Kappeln, im April 1899
26. Kapitel: Berlin, Mitte Mai 1899
27. Kapitel: Kappeln, 17. März 1900
28. Kapitel: Berlin, nach Ostern 1900
29. Kapitel: Kappeln, im Dezember 1901
30. Kapitel: Berlin, an Neujahr 1902
31. Kapitel: Kappeln, im Juni 1903
32. Kapitel: Berlin, im August 1903
33. Kapitel: Kappeln, Mitte Juni 1904
34. Kapitel: Berlin, Ende September 1904
35. Kapitel: Kappeln, im Dezember 1904
36. Kapitel: Berlin, Februar 1905
37. Kapitel: Kappeln, November 1905
38. Kapitel: Berlin, Ende Mai 1907
39. Kapitel: Kappeln, Ende Mai 1907
40. Kapitel: Berlin/Kappeln, im Juni 1907
41. Kapitel: Berlin, im August 1908
42. Kapitel: Kappeln, kurz vor Weihnachten 1909
43. Kapitel: Berlin, zum Jahresbeginn 1910
44. Kapitel: Kappeln, im Januar 1910
45. Kapitel: Berlin, Juni 1911
46. Kapitel: Kappeln, im Juli 1911
47. Kapitel: Berlin, August 1911
48. Kapitel: Kappeln, im April 1912
49. Kapitel: Berlin, im April 1912
50. Kapitel: Kappeln, im Mai 1913
51. Kapitel: Berlin, Ende Juni 1913
52. Kapitel: Kappeln, im August 1914
53. Kapitel: Berlin, Anfang August 1914
1. Kapitel
Kappeln, 18. Januar 1890
Auf Zehenspitzen schlich Friederike zu Wilhelmines Zimmer. Sie freute sich auf diesen Tag, den neunzehnten Geburtstag Ihrer Tochter. Er sollte etwas ganz Besonderes werden und wieder ein Lächeln in das verschlossene Gesicht des Mädchens zaubern. Leise drückte sie die Türklinke herunter und öffnete die Tür einen Spalt weit. Im Dunkel dieses Januartages erkannte sie nur schemenhaft die Umrisse des Bettes. Sie lauschte. Stille, tiefe Stille, auch von draußen drang kein Laut durch das geschlossene Fenster.
«Minchen, aufwachen, du hast Geburtstag ....»
Es blieb ruhig. Friederike versuchte es erneut: «Aufstehen, mein Kind...»
Wieder erhielt sie keine Antwort. Ein seltsames Gefühl beschlich sie, da stimmte etwas nicht. Sie tastete neben der Tür nach dem Lichtschalter und dankte insgeheim ihrem Mann, der als einer der Ersten in dieser Stadt sich mit der Elektrizität angefreundet und Strom ins Haus hatte legen lassen.
Grell flammte das Licht der Deckenlampe auf und Friederike erkannte, warum ihre Tochter weder aufgewacht, noch sich geregt und ihr auch nicht geantwortet hatte. Ihr Bett war leer.
«Nein! Oh nein, das ist doch nicht möglich! Minchen, wo bist du?» Riekes Schrei hallte durch die Morgenstille des kleinen Hauses an der Schlei, weckte Ihren Mann Wilhelm und Janne, die Dienstmagd. Mit weit aufgerissenen Augen sah sie sich um, ehe sie auf dem unbenutzten Bett ihrer Tochter zusammensank. Die polternden Schritte ihres Ehemannes auf der Treppe hörte sie schon nicht mehr, sie war in eine gnädige Ohnmacht gesunken. Wilhelm Schulze genügte ein Blick in das Zimmer, um die Situation zu erkennen. So rasch der schwere, über vierzigjährige Mann konnte, eilte er zum Bett und schloss seine Frau in die Arme, rieb ihr sanft die Stirn und hoffte, dass sie bald aus ihrer Bewusstlosigkeit erwachen würde. Seine Augen schweiften durch das Jungmädchenzimmer.
Was hatte Rieke so erschreckt? Auf den ersten Blick fiel ihm nichts auf. Er dachte kurz daran, wie hingebungsvoll Friederike den Raum eingerichtet hatte, als sie schwanger war, für das Töchterlein, das ihr einziges Kind bleiben sollte. Wilhelmine nannten sie das zarte Mädchen, nach ihm, dem Vater und nach Wilhelm, dem König von Preußen, der in dem Augenblick als das Kind zur Welt kam, zum ersten Kaiser des Deutschen Reiches gekrönt wurde. Er, Wilhelm Schulze, preußischer Beamter und Baubeauftragter in Kappeln, liebte das winzige Wesen von dem Moment an, als seine Frau ihm das Neugeborene in die Arme legte. Nie würde er den intensiven Blick vergessen, mit dem ihn das Kind angeschaut hatte, fragend und wissend zugleich. Fragend, ob er sich auch richtig kümmern würde und wissend, dass es bei ihm in guten Händen wäre. Hatte der Doktor nicht kurz zuvor behauptet, solch kleine Kinder könnten nicht gut sehen und kaum etwas aus ihrer Umgebung erkennen? Dieser Arzt erkannte das Besondere in dem winzigen Mädchen nicht, das anders als alle Kleinkinder zu sein schien. Minchen, sein Minchen, wie es bald genannt wurde, wurde zum Sonnenschein in seinem Leben. Als es klar war, dass Rieke ihm kein weiteres Kind mehr schenken würde, schüttete er alle Liebe über die Tochter aus.
Nun war sie fort. Sollte sie davongelaufen sein? Aber warum? Wilhelm fiel das unbenutzte Bett auf und die ungewohnte Ordnung, doch er sah nirgendwo eine Nachricht, keinen Brief, nichts, das über Minchens Verbleib Aufschluss gab. Ob Friederike mehr wusste? Ob sie ahnte, wo das Mädchen sein könnte?
«Liebes», vorsichtig schüttelte er seine Frau, legte ihren zarten Körper ein wenig bequemer hin, «Rieke, bitte, so wach doch auf! Wo ist Wilhelmine?»
Im selben Augenblick öffnete Friederike ihre Augen, setzte sich auf und schaute sich verwundert um.
«Wo ist unser Minchen», flüsterte sie, sichtlich verwirrt, «was tue ich hier, in ihrem Zimmer, auf ihrem Bett?»
Sie schien vergessen zu haben, dass sie ihre Tochter suchte, deren Kammer leer und verlassen vorfand.
«Liebes, lass uns hinunter in die Stube gehen, dort reden wir in Ruhe über alles», sanft streichelte Wilhelm über die blasse Wange seiner Frau. Die ließ sich von ihm beinahe willenlos nach unten führen, wo Janne, das Dienstmädchen, bereits den Frühstückstisch gedeckt hatte und soeben mit dem Kaffee hereinkam, dessen aromatischer Duft Friederikes Lebensgeister wecken sollte. Dieses Mal verfehlte der Kaffee seinen Zweck. Rieke ließ sich matt auf den Stuhl sinken und vermied es, ihrem Mann in die Augen zu schauen. Wie sollte sie ihm erklären, dass sie schon seit geraumer Zeit ahnte, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmte. Seit dem Weihnachtsfest, das in gedrückter Stimmung begangen wurde, weil die geplante Verlobung mit Jan Paulsen, Minchens langjährigem Jugendfreund, nicht stattfand, änderte sich das Verhalten des jungen Mädchens von Tag zu Tag. Immer stiller wurde die sonst so fröhliche Wilhelmine, zog sich immer öfter in ihr Zimmer zurück und war nicht ansprechbar. Auf die Fragen der besorgten Mutter antwortete sie einsilbig oder gar nicht und bedachte sie mit einem solch abweisenden Blick, dass Friederike sich erschrocken abwandte. Sie fühlte sich hilflos, wusste nicht, wie sie sich Minchen gegenüber verhalten sollte. Tausend Fragen hätte sie ihrer Tochter gern gestellt, doch die blieben ungesagt und unbeantwortet. Sorgenvoll besprach sich Rieke mit Meta Paulsen, ihrer Nachbarin, besten Freundin und der Mutter von Jan. Doch auch Meta wusste nicht, was zwischen den beiden jungen Menschen vorgefallen sein mochte. Jan, der nach den Weihnachtstagen beinahe überstürzt zurück nach Kiel gefahren war, um weiterzustudieren, wie er behauptete, schwieg sich aus. Ihn konnten die zwei Frauen also nicht fragen.
Jan und Minchen waren schon als Kinder unzertrennlich, der kräftige blonde Junge mit dem schelmischen Lachen und Augen, so blau wie ein Frühlingshimmel und das zierliche Mädchen mit dem haselnussbraunen Haar und Bernsteinaugen. Jan war für sie wie ein großer Bruder, weil er, ebenso wie Wilhelmine, ein Einzelkind blieb. Die beiden lernten, spielten, aßen gemeinsam und darüber wurden ihre Mütter zu Freundinnen. Als Jan das Gymnasium besuchte, änderte sich noch nichts. Erst als er ein Studium begann und nach Kiel in eine karge Studentenbude zog, spürten die jungen Leute, dass sie viel mehr verband, als eine Kinderfreundschaft.
Sollte es wirklich Liebe sein, fragten sie sich, oder ist es die Verlorenheit, die sich einstellte, als sie auf einmal ohne einander auskommen mussten? Wann immer Jan in den Semesterferien nach Hause kam, sprachen sie darüber und wurden sich einig, dass sie zueinander gehörten. Ihre Liebe wollten sie mit der Verlobung an diesem Weihnachtsfest besiegeln und das teilten sie den Eltern mit. Die Freude schien auf allen Seiten groß. Was ging dann aber so schief?
«Ach Wilhelm», seufzte Friederike, «wo mag unser Kind sein. Ohne ein Wort, uns einfach zu verlassen, wie konnte sie das tun! Nicht einmal einen Brief schrieb sie. Glaube mir, ich mache mir die größten Sorgen um Minchen.»
«Ich verstehe es doch auch nicht, mein Riekchen», meinte Wilhelm und sah seine Frau sorgenvoll an, «was hat sie zu solch einem Schritt getrieben. Sie hatte es gut bei uns, haben ihr jeden Wunsch erfüllt, wenn es irgendwie möglich war.»
«Ja», dachte Friederike und unterdrückte eine aufkeimende Vorahnung, «wenn es uns möglich war.»
Tief in ihrem Herzen glaubte sie zu wissen, was ihr Minchen aus dem Elternhaus getrieben haben könnte, doch diese Vermutung behielt sie für sich.
Wilhelm, dem die Überlegungen seiner Frau verschlossen blieben, wandte sich zu Janne um, die soeben mit einer Kanne frischen Kaffees die Stube betrat.
«Räume bitte das dritte Gedeck ab, Janne, das benötigen wir nicht mehr!»
«Niemals mehr», setzte Friederike in Gedanken hinzu und ließ ihren Tränen freien Lauf...nie mehr...»
2. Kapitel
Unterwegs nach Berlin, 18. Januar 1890
«Frei sein, frei sein, frei sein», sangen die Räder der Eisenbahn und gaben ratternd den Takt vor, der das junge Mädchen langsam einlullte. Der Kopf sank Wilhelmine auf die Brust und sie fing an zu träumen, träumte von der Ferne, der Stadt, der großen Metropole, die nun bald ihr Zuhause sein würde. Sie sah sich durch breite Straßen bummeln, in die neueste Mode gekleidet, am Arm eines schmucken Kavaliers. Sie sah hoch, wollte ihm ins Gesicht schauen, wollte wissen, wer sie da begleitete, da riss ein unsanfter Rippenstoß sie aus dem Halbschlaf. Wilhelmine schreckte auf, fand sich, jäh aus dem schönen Traum gerissen, in einem muffigen Zugabteil dritter Klasse wieder. Eingekeilt zwischen einer dicken Bäuerin, die mit einem noch dickeren Korb auf dem Schoß sich unsanft auf der Holzbank breitmachte und Wilhelmine einen schmerzhaften Stoß mit ihrem Ellenbogen versetzte. Unversehens in ihrem kurzen Schlummer unterbrochen, fand das Mädchen nicht so rasch in die Wirklichkeit zurück.
Ein penetranter Geruch nach ungewaschenen Menschen stieg ihr in die Nase, der sich mit den Ausdünstungen der Hühner mischte, die mit gefesselten Beinen im Korb neben ihr lagen, so still, als wären sie schon tot. Auf der anderen Seite biss ein hagerer älterer Mann mit schütterem Haar und dünnem Bart, herzhaft in ein dickes Brot, das mit etwas streng Riechendem belegt war. Bewegen konnte sich Wilhelmine nur wenig, das Fenster lag außerhalb ihrer Sichtweite und sie machte sich Sorgen, ihr Ziel verpasst zu haben.
«Bitte», wandte sie sich schüchtern an die Sitznachbarin, «können Sie mir vielleicht sagen, ob es noch weit ist bis Berlin?»
«Ach ne, nach Berlin willste? Hab ick mir schon jedacht», die Bäuerin lachte breit, «det dauert noch. Wo willste denn hin? Wirste abjeholt?»
«Vielen Dank, meine Tante erwartet mich!»
Wilhelmine drehte sich zur Seite, die Bäuerin schien ihr zu neugierig. Der Mann neben ihr kaute mit vollen Backen und beäugte sie. Das Mädchen schloss die Augen, tat so, als ob es weiterschliefe und atmete bewusst langsam und gleichmäßig. Seltsam, dachte Wilhelmine, wovon hatte sie geträumt?
Vergeblich versuchte sie sich zu erinnern, doch nur ein vages Gefühl von Freiheit und Abenteuer stieg in ihr auf. Dieses Gefühl begleitete sie seit ihrem Aufbruch von Zuhause. Seit sie den Norden und die kleine verträumte Stadt Kappeln am Ufer der Schlei hinter sich gelassen hatte, spürte sie, wie die Ängste von ihr abfielen, sie leichter atmete und ihre Zukunft wie ein leuchtender Stern am Himmel über ihr stand.
«Warum soll ich nicht nach den Sternen greifen», dachte sie, «warum darf ich meine Zukunft nicht selbst in die Hand nehmen? Ich glaube fest daran, dass in Berlin das Glück auf mich wartet!»
Ein weiterer grober Stoß brachte Wilhelmine wieder auf den Boden der Tatsachen. In das bereits vollbesetzte Abteil drängte sich rücksichtslos ein neuer Fahrgast, und der Korb der dicken Bäuerin traf das junge Mädchen schmerzhaft in die ohnehin schon geprellten Rippen. Vorüber schien der kurze Moment der Euphorie und der Sehnsucht nach einer goldenen Zukunft.
«Wäre ich doch endlich am Ziel», dachte sie niedergeschlagen, «nie im Leben hätte ich mir diese Fahrt so furchtbar und so lang vorgestellt.»
Die Reisen nach Berlin, die sie mit ihren Eltern als Kind unternommen hatte, vergingen meistens wie im Flug. Nicht nur, dass sie erster Klasse reisten, nein, der Vater gestaltete die Fahrten so kurzweilig, dass es dem wissbegierigen Mädchen nie zu viel wurde. Mutter, wie immer um das leibliche Wohl besorgt, packte die feinsten Dinge in den Picknickkorb und am Bahnhof wartet stets schon die Kutsche der Großeltern auf sie.
Ach ja, die noble Kutsche, aus der Großmama Lavalle stieg, jederzeit ganz Dame, die mit dem Heben einer Augenbraue den Diener anwies, die Koffer aufzuladen, um dann das kleine Mädchen mit sorgsam gespitzten Lippen zu küssen. Die Scheu vor der Mutter ihrer Mutter verließ Wilhelmine auch in späteren Jahren nie, zu vornehm und distanziert erschien ihr die Nachfahrin der Hugenotten, die auch im Alter noch am liebsten Französisch sprach und sich für etwas Besseres hielt. Leider verstarben sie und Großvater Lavalle vor ein paar Jahren, kurz nacheinander. Seitdem war das Verhältnis zu Großmutter Schulze enger und inniger geworden. Die fröhliche behäbige Ostpreußin drückte die Kleine bei ihren Besuchen stets so fest an ihren umfangreichen Busen, dass Wilhelmine Angst hatte, zu ersticken. Und kochen konnte sie, ihre Pfannkuchen waren das Beste, das Minchen jemals gegessen hatte. Beinahe hatte sie deren köstlichen Duft wieder in der Nase. Wenn sie sich erst etabliert hätte, in Berlin, dann würde sie die Großeltern ganz bestimmt aufsuchen.
Doch noch schien es besser, wenn die beiden alten Leutchen nichts von Minchens Aufenthalt in Berlin wussten. Wenn sie erst einmal...Wieder traf sie ein heftiger Ellenbogenstoß und riss sie in die raue Wirklichkeit zurück. Diesmal kam er von dem Mann neben ihr, der seine Stulle aufgegessen hatte und sich kräftig in ein schmuddeliges Taschentuch schnäuzte.
«Nu, Frolleinchen, wolln se denn nich aussteigen? Hier jehts nich weiter, Endstation, vastehn se?»
Die Bäuerin quälte sich umständlich aus der Sitzbank und schubste dabei Wilhelmine mit hinunter. Die angelte sich ihren Koffer und stieg im bequemen Kielwasser der Dicken aus dem Zug.
«Wissense, denn wohin? Da drüben jibts Droschken, ooch welche zweeter Klasse, wenn se jerade nich bei Kasse sind», die Bäuerin gab nicht auf.
«Danke, aber ich werde abgeholt», gab Wilhelmine knapp zur Antwort und ignorierte die neugierigen Blicke.
Draußen auf dem Bahnsteig blieb sie stehen, wollte sich kurz orientieren, doch die Menge der Reisenden schob sie unbarmherzig vorwärts.
«Willste hier festwachsen oder wat?» Ein grober Kerl drängte sich an ihr vorbei und trat ihr rücksichtslos auf die Zehen, als sie stehenblieb. Wilhelmine wurde angerempelt, zur Seite geschoben und spürte das schmiedeeiserne Geländer, das die Bahnhofshalle abgrenzte, schmerzhaft an ihrer Hüfte. Alle Welt eilte an Wilhelmine vorüber, so kam es ihr vor. Sie hielt sich krampfhaft an den Streben fest und schaute sich um. Panik überfiel sie, so viele Menschen drängten sich auf engstem Raum. Männer, Frauen, Kinder, Mägde mit großen Körben, Gepäckträger, die sich ohne Rücksicht ihren Weg bahnten, Damen, die ihre Röcke rafften, Herren, die ihren Zylinder festhielten, Arbeiter, abgekämpft und schmutzig, Mütter, die ihre Kinder festhielten. Dazwischen tummelten sich freche Jungs, die alles verkauften, was sich zu Geld machen ließ und auch den Griff in fremde Taschen nicht scheuten.
Der Lärm um sie herum war unbeschreiblich, Lachen und Fluchen, Kreischen und Heulen, dazu das Dröhnen der eisernen Räder, das Zischen von Dampf aus den Lokomotiven, dichter Rauch, der die Bahnhofshalle vernebelte. Wilhelmine sah sich verschüchtert um. Wieso war sie nicht höher gewachsen, kaum dass sie über die Schulter der vor ihr Gehenden blicken konnte. Wie sollte sie so ihre Kusine finden.
«Wo bleibst du nur, Elisabeth», flüsterte sie, «wirst du kommen? Wirst du mich finden? Hast du meinen Brief überhaupt erhalten?»
Wilhelmine fühlte Angst in sich aufsteigen, eine abgrundtiefe Angst, die ihr den Atem raubte. Wie furchtbar, wenn niemand sie holen käme, kein Brief von ihr die Kusine erreicht hatte. Das wäre das Ende ihrer Reise. Allein traute sie sich aus diesem Menschengewühl nie heraus. Wo sollte sie hin? Die Adresse der Tante, die sie heimlich aufgeschrieben hatte, lag irgendwo in ihrer Reisetasche, unmöglich, sie hier zu öffnen, wo sie selbst kaum genug Platz zum Stehen hatte.
«Oh Himmel hilf», dachte sie verzweifelt, «wie soll Elisabeth mich finden, sie weiß doch gar nicht, wie ich jetzt aussehe. Das letzte Mal, als ich sie mit den Eltern in Berlin besuchte, ging ich noch zur Schule!»
Daran, dass sie selbst ihre Kusine sofort erkennen würde, daran zweifelte sie nicht einen Augenblick. Das feuerrote Haar, die hochaufgeschossene dünne Gestalt und die grünen Augen, all das konnte sich kaum verändert haben.
Ein gellender Pfiff, ein neuer Dampfstoß, dann rollte der Zug gemächlich aus der Halle. Als der Qualm sich endlich verzogen hatte, sah Wilhelmine überrascht, dass es um sie herum deutlich ruhiger und leerer geworden war. Nur ein spindeldürrer Junge, der gemeinsam mit einem noch magereren Hund einen vollbepackten Karren zog, schlurfte teilnahmslos an ihr vorbei. Wilhelmine reckte sich, sah sich nach allen Seiten um und konnte nicht das Geringste von Elisabeth entdecken. Sie würde wohl doch den zweifelhaften Schutz des Bahnhofs verlassen müssen und sich mutig ins Großstadtgetümmel stürzen. Nur noch einen einzigen, einen winzigen Augenblick verweilen wollte sie, dann liefe sie los, versprach sie sich selbst und hob die Reisetasche an, die sie zwischen ihren Füßen abgestellt hatte.
«Ach, sieh mal einer an, das Minchen», hörte sie eine helle spöttische Stimme neben sich und fuhr erschrocken in die Höhe, «fast hätte ich geglaubt, du kneifst im letzten Moment und bleibst doch lieber bei der Mama!»
«Elisabeth!» Sie fiel der Kusine um den Hals, «endlich, ich glaubte schon...»
Die Tränen erstickten jedes weitere Wort. Schluchzend und schniefend stand sie da und sah ihre Kusine staunend an. Kaum zu glauben, wie die sich verändert hatte. Die schlaksige Magerkeit war einer aparten, schlanken Figur gewichen und das karottenrote Haar loderte nun in einem satten Kupferton, der die vornehme Blässe der Haut noch unterstrich. Nur die grünen Augen funkelten belustigt, genauso wie früher. Elisabeth betrachtete ihre Kusine ein wenig von oben herab, wie eine Großstadtpflanze so ein Landei eben anschaut.
«Na, was denn, hast du gedacht, ich lasse dich hier einsam und allein herumstehen? Was glaubst du, wie oft ich heute schon hier war, immer dann, wenn ein Zug aus dem Norden erwartet wurde, suchte ich nach dir. Und jetzt bist du endlich da. Nun mach schon, meine Mutter denkt sicher, ich wäre unter die Räder gekommen!»
Wortlos, beinahe willenlos ließ sich Wilhelmine mitziehen. Draußen vor dem Bahnhofsgebäude rief Elisabeth mit der Selbstverständlichkeit eines echten Großstadtkindes eine freie Droschke heran. Staunend stieg Wilhelmine ein, nur einen Moment zögernd, als sie dem Kutscher ihre Tasche überlassen sollte.
«Elisabeth, wie hast du dich verändert», stammelte sie, als die Kusine sich neben sie auf den Sitz fallen ließ, «ehrlich, ich hätte dich nicht wiedererkannt. Du siehst so erwachsen aus, obwohl du nur ein paar Tage älter bist als ich.»
«Na ja, hat auch lange genug gedauert, bis Mutter merkte, dass ich kein Kind mehr bin. Und sag nicht Elisabeth zu mir. Seit meinem letzten Geburtstag nenne ich mich Leila. Das steht mir besser, denke ich!».
«Leila? Hört sich irgendwie orientalisch an», meinte Wilhelmine skeptisch, «wie eine osmanische Haremsdame siehst du aber nicht aus, finde ich.»
«Na und?» Elisabeth-Leila konterte gewandt, «der Orient ist hier in Berlin gerade en vogue und ich will mit der Zeit gehen, modern sein. Elisabeth, das hört sich altjüngferlich an, genauso wie Wilhelmine. Für dich finden wir auch noch einen anderen Namen.»
Über die unmöglichsten neuen Namen für Minchen immer wieder in lautes Gelächter ausbrechend, ließen sich die Kusinen durch Berlin kutschieren. Von der Hauptstadt bekam Wilhelmine wenig mit, weil sie ihr Spiegelbild im nicht sehr sauberen Fenster der Kutsche anschaute und mit sich unzufrieden war.
«Hab ich mich denn gar nicht in eine erwachsene Frau verwandelt, liebe Leila», meinte sie nachdenklich, «weil du mich doch sofort erkanntest?»
Mit einem übermütigen Blitzen in den grünen Augen betrachtete die Kusine sie ausgiebig. Gespannt erwartete Wilhelmine das Urteil.
«Mh, ja, doch, verändert hast du dich schon», Leila machte es spannend, «du bist zwar immer noch recht klein und hast, wie vorher auch, diese haselnussbraunen Locken und die braunen Augen, die du gerade aufreißt, wie ein erschrockenes Reh. Aber trotzdem bist du erwachsener geworden und hast eine etwas weiblichere Figur, mit einer beneidenswert schmalen Taille. Was dich ausmacht, meine Liebe, ist das unwiderstehliche Lächeln, das jeden sofort bezaubert. Reicht dir das? Wir sind nämlich gleich da.»
Leila lachte und Wilhelmine fiel mit ein. So, wie die Kusine sie beschrieb, hatte sie sich selbst noch nie betrachtet. Ob die Tante wohl einen großen Spiegel hatte, in dem sie sich anschauen durfte? War sie auch so, wie Eli... Leila, verbesserte sie sich in Gedanken, beinahe eine junge Dame, die ihr Leben in die eigenen Hände nahm? Mit einem Ruck hielt die Droschke. Verwirrt schaute sie sich um, während Leila dem Kutscher ein paar Münzen reichte. Sie war es auch, die sich die Reisetasche griff und die immer noch staunende Wilhelmine am Arm mit sich zog. Die sah ungläubig an den vier- bis fünfstöckigen Gebäuden mit eindrucksvollen Fassaden empor, die sich die Straße entlang aneinanderreihten. Nur das Haus, vor dem sie standen, wirkte wie ein Kind zwischen lauter Erwachsenen. Es war sichtlich älter und nur zwei Etagen hoch, dazu etwas renovierungsbedürftig und stach aus den vornehmen Nachbarbauten heraus. Ausgerechnet dorthin zog Leila die Kusine, die ihre Enttäuschung nur schwer verbergen konnte. Die Tür öffnete sich und ein spindeldürres Mädchen nahm Leila wortlos die Tasche ab.
«Auguste, ist die Mutter da? Hast du etwas Anständiges gekocht? Nun steh doch nicht so rum, lass uns endlich rein!»
Kopfschüttelnd drängte sich Leila an dem Mädchen vorbei. Wilhelmine folgte ihr, immer noch reichlich verwirrt. Wer war nur dieses Mädchen? Die Antwort musste warten, denn die Dame des Hauses erschien auf der Treppe und ließ ihren Blick über die verlegene Wilhelmine schweifen.
«Das ist aber eine nette Überraschung, meine liebe Nichte, dass du uns in Berlin besuchst. Wie geht es meinem lieben Bruder und deiner Mama? Dass sie dich mitten im Winter so eine weite Reise allein unternehmen lassen, erstaunt mich sehr, doch dafür werden sie wohl ihre Gründe gehabt haben, die du mir sicher darlegen wirst. Auf jeden Fall heiße ich dich ganz herzlich bei uns willkommen, Wilhelmine und hoffe, dass du dich bei uns wohlfühlst. Auguste hat Elisabeths Zimmer für euch beide umgestellt. Unterm Dach gibt es zwar noch ein Kämmerchen, aber das ist nicht zu heizen und deshalb im Winter nicht bewohnbar. Nun lauf, lass dir alles zeigen. Wir sehen uns beim Essen!»
Abrupt brach die Tante ihren Redeschwall ab und ließ die Mädchen einfach stehen. Leila lachte, als ihre Mutter in der Tür zum Salon verschwand.
«Mach dir nichts draus, Minchen, so ist sie nun mal, deine Tante. Ihr großes Herz verbirgt sie gern hinter einer kühlen Fassade. Komm, damit du dich ein bisschen herrichten kannst. Ich zeige dir unser Zimmer.»
Wilhelmine, die nicht viele Erinnerungen an die jüngere Schwester ihres Vaters hatte, erkannte schnell die Ähnlichkeiten zwischen Annemarie und Wilhelm Schulze. Beide waren kräftig gebaut, mit rundlichen Gesichtern und warmen braunen Augen. Wo beim Vater das dunkle Haar sich bereits etwas lichtete, prangten bei seiner Schwester noch viele Locken, zu einer raffinierten Frisur aufgesteckt. Beide trugen ihr gefühlvolles Herz nicht auf der Zunge. Wilhelmine ahnte, dass sie es hier gut haben würde, wenn, ja wenn sie sich durchringen könnte, die Wahrheit zu gestehen.
«Nun komm endlich, grübeln kannst du später. Ich will jetzt unbedingt wissen, was dich wirklich hierher treibt. Dass du hier nur für ein paar Wochen unsere Berliner Luft genießen willst, kannst du deiner Großmutter erzählen, aber ganz bestimmt nicht mir. Ach ja, du musst dir schon eine gute Ausrede für meine Mutter einfallen lassen, warum du nicht bei Oma Schulze abgestiegen bist. Nun komm!»
Ungeduldig zerrte Leila das wie erstarrt dastehende Mädchen die Treppe hinauf bis zu einer Tür, die in einen Raum führte, der Wilhelmine ein weiteres Mal staunen ließ. Hohe Decken, üppig mit Stuck verziert, weiß gestrichene Wände, die das Zimmer geräumiger wirken ließen und große Fenster, die auf der Rückseite des Hauses in einen Garten schauten, in dem ein riesiger Baum die winterkahlen Äste in die frostige Luft reckte.
«Oh, wie schön!» Wilhelmines Ausruf galt nicht etwa der Aussicht, sondern den zierlichen Möbeln, wie für eine Prinzessin gemacht, weiß mit goldenen Schnörkeln und mit zartrosa Stoffen bezogenen Sesselchen. Ein großes Bett an der einen Wand, ein weiteres gegenüber, beide mit einem Überwurf, ebenfalls in Rosa gehalten, luden die Mädchen ein, sich dort auszustrecken und über all die wichtigen Nichtigkeiten zu schwatzen, die junge Damen so umtreibt. Die Taschen blieben zunächst unbeachtet und unausgepackt, so viel hatten die Kusinen sich zu erzählen. Dann unterbrach Leila abrupt das Geplauder.
«Wolltest du dich nicht noch umziehen und vorher ein bisschen waschen, liebes Minchen? Meine Mutter würde das sicher zu schätzen wissen. Quasseln können wir später noch genug, meinst du nicht?»
Mit einem spitzbübischen Lächeln öffnete Leila eine beinahe unsichtbare Tapetentür und präsentierte der sprachlosen Wilhelmine ein Badezimmer, mit einer eigenen Toilette, einem Waschbecken, über dem ein Spiegel hing und sogar einer kleinen Badewanne.
«Da staunst du, was? Mama hatte die ewige Wasserschlepperei satt. Bis man die Wanne von Hand endlich gefüllt hatte, war jedes noch so heiße Wasser längst abgekühlt. Als man die Wasserleitungen in der Nachbarschaft verlegte, fackelte sie nicht lange und ließ sie bei uns auch legen. Puh, ich kann dir sagen, das war ein Lärm und ein Dreck, bis alles fertig war. Hat sich aber gelohnt, oder? Nun mach dich mal landfein und dann gibts endlich was zu futtern. Ich komme schon um vor Hunger!»
Leila schloss die Tür und Wilhelmine beeilte sich mit dem Umkleiden. Eine Katzenwäsche sollte fürs Erste genügen, denn Leilas Ankündigung, dass es bald etwas zu essen gäbe, ließ Minchens Magen nicht unkommentiert. Vernehmlich meldete er sich zu Wort. Mit einem sehnsüchtigen Blick auf die Badewanne verließ sie das Bad und eilte mit Leila ins Esszimmer, wo die Tante sie erwartete.
«Nehmt bitte Platz, damit Auguste das Essen servieren kann.»
Die Tante deutete auf die Stühle mit der eleganten hohen Lehne, die an der Längsseite des großen Esstisches standen. Sie selbst saß an der Kopfseite, wie es ihr als Hausherrin zustand. Einen Hausherrn gab es schon lange nicht mehr. Der nicht unvermögende Herr mit dem italienisch anmutenden Namen Joachim Clementi ließ seine Frau mit dem ungeborenen Kind zurück, als er im Jahre 1870 gegen Frankreich zog, in den letzten Tagen dieses Krieges von einer verirrten Kugel getroffen wurde und an Ort und Stelle verstarb. Dass ausgerechnet am Tage seines viel zu frühen Todes die kleine Tochter zur Welt kam, schien eine Ironie des Schicksals zu sein. Joachims Ehefrau Annemarie trug seitdem nur noch schwarze Kleidung und duldete nie wieder einen Mann in ihrer Nähe. Allein zog sie ihre Tochter auf und ließ ihr die beste Bildung angedeihen, die ihr möglich war. Das wusste Wilhelmine aus den Erzählungen ihres Vaters, der stets mit einer Mischung aus Bewunderung und Nachsicht von seiner jüngeren Schwester sprach. Das war für sie Grund genug gewesen, sich mit Leila heimlich in Verbindung zu setzen und nicht bei ihren Großeltern Unterschlupf zu suchen. Die befehlsgewohnte Stimme der Tante riss Wilhelmine aus ihren Gedanken.
«Auguste, du kannst auftragen», und zu Minchen gewandt meinte sie, «es wird heute nur ein schlichtes Abendessen geben. Unter der Woche, und wenn es keine Einladungen gibt, pflegen wir recht einfach zu speisen. Ich hoffe, du kannst dich damit anfreunden, meine liebe Nichte» und noch ehe das Mädchen Gelegenheit hatte zu antworten, hob die Tante ihr Glas, «Guten Appetit!»
Dass sich in den kostbaren Kristallgläsern nur reines Wasser befand, fiel Wilhelmine auf, ebenso wie das blütenweiße Tischtuch. Das schlichte Porzellan kam ihr, wie das Menü, alles andere als einfach vor. Nach der klaren Brühe servierte Auguste kleine, köstlich gefüllte Pastetchen, danach einen zarten Rinderbraten mit buntem Gemüse und Kartoffelpüree. Zum Nachtisch kamen eingemachte Mirabellen auf den Tisch. Wilhelmine fragte sich im Stillen, wie man im Hause Clementi wohl an Feiertagen zu speisen pflegte. Gesprochen wurde während des Essens nicht, die Tante legte gehobenen Wert auf Etikette. Das hatte Leila ihrer Kusine vorher noch rasch zugeflüstert. Dann, nachdem man in den Salon wechselte, kamen von der Tante die Fragen, vor denen sich Wilhelmine insgeheim gefürchtet und auf die sie sich ihre Antworten sorgfältig zurechtgelegt hatte.
«Liebe Nichte», begann Annemarie Clementi, «so gern ich dich hier bei uns aufnehmen will, es gibt doch einige Dinge, die ich mit dir klären möchte. Mir stellt sich vor allem die Frage, was dich mutterseelenallein und mitten im Winter nach Berlin führt. Wieso haben deine Eltern dich nicht angekündigt? Kannst du mir das beantworten?»
«Sehr gern, liebe Tante», auf dieses Thema hatte sich Wilhelmine vorbereitet und antwortete sofort, «Es ist sehr persönlich, deshalb wollte ich meine Gründe auch nicht einem Brief anvertrauen. Ich bitte dich um dein Verständnis. Mein langjähriger Freund, mit dem ich mich an Weihnachten verloben wollte, hatte sich kurzfristig entschlossen, seine Absicht Lehrer zu werden aufzugeben und statt dessen Jura zu studieren. Das liege ihm weit mehr, bat er um mein Verständnis. Doch ich wollte nicht noch länger auf ihn warten. So ein Jurastudium dauert viele Jahre und bis er als Anwalt ein eigenes Einkommen hätte und eine Familie ernähren könnte, müsste ich bei meinen Eltern ausharren. Diese Enttäuschung verwand ich nicht so schnell und bat deshalb die Eltern, für einige Zeit Kappeln verlassen und mich hier erholen zu dürfen. Kannst du meine Beweggründe nachvollziehen? Darf ich auf deine Erlaubnis hoffen, hierzubleiben? Ich wünsche mir nichts mehr als das, verehrte Tante.»
Annemarie ließ sich Zeit mit einer Antwort. Die lange Stille, die in dem eleganten Raum herrschte, machte Wilhelmine beklommen. Was käme auf sie zu, wenn die Tante ihr die Geschichte nicht glaubte und sie auf der Stelle nach Hause schickte? Wie sollte sie die Schmach überwinden, wenn sie bei den Eltern zu Kreuze kriechen müsste. Wären dann alle ihre Träume vorbei? Äußerlich ruhig, aber innerlich vor Angst bebend, wartete sie darauf, dass die Tante endlich sprach. Als sie die erlösenden Worte hörte, dass sie so lange bleiben könne, wie sie es wünsche, wäre sie vor Erleichterung beinahe in Ohnmacht gefallen. Eine seltsame Schwäche ergriff sie und ließ sie nach Leilas Hand greifen. Die kam ihrer Kusine zu Hilfe und erklärte ihrer Mutter, dass sie Wilhelmine liebend gern an ihrer Seite hätte.
«Zu zweit lernt es sich leichter, liebste Mama, du wirst sehen, dass ich die bevorstehende Prüfung auf meiner Schule mit Bravour abschließen werde.»
Darauf hatte Wilhelmine gehofft. Mit der Kusine gemeinsam lernen zu dürfen und sich dann selbst auf einer entsprechenden Schule für das Abitur anmelden zu können, das war der Grund, nach Berlin zu fahren. Alle heimlichen Sorgen und Ängste fielen von dem Mädchen ab. Eine bleierne Müdigkeit überkam sie und sie bat die Tante leise, sich zurückziehen zu dürfen, was ihr angesichts ihrer unübersehbaren Blässe auch gern gewährt wurde. Leila folgte Wilhelmine in das gemeinsame Zimmer und bald lagen die beiden Mädchen unter dicken Plumeaus in ihren warmen Betten. Leila schwatze drauf los. Wie sie ihr Berlin zeigen würde und wie sie die Kusine ihren Freundinnen vorstellen wollte. Leilas Stimme wurde leiser und Wilhelmine fiel in einen tiefen Schlummer, aus dem sie erst erwachte, als kalte Morgenluft sie weckte. Leila stand neben dem Bett und hielt lachend das prall gefüllte Federbett in der Hand.
«Steh schon auf, du Schlafmütze! Es ist heller Morgen und ganz Berlin wartet nur darauf, von dir erobert zu werden. Los, hoch mit dir, sonst....!»
Wilhelmine lachte, hellwach sprang sie auf, schnappte sich ein Kissen und warf es Leila ins immer noch lachende Gesicht. Dann schaute sie aus dem Fenster und jubelte. Über Nacht hatte es geschneit und Berlin hüllte sich wie eine Feenkönigin in schwanenweiße Kristalle aus Schnee.
«Ich bin hier, endlich in Berlin!», Wilhelmine spürte, wie sich eine lange verschlossene Tür in ihrer Seele auftat, «hier liegt meine Zukunft, so strahlend wie der Schnee und glänzend wie das Licht der Sonne, das sich darauf bricht. Warte nur, Berlin, ich komme ......!»
3. Kapitel
Kappeln, 18. Januar 1890
Innerlich zu Eis erstarrt, saß Friederike am Frühstückstisch und sah fassungslos ihrem Gatten zu, wie er es sich schmecken ließ und nun auch noch nach der Zeitung griff. Wie konnte er das tun? Während sie sich das Gehirn zermarterte, wo ihre Tochter hingegangen sein könnte, blieb Wilhelm kühl und teilnahmslos. Mit tränenerstickter Stimme bat sie ihn um Gehör.
«Wilhelm, wie kannst du nur so tun, als wäre nichts geschehen? Berührt dich das Schicksal unserer Tochter so wenig? Vielleicht lebt sie schon nicht mehr, ist irgendwelchen Verbrechern zum Opfer gefallen und wurde dahingemeuchelt, ohne dass wir ihr helfen konnten. Ach, mein armes Minchen. Warum durfte ich in deiner letzten schweren Stunde nicht bei dir sein! Musstest du so ganz ohne mütterlichen Beistand von dieser Welt scheiden?»
Sie brach ab, hörte verwundert Wilhelm lauthals lachen. Wie konnte er das wagen. Schon wollte sie aufstehen, ihm den Rücken zukehren und auf diese Weise ihre Verachtung zeigen, da fühlte sie seine warme, zuverlässige Hand auf ihrem Arm. Zärtlich besorgt schaute er sie an.
«Riekchen, mein armes Riekchen, verrenne dich nicht zu sehr in solche Hirngespinste. Weder wissen wir, wo Wilhelmine wirklich steckt, noch, ob ihr etwas zugestoßen ist. Vielleicht hat sie einen Galan gefunden, der ihr das Blaue vom Himmel versprach, und ist mit ihm über alle Berge. Oder sie hat sich nach Berlin davongemacht, weil sie glaubte, dort ihr Glück zu finden. Solange wir nicht wissen, wo sie ist und was sie von uns fortgetrieben hat, darfst du nicht denken, sie sei nicht mehr am Leben. Versprichst du mir das, bitte?»
Friederike nickte beklommen, die Worte blieben ihr im Halse stecken, sie ängstigte sich um ihr Kind. So sehr sie sich über ihren Mann ärgerte, sie konnte nicht umhin, ihm beizupflichten. Sich Gewissheit über den Verbleib Wilhelmines zu verschaffen, das schien das einzig Richtige. Wilhelm, der seine Frau gut zu kennen glaubte, erhob sich und hauchte ihr sanft einen Kuss auf die Stirn.
«Rieke, ich verlasse dich äußerst ungern in dieser heiklen Situation, aber der Herr Bürgermeister hat eine Sondersitzung für heute anberaumt, an der ich unbedingt teilnehmen muss. Bitte, habe dafür ein wenig Verständnis. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Vielleicht magst du Meta fragen, ob Jan ihr, als seiner Mutter, etwas mitgeteilt hat. Es wäre immerhin eine Möglichkeit!»
Friederike nickte erneut, versuchte, ihn zu verstehen, doch schon traten ihr die Tränen wieder in die Augen und hinderten sie am Antworten. Ein letzter Kuss, ein sanftes Streicheln über Riekes Hand, dann verließ Wilhelm den Raum. Als sei mit ihm jeder Halt verschwunden, brach Friederike nun zusammen und weinte. Janne, die den Esstisch abräumen wollte, sah sich das Elend nicht lange an, sondern lief rasch hinüber zur Nachbarin.
«Frau Paulsen», rief sie laut, als sie ohne anzuklopfen in den Flur des Nachbarhauses stürmte, «kommen Sie, schnell, meine Madame braucht sie, jetzt, dringend!»
Meta Paulsen kam aus der Küche, wischte sich die nassen Hände an ihrer Schürze ab und folgte Janne, die bereits wieder auf dem kurzen Weg nach Hause war. Ohne lange zu fragen, begab sich die stattliche Blondine, in den Salon, wo Friederike die Arme auf den Tisch gelegt und ihren Kopf darauf gebettet hatte. Das krampfhafte Zucken ihres Rückens verriet, dass sie immer noch weinte. Meta, Riekes Nachbarin und beste Freundin, seit die junge Frau mit ihrem Wilhelm aus Berlin in die kleine Stadt an der Schlei gezogen war, zog sich einen Stuhl heran und legte ihren Arm tröstend um Riekes schmale Schultern. Ihr blonder Schopf mischte sich mit den kastanienbraunen Locken Friederikes, die klein und zierlich war, wo Meta groß und stattlich erschien.
Der äußere Unterschied spielte bei ihnen nie eine Rolle. Sie verstanden sich von der ersten Begegnung an und Jan, Metas Sohn, wurde schnell der beste Freund und Beschützer von Riekes drei Jahre jüngerem Töchterchen. Eine Verlobung der beiden war geplant, doch seit Jan kurz nach Weihnachten Hals über Kopf abgereist war, stand der Termin in den Sternen. Endlich versiegten Riekes Tränen und sie berichtete Meta, dass Minchen fortgelaufen war. Wortlos hörte die Freundin zu, erst als Rieke geendet hatte, äußerte sie sich dazu.
«Du Ärmste, das muss dich schrecklich mitnehmen. Hat Wilhelmine keine Nachricht hinterlassen? Gibt es nichts, was darauf hinweisen könnte, wo sie sich hinwenden wollte? Hast du ihr Zimmer gründlich durchsucht?»
«Oh, nein, dazu fühlte ich mich noch nicht in der Lage», Rieke schluchzte erneut und sah hilfesuchend zu Meta auf.
«Dann sollten wir es jetzt gemeinsam angehen, was meinst du? Vielleicht finden wir ja einen Fingerzeig, aus dem wir schließen können, was sie vorhatte.»
Miteinander durchsuchten die beiden Wilhelmines Zimmer. Immer wieder kam von der einen oder der anderen ein leiser Aufschrei.
«Rieke, weißt du noch, als mein Jan deinem Mädchen dieses Schaukelpferd geschenkt hat, weil Minchen unbedingt reiten lernen wollte?»
«Oh ja, was hat mein Kind dieses Ding geliebt, obwohl es eher einem Esel glich, als einem Pferd.»
«Schau mal, Meta, hier ist eine Schachtel, in der Minchen alles Mögliche aufbewahrt hat. Sie hat es so schön mit Goldpapier beklebt, sieh nur!»
«Ich weiß noch gut, wie Jan mir das feine Papier abgeschwatzt hat, das ich eigentlich für den Christbaumschmuck brauchte. Es war eine wunderbare Zeit, mit unseren Kindern», seufzte Meta und Rieke stimmte ihr zu.
«Zu schade, dass sie viel zu schnell vorüber ging, diese Kinderzeit. Jetzt sind die beiden erwachsen oder glauben, es zu sein und gehen ihre eigenen Wege. Leider wird daraus kein gemeinsamer Weg, das zeigt uns das Verschwinden meines Mädchens deutlich. Wenn ich nur wüsste, welchen Irrweg das Kind eingeschlagen hat.»
Schon rannen ihre Tränen wieder und Rieke sank schluchzend auf das Bett. Meta setzte sich neben sie und versuchte, die Freundin abzulenken.
«Liebes, es hat keinen Sinn, hier kopflos weiterzusuchen. Du weißt am besten, was Minchen gehört und was jetzt fehlen könnte. Lass uns gemeinsam die Sache angehen und gezielt überlegen. Einverstanden?»
Friederike nickte ergeben, sie befürchtete nach wie vor, dass ihr Mädchen sich etwas angetan haben könnte. Meta, die Praktische, zählte nun einzelne Dinge auf, von denen sie glaubte, dass Minchen sie mitgenommen habe.
«Hat sie einen eigenen Koffer? Nein? Aber eine Reisetasche? Ja? Wo bewahrt sie das Ding auf?»
Friederike deutete auf den Kleiderschrank, da fand sich nichts, was einer Reisetasche auch nur im entferntesten ähnelte. Meta fragte weiter, nach der Kleidung und den Toilettenartikeln. Es stellte sich schnell heraus, dass vor allem warme Kleidung fehlte und die notwendigsten Dinge wie Zahnbürste, Kamm und Bürste. Auch ein Paar festere Schuhe waren nicht aufzufinden. Das sah nicht nach Selbstmord aus, fand Meta. Das Bücherbord schien vollständig zu sein, aber in der Schublade des zierlichen Damenschreibtisches gähnte Leere.
«Aus welchem Grund hat Minchen ihre Schreibutensilien und all ihre alten Schulhefte mitgenommen», rätselte Friederike, «was will sie damit. Ist ihre Reisetasche nicht schwer genug? Was kann ihr daran so wichtig sein?»
Ratlos schaute Rieke die Freundin an. Meta überlegte, drehte jeden ihrer Gedanken hin und her, um Riekes Hoffnung nicht zu voreilig zu wecken.
«Dein Mädchen lernte doch immer gern. Wie oft saß sie noch bis vor kurzer Zeit mit Jan zusammen und bat ihn, sein Lernpensum mit ihr zu teilen. Schon von klein auf konnte man Minchens Wissensdurst kaum stillen.»
«Was willst du damit sagen?»
«Ich überlege mir, dass Minchen möglicherweise zu Jan nach Kiel gefahren ist, um sich dort nach einer weiterführenden Schule umzuschauen.»
«Ich weiß nicht recht», Rieke wiegte zweifelnd den Kopf, «wo sollte sie in Kiel unterkommen? Außer Jan kennt sie niemanden in Kiel, selbst auf Lehramt studieren kann sie nicht, weil sie kein Abitur hat. Es ihr zu ermöglichen, lag nicht in unserer Macht. Wie sehr ich das immer bedauert habe, weißt du genau.»
Meta musste ihr recht geben, Kiel schien nicht das geeignete Ziel zu sein. Wohin könnte das Mädchen sich sonst gewandt haben?
«Nach Berlin!» Beinahe gleichzeitig kam beiden Frauen dieser Gedanke.
«Ganz bestimmt ist Minchen nach Berlin», meinte Rieke, in der ein wenig Hoffnung aufkeimte, «sicher kriecht sie bei den Großeltern Schulze unter. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Von dort aus wird sie nach weiterführenden Schulen suchen. Ja, das wäre durchaus denkbar!»
Verflogen schien bei Friederike alle Traurigkeit, einer euphorischen neuen Zuversicht gewichen. Nur ungern gab Meta ihre Bedenken preis.
«Bist du sicher, dass Minchen auf gut Glück zu den Großeltern nach Berlin ist? Wird sie nicht vorher Kontakt aufgenommen und gefragt haben, ob sie dort auch wohnen darf? Wie lange mag sie ihr Fortgehen schon geplant und dir verheimlicht haben?»
Rieke hob den Kopf, auf einmal fiel ihr etwas ein.
«Meta, was ist eigentlich geschehen, zwischen deinem Jan und meinem Minchen? Wir haben völlig aus den Augen verloren, dass sie sich doch verloben wollten. Es muss doch irgendwo einen Zusammenhang geben, zwischen ihrer geplanten Verlobung, die jetzt zu Weihnachten hätte stattfinden sollen, dann verschoben wurde und dem heimlichen Verschwinden meines Mädchens. Hat Jan dir nichts gesagt? Er ist doch früher abgereist, als er eigentlich wollte.»
Meta überlegte, da gab es eine Bemerkung ihres Sohnes, der sie keine Bedeutung beigemessen hatte. Was war das? Es ging um sein Studium und darum, dass er sich die Erfüllung seines Kindertraums, als Lehrer selbst vor einer eigenen Klasse zu stehen, ganz anders vorgestellt hatte. Er bemängelte die leider immer noch herrschende Hierarchie der alten Männer, die den jungen Lehramtsanwärtern Steine in den Weg legten und bis heute nach Rang und Namen der Eltern fragten. Wenn er der Sohn eines Arztes, eines Professors, oder von einem Adligen wäre, dann läge eine rosige Zukunft vor ihm. Doch als Landei einfacher Herkunft hatte er nichts zu erwarten, außer einer Lehrerstelle irgendwo auf einem Dorf. So hatte Jan sich bei ihr beklagt. Warum war sie nicht darauf eingegangen, fragte sich Meta nun. Sie hätte ihm zuhören, ihm helfen müssen, schließlich war Jan ihr einziges Kind. Was sie davon abhielt, daran konnte sie sich nicht erinnern. Beschämt gestand sie Friederike ihr Versagen.
«Ach Meta, sieh dein Verhalten nicht als Versagen an. Da müsste ich mir doch auch Vorwürfe machen. Warum habe ich nicht gemerkt, dass Minchen sich mit Problemen herumschlug, die sie unmöglich alleine tragen konnte. Mütter sind auch nur Menschen und gerade um Weihnachten herum mit so vielen Dingen beschäftigt, dass sie kaum zum Atmen kommen. Unsere Kinder haben die Sache, um was es auch ging, unter sich geklärt. Sie sind alt genug und wir müssen uns nicht in alles einmischen. Natürlich finde ich es schade, dass Minchen mich nicht ins Vertrauen gezogen hat. Sie wird ihre Gründe gehabt haben. Aber sind wir beide denn nun schlauer? Kann es sein, dass Wilhelmine tatsächlich allein nach Berlin gereist ist? Oder hat Jan sie begleitet, weil auch er in Berlin sich ein besseres Vorankommen erhoffte?»
Meta, die sich erneut neben Rieke auf das Bett hatte sinken lassen, hob den Kopf und konnte sehen, dass die sonst so starke, tapfere Freundin ebenfalls geweint hatte. Das rührte Rieke zutiefst, war doch bisher meistens sie diejenige, die Metas Trost und Halt benötigte. Zärtlich strich sie über den Arm ihrer Freundin, griff in die Schublade von Minchens Nachttisch und reichte Meta wortlos ein Taschentuch. Die nahm es dankbar entgegen, schnäuzte sich laut und verzog ihr vom Weinen geschwollenes Gesicht zu etwas, das wohl ein Lächeln sein sollte.
«Was wirst du jetzt tun?», fragte sie nach einer Weile, «unsere Vermutung, dass Minchen bei ihren Großeltern ist, bleibt solange unklar, bis du nachgefragt hast, ob deine Schwiegereltern etwas über Wilhelmines Verbleib wissen. Am besten wäre es, du würdest sofort einen Brief nach Berlin senden.»
«Ja, Meta, das mache ich, auf der Stelle. Wie spät ist es? Wird die Post heute noch befördert? Ich schreibe gleich an Großmutter Schulze. Je schneller der Brief in Berlin ankommt, desto eher erhalten wir Antwort. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass es Minchen in der großen Stadt gut geht.»
Eifrig erhob sich Friederike und eilte hinunter in ihren Salon, wo sie sich auf der Stelle ans Schreiben machte. Meta, die ihr kopfschüttelnd folgte, schien sie vergessen zu haben. Die Freundin nahm es lächelnd hin, sie kannte die impulsive Rieke und trug ihr dieses Benehmen nicht nach. Auch sie nahm sich vor, Jan einen Brief zu schreiben, um ihn über Minchens Verschwinden zu informieren. Aber, befand Jan noch in Kiel? Konnte er nicht mit Wilhelmine gemeinsam nach Berlin gereist sein? Diesen Gedanken schob Meta beiseite, sie wollte sich mit Rieke erst beratschlagen, wenn Jan eine Antwort sandte.
Als Wilhelm Schulze am Abend nach Hause kam, fand der zu seiner Überraschung eine muntere Friederike vor, die ihm einen Glühwein servierte.
«Womit habe ich eine solch unerwartete Köstlichkeit verdient? Eigentlich erwartete ich, dich in Tränen aufgelöst vorzufinden. Ist unser Minchen etwa schon wieder von ihrem unbedachten Abenteuer zurück?»
«Aber Wilhelm, wie sollte sie so rasch nach Hause kommen. Sie wird wohl soeben erst in Berlin eingetroffen sein.»
«Wieso in Berlin eingetroffen? Das verstehe ich nicht», fragte er verblüfft, «was macht Minchen in Berlin? Woher weißt du, dass sie dorthin will?»
Der Baubeamte verstand den raschen Stimmungswechsel seiner Frau nicht. Den Glühwein ließ er sich dennoch schmecken und hörte den weitschweifigen Erklärungen Riekes zu.
«Aha», meinte er nach einer Weile, während der heiße, gewürzte Wein Wirkung zeigte, «ihr Mütter habt also aus dem Verschwinden Minchens und den wenigen Dingen, die sie mitnahm, geschlossen, dass sie zu meinen Eltern gereist sein muss. Wenn dem so ist, dann können wir beruhigt sein. Hast du schon nach Berlin geschrieben?»
Rieke nickte, die Tochter lebte, so glaubte und hoffte sie, und war bei den Großeltern in guten Händen. Der Friede im Hause Schulze schien fürs Erste wieder hergestellt.
4. Kapitel
Berlin, Ende Januar 1890
Wilhelmine erwachte jäh! War sie wirklich noch einmal eingeschlafen, nachdem Leila sie geweckt und ihr mitgeteilt hatte, dass sie zur Schule müsse, am Nachmittag aber Zeit für die Kusine habe?
«Mit meiner Mutter brauchst du heute Vormittag nicht zu rechnen, sie schläft gerne lange, besonders, wenn sie die halbe Nacht mit dem Lesen ihrer heißgeliebten Liebesromane verbracht hat. Am besten, du gehst zu Auguste in die Küche und lässt dir von ihr ein Frühstück servieren. Wir sehen uns später, Tschühüss!»
Weg war sie und Wilhelmine, der die lange Bahnfahrt noch in den Knochen steckte, drehte sich im warmen Bett genüsslich noch einmal um und schlief gleich wieder ein. Als sie erneut erwachte, knurrte ihr Magen vernehmlich. Sie rief ihn zur Ordnung und genoss das Bad im angrenzenden Badezimmer. Dann fühlte sie sich bereit für ihren ersten Tag in Berlin. Vorsichtig öffnete sie die Tür und lauschte. Aus dem Schlafzimmer ihrer Tante kamen unmissverständliche Schnarchgeräusche. Minchen schlich auf Zehenspitzen daran vorbei, tappte leise die Treppe hinunter und suchte die Küche. Viel hatte sie gestern Abend von der Wohnung nicht mitbekommen, nur dass die Räume hoch und mit reichlich Stuck verziert waren. Sie orientierte sich kurz und kam zu einem Raum, der den repräsentativen Teil der Wohnung, der zur Straße hin lag, mit den Zimmern verband, die zum Hof hin schauten. Erst später sollte sie erfahren, dass man dies ein «Berliner Zimmer» nannte, in dem die Familie sich unter der Woche meistens aufhielt. Den Salon nutzte man nur für festliche Gelegenheiten. In diesem Zimmer herrschte Unordnung. Auf dem großen Tisch in der Mitte stand noch immer das benutzte Frühstücksgeschirr von Leila. Wilhelmine schüttelte den Kopf, wollte gerade danach greifen, da erschreckte sie eine leise Stimme.
«Suchste mich? Dann komm mal mit, ich zeig dir, wo du lang musst!»
In der Tür, die vermutlich in die Küche führte, stand das dünne Mädchen, das gestern das Abendessen serviert hatte. Es winkte auffordernd, dass sie ihm folgen solle und der Hunger, den sie jetzt nicht mehr ignorieren konnte, trieb sie hinter dem Dienstmädchen her. Minchen lachte verlegen. Sie wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte.
«Du bist Auguste, ja? Könntest du mir vielleicht noch ein kleines Frühstück zubereiten? Bitte, ich komme um vor Hunger, verstehst du?»
«Du kannst ruhig Juste sagen, so nennen sie mich hier in Berlin alle. Keiner sagt Auguste zu mir, außer meiner Gnädigen», das Mädchen lächelte schief und offenbarte dabei eine Zahnlücke, «was willste denn, Kaffee ist noch da, Brot auch und ein paar Eier haue ich dir noch in die Pfanne, wenns recht ist. Morgens gibt das nichts Großes, ist auch gut, hab ich doch massig Arbeit mit der Wohnung und dem Einkaufen und so.»
Fasziniert schaute Minchen zu, wie das Mädchen, Juste, wie sie sich nannte, im Handumdrehen ein Frühstück herbeizauberte, ohne dass ihr Mund auch nur eine Sekunde stillstand. Alles verstand sie nicht, was Juste von sich gab, aber sie konnte sich das Meiste zusammenreimen.
«Willste hier essen? Ich muss noch das Berliner Zimmer aufräumen. Oder bist du so etepetete, dass dir die Küche nicht gut genug ist?»
«Das ist in Ordnung, liebe Juste, lass mich ruhig hier. Ich helfe dir auch gern nachher beim Saubermachen», wandte Minchen ein, «ich wüsste sowieso nicht, was ich sonst anfangen sollte.»
Juste widmete sich dem Abwasch und nachdem Minchen sich das gute und reichhaltige Frühstück hatte schmecken lassen, griff sie zum Abtrockentuch.
Justes Geplapper hörte nicht auf und das Kappelner Mädchen erfuhr dabei manches, was in dieser Großstadt gang und gäbe zu sein schien. Am meisten verblüffte sie, dass Juste auf einem Hängeboden schlief. Auf Minchens Frage hin, wo sie als Dienstmädchen ihr Zimmer habe, lachte sie laut.
«Was denn, ich? Eine Kammer für mich allein? Ne, guck mal da rauf, da schlaf ich, jedenfalls im Winter», sie deutete nach oben, zur Küchendecke, wo über dem Herd ein breites Brett eingezogen war, «da gehts die Leiter rauf und dann da oben ins Bett. Willste mal sehen?»
Das ließ Minchen sich nicht zweimal sagen, kletterte geschwind die schmale Leiter hinauf, die hinter einem Vorhang verborgen stand, und staunte über den winzigen Raum, der Justes Reich darstellte. Nur eine dünne Matratze lag da, ein Kissen und eine Decke darauf. Kaum mehr als einen Meter Höhe hatte die Schlafgelegenheit, schätzte Minchen. Sitzen konnte man dort kaum, vom Stehen gar nicht zu reden. Das war alles, was Juste an Rückzug und Schlafstelle blieb. Minchen tat das Mädchen leid. Doch es lachte nur und hob gleichgültig die Schultern. Das Leben hatte Juste bisher nicht verwöhnt.
«Is doch gemütlich warm da oben, was willste mehr. Bei mir daheim lagen wir vier Geschwister in einem Bett und das war noch richtig komfortabel, sag ich dir. Find ich ganz großartig, dass ich hier so prima untergekommen bin. Mit die Gnädige ist gut auskommen, kannste mir glauben. Und das Fräulein Leila, die hält dicht, wenn mal was schiefgeht, verstehste?»
Gemeinsam machten sich die beiden Mädchen über das Aufräumen und die Vorbereitungen für das Essen her. Juste redete und redete und Wilhelmine erfuhr, dass sie erst vierzehn Jahre alt war und aus Brandenburg stammte. Das kleine Dorf, gleich hinter der Grenze zur Hauptstadt, bot Auguste, wie vielen anderen Mädchen vom Land, kaum ein Auskommen. Arbeit fanden sie nur in Berlin, wenn sie sich nicht schnell einen Bauernsohn angelten, dessen Hof groß genug war, dass er eine Familie ernähren konnte. Auguste hatte das Glück leider nicht gepachtet, erzählte sie, ließ sich aber keine Trauer anmerken. Mit zwölf Jahren kündigte ihr die Frau des Dorfschullehrers, bei der sie zwei Jahre als Kindermädchen in Stellung gewesen war. Eine Begründung gab es nicht von der strengen Dienstherrin, der Eintrag in ihr Gesindebuch, ohne das sie keine weitere Anstellung bekäme, ließ kurz und knapp ahnen, dass Auguste ihre Arbeit zur Zufriedenheit ausgeführt habe.
«Da musste ich also meine Sachen packen, viel war es ja sowieso nicht, und mein Zuhause verlassen. Niemand fragte, ob ich weggehen wollte, die Eltern waren froh, einen unnützen Fresser weniger im Haus zu haben. Ohne Lohn, auch wenn ich nur für Kost und Logis schuftete, wie bei den Lehrers, zählte ich doch nichts, als Mädchen sowieso nicht.»
Auguste brach ab und Wilhelmine glaubte, Tränen in ihren müden Augen zu sehen. Der unermüdliche Redefluss sprudelte weiter. Beinahe emotionslos berichtete das Dienstmädchen von der Ankunft in der großen Stadt, von ihrer Verwirrung und ihrer Ratlosigkeit.
«Am Bahnhof stand ich da, wie bestellt und nicht abgeholt und wusste nicht wohin. Da kam eine Dame, jedenfalls dachte ich das damals, und fragte, ob ich mit ihr kommen wolle, sie suche gerade ein Mädchen. Was sollte ich machen, draußen wurde es schon dunkel und ich wusste nicht wohin. Also ging ich mit und blieb über ein Jahr bei der Frau, bis ich dann in arge Not geriet.»
Wieder stockte Juste, griff nach dem Staubwedel und marschierte den Flur entlang in den Salon, wo sie sich, scheinbar mit Feuereifer, über all den Nippes hermachte, der Büffet und Schränke zierte.
«Wenn du willst, kannst du den Tisch polieren», rief sie Minchen über die Schulter zu und warf ihr geschickt ein weiches Tuch hin, «der ganze Kram hier kostet viel zu viel Zeit, soll aber immer picobello aussehen, sagt unsere Gnädige. Dabei kommt so selten Besuch, dass der Salon kaum gebraucht wird. Na, mir solls recht sein, so hab ich weniger Arbeit damit.»
Minchen schnappte sich das Tuch und wienerte die Tischplatte, bis das schön gemaserte Holz glänzte. Den zahlreichen Verzierungen und Schnörkeln an Kommode und Schrank widmete sie sich ebenfalls mit großer Sorgfalt. Wie gut sie das Mädchen verstand, war es ihr bei ihrer eigenen Ankunft am Bahnhof in Berlin ähnlich ergangen. Welch ein Glück sie gehabt hatte, nicht einer solchen hinterhältigen Frau in die Hände zu fallen, das ahnte sie nicht. Im Stillen hoffte sie, dass Auguste weitere Einzelheiten aus ihrem Leben berichten würde. Die Diskrepanz, die ihr aufgefallen war, zwischen dem jetzigen Alter des Mädchens und dem, an deren Anreise, machte sie stutzig. Doch Juste schwieg beharrlich. Wo sie sich aufgehalten hatte und was ihr widerfahren war, in dem knappen Jahr, bevor Minchens Tante sie zu sich holte, das behielt sie für sich. Wilhelmine tröstete sich damit, dass Leila vielleicht mehr darüber wüsste.
Es wurde Nachmittag, draußen fiel der Schnee in dicken, nassen Flocken, als die Wohnungstür sich öffnete und eine pudelnasse Leila den Schal von den Haaren zog und sich schüttelte wie ein Hund.
«Bäh, was für ein Wetter, da sollte man lieber hinter dem Ofen bleiben, so wie du Kusinchen. Na, was hast du die ganze Zeit getrieben?»
Gerade als Minchen eine Antwort auf Leilas lautstarke Frage geben wollte, öffnete sich die Schlafzimmertür und die Tante schaute mit vom Schlaf zerzaustem Haar und geröteten Augen heraus.
«Bitte Kinder, nehmt doch ein wenig Rücksicht auf eine alte Frau. Meine Migräne hat mich leider fest im Griff. Ihr müsst heute ohne mich auskommen. Auguste, du weißt ja, was mir hilft. Bereite mir einen Tee zu, du weißt, den gegen die Kopfschmerzen und dann möchte ich nicht mehr gestört werden!»
Beide Hände theatralisch an die Schläfen gepresst, wankte die Tante zurück in ihren Schlafraum. Leila verdrehte die Augen und verbiss sich ein Lachen. Mit Staunen hatte Minchen dieser Szene beigewohnt. Migräne, die kannte sie nur vom Hörensagen, wenn ihre Mutter mal wieder den Besuch bei der Gattin des Bürgermeisters verschieben musste, weil diese zartbesaitete Frau sich einmal mehr hinter ihrer Migräne versteckte. Dass die wesentlich kräftigere und energischere Tante, ebenfalls unter dieser mysteriösen Erkrankung litt, wollte Minchen nicht so recht in den Kopf. Vor allem Leilas Reaktion verwirrte sie. Die eilte voraus in die Küche, wo sie sich über einen großen Topf beugte, den schweren Deckel abhob und den Inhalt genüsslich begutachtete.
«Na, wenigstens was Anständiges zu essen kriegt man in diesem Haus», mit diesen Worten schnappte sie sich einen Teller vom Bord und füllte sich eine ansehnliche Portion des deftigen Eintopfes auf, «Minchen, worauf wartest du? Hier bedient sich jeder selbst, wenn Mutter ihre Migräne hat, sonst wäre ich schon lange verhungert. Juste hat viel zu viel um die Öhrchen, um uns zwei auch noch zu bedienen. Du wirst bestimmt bald merken, wie hier der Hase läuft.»
Wilhelmine folgte dem guten Rat der Kusine und verschob ihre dringenden Fragen auf später. Leila berichtete unterdessen von ihrer Schule, einer Anstalt für höhere Töchter, die sich dort auf ihr Pudding-Abitur vorbereiten konnten, wie es unter den Mädchen spöttisch genannt wurde. Bald müsste sie sich der Abschlussprüfung stellen und dann hätte sie endlich ihre Ausbildung beendet.