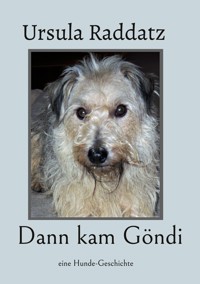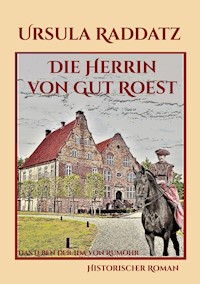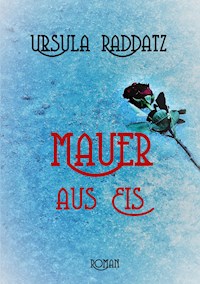Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eine Familie zwischen Kappeln und Berlin
- Sprache: Deutsch
Friederike Schulze, ein echtes Berliner Großstadtkind, folgt im Mai 1870 ihrem frisch angetrauten Ehemann in die Stadt Kappeln. Sie hat keine Ahnung, was sie dort erwartet, denn Kappeln hat soeben erst das preußische Stadtrecht erhalten. Friederike fühlt sich fremd in dem kleinen Ort, der erst zu einer Stadt werden soll und in dem Land zwischen Nord- und Ostsee, dessen Menschen, Sprache und Tradition sie nicht versteht. Von anfänglichem Heimweh geplagt, erzählt sie, was sie erlebt. Unheil verfolgt sie, aber auch Freundschaft und Liebe lernt sie kennen. Ein Kind wird geboren, doch Berlin und die Eltern sind weit weg. Immer wieder fühlt sie sich bedroht und weiß selbst nicht, ist es Einbildung oder ist es Realität? Steht ihr Ehemann an ihrer Seite? Wird sie mit der Hilfe der Nachbarin Meta die Stadt Kappeln und das Land Angeln kennen und lieben lernen? Darf sie ihre Träume leben oder muss sie sich unterordnen? Ein Frauenleben, wie wir es uns heute kaum mehr vorstellen können, verbindet sich hier mit einem Stück Kappelner Stadtgeschichte, nachdem am 7. März 1870 aus dem Flecken Cappeln in Schleswig-Holstein die Stadt Kappeln wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchbeschreibung:
Friederike Schulze, ein Berliner Großstadtkind, folgt ihrem frisch angetrauten Ehemann im Mai 1870 in die Stadt Kappeln. Sie ahnt nicht, was sie dort erwartet, denn Kappeln hat soeben erst das preußische Stadtrecht erhalten. Friederike fühlt sich fremd in dem kleinen Ort und in dem Land zwischen Nord- und Ostsee, dessen Menschen, Sprache und Tradition sie nicht versteht.
Von anfänglichem Heimweh geplagt, erzählt sie, was sie erlebt. Unheil verfolgt sie, aber Freundschaft und Liebe umgeben sie auch. Ein Kind wird geboren, doch Berlin und die Eltern sind weit weg. Immer wieder fühlt sie sich bedroht und weiß selbst nicht, ist es nur Einbildung oder ist «der schwarze Mann» Realität? Steht ihr Ehemann an ihrer Seite? Wird sie mit der Hilfe der Nachbarin die Stadt Kappeln und das Land Angeln kennen und lieben lernen? Darf sie ihre Träume leben oder muss sie sich unterordnen?
Ein Frauenleben, wie wir es uns heute kaum vorstellen können, verbindet sich hier mit einem Stück Kappelner Stadtgeschichte und wird in diesem Buch erzählt, als sei man dabei gewesen, 150 Jahre nachdem am 7. März 1870 aus dem kleinen Flecken Cappeln in Schleswig-Holstein die Stadt Kappeln wurde.
Personenregister:
Fiktive Personen:
Friederike Schulze geb. Lavalle - * 28.02.1852 in Berlin
Georg Lavalle, Vater
Luise Lavalle, Mutter
Wilhelm Schulze, * 05.09.1842 in Danzig
Otto Schulze, Vater
Marie Schulze, Mutter
Wilhelmine (Minchen) Schulze, * 18.01. 1872 in Kappeln Einziges Kind von Friederike und Wilhelm
Meta Paulsen geb. Steen * 25.02.1851 in Kappeln
Friederikes Nachbarin und Freundin in Kappeln
Jes Paulsen, Metas Mann, 14.04.1844 in Kappeln
Viehhändler und Gastwirt
Jan Paulsen, * 01.07. 1867 in Kappeln
Sohn von Meta und Jes
NielsWulf, * 09.11.1848 in Kiel – Gehilfe von Wilhelm Schulze
Mia, Friederikes erstes Dienstmädchen
Janne, Friederikes zweites Dienstmädchen
Malwine, ehemalige Schulfreundin aus Berlin
Berta – Ehefrau des Schulleiters
Ottilie – Ehefrau des Bürgermeisters Rathlev
Emilie– Ehefrau des Bürgermeisters Viereck
Gertrud – Ehefrau des Pastors
Luise – Ehefrau des Polizeioberen
Georg Rodensee, Lehrer in Kappeln
Hinnerk Jacobsen und Amalie Peters, Brautpaar
Reale Personen:
Überregional:
König WilhelmI. von Preußen * 22.03. 1797 – + 09.03. 1888
König Friedrich III. von Preußen * 18.10.1831 – + 15.06. 1888
König WilhelmII. und deutscher Kaiser * 27.01.1859 – * 04.06. 1941
Kaiser Napoleon III. von Frankreich * 20.04. 1808 – + 09.01.1873
Otto von Bismarck, Reichskanzler * 01.04.1814 – + 30.06. 1898
In Kappeln:
Hugo Emil von Buchwaldt Hardesvogt und Amtsrichter
Bürgermeister Rahtlev, vor 1870 Hardes- und Fleckensvogt
Bürgermeister und Rathmann Viereck, bis 1890,
Carl Eduard, Claussen Rechtsanwalt und Fabrikant
Poppenhusen, Vereinslokal-Inhaber
Otto Köhnke, Tierarzt und Fotograf
Julius Thomsen, Arzt und Kreisphysikus
Otto Spliedt, Arzt ab 1861 in Kappeln
Peter Thomsen, Müller und Erbauer der Mühle Amanda
Oluf Bentien, Gründer des Schützenvereins
Emil Hieronymus Kurth, Eisenbahndirektor
Jens Petersen, Inhaber des Schauspielhauses
Gruß an Kappeln
Von E. Arndt
Kennt Ihr die Stadt im schönen Angellande
wohin das Meer die blauen Fluten trägt?
Wo Stadt und Land vereint zum Freundschaftsbande,
ein jedes Herz in deutscher Treue schlägt?
Wo hoch am Strand die Dächer freundlich blinken,
in deren Schutz der Fischer friedlich lebt.
Wo auf der Schlei die weißen Segel winken,
darüber stolz die schlanke Möwe schwebt?
Es kehrt der Schiffer heim aus fernen Landen
zur kurzen Rast am trauten Heimatstrand.
Vergessen ist das Leid, das er bestanden,
schaut er auf´s neu die Stadt so wohlbekannt.
Er grüßt die heimatlichen Fluren wieder,
mit Freudentränen füllt sein Auge sich.
Gar lieblich klingen ihm die Jugendlieder,
o du mein Kappeln, ach wie lieb ich dich!
Inhaltsverzeichnis
Prolog
1870 – die Ankunft
Ein halbes Jahr zuvor
1870 – Die fremde Stadt
1870 im Sommer – Krieg oder Leben?
1871 – Neue Zeiten
1872 – Vereine und Verbote
1873 – Einsamkeit
1874 – Zuhause, wo ist das?
1875 – ein Sorgenjahr...
1876 – Suchen hier und da...
1877 – Was bringt die Zukunft?
1878 – unruhige Zeiten
1879 – Feuersbrunst
1880 – Reales und Irreales
1881 – noch mehr Sorgen?
1882 – Möglichkeiten
1883 – Aktivitäten aller Art
1884 – Beginn und Vollendung
1885 – Gold und Silber und...
1886 – Beförderungen
1887 – Entäuschungen
1888 – Verbote und Enthüllungen
Das Jahr 1889 – Rückschau und Zukunft
Epilog
150 Jahre – Stadt Kappeln
Prolog
1870 – die Ankunft
Dunkelheit umgab mich, rabenschwarze Nacht! In tiefster Finsternis lag ich schlaflos da und fürchtete mich vor dem kommenden Morgen. Was erwartete mich dort draußen? Wie würde mich die fremde Stadt empfangen, von der ich bei unserer Ankunft so gut wie gar nichts sah? Mitten in der Nacht war unsere Kutsche endlich zum Stehen gekommen. Mühsam rappelte ich mich hoch, jeder Knochen in meinem Leib tat mir weh von dem stundenlangen Geruckel auf den schlechten Wegen. Es war stockfinster, als wir endlich in der Stadt Kappeln ankamen, und ich schaute mich verwundert um. Wo war die versprochene Straßenbeleuchtung? Und wieso schienen die Wege holprig und unbefestigt? Mein Gatte half mir aus der Kutsche und die wenigen Stufen hinauf, die wir im Dunkeln erkennen konnten. Ein Mann mit Nachtmütze und einem schlichten Umhang über dem Nachtgewand, öffnete eine knarrende Tür, kam uns mit einer einzigen brennenden Kerze entgegen, brummte Unverständliches und führte uns in eine winzige Kammer, in der nur ein Bett stand, ein etwas Breiteres zum Glück. Wilhelm, mein mir frisch angetrauter Gatte, zog nur die Stiefel aus und fiel, schon halb im Schlaf, auf die Bettstatt. Im Finstern, denn der Wirt, wenn er es war, nahm die Kerze wieder mit, entledigte ich mich rasch meiner Schuhe und der Röcke. Ohne Hilfe konnte ich das Korsett nicht ablegen, also streckte ich mich, so gut es ging, neben Wilhelm aus und versuchte einzuschlafen. Es gelang mir nicht, zu viele Gedanken liefen mir durch den Kopf.
Was tat ich nur hier, ich, Friederike Schulze, geborene Lavalle aus Berlin? Welches Schicksal hatte mich in diese fremde Stadt am Meer gespült? War mir an der Wiege gesungen worden, dass ich eines Tages mein geliebtes Berlin verlassen müsste, um in unbekannten Fernen mein Dasein zu fristen? Wie konnte ich ahnen, als ich mich vor nicht einmal einem halben Jahr mit meinem Wilhelm Schulze verlobte, dass ich seinetwegen vor diese unsagbar schreckliche Entscheidung gestellt würde? Hatten meine Eltern, die so ungemein stolz auf ihre hugenottische Abstammung waren, mich etwa nicht davor gewarnt, diesem schlichten preußischen Beamten, der dazu auch noch aus Ostpreußen stammte, mein Jawort zu geben? Aber nein, die liebe Friederike musste ja ihren Kopf durchsetzen. Tat es mir nun leid? Tat ich mir selber leid? Sah die Welt und vor allem diese fremde Stadt morgen früh, im hellen Tageslicht nicht vielleicht schon viel freundlicher aus? Schlaf endlich, befahl ich mir, doch Morpheus Arme wollten mich einfach nicht umfangen. Im unruhigen Dämmerschlaf sah ich wieder diesen jungen Mann vor mir, der mit uns im selben Eisenbahnabteil bis Schleswig gefahren war. Irgendetwas an ihm beunruhigte mich vom ersten Moment an. Im Halbschlaf verzerrte sich sein eigentlich recht ansehnliches Jungmännergesicht zu einer abscheulichen Fratze, sein schwarzes Haar mutierte zu einem struppigen Fell, er bleckte sein grausiges Wolfsgebiss, starrte mich mit glühenden Augen an und dann....dann packte er mich!
«Nein! Nein! Lass mich!»
Ich schrie und schlug nach ihm. Doch zwei starke Arme hielten mich fest.
«Rieke, Riekchen, wach auf! Du träumst!»
Wilhelm rüttelte mich wach. Erleichtert, dass es seine Arme waren, die mich umfangen hielten, ließ ich mich an seine Schulter sinken. Bei ihm fühlte ich mich geborgen und ich dachte noch, dass morgen wirklich alles anders aussehen würde, da schlief ich auch schon.
Seltsamerweise tauchte der junge Mann wieder auf, im Traum sah ich deutlich sein dunkelbraunes, wild gelocktes Haar, für einen Mann ein wenig zu lang, das Gesicht, glatt, ohne jeden Bartwuchs. Seine Augen aber, sie waren das Schrecklichste an ihm, sie schienen in einem unwirklichen Gelb zu glühen, das mich bis zum frühen Morgen begleitete und sich zu einem roten Schein veränderte.
Es war die Morgensonne, die mir ins Gesicht schien, durch das kleine schmutzige Fenster in dieser schäbigen Herberge....in dieser mir noch viel zu fremdem Stadt..
Ein halbes Jahr zuvor
1869 – Berlin, Verlobung zu Weihnachten
Kokett lächelte ich meinem Spiegelbild zu. Was ich sah, gefiel mir. Es gefiel mir sogar ausgesprochen gut, auch wenn meine Mutter, die hinter mir stand und mir das Korsett schnürte, missbilligend den Kopf schüttelte.
«Kind, ich verstehe dich nicht. Warum muss es dieser langweilige Beamte sein, den du unbedingt heiraten willst? So schön, wie du bist, hättest du ohne weiteres einen hochrangigen Offizier oder sogar einen Adligen, der beim König ein und aus geht, haben können.»
Stolz drehte ich mich weiter vor dem Spiegel. Mutter hatte recht, ich war schön und passte mit meiner zierlichen Figur perfekt zur heutigen Mode, die eine schmale Taille und eine graziöse Haltung vorschrieb. Mein hugenottisches Erbe konnte ich nicht verleugnen. War der Teint meiner Mutter noch eher mediterran und ins Olivfarbene spielend, so strahlte meine ebenmäßige Haut in hellen, zarten Goldtönen. Dunkles Gold leuchtete in meinen Augen und das volle lockige Haar schimmerte wie poliertes Mahagoniholz.
«Ach Mama!», ich drehte mich zu ihr um, «das verstehst du nicht! Wilhelm ist ein Mann, auf den ich mich immer verlassen kann. Er wird mich nie schlagen oder betrügen, er lässt mir sicher freie Hand im Haushalt und liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Ein hoher Offizier oder ein Adliger würde mich nur als Vorzeigeobjekt behandeln, als Mensch wäre ich ihm gleichgültig. Mein Wilhelm liebt mich und das allein ist mir wichtig. Begreifst du das, Mama?»
Luise Lavalle, meine liebe Mutter, seufzte. Sie kannte mich gut genug, um zu wissen, dass ich mich nicht von dem abbringen ließ, was ich mir einmal in den Kopf gesetzt hatte. So half sie mir, das elegante Kleid anzuziehen, dass ich heute zu meiner Verlobung tragen würde. Es war ein Traum aus fliederfarbener Seide, die meinen Teint strahlen ließ. Das knappe Oberteil, mit winzigen Perlen besetzt, betonte meine schmale Taille besonders gut und der weite Rock besaß eine halbrunde Schleppe, die elegant um meine Füße drapiert werden konnte. Es schien mir viel zu teuer, aber mein Vater Georg Lavalle, wie Mutter auch er ein Hugenottennachkomme, ließ sich das Glück seines einzigen Kindes etwas kosten. Aber auch er fand, ich hätte Besseres verdient, als einen Beamten der Berliner Baubehörde. Dass mein Wilhelm ein guter, ein studierter Ingenieur war, beeindruckte Vater nicht im Mindesten.
Es dämmerte draußen, Schnee fiel in zarten Flocken, die im bläulichen Licht der Gaslaternen wie Kristalle schimmerten, nur um unten auf den Gehwegen von zahlreichen eiligen Füßen zu grauem, unansehnlichen Matsch zertreten zu werden. Ungeduldig stand ich am Fenster und wartete auf Wilhelm, denn heute, am ersten Weihnachtsfeiertag sollte meine Verlobung sein.
Endlich läutete es an der Haustür, das Mädchen öffnete, nahm Wilhelm den warmen Mantel ab und geleitete ihn in den Salon, wo ich mit den Eltern auf ihn wartete. Liebevoll betrachtete ich ihn, während er Mutter mit einem galant angedeuteten Handkuss begrüßte und Vater ihm beinahe kameradschaftlich seine Hand reichte. Wilhelm war nicht besonders groß aber kräftig gebaut, mit breiten Schultern, an die ich mich so gern anlehnte. Die Arbeit auf dem Bau, die er in Vorbereitung auf sein Ingenieurstudium geleistet hatte, brachte ihm ein paar pralle Muskeln ein, die das schon vorhandene kleine Bäuchlein vergessen machten. Sein rundliches Gesicht strahlte Verlässlichkeit und Gemütlichkeit aus, das dunkelblonde Haar wich an den Schläfen bereits ein wenig zurück und ließ ihn über seine achtundzwanzig Jahre hinaus älter erscheinen. Den Schnurrbart trug er, wie unser König Wilhelm I. an den Spitzen hochgezwirbelt. Das gab ihm ein ungewollt militärisches Aussehen.
«Welch ein stattlicher Herr», dachte ich und freute mich darauf, bald seine Ehefrau zu sein. An Wilhelms Seite war mir ein sicheres Leben gewiss, niemals könnte ich mittellos auf der Straße landen, wie es einer ehemaligen Freundin geschehen war. Eine große, elegante Wohnung, natürlich mit einem Laufburschen und einem Dienstmädchen, stünde mir zu, und ich sah mich bereits als die mondäne Madame Schulze «Unter den Linden» flanieren.
Nach dem opulenten Mahl hielt Wilhelm in aller Form bei meinem Vater um meine Hand an. Der gewährte sie ihm gern und dann, mein Herz klopfte heftig, steckte mir Wilhelm den Verlobungsring an den Finger, einen Granat, in atemberaubendem rotem Feuer wie in leidenschaftlicher Liebe glühend und in zartes Gold gefasst. Mein Glück schien vollkommen. Noch lange saßen wir an diesem unvergesslichen Abend beisammen und planten unsere gemeinsame Zukunft. Niemand warnte uns, dass alles ganz anders kommen könnte.
Wilhelm versprach, sich nach einer geeigneten Wohnung umzuschauen, und meine lieben Eltern signalisierten ihre Bereitschaft, unsere Hochzeit zum kommenden Pfingstfest auszurichten. In dieser Nacht träumte ich von einer strahlenden Zukunft, in der mein Gatte sich einen Namen als Architekt für den König machte und wir bei Hofe eingeladen würden..
Das neue Jahr, das sich 1870 nannte, fing recht unspektakulär an. Erst als der Karneval zu Ende ging, kam Wilhelm mit nachdenklicher Miene bei uns an. Mutter und ich, wir saßen im Salon und stellten lange Listen für die Aussteuer zusammen. Mein Liebster setzte sich dazu und unterrichtete uns ahnungslose Frauen über die jüngsten politischen Entwicklungen in Preußen.
«Es tut sich was bei uns», begann er und hob die Stimme, «Preußen hat ja, seit es 1864 gegen Dänemark und 1866 gegen Österreich ins Feld gezogen ist, den Norddeutschen Bund zu einem einheitlichen Staat unter der Führung Preußens vereinigt. Alles Land zwischen der Mainlinie und Dänemarks Grenze an der Königsau, untersteht dem Bundeskanzler Otto von Bismarck. Der will die Monarchie erhalten und Preußen noch größer machen, zu einem deutschen Staat, der sich gegen Frankreich behaupten kann.»
«Ja, aber was soll das alles bedeuten?», fiel ich ihm in die Rede, «und was hat das mit uns zu tun? Berlin ist weit weg von Frankreich.»
«Das stimmt, liebe Friederike», meinte Wilhelm beruhigend, « aber nun kommt die Thronfolge-Frage in Spanien dazu. Ein Hohenzollernprinz ist im Gespräch. Der aber ist für Napoleon III. von Frankreich ein rotes Tuch, weil der sich dann von zwei Seiten von «Feinden» umklammert sieht. Verstehst du?»
Ich schüttelte hilflos den Kopf, diese höhere Politik begriff ich einfach nicht. Bismarck, Hohenzollern, Napoleon III., mir schwirrten die Namen durch meine Gedanken. Das Einzige, was mir dazu einfiel, war, dass Kaiserin Eugenie, die Gattin des Franzosenkaisers, eine der schönsten und am besten gekleideten Frauen Europas sei, neben Sissi, der österreichischen Kaiserin natürlich, die ich schon wegen ihrer unglaublichen Haarfülle bewunderte. Wilhelm lachte über meine Naivität. Mutter schwieg, wie immer bei solchen Gesprächen und Vater, der hinzugekommen war, meinte, dass wohl Krieg in der Luft läge. Wilhelm pflichtete seinem zukünftigen Schwiegervater bei,
«Bismarck wird das Feuer noch schüren, das unter dem französischen Thron schwelt. Und er will ein großes Deutsches Reich. Warten wir also ab, was geschieht.»
Lange sollten wir nicht warten müssen. Während ich den Gedanken an einen Krieg zugunsten meiner Hochzeit verdrängte, wurde Wilhelm direkt damit konfrontiert. Er, der immer freundliche und gutgelaunte Mann, kam Mitte März zu mir. Ich erschrak über sein bleiches Gesicht, in dem selbst der Schnurrbart traurig herabhing. Meine Eltern gesellten sich zu uns, auch Verlobte durften nicht zu lange allein gelassen werden. Mutter schickte das Mädchen nach einem Tee. Vater nahm eine bauchige Flasche aus der Anrichte und goss sich und Wilhelm einen alten Cognac ein. Mein Verlobter trank ihn in einem Schluck aus, atmete tief durch und sprach dann die Worte aus, die unser beider Leben für immer verändern sollten.
«Meine liebe Friederike, ich muss dir eine Frage stellen, die mir nur schwer über die Lippen geht. Man hat mich zur Armee abkommandiert. Es wird zu einem Krieg gegen Frankreich kommen und das Heer soll um alle Soldaten erweitert werden, die man irgendwie zu den Waffen rufen kann. Weil ich als Beamter sowieso dem Staat unterstehe, muss ich mich fügen, ob ich will oder nicht.»
«Um Himmels Willen», schrie ich voller Furcht auf, «was ist, wenn du fällst, wenn du in diesem Krieg stirbst, allein, irgendwo in der Fremde? Was wird dann aus mir? Wie soll ich nur weiterleben, ohne dich?»
«Kind, echauffiere dich nicht», Mutter blieb kühl, wie immer, «noch ist es ja nicht soweit und ich habe das Gefühl, dass dein Verlobter einen Ausweg weiß!»
«Sie sind eine sehr kluge Frau, verehrte Schwiegermama», Wilhelm deutete eine kleine Verbeugung in Mutters Richtung an, «es gibt in der Tat eine Wahl, die ich jetzt Ihrer Tochter vortragen möchte!»
Er stand auf und trat vor mich hin, nahm mein eiskaltes Händchen in seine warme, große, so ungemein zuverlässig wirkende Männerhand.
«Liebste, es gibt eine Möglichkeit, nicht als Soldat dienen zu müssen, aber dennoch unserem preußischen Vaterland Ehre zu machen», er schluckte, es schien ihm schwerzufallen, das auszusprechen, was nun folgte, «im Norden, in den neuen preußischen Gebieten, die einst zu Dänemark gehörten, gibt es seit kurzem Städte, die baulich noch viel zu wünschen übrig lassen. Es geht vor allem um die nötigen Verwaltungsgebäude. Dorthin soll ich nun als Baubeauftragter gehen, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, und Preußens Glanz und Gloria bis in den letzten Winkel Schleswigs zu tragen.»
Er schwieg und schaute mich fragend an. Was hatte das alles mit mir zu tun, fragte ich mich. Wenn er in den Norden ginge, bliebe ich doch ebenfalls hier allein zurück. Der Unterschied war nur der, dass er als Baubeauftragter nicht um sein Leben fürchten musste. Wilhelm spürte wohl, dass ich seinen Gedanken nicht Folge leisten konnte und fragte deutlicher nach.
«Willst du, Friederike, mit mir in den Norden ziehen, als meine Ehefrau?»
Verwundert starrte ich ihn an! Hatte er gerade gesagt, dass ich mit ihm von Berlin fortgehen soll? Wie könnte ich Berlin verlassen. Ich vergewisserte mich.
«Lieber Wilhelm, fragtest du mich soeben, ob ich mit dir in den Norden ziehen will? Aber warum denn nur, ich kann doch ein paar Wochen oder sogar Monate auf dich warten und schlimmstenfalls verschieben wir die Hochzeit eben, bis du wieder zurück bist.»
Wilhelm sah mich an, als zweifele er an meinem Verstand. Hilfesuchend schaute ich zu den Eltern hin. Mutter begriff anscheinend ebenfalls nichts und Vater wiegte bedenklich seinen Kopf hin und her. Ihm schien die Geschichte auch nicht zu gefallen.
«Friederike!» Wilhelm begann von vorn, «Es ist aber doch nicht mit ein paar Monaten getan. Es geht um große Bauvorhaben, das kann einige Jahre dauern. Möchtest du tatsächlich so lange auf mich warten? Was ist, wenn inzwischen einer kommt, der dir besser gefällt als ich? Dann komme ich zurück und du hast einen anderen geheiratet? Das würde mir das Herz zerreißen.»
Er brach ab, schaute mich flehend an und ich wusste nicht, was ich ihm antworten sollte. Ohne ihn mochte ich nicht sein, aber von Berlin fortgehen, das wollte ich auch nicht.
«Liebste», Wilhelm gab nicht auf, «wenn du nicht mitkommen willst, dann bleibt mir nichts übrig, als unsere Verlobung sofort zu lösen. Dann bist du frei, dir einen Anderen, einen Besseren zu suchen. Und ich», er rang sichtlich um seine Fassung und um die richtigen Worte, «ich weiß dann, dass du mich nie geliebt hast!»
Er drehte sich um, wollte fort, ohne meine Antwort abzuwarten, mit hängenden Schultern und todtraurigem Blick. Da hielt es mich nicht mehr. Ich stellte mich ihm in den Weg und küsste ihn, vor den Augen meiner Eltern.
«Wilhelm, ich komme mit dir, wenn es sein muss, bis ans Ende der Welt. Ich habe jetzt erst gespürt, was du für mich bist und dass ich nicht ohne dich leben mag, auch nicht in meinem geliebten Berlin.»
Da fiel dieser starke Mann vor mir auf die Knie und schluchzte. Als er sich ein wenig beruhigt hatte, nahm er meine Hand und ließ sie lange nicht los. Dann wurde geplant, gerechnet und aufgeschrieben. Mama schien in ihrem Element. Vater nahm den Kalender zu Hilfe und setzte den Hochzeitstermin fest.
Mutter war entsetzt! Blieben uns wirklich nur vier Wochen, um alles für eine Hochzeit zu regeln? Das schien unmöglich. Doch da Wilhelm am ersten Mai seinen Dienst in der neuen Stadt antreten sollte und vor Ostern eine Trauung nicht schicklich wäre, blieb nur der Sonntag nach Ostern, der 25. April als geeigneter Termin. Mir war es auf einmal egal, auch dass es eine kleine Hochzeit im engsten Kreis sein würde. Auch den Traum von einem verschwenderisch schönen Hochzeitskleid begrub ich ohne Zögern, wollte etwas Praktisches, dass ich später noch tragen könnte, eingefärbt vielleicht. Die Aussteuer, zum Glück so gut wie fertig, verpackte man gleich in Kisten, die eine lange Reise überstehen würden. Die Möbel, auch längst für die elegante Wohnung in der Nähe der Hackeschen Höfe ausgesucht, sollten mit uns auf die Reise in den Norden gehen.
Viel zu schnell verging die Zeit bis zur Eheschließung. Protestantisch, wie wir waren, reichte uns eine kurze Zeremonie. Nur das geplante Hochzeitsessen, das hatten meine Eltern sich nicht nehmen lassen, durften wir noch in Ruhe genießen. Was uns serviert wurde, vergaß ich gleich wieder, so angespannt war ich. Irgendwie freute ich mich auf die Reise in den unbekannten Norden und auf meine neue Rolle als Ehefrau, und doch fürchtete ich mich vor all dem Neuen, das da auf mich einstürmen würde. Da wir keine eigene Wohnung besaßen und die Eltern uns als letzten Liebesdienst eine angenehme Hochzeitsnacht bereiten wollten, fanden wir uns bald in einem luxuriösen Hotelzimmer wieder. Was dort vor sich ging, darüber schweige ich lieber. Nur so viel, dass mich Wilhelm mit Zärtlichkeit und Geduld in mein neues, aufregendes Eheleben einweihte. Der nächste Morgen und damit die Abreise kamen viel zu schnell. Eine letzte Umarmung für die Eltern, Küsschen für die Freundinnen, die mich um mein nordisches Abenteuer glühend beneideten, ein letztes Winken, ein langer Blick auf die zurückbleibende Stadt Berlin, dann trugen uns die Räder der Eisenbahn davon. Wir sahen uns an, lächelten, bis mir plötzlich etwas siedendheiß einfiel.
«Liebster, wie heißt eigentlich die Stadt am Meer, in die wir nun ziehen?»
«Ach du liebes Schäfchen, habe ich dir das noch nicht gesagt?» Mein Gatte lächelte, «wir fahren nach Kappeln, nach Kappeln an der Schlei!»
1870 – Die fremde Stadt
Eine frühe Maisonne leuchtete mir direkt ins Gesicht und verzauberte mit ihren Rosenfingern die triste Umgebung. Mühsam erhob ich mich aus dem Bett, spürte jeden Knochen im Leib, teils von der langen Fahrt, teils von dem klumpigen Strohsack, auf dem ich genächtigt hatte. Mein mir soeben erst Angetrauter schlief noch tief und fest, wie ich unschwer an seinem leisen Schnarchen feststellen konnte. Lautlos schlich ich zu dem kleinen Fenster, durch das die Sonne mich anlächelte. Doch das, was ich draußen erkennen konnte, ließ mein eigenes Lächeln gefrieren. Einen Weg sah ich, der die Bezeichnung Straße bei weitem nicht verdiente, uneben, voller Schlaglöcher und ohne jegliche Befestigung. Auf der anderen Seite hockte wie eine behäbige Kröte, ein kleines Haus unter seinem dicken Strohdach. Bäuerlich, keineswegs städtisch, so kam mir die Umgebung vor. Sollten wir vielleicht irgendwo am Stadtrand genächtigt haben? Lag die eigentliche Stadt seitab, meine Blicken verborgen? Ich überlegte, ob ich Wilhelm wecken sollte oder lieber nicht, da meldete sich recht vernehmlich mein Magen, hatte ich doch gestern vor Aufregung nicht viel zu mir genommen. Die Antwort auf mein Magengrummeln kam vom Bett, von Wilhelm, mit einem herzhaften Gähnen.
«Oh, guten Morgen, meine Liebste», Wilhelm schwang die Beine aus dem Bett, «hast du gut geschlafen? Wie geht es dir? Möchtest du noch einmal zu mir ins Bettchen?»
Die letzte Frage wurde von einem so unwiderstehlich schelmischen Grinsen begleitet, dass ich beinahe schwach wurde. Nur der Hunger hielt mich zurück.
«Wilhelm, ich sterbe fast vor Hunger. Bitte, steh auf und schau nach, ob wir in diesem seltsamen Etablissement so etwas wie ein Frühstück bekommen können!»
Mein Gatte sah mich an, ließ seinen Blick durch das ärmliche Zimmer schweifen. Dann stand er entschlossen auf und kleidete sich an.
«Bitte entschuldige, liebe Friederike, dass ich dir nichts Besseres bieten kann. Doch in dieser rückständigen Region gibt es nicht viele Gasthäuser. Nach vornehmen Hotels schaut man hier vergebens. Ich suche jetzt den Wirt und beim Frühstück beratschlagen wir dann, wie es weitergeht. Einverstanden?»
Was blieb mir anderes übrig. Ich kleidete mich an, so gut es mir möglich war ohne Hilfe, und wünschte mir, dass ich wenigstens ein Dienstmädchen aus Berlin mitgenommen hätte. Der Wirt servierte uns bald in der einigermaßen reinlichen Gaststube etwas, das wohl hier als Frühstück durchging, mir aber nach Haferbrei mit ein wenig Honig aussah. Der Kaffee schmeckte dagegen überraschend gut.
«Friederike», begann Wilhelm so vorsichtig, dass ich Böses ahnte, «ich muss dich leider gleich ein wenig allein lassen. Weil wir noch in Schleswig Halt machen mussten, um neue Instruktionen zu empfangen, bin ich mit meiner Ankunft hier schon einen Tag im Verzug. Der Herr Bürgermeister erwartet mich und ich darf ihn nicht warten lassen. Nach meinem Antrittsbesuch im Rathaus, das verspreche ich dir, zeige ich dir Kappeln. Bin selbst schon gespannt darauf, weil ich es auch noch nicht kenne. Du kannst dich ja derweil ein wenig in der näheren Umgebung umschauen. Es dauert auch bestimmt nicht lange!»
Ich nickte ergeben, was blieb mir anderes übrig? Nachdem mein Ehemann das Gasthaus verlassen hatte, zögerte ich nicht einen Moment, so sehr drängte es mich, die neue Umgebung anzuschauen, zu wissen, an welches Ende der Welt ich geraten sei. Schon der erste Schritt auf die Straße hinaus, bestätigte mir den Eindruck, den ich vorhin vom Fenster aus hatte. Der Weg war zum Glück trocken, aber nichts anderes als ein besserer Feldweg und die Häuser, die sich daran reihten, sahen nicht schöner aus, als die Kate gegenüber. Sie waren klein, mit Fachwerk gebaut und anscheinend mit Stroh gedeckt. Etwas größer schien mir das Haus nebenan zu sein. Langsam folgte ich dem Weg, der um die Ecke bog und hielt lachend inne. Da stand neben einer kleinen Treppe ein blaues Untier. Mit einer Krone auf dem Kopf riss es das Maul mit dem imponierenden Gebiss weit auf und zeigte eine lange rote Zunge. Ein Blick auf den Eingang des Hauses, das zu der wilden Bestie gehörte, zeigte mir, dass dies die Löwenapotheke sei.
«Aha», dachte ich, «so hat man sich hier also die Löwen vorgestellt, schon merkwürdig, weil ich richtige, lebendige Löwen bei uns in Berlin im Tiergarten oft bewundert habe.»
Immer noch kichernd bog ich um eine weitere Ecke und sah vor mir einen Fluss. Den wollte ich mir genauer anschauen und ging den etwas abschüssigen Weg weiter hinunter. Dann stand ich endlich am Ufer und wunderte mich über die Brücke, die diesen Fluss überquerte. Sie schien aus vielen Booten zu bestehen, die man nebeneinander gelegt hatte. Darüber zu laufen oder gar mit einer Kutsche auf die andere Seite zu fahren, stellte ich mir als ziemlich wackelige Angelegenheit vor. Neben dieser Brücke ragten kreuz und quer kurze Pfähle aus dem Wasser, auf den meisten hockten Möwen, die aber viel größer waren als ihre Verwandten in Berlin. Was es mit den Pfosten wohl auf sich hatte, fragte ich mich und sah eine Weile dem träge dahinfließenden Gewässer zu. Ein kühler Wind kam auf, ließ mich erschauern. Es war doch erst Anfang Mai, erinnerte ich mich selbst. Als ich mich umdrehte und zurück zum Gasthaus gehen wollte, fiel mir der große Kirchturm auf, der zu einem ebenso großen Gotteshaus gehörte und in einem Kranz aus Linden hoch über dem Ufer aufragte. Wie hatte ich diese Kirche nur übersehen können? Sie machte mich neugierig und ich nahm mir vor, sie so bald wie möglich zu besuchen. Ein neuerlicher Windstoß trieb mich schneller voran, die kleine Anhöhe hinauf und von dort kam mir auch schon mein Wilhelm entgegen.
«Liebste Friederike, ich habe dich bereits gesucht. Denk dir nur, der Herr Bürgermeister hat schon für uns ein Haus gefunden, hier ganz in der Nähe. So musst du nicht mehr lange in diesem ungemütlichen Gasthaus bleiben!»
Mein Gatte strahlte über sein ganzes liebes Gesicht und ich konnte nicht anders, ich musste mich einfach mit ihm freuen.
«Das ist wunderbar, Wilhelm», ich hängte mich bei ihm ein, «können wir uns das Haus gleich ansehen? Ja?»
«Nichts lieber als das», lachte mein Mann und zog mich mit sich. Es war wirklich nicht weit. Wir ließen die Apotheke zur Rechten liegen und wanderten weiter, der Straße folgend. Ich betrachtete die Häuser und fragte mich bang, welches davon ich bald bewohnen sollte. Alle schienen mir klein und auf altmodische Fachwerkart gebaut. Wilhelm blieb schon bald stehen und deutete auf das winzige Häuschen, das vor uns lag. Nach den großen Stadthäusern in Berlin, die ich gewohnt war, musste mir hier alles viel zu klein erscheinen.
«Schau, liebe Friederike, hier werden wir wohnen. Es liegt günstig, nicht weit von der Schlei, der Kirche, dem Markt und was es sonst noch so alles gibt in Kappeln. Und hier ist der Schlüssel zu unserem neuen Himmelreich!»
Er schien meine enttäuschte Miene gar nicht zu bemerken, schwenkte triumphierend den Schlüssel und öffnete damit eine, wie ich zugeben muss, schön geschnitzte Eingangstür.
«Bitte einzutreten Madame Schulze», galant nahm er meinen Arm und geleitete mich ins Innere des Hauses. Kritisch sah ich mich um, erschrak über die niedrigen Decken und die kleinen Fenster. Von Berlin war ich an hohe Räume gewöhnt, mit großen Fenstern, die oft auf die hell erleuchteten Straßen hinausgingen. Aber hier, hier gab es keinerlei Beleuchtung, auch drinnen nicht. Wie sollte ich hier meine Möbel unterbringen, die für eine Beletage in Berlin gedacht waren. Sie wären ganz bestimmt zu wuchtig, zu groß, zu hoch. Die Enttäuschung trieb mir die Tränen in die Augen und ich wandte mich ab. Wilhelm war mir schon vorausgeeilt und rief mich aufgeregt.
«Riekchen, komm, hier gibt es sogar einen richtigen Garten. Komm, sieh doch selbst!»
Betont langsam, um mich wieder etwas zu fassen, betrat ich das nächste Zimmer, das mir heller und lichtdurchfluteter erschien als das vordere. Durch die offene Tür sah ich Wilhelm, der mit weit ausgebreiteten Armen draußen stand, als wolle er die ganze Welt umarmen.
«Ein Garten, ganz allein für uns!», mit glänzenden Augen stand mein Mann dort und schien so glücklich zu sein, dass ich nicht anders konnte, als zu ihm zu gehen und mich in seine Arme zu schmiegen. Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen und genoss die warmen Sonnenstrahlen auf meinem Gesicht. Dann sah ich mich um und musste Wilhelm recht geben. Der Garten war das Schönste an diesem Haus. Im hellen Licht der Maisonne schienen die Blüten der Obstbäume von innen heraus zu leuchten und auf den Beeten lachten mir bunte Blumen entgegen. Am allerschönsten aber war der Blick auf den Fluss, der, so glaubte ich mich zu erinnern, Schlei hieß. Das zarte Blau des Himmels spiegelte sich in den sanften Wellen, die mit leisem Gluckern an die Ufer stießen. Hier, das ahnte ich nun, hier könnte ich glücklich werden.
«Mein Riekchen, Liebes», Wilhelm drehte mich zu sich herum und sah mir tief in die Augen, «ich sehe uns schon hier sitzen und unsere Kinder um uns herum, die in diesem Garten spielen werden.»
Ich errötete, wie konnte er jetzt schon an Kinder denken, wir waren doch erst ein paar Tage verheiratet. Doch dann schaute ich hinüber, in den Garten des Hauses nebenan. Da saß eine dieser schönen, stattlichen Blondinen, die man hier im Norden häufig antrifft. Sie lächelte zu mir herüber, ein wenig neugierig, wie mir schien. Ein kleiner hellblonder Junge, offensichtlich ihr Söhnchen, winkte mir zu. Ich sah Wilhelm an und wusste, er dachte, genau wie ich, daran, dass wir vielleicht bald auch so ein Kind unser eigen nennen würden. Dann gingen wir zurück ins Haus und machten Pläne, wie wir es einrichten könnten.
Später erklärte mir Wilhelm, bei einem recht frugalen Mittagessen, dass der Fluss, eigentlich gar keiner sei. Was wir in Zukunft vom Garten aus bewundern durften, ist ein Meeresarm. Die Ostsee, die zu meiner Enttäuschung etliche Kilometer weit entfernt lag, streckte diesen langen, schmalen Arm weit ins Land hinein, bis nach Schleswig, sagte mein Gatte, wo wir gestern waren. Mir fielen beinahe die Augen zu, nach der schlaflosen Nacht, doch das Leben gönnte mir keine Ruhepause. Als wir uns gerade erheben wollten, trat ein junger Mann in die Gaststube, den ich sofort wiedererkannte. Es war der Reisende, der schon mit uns im Zugabteil von Kiel nach Schleswig gesessen hatte. Mir fuhr der Schreck in die Glieder, war er mir doch in Wolfsgestalt in meinem grausigen Albtraum erschienen.
Freundlich lächelnd stellte er sich vor, seine Augen glühten keineswegs und auch seine Zähne schienen völlig normal. Vielleicht hatte mir nur meine tiefe Erschöpfung all dies im Traum vorgegaukelt.
«Gestatten Sie, verehrter Herr Schulze, gnädige Frau, mein Name ist Wulf, Niels Wulf», höflich ist er ja, dachte ich noch, da sprach er schon weiter, «und ich bin der Assistent des Herrn Bürgermeisters, der Sie bitten lässt, solange seine Gäste zu sein, bis ihre Möbel aus Berlin eingetroffen sind. Ein Bursche, der Ihre Sachen abholt, wird gleich nachkommen. Wenn Sie mir also bitte folgen möchten?»
Wilhelm sah zu mir und ich nickte unmerklich. Noch eine Nacht oder sogar mehrere in diesem tristen Gasthaus zu verbringen, das musste nicht sein, wenn es eine andere Möglichkeit gab. Der Bürgermeister empfing uns freundlich, seine reizende Gattin kümmerte sich gleich um meine Bedürfnisse und stellte mir eines ihrer Mädchen zur Verfügung, das mir beim Umkleiden behilflich sein würde. Erleichterung machte sich in mir breit. Das Abendessen verging mit angenehmem Geplauder über dies und das und das Gästezimmer ließ nichts zu wünschen übrig. Kaum berührte mein Kopf das Kissen, schlief ich auch schon.
Am nächsten Morgen, Wilhelm war bereits mit dem Herrn Bürgermeister unterwegs, fragte mich seine Gattin, ob ich mir das Haus, das sie für uns ausgesucht hatten, schon angesehen habe. Ob ich Hilfe bräuchte, es zu reinigen, ehe die Möbel kämen? Beschämt gestand ich ein, dass ich noch wenig Erfahrung als Hausfrau habe und Ottilie Rahtlev, so hieß die Gute, bot mir weitere Unterstützung an. Wir machten uns also auf und da dieses Kappeln nicht sehr groß zu sein schien, war der Weg nicht weit bis zu unserem Haus, das für mich noch lange nicht «unser Haus» war. Während zwei Mägde die Fenster putzten und die Böden schrubbten, kümmerte sich ein Knecht um die gusseisernen Öfen, von denen sogar einer in dem Raum stand, der das Schlafzimmer werden sollte. Ottilie und ich hielten uns im Garten auf, wo sie mir wertvolle Tipps gab, denn einen Garten hatte ich Stadtkind noch nie besessen. Da kam ein Bote vom Rathaus und berichtete ein wenig atemlos, dass die Möbel unterwegs seien und im Laufe des Tages eintreffen dürften. Ottilie trieb daraufhin die beiden Mägde an, sich zu beeilen, damit alles fertig wäre. Sie befragte mich eingehend nach den Möbeln und schien fast genauso gespannt darauf zu sein, wie die sich in dem kleinen Häuschen unterbringen ließen, wie ich selbst. Der Tag verging rasch, Wilhelm kam und wir warteten gemeinsam auf den Wagen mit unseren Sachen. Es dunkelte bereits, da traf Niels Wulf ein und bat uns im Namen des Bürgermeisters, noch eine Nacht in seinem Haus zu verbringen, da die Ankunft der Möbel sich wohl verzögere. Was blieb uns anderes übrig, als ihm zu folgen.
Mitten in der Nacht wachte ich auf und hörte draußen den Regen rauschen. Ob er morgen vorbei wäre, dachte ich noch, da schlief ich auch schon wieder. Kaum dass ich frühstücken konnte, trieb es mich zum Haus. Wartete der Wagen mit meinen Sachen schon? Lud man die Möbel bereits aus? Doch der Weg vor dem Haus war leer, in den Pfützen spiegelten sich die Wolken, die wie träge Schafe über einen blankgeputzten Himmel zogen. Der Regen war vorbei und die Sonne trocknete die nassen Strohdächer schnell. Niedergeschlagen sah ich mich um. Niemand ließ sich blicken, nicht einmal die neue Nachbarin und ich hätte doch so gern jemandem mein Leid geklagt. Ratlos, was ich nun unternehmen sollte, stand ich noch vor der Haustür, als Niels Wulf angelaufen kam.
«Frau Schulze, Frau Schulze, kommen Sie schnell», keuchte er völlig außer Atem, «es ist etwas Furchtbares passiert!»
Schon rannte er davon und ich lief hinterher, ehe ich ihn fragen konnte. Die schlimmsten Gedanken rasten mir durch den Kopf.
«Wilhelm, hoffentlich ist ihm nichts geschehen», dachte ich und raffte meine Röcke, um den jungen Mann nicht aus den Augen zu verlieren. Es ging leicht bergauf, das machte es mir nicht einfacher. Endlich hielt Wulf an und deutete auf den Straßenrand. Ich traute meinen Augen nicht, als ich erkannte, was da wahllos, lieblos abgestellt worden war.
«Meine Möbel!» Ich schrie vor Entsetzen. Da standen meine teuren Möbel, vom nächtlichen Regen völlig durchnässt und unbrauchbar geworden.
«Oh nein, das darf doch nicht wahr sein» flüsterte ich noch, dann hüllte mich eine Ohnmacht in gnädige Dunkelheit. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in Wilhelms Armen, der nach einer Kutsche geschickt hatte. Ottilie Rathlev nahm uns an ihrer Tür in Empfang und stärkte mich mit einem Tee, der verdächtig nach Rum roch. Wilhelm und Niels Wulf organisierten einen Karren, auf dem die ramponierten Möbel zu unserem Haus geschafft wurden. Beinahe gleichzeitig traf das Fuhrwerk mit meiner Aussteuer und den großen Kisten mit den empfindlicheren Kleinmöbeln ein. Glück im Unglück für uns, alles was sich auf diesem Fuhrwerk befand, war trocken geblieben. Sobald ich mich ein wenig erholt hatte, machte ich mich auf, um vor Ort den Schaden zu besichtigen. Zu meiner größten Überraschung fand ich die blonde Nachbarin vor, die sich mit einer Politur an dem Esszimmertisch zu schaffen machte. Sie sah hoch und lächelte mich beruhigend an.
«Liebe neue Nachbarin, ich bin Meta Paulsen und habe angefangen, den schlimmsten Schaden zu beheben. Es sind so schöne Möbel, vor allem gut verarbeitet. Das Wasser ist schon getrocknet, sehen Sie? Die Ränder kriegen wir auch weg, die Grundpolitur ist so gut, da geht das ziemlich schnell.»
Fasziniert sah ich zu, wie Frau Paulsen mit einem weichen Lappen etwas aus einem Tiegel nahm und auf die Tischplatte rieb. Ich trat ein wenig näher und roch zum allerersten Mal diesen ganz speziellen süßen Duft von Raps, der später mit seinen leuchtend gelben Blüten für mich untrennbar mit dem Frühling in und um Kappeln verbunden sein sollte. Frau Paulsen lachte, gab mir ein Tuch und gemeinsam rieben wir den Tisch so gründlich ab, dass er aussah wie neu.
«Das Rezept hab ich von meiner Großmutter», Frau Paulsen lächelte, « es ist reines Rapsöl, mit Salz vermischt. Das hilft, wie Sie sehen, garantiert!»
Etwas zuversichtlicher geworden, schauten wir drei, Wilhelm, Frau Paulsen und ich, uns die Polstermöbel an. Das Sofa war nicht mehr zu retten, der teure Samt hatte sich so mit Wasser vollgesogen, dass zwei Männer es kaum bewegen konnten. Die Polster tropften immer noch. Die viel dünneren Polster der Stühle, die man aus dem Rahmen heben konnte, trockneten schon draußen in der wärmenden Sonne. Sie waren mit Rosshaar gefüllt, das kaum Schaden nahm. Ein neuer Bezug, und sie könnten wieder benutzt werden. Was mich aber sehr traurig machte und wütend zugleich, war die Tatsache, dass mein kleines Klavier unwiderruflich dahin war. Das Holz hatte sich verzogen durch die Nässe und die Saiten rissen, weil die Spannung beim Trocknen zu stark wurde. Der Deckel schloss nicht mehr und als ich versuchte, eine Taste anzuschlagen, brachte mein Klavierchen einen solch kläglichen Jammerlaut hervor, dass ich sofort wieder in Tränen ausbrach. Wie sehr hatte ich mich darauf gefreut, mir hier in der Fremde die Zeit mit meiner geliebten Musik zu vertreiben. Und nun das!
Wilhelm nahm mich tröstend in seine Arme und Frau Paulsen meinte es gut, denn sie schlug vor, dass wir ja singen könnten, das sei doch auch Musik. Und schon rannen bei mir die Tränen wieder. Mein Liebster küsste sie mir fort und gemeinsam beratschlagten wir, wie wir die Möbel am besten aufstellen sollten. Die beiden Knechte der Bürgermeisterin schoben alles so hin, wie wir es ihnen sagten. Am Abend sah das Häuschen schon recht wohnlich aus. Die Möbel gefielen mir hier sogar noch besser als in Berlin, weil sie sich nicht in allzu hohen Räumen verloren. Wilhelm war sich nicht zu schade, höchstpersönlich im eisernen Ofen ein lustig prasselndes Feuer zu entzünden, und wir beide stießen mit einem Glas vom mitgebrachten Rotwein auf unser neues Domizil an. Nur, wer den Wagen an die falsche Adresse geschickt hatte, erfuhren wir nie...
1870 im Sommer – Krieg oder Leben?
Ein paar Wochen später war das ganze Malheur so gut wie vergessen. Aus Frau Paulsen wurde schnell meine Freundin Meta und oft saßen wir gemeinsam im Garten, der, wie von Wilhelm vorausgesagt, unser Lieblingsplatz blieb.
Längst hatte Meta mir die schöne Aussicht genau erklärt. Vom Garten aus schauten wir auf die Schlei, wo schlanke Segelschiffe, ähnlich den eleganten Damen in Berlin, zur Ostsee hin promenierten. Die merkwürdige Brücke, eine Pontonbrücke, bestand tatsächlich aus aneinandergelegten Bootskörpern und war mir immer noch so unheimlich wie am Tag meiner Ankunft. Direkt am Ufer hatte man das große Holzlager der Lorentzens angelegt. Ich deutete auf das quadratische Haus, das etwas unterhalb zu meiner Rechten lag. Irgendwie putzig sah es aus, mit dem großen Dach, das wie eine übergestülpte Mütze wirkte. Und obendrauf, das sah wirklich seltsam aus, schien eine Art Krähennest zu sein. Meine Freundin lachte und erklärte mir, dass es tatsächlich ein Ausguck war, der zu dem Packhaus gehörte, nichts anderes stellte dieses Gebäude dar.
«Sieh mal, von dort aus», Meta deutete mit dem ausgestreckten Arm hin, «von dort kann man bis nach Schleimünde schauen und die Segelschiffe, die von der Ostsee kommen und Holz geladen haben, rechtzeitig erkennen!»
«Ja aber...» So recht konnte ich mir das nicht vorstellen,» wie erkennt man auf diese Entfernung, welches Schiff da kommt und was es geladen hat?»
Metas Söhnchen Jan, der vor ein paar Tagen seinen dritten Geburtstag feiern durfte, lachte und plapperte drauf los.
«Tante Rieke, dafür gibt es Flaggen, das weiß doch jedes Kind!»
Dann spielte er zu unseren Füßen seelenruhig weiter mit nichts anderem als ein paar Stöckchen und einer alten Schüssel voller Sand. Da kam Wilhelm aufgeregt an, setzte sich auf einen freien Stuhl und fächelte sich mit dem Taschentuch frische Luft zu. Mit hochroten Kopf vom eiligen Lauf und von der drückenden Hitze, die uns allen zu schaffen machte, japste er nach Luft, trank rasch von dem kühlen Wasser, das für uns bereit stand und rückte dann endlich mit der Sprache raus.
«Jetzt ist es soweit, das habe ich kommen sehen, nun werden wir es den Franzosen aber zeigen!»
Meta und ich, wir sahen uns an und wussten nicht, was wir von dieser Rede halten sollten.
«Wilhelm, bitte sprich langsam», beruhigte ich meinen Mann, «was ist denn geschehen?»
«Das, was uns von Berlin hierher nach Kappeln brachte, mein Riekchen, der Krieg, der Krieg gegen die Franzosen!»
Ich schnappte nach Luft, mir war in der letzten Zeit sowieso oft übel. Das lag wohl an der Hitze und am vielen Fisch, den uns mein Dienstmädchen servierte. Inzwischen sprach Wilhelm weiter.
«Es ist in Spanien nun doch zu einem Streit um die Thronfolge gekommen. Als Kandidat für die Krone stand unter anderem Prinz Leopold von Hohenzollern zur Wahl. Dies wollte Napoleon III., der Kaiser von Frankreich, aber unbedingt verhindern, da er glaubte, die Einsetzung eines Hohenzollern in Spanien würde für ihn eine Bedrohung darstellen, er fühle sich dadurch von zwei Fronten «umklammert», vom Deutschen Bund und von Spanien. Daher forderte Napoleon III. Preußens König zu dem Verzicht auf die Thronkandidatur in Spanien, wohlgemerkt, zum Verzicht aller Hohenzollern.
Bismarck ging dann bewusst eine Provokation ein, indem er das französische Telegramm an den preußischen König, der gerade in Bad Ems weilte, kürzte, veränderte und in der Presse veröffentlichte. Dadurch erweckte er den Anschein, als ob diese unselige französische Forderung unserem König Wilhelm I. bedingungslos aufgezwungen worden wäre. Dies wiederum fasste die französische Regierung als Demütigung auf, sodass sie Preußen gestern, am 19. Juli den Krieg erklärte. Nun, also, jetzt befinden wir uns im Krieg!»
Meta und ich, wir sahen meinen Gatten fassungslos an. Hatten wir richtig verstanden? Wir, das heißt Preußen, befand sich im Krieg? Wie gut, dass wir uns dafür entschieden hatten, nach Kappeln zu gehen.
«Denk dir nur, liebster Wilhelm», sprach ich es dann aus, «wären wir in Berlin geblieben, dann müsstest du als Soldat gegen die Franzosen kämpfen und ich wüsste nicht, ob ich dich lebend wiedersehen würde.»
«Und das Kind müsste dann vielleicht ohne Vater aufwachsen», Meta sah bedenklich drein. Zunächst glaubte ich, sie meine ihr Söhnchen und versuchte sie zu trösten.
«Aber Meta, ich glaube kaum, dass dein Mann als Soldat nach Frankreich ziehen muss. Er bleibt dir ganz bestimmt erhalten!»
«Friederike, nun sag bloß, du hast das noch nicht bemerkt!», Meta lachte und ich ahnte immer noch nicht, was sie eigentlich meinte, «Du bist schwanger, mien Deern, du erwartest ein Kind! «
Verblüfft sah ich an mir herunter, da war nichts, kein Bäuchlein verunzierte meine zarte Taille. Auch Wilhelms Blick ruhte auf mir, dort, wo sich ein Kind befinden könnte.
«Meta», mein Ton klang gereizter, als ich es eigentlich wollte, «bist du dir sicher? Kann es nicht sein, dass du dich irrst?»
Meine neue Freundin lächelte überlegen, sie war ja schon Mutter und kannte sich mit so etwas aus.
«Friederike», begann sie, «erinnerst du dich daran, dass du mir vor kurzem deine wunderschönen Kleider aus Berlin vorgeführt hast? Dabei, als du dich vor mir umkleidetest, sah ich diese kleine Wölbung an deinem Bauch. Darüber hinaus fiel mir auf, dass dir morgens manchmal übel ist und du Speisen, die du sonst gern mochtest, auf einmal nicht mehr verträgst. All dies zusammen lässt nur den einen Schluss zu, nämlich den, dass du ein Kind erwartest!»
Sie hatte recht, das musste ich nach kurzem Überlegen zugeben. Schnell rechnete ich nach. Geheiratet hatten wir Ende April, jetzt war es Mitte Juli, das sind fast drei Monate, Zeit genug, um schwanger zu werden. Wenn ich also gleich nach der Hochzeit empfangen hatte, würde das Kind im Januar nächsten Jahres zur Welt kommen. Gerade wollte ich mein Ergebnis freudig verkünden, da merkte ich, dass Wilhelm und Meta lautstark stritten. Er bestand darauf, alle Ärzte Kappelns zu Rate zu ziehen, sie meinte, dass eine Hebamme ausreichte.
Niemand freute sich mit mir! Zwischen Meta und Wilhelm ging es immer lauter zu. Leise drehte ich ihnen den Rücken und lief ins Haus. Dort legte ich mich auf mein Bett und weinte.
«Friederike, mein Riekchen!» Wilhelm war mir gefolgt und streichelte mir nun zart über den Rücken, «du machst mich so unsagbar glücklich und jetzt schenkst du mir zu meiner größten Freude auch noch ein Kind. Es gibt niemanden, der heute dankbarer und froher ist als ich!»
Meta, die uns nicht stören wollte, nahm ihren kleinen Jan an die Hand und verschwand in ihrem eigenen Haus. Ein wackeliger Scheinfrieden stellte sich zwischen uns ein. Sie war gekränkt, dass ich ihr nicht geglaubt hatte, Wilhelm spielte den überbesorgten Ehemann und ich gab mich den Launen hin, in die mich mein Körper trieb. Nacheinander gaben sich, auf Wilhelms Betreiben hin, die drei Kappelner Ärzte, Dr. Julius Thomsen, Dr. Otto Spliedt und Dr. Marxen in unserem Haus die Klinke in die Hand. Dann kam Meta mit der Hebamme an und ich fühlte mich sofort gut aufgehoben bei ihr. Das sagte ich auch Wilhelm und bat ihn um Verständnis, dass ich zu einer erfahrenen Hebamme einfach mehr Vertrauen habe, als zu den Ärzten, die schließlich auch nur Männer waren.
«Wenn du meinst, geliebtes Riekchen», Wilhelm gab nach, «aber wenn es Komplikationen geben sollte, dann, bitte, versprich mir, dass du die Ärzte zu Rate ziehst, ja?»
Natürlich versprach ich das und Wilhelm ging beruhigt wieder seiner Arbeit nach. Im Laufe des Sommers aber verschlechterte sich seine Laune immer mehr, er wurde regelrecht griesgrämig. Eines Abends, wir saßen in der lauen Nachtluft draußen unter der schönen Kastanie auf einer Bank und schauten fasziniert zu, wie der Himmel über der Schlei einfach nicht dunkel werden wollte. Die Sonne zog einen großen Kreis, schien gar nicht richtig unterzugehen und bescherte uns eine unendliche Dämmerung in flammendroten Farben, die sich mit den zartrosa Wolken im Osten zu vermischen schienen, dort wo sie bereits wieder den neuen Tag begrüßten. Süßer Blütenduft durchzog den Garten und wir mochten uns gar nicht davon trennen, Schlaf war unwichtig geworden. Da seufzte Wilhelm mit einem Mal tief und begann mir endlich sein Leid zu klagen.
«Nicht dass ich es bereue, hierher gezogen zu sein, liebe Rieke, in Berlin hätten wir so etwas Wunderbares wie diese Nacht nie erlebt», er machte eine Pause, suchte nach Worten, «und doch habe ich große Sorgen. Nichts läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe. Überall stoße ich auf Widerstände. Meine Pläne verlaufen im Sand. Ich verstehe die hiesige Sprache nicht und die Arbeiter machen sich einen Spaß daraus, so zu tun, als verstünden sie mein Hochdeutsch nicht. Es sind vor allem die Optanten, die mir die meisten Schwierigkeiten bereiten.»
«Aber, Liebster», unterbrach ich ihn verwundert, «was sind Optanten? Das hat doch sicher nichts mit einer Tante zu tun, oder?»
Wider Willen musste mein Ehemann lachen und erklärte mit dann lang und breit, dass Optanten Menschen wären, die eine Option besäßen.
«So hat die dänisch-gesinnte Bevölkerung in Schleswig oder Sønderjylland, wie die Dänen unser Land hier nennen, die Option erhalten, vom Wiener Friedensvertrag nach dem Ende des deutsch-dänischen Krieges 1864, sich für die dänische Staatsbürgerschaft zu entscheiden oder auch nicht. Diese Option lässt viele noch schwanken und manche hassen die Preußen, die ihr Land besetzen, wie sie glauben. Verstehst du nun, wie schwer ich es habe, diese Leute zur Arbeit zu bewegen?»
Ach ja, mein Wilhelm hatte mein vollstes Mitgefühl. Ich selbst bekam es auch immer wieder zu spüren, dass ich als Fremde nicht dazu gehörte. Auf dem Markt, den ich mit meinem Dienstmädchen besuchte, kam ich nicht umhin, die scheelen Blicke zu bemerken, mit denen man mich bedachte. Außer Meta, meiner Nachbarin, hatte ich keine weiteren Kontakte zu den Kapplerinnen, obwohl ich immer freundlich grüßte. Das seltsame «Moin», das hier als Gruß galt, wollte mir noch nicht über die Lippen. Irgendwie, hatte mir Meta erklärt, sei das eine Abkürzung von «Guten Morgen». Genaueres wusste sie aber auch nicht. Nur der Gehilfe des Herrn Bürgermeisters, dieser Niels Wulf, war bisher immer sehr zuvorkommend, wenn ich ihn traf. Meta traute ihm aber nicht über den Weg, er sei ihr unheimlich, meinte sie. Es erging mir ebenso.
Wieder kam Wilhelm eines Abends nach Hause und sah recht ärgerlich drein. Schnell servierte ich ihm das herbe Bier, das in dieser Gegend gebraut wird und dem mein Mann gern zuspricht. Er nahm einen tiefen Zug und rülpste vernehmlich. Ich zog die Augenbrauen hoch und schalt ihn einen Rüpel, der keine Umgangsformen habe. Wilhelm lachte, entschuldigte sich dann aber.
«Liebes Riekchen, sei mir nicht gram», er umfasste besitzergreifend meine stärker gewordene Taille, «heute hatte ich wieder einmal einen Disput mit dem Bauunternehmer. Es ging ums liebe Geld, wie meistens. Der preußische Taler, eigentlich schon seit ein paar Jahren das reguläre Zahlungsmittel hier, hat immer noch keine große Akzeptanz gefunden. Schwierig genug ist leider auch, das notwendige Baumaterial zu beschaffen. Da stoße ich ebenfalls immer wieder auf unnötige Behinderungen. Wie soll das gehen, frage ich mich, hier die wichtigen Gebäude zu erstellen, die für eine Stadt nötig sind, wenn ich auf alle Fragen nur ein «weet ick nich», ein «weiß ich nicht», zu hören bekomme. Manchmal wünsche ich uns nach Berlin zurück!»
Ich erschrak, mein Liebster hatte da einen Nerv getroffen, der mich auch immer wieder schmerzte. Dieses «was wäre wenn», plagte mich doch selbst auch des Öfteren. Laut tröstete ich ihn: «Wilhelm, gräme dich nicht, wären wir in Berlin geblieben, dann stündest du jetzt als Soldat in Frankreich an der Front oder du lägest schon tot irgendwo im fremden Land, erschossen, mit vielen deiner Kameraden in einem Massengrab. Was würde dann aus mir und unserem Kind? Ist es nicht besser, den Ärger hier in Kauf zu nehmen, als täglich den Tod vor Augen zu haben?»
In den Zeitungen las ich täglich, dass jetzt, Ende August, viele Schlachten zugunsten Preußens ausgingen, Frankreich aber noch nicht besiegt war. Wie lange der Krieg noch dauern könnte, wusste niemand vorherzusagen. Aber dass wir hier im Norden in Sicherheit wären, das hatte sogar ich, als Frau erkannt. Meta meinte, ich solle den Anglern oder eher Angelitern, wie sich der Menschenschlag hier nennt, so genau kenne ich diesen Unterschied auch nicht, einfach etwas Zeit geben. Irgendwann würde ich akzeptiert und gehöre dann dazu.
Womit ich aber nicht mehr warten konnte, war die Tatsache, dass mir kein Kleid mehr passte. Dreimal waren die Nähte schon ausgelassen worden, nun ging es nicht mehr. Einen Schneider, oder gar ein Modehaus, dass sich auf die Haute Couture verstand, suchte man hier vergebens. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich den Künsten einer Näherin anzuvertrauen, die aus dem hier üblichen, reichlich groben Leinen und kratziger Wolle, einen Rock, Hemden und Mieder fertigte. Als ich meine neue Kleidung das erste Mal Wilhelm vorführte, lachte er.
«Oh, mein Riekchen, du siehst aus wie eines dieser entzückenden Landmädchen auf den Gemälden, so rosig und rund. Ich hoffe, du schenkst mir einen strammen Sohn, einen, der einmal in meine Fußstapfen tritt!»
Einen Sohn, den wünschte ich mir auch, am liebsten so einen reizenden Jungen, wie Metas Kind. Doch bis es so weit wäre, dachte ich mir, verginge noch viel Zeit.
Ein Lichtblick war, dass die Einstellungen der Leute um uns herum sich schlagartig änderten. Anfang September überschlugen sich die Zeitungen mit den Schlagzeilen «Wir sind die Sieger» und «Frankreich am Ende»!
Denn am zweiten September dieses ganz besonderen Jahres 1870 schlug die preußische Armee das französische Heer bei Sedan vernichtend. Der Kaiser von Frankreich, Napoleon III. wurde gefangen genommen und auf die Wilhelmshöhe bei Kassel gebracht. Und auf einmal waren die Preußen die Sieger und wir, das heißt die Schleswig-Holsteiner, damit auch. In den Köpfen der Menschen gehörten wir nun zu Preußen und sie sahen es nicht mehr als die verhasste Besatzungsmacht an. Nun ja, die meisten dachten so und das sollte, so hoffte ich, meinem Wilhelm zugute kommen.
Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, war die Anteilnahme der Kappelner Bürger an diesem Krieg. Es wurde richtig viel Geld gespendet für die Verpflegung verwundeter Soldaten. Es kam sogar zu der Gründung eines Vereins «zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger». Hatte die Idee des Schweizers Henri Dunant derart schnell Wirkung gezeigt? Er rief das Rote Kreuz ins Leben, dass sich zum allerersten Mal im Jahre 1864 bei den Düppeler Schanzen bewährt hatte. Dort betreute und pflegte man verletzte Soldaten, egal ob sie Dänisch, Deutsch oder etwas anderes waren. Das berichtete mir mein Gatte voller Freude.
Viel leichter hatte Wilhelm es trotz allem nicht. Mit seiner forschen Berliner Art kam er bei den schwerblütigen Angeliter Bauern nicht gut an und die Kappelner redeten nur noch davon, ob Neu-Kappeln zum Landdistrikt Roest gehören sollte oder der Stadt Kappeln zugeschlagen würde. Der Entscheid der Regierung in Schleswig stand noch aus. Wilhelm ärgerte sich auch immer noch mit der Auswahl der Grundstücke herum, auf denen das zu erbauende Amtsgericht und ein Postamt errichtet werden könnten.