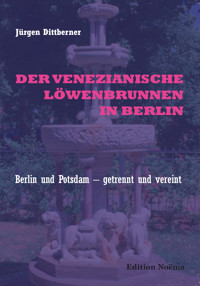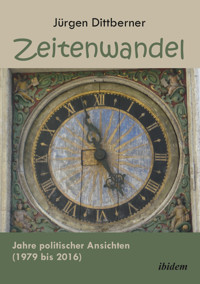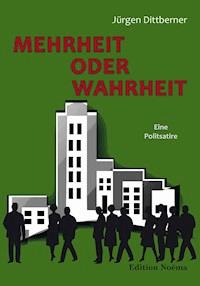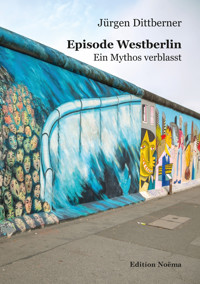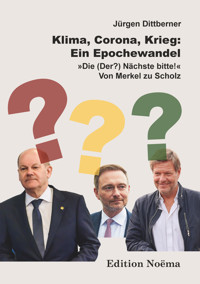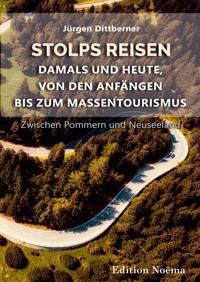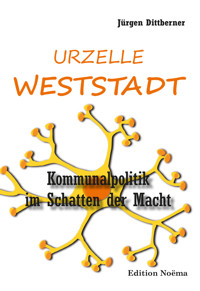
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Noema
- Sprache: Deutsch
Die Gemeinde gilt als Urzelle der Demokratie. Auch renovierungsbedürftige, stinkende Schulklos soll sie beseitigen können – wenn sie das schafft, muss es auch im Land und im Bund funktionieren. Klaus Mitt aber wohnt in Berlin, der Bundeshauptstadt. Was ist seine Gemeinde? – Berlin ist es nicht: Die Metropole saniert nämlich keine Schulklos. Der Bezirk, in dem er lebt, wäre zuständig. Aber der wird gerade fusioniert mit einem anderen Berliner Bezirk. Der “Großbezirk” Charlottenburg-Wilmersdorf muss jetzt die Schulklos in seinem Terrain sanieren. Söhnchen Lars Mitt, acht Jahre alt, hätte das gerne so. Also zieht Vater Klaus über eine Partei in das an sich kompetenzlose Kommunalparlament ein, das sich Bezirksverordnetenversammlung, BVV, nennt. Mitts Frau Helga engagiert sich lieber in der Elternvertretung der Schule des gemeinsamen Sohnes. In der BVV stößt Mitt auf die Theatervielfalt seines Bezirkes, erfährt etwas über das horizontale Gewerbe, Parkraumbewirtschaftung, Gender Mainstreaming, Karneval in Berlin, Flüchtlinge und die Deutschlandhalle. Das alles fesselt ihn so sehr, dass er die Schulklos darüber aus den Augen verliert. Sie stinken weiter. Jürgen Dittberner, lange Jahre für die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus und in einer BVV, legt mit Urzelle „Weststadt“ einen pointiert und lebensnah verfassten Roman über die real existierende Lokalpolitik in Berlin vor – unbedingt lesenswert!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Vorwort
Westlich der Weststadt
1. Vor dem Rathaus
2. Flügeltreffen
3. Wahlkampf
4. Anfang
5. Ein Bezirk, ein Rathaus für Flüchtlinge
6. Weststadt: Theater, Theater
7. Horizontal im Wohnhaus, „Schwuchtel-Fahne“
8. Schrippentaste, Kiezpolizei
9. Preußenpark, Deutschlandhalle
10. Deutschenmacher, Karneval
11. Laubenpieper, Schankveranden
12. Bürgerhaushalt, Gender Mainstreaming
13. Sparen bis es quietscht, Krakau und Kracauer
14. Nirgendwo Verkehr – Kurfürstendammtunnel, Straßenbahn, Aussichtsrad und Bahnhof Zoo
Dann wird es nicht mehr stinken!
Anhang
Vorwort
„Charlottenburg-Wilmersdorf“ ist einer von zwölf Verwaltungsbezirken Berlins. Andere Verwaltungsbezirke der deutschen Hauptstadt heißen „Spandau“, „Marzahn-Hellersdorf“, „Steglitz-Zehlendorf“ oder „Mitte“.
Berlin ist eine „Einheitsgemeinde“, in der alle Angelegenheiten zentral vom „Abgeordnetenhaus“ – dem Landesparlament – oder vom „Senat“ – der Landesregierung – geregelt werden. Dennoch leistet sich Berlin „Bezirke“ als Quasigemeinden. Diese haben eigene politische Organe, die „Bezirksverordnetenversammlungen“ („BVV“en) als eine Art Kommunalparlamente und die „Bezirksämter“ („BA“) als vorgebliche Gemeindevorstände. Kompetenzen haben die Bezirke wenige. So wird der Etat für jeden einzelnen Berliner Bezirk vom Abgeordnetenhaus beschlossen. Die Bezirke dürfen jedoch beispielsweise ihren Straßen und Plätzen Namen geben, Bebauungspläne aufstellen oder Facilities der Schulen ihrer Territorien regeln.
„Charlottenburg-Wilmersdorf“ wurde aus den alten Bezirken „Charlottenburg“ und „Wilmersdorf“ geschaffen („fusioniert“), als es in Berlin am 1. Januar 2001 eine Reform gab, bei der „Großbezirke“ gebildet wurden, die mit den Landkreisen Brandenburgs kompatibel sein sollten. Das hätte die Gründung eines Bundeslandes „Berlin-Brandenburg“ erleichtert, wenn es dazu gekommen wäre.
In den „BVV“en gibt es Fraktionen. In „Charlottenburg-Wilmersdorf“ waren das einst die „Schwarzen“, die „Roten“, die „Grünen“ und die „Gelben“. Kommt eine Partei oder Gruppe bei den „BVV“-Wahlen – die zusammen mit den Landeswahlen stattfinden – nicht über die 5-%-Grenze hinaus, aber auf mindestens drei Prozent, so hat ein „fraktionsloser“ Verordneter ein Mandat errungen. Das war im alten Bezirk „Wilmersdorf“ der Fall gewesen, als es dort je einen Verordneten der „Gelben“ und der „Dunkelroten“ gegeben hatte.
Das Geschehen in der BVV wird hier aus der Perspektive der „Gelben“ geschildert. Ob diese mit ihren Einschätzungen immer richtig lagen, mögen die Leser entscheiden.
Die „Gelben“ jedenfalls wollten den Fusionsbezirk unbedingt „Weststadt“ nennen, was bei den anderen auf keine Gegenliebe stieß.
Ein Mitglied der „gelben“ Fraktion war Klaus Mitt, der schon in Potsdam als „Leihbeamter“ der dortigen Landesregierung gearbeitet hatte und seinen eigentlichen Job im Wirtschaftsamt eines anderen Berliner Bezirks ausübte.
Klaus war von seiner Ehefrau und seinem achtjährigen Sohn darauf aufmerksam gemacht worden, dass es auf den Toiletten der Schulen seines Bezirkes „stinke“. Das wollte er ändern. Klaus trat den „Gelben“ bei und wurde schnell deren Bezirksverordneter und sogar Fraktionsvorsitzender. In der „BVV“ jedoch stürzten viele neue Themen auf ihn ein, sodass er die stinkenden Klos vergaß.
Als Klaus die BVV wieder verließ, ärgerte es ihn, dass er zu den Klos nicht gekommen war. Außerdem kam jetzt heraus, dass die Schatzmeisterin seiner Fraktion – die immer auf Sparsamkeit gedrängt hatte – bigott war.
Klaus kehrte der „Kommunalpolitik“ den Rücken. Er wollte die Sache mit den Klos künftig zusammen mit seiner Ehefrau vor Ort und direkt angehen.
Meiner Frau Elke Dittberner danke ich für ihre Unterstützung.
Berlin, 2019
Jürgen Dittberner
Westlich der Weststadt
Eine bekannte „Oststadt“ liegt im Westen der „Weststadt“:
Potsdam befindet sich westlich von Charlottenburg-Wilmersdorf. Es schmückt sich seit der Wiedervereinigung als Landeshauptstadt des „neuen“ Bundeslandes Brandenburg. In diesem Ort waren zu der Zeit der Gründung des neuen Landes Brandenburg noch Soldaten der „Roten Armee“ der UdSSR stationiert. Mit Reisigbesen fegten sie Bundesstraßen. Hatten sie frei, versammelten sie sich in kleinen Grüppchen an den Ufern der Havel und lauschten den heimatlichen Tönen einer Mundharmonika.
In der Potsdamer Heinrich-Mann-Allee wurden brandenburgische Ministerien bundesdeutscher Art eingerichtet. Diese residierten in alten Villen. Vormittags waren dort noch die alten Bezirksregierungen der DDR tätig, zuständig für die „Bezirke“ Brandenburg/H., Frankfurt/O. und Cottbus. Wenn deren Angestellte nach Hause gingen, versiegelten sie vorher ihre Büros mit Wachs.
Nachmittags zog die Landesregierung mit ihren Ministerien ein. Auf Zetteln war mit Kugelschreiber geschrieben „Ministerium der Finanzen“ oder „Landwirtschaftsministerium“ usw. Diese Zettel wurden mit Reißzwecken an Türrahmen befestigt.
Auch in Potsdams Ämtern stanken die Klos. Aber das störte nicht. Hoher Besuch kam zu den gesamtdeutschen Ministerien: der Präsident des Bundestages, berühmte Abgeordnete und Minister aus dem „Westen“. Sie sprachen von „Aufbauarbeit“ im Osten. Diese leisteten „Leihbeamte“, meist aus Nordrhein-Westfalen, die montags in Heerscharen und schwarz gekleidet auf dem Flughafen landeten und freitags wieder in die Lüfte entschwanden.
Später ließen sich die meisten dieser Beamten nach Brandenburg versetzen. Sie wurden dann befördert, bekamen „Trennungs-“ oder „Buschgeld“. Das empörte viele Einheimische, die selber gerne Beamte geworden wären.
Die Grenze zwischen Brandenburg und Berlin verging und vertrocknete allmählich. Bald kontrollierte niemand mehr diese ehemalige „Staatsgrenze“.
Mitarbeiter der Stiftung „Schlösser und Gärten“ sowie des „Studentenwerks“ wurden politisch überprüft. Wer in der SED gewesen war oder gar bei der „Stasi“, wurde gefeuert. Manchmal denunzierten sich Ostmitarbeiter gegenseitig, und ein Denunziant saß plötzlich auf einem Direktorenstuhl.
An die Spitzen der Hochschulen wurden meist „Westprofessoren“ gesetzt. Sie waren jetzt Rektoren und Dekane, was sie im „Westen“ wohl nie geschafft hätten.
Verkehrsregeln galten für das Volk, nicht jedoch für Minister, Präsidenten und Staatssekretäre. Diese durften überall fahren, parken oder wenden: Ein Hoch der oberen Staatsdienerschaft!
Berlin galt in Potsdam als feindliches Gebiet. Von dort kamen imperiale Ansprüche. Brandenburg wollte selbst auf die Beine kommen. Hauptstadtregion allerdings ist man gerne geworden.
Brandenburg selbst war ein weithin unbekanntes Land. Potsdamer Bedienstete machten sich auf die Wege: nach Prenzlau und Finsterwalde, nach Cottbus und Oranienburg, nach Frankfurt an der Oder und nach Havelberg.
„Steige hoch, Du roter Adler!“
Die Landesplanung erfand ein seltsames Gebilde: die „dezentrale Konzentration“. Randgebiete Brandenburgs sollten wirtschaftlich gefördert werden, damit um Berlin herum kein „Speckgürtel“ entstünde. Das funktionierte nicht.
Ein demokratisch gewählter Bürgermeister von Potsdam war ein alter Kommunist, vielleicht war er sogar ein tüchtiger Mann. Aber er wurde von allen anderen Parteien aus dem Amt gejagt.
Dann forderten plötzlich viele in Potsdam, die Berliner S-Bahn möge in ihre Stadt fahren. Zwar sei Berlin „feindliches Gebiet“ – ein „Moloch“ – aber auch gruselig-schön und eben die deutsche Hauptstadt.
Da mochte Klaus nicht mehr im Abseits bleiben.
Klaus hatte in Potsdam schon viel erlebt. Ursprünglich war es für ihn ein Traum, in Brandenburg arbeiten zu dürfen. Aber der Traum war jäh aus. Nun wollte Berlin eine „Verwaltungsreform“ durchführen und alte Bezirke zusammenführen. Charlottenburg und Wilmersdorf beispielsweise sollten fusioniert werden. Nach der großen Vereinigung des Landes lockten viele kleine in dessen Hauptstadt.
So zog es Klaus auf die „AVUS“ – in den Osten zur „Weststadt“ hin.
Er wechselte von einem Ministerium in Potsdam in ein Berliner Rathaus.
1. Vor dem Rathaus
I.
Deutschland liegt inmitten des europäischen Kontinents. Es hat etwa 80 Millionen Einwohner und stößt im Norden ans Meer, im Süden an die Berge. Im Osten grenzt es wie im Westen an viele Nachbarn: Neun sind es zusammen. Das Land ist über 1000 Jahre alt, war früher eine zerstückelte Monarchie. Heute ist es eine gefestigte parlamentarische Republik. Führender Politiker ist der Chef – oder die Chefin – der Regierung, der Kanzler – oder eben die Kanzlerin. Das Land ist ein Bundesstaat, bestehend aus Bundesländern. Es lebt überwiegend von hochentwickelter Industrie und ist dadurch überaus wohlhabend. Die Zahl der Bewohner, die dieses Land trotzdem schlecht reden, nimmt aber zu.
Folgen den fetten magere Jahre?
Die Hauptstadt heißt Berlin, hat vier Millionen Einwohner und gliedert sich in zwölf „Bezirke“. Bis ins Jahr 2000 hatte Berlin noch mehr Bezirke. Die Reduzierung erfolgte durch die Fusionen, „Verwaltungsreform“ genannt. Da Berlin sich als „Einheitsgemeinde“ versteht, hängen die Bezirke am kommunalpolitischen Tropf der Gesamtstadt. Dennoch verfügt jeder Bezirk über ein eigenes „Parlament“ und eine „Regierung“. Das Parlament heißt „Bezirksverordnetenversammlung“ (BVV), besteht aus fünfundvierzig „Verordneten“. Die Regierung heißt „Bezirksamt“ (BA). Dieses hat fünf Mitglieder („Stadträte“ und einen „Bezirksbürgermeister“).
Berlin ist Sitz des nationalen Parlamentes und der Regierung des Landes. Die Botschaften aller Herren Länder haben hier ihre Sitze. Staatspräsidenten und weitere Politiker aus dem In- und Ausland geben sich die Klinke in die Hand. Alle Parteien, Gewerkschaften und Lobbyverbände haben in Berlin ihre Zentralen. Über Krieg und Frieden in der Welt, über nach außen gehende Wirtschaftshilfen, über die Klimapolitik sowie über Handelsbilanzen oder das Verhältnis zur Weltmacht USA wird hier mitentschieden. Debatten zum nationalen Gesundheitswesen, zum Rechtsradikalismus im Lande, zur Konjunktur oder das zulässige Tempo auf den Autobahnen werden hier geführt. Das nationale Fernsehen berichtet ständig darüber.
Berlin ist das Zentrum der Macht im Lande.
Die Bürger von Berlin wissen oft nicht, ob ihr Wohnbezirk oder die Gesamtstadt für ihre alltäglichen Angelegenheiten zuständig ist. Das Zentrum der Macht im Lande ist ihnen ohnehin fern, obwohl es regional doch so nahe liegt. Die Politik auf sämtlichen Ebenen nutzt das aus. Proklamativ sind sich sämtliche Politiker darin einig, dass gerade an diesem Ort der jeweilige Bezirk die „Urzelle“ des Gemeinwesens sei.
Stimmt das eigentlich, oder ist diese Darstellung des Bezirks als Urzelle des Gemeinwesens ein „Fake“ oder zumindest eine Illusion?
Die „bürgerlichen“ Bezirke Charlottenburg und Wilmersdorf wurden im Jahre 2001 fusioniert.
Ein Einwohner war Klaus Mitt, dessen Familie andere Sorgen hatte als die Politiker in den Rathäusern.
II.
„Weißt Du, Onkel Hans: Im Oval Office, da sitzt die Kanzlerin beim US-Präsidenten auf’m Schoß, und hier in unserem Bezirk in den Schulen – da stinken die Klos. – Oben hui, unten pfui: Das ist die Wahrheit!“, schimpfte Vater Klaus und legte die Tageszeitung beiseite. Seine Frau Helga sekundierte: „Bei uns in der Elternvertretung ist noch niemals so ein feiner Politiker aufgetaucht. Klaus hat recht: Um die Schulklos sollten die sich mal kümmern. Die stinken nämlich mehr als deren blödes Weltklima. Das überlässt man lieber uns kleinen Leuten.“ – Auch Söhnchen Lars steuerte etwas bei. Schließlich kannte er als Schüler die Not aus eigenem Erleben. „Bei uns ham’se jetzt ’ne Jungstoilette dicht gemacht. Kannste einfach nich’ ’raufgehn – stinkt zu sehr.“ – „Das ist die Lage!“, fasste Helga zusammen, und wandte sich ihrem Gast, dem Onkel Hans, zu.
Dr. Hans Güldenpfennig war Ministerialbeamter im Bundesjustizministerium und zu Besuch. Er war Helgas Onkel und hatte Jura studiert. Nun versuchte er, seine Verwandten zu belehren: „Das mit den Klos ist überhaupt nicht Sache der Kanzlerin oder irgendeines Ministers. Darum muss sich euer großartiger Bezirk schon selber kümmern. Steht doch im Grundgesetz, Artikel 28: ‚kommunale Selbstverwaltung‘.“ – „Aber unser Bezirk ist doch gar keine richtige Gemeinde – oder ‚Kommune‘ – wie ihr Juristen euch so vornehm auszudrücken pflegt.“ – „Trotzdem: Er ist als ein Bezirk von Berlin auch für die Schulklos zuständig. Das ist gar nicht die Sache der Bundesregierung.“
Als diese Unterhaltung stattfand, existierten noch die „alten“ Bezirke Charlottenburg und Wilmersdorf. Sie lagen im Westen Berlins und waren bis 1920 eigenständige Gemeinden, dabei ziemlich wohlhabend gewesen. Beide Bezirke hatten ihre eigenen Rathäuser. Das Charlottenburger lag in der Otto-Suhr-Alle und hatte einen Turm, der von den Bürgern höher gebaut worden war als der des nahegelegenen Königsschlosses. Das Wilmersdorfer Rathaus lag am Fehrbelliner Platz und war nach dem architektonischen Vorbild des Polizeipräsidiums in Kopenhagen erbaut worden. Da sie in der Holsteinischen Straße wohnten, waren Klaus, Helga und Lars halt Wilmersdorfer.
Noch: Denn Wilmersdorf wurde bald mit dem Bezirk Charlottenburg zusammengetan. So entstand der Bezirk „Charlottenburg-Wilmersdorf“ als einer von zwölf Verwaltungsbezirken Berlins. In dem fusionierten Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wohnten dann etwa 339.000 Menschen. Ungefähr 30 % davon waren Ausländer. Ein Königsschloss („Schloss Charlottenburg“), der Prachtboulevard Kurfürstendamm und der Grunewald gehörten zu den bekannten Örtlichkeiten. Im Jahre 2001 geschah die Vereinigung. Beide Bezirke hatten nach 1945 zum britischen Sektor Berlins gehört. „Charlottenburg-Wilmersdorf“, wie es ab 2001 hieß, hatte seine eine „Bezirksverordnetenversammlung“ („BVV“) mit zunächst 49, dann 45 Mitgliedern. Dieses Bezirksparlament bestand aus Fraktionen, und an seiner Spitze amtierte ein „Vorsteher“ – oder eine „Vorsteherin“. Da Berlin ja eine „Einheitsgemeinde“ war, hatte der Bezirk keine Finanzhoheit. Die lag beim Landesparlament, dem „Abgeordnetenhaus“. Entsprechend konnte der „Senat von Berlin“ – also die Landesregierung – in den Bezirk hinein regieren und viele Entscheidungen an sich ziehen. In der Praxis war Bezirkspolitik daher ein Lavieren zwischen Land und Bezirk.
„Bei aller Gängelung des Bezirks: Für die Klos ist er eindeutig da. Da beißt die Maus keinen Faden ab! Der Senat oder gar die Regierung der Bundesrepublik haben damit nun wirklich nichts zu tun!“, versicherte Dr. Güldenpfennig der kleinen Familie noch einmal.
„Wenn das so ist, Onkel Hans“, reagierte Helga, „gehe ich in die Bezirkspolitik!“ – „Na bitte!“, kommentierte der juristisch Vorgebildete.
Tatsächlich hatte Helga schon früher mit dem Gedanken gespielt, „in die Politik zu gehen“. Klaus brummte: „Na ja, das wird doch nur langweilige Kommunalpolitik.“ Dann sagte er es deutlich: „Kommunalpolitik ist doch nur was für Funktionäre. Versuch’ doch lieber gleich, auf die Landes- und Bundespolitik Einfluss zu nehmen!“ – „Das ist leichthin gesagt, mein Lieber. Jedenfalls trete ich jetzt erst mal einer Partei bei und fange unten an!“
III.
Helga versuchte es tatsächlich.
Sie trat in eine Partei, die „Gelben“, ein. Da war sie 35 Jahre alt. Die verheiratete Mutter eines Kindes bezog als Kindergärtnerin regelmäßiges Einkommen und steuerte damit zum Familienetat bei. Da der erwählten Partei weiter nichts über sie bekannt war, wurde sie aufgenommen und erhielt bald eine Einladung zu einer Mitgliederversammlung des für sie zuständigen Ortsverbandes – im allseits bekannten „Bürgerstübchen“.
Die Partei tagte in einem Hinterzimmer, in das Helga fünf Minuten vor Versammlungsbeginn eintrat. Dort saßen zehn Personen, die meisten von ihnen Männer und grauköpfig. Ein Jugendlicher mit Baseballkappe war auch dabei. Aller Augen richten sich auf sie.
Von der Frontseite des Tisches her erhob sich ein älterer Pulloverträger und sagte: „Bist Du die Neue? – Freut mich, dass Du zu uns gefunden hast.“ An die Versammlung: „Das ist die neue Parteifreundin Helga!“ Und wieder zu ihr: „Willkommen bei uns!“ Dann verkündet er: „Der Vorstand hat gerade seine Sitzung beendet, in fünf Minuten beginnt die Versammlung.“ Und: „Setz Dich doch, Helga!“
Helga nahm Platz am das gesamte „Bürgerstübchen“ ausfüllenden Tisch und bestellte bei der herbeigeeilten Serviererin einen Tee. Sie sah, dass die meisten der Versammelten Biergläser vor sich hatten, manche noch „Schnäpschen“ daneben. Während sie ihren neuen „Parteifreunden“ zunickte, kamen weitere Personen in den Raum, begrüßten sich gegenseitig, warfen Helga fragende Blicke zu und nahmen Platz.
Da ergriff der Pulloverträger das Wort: „Liebe Parteifreunde! Ich eröffne die Versammlung. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, begrüße ich unsere neue Parteifreundin Helga. – Steh doch mal auf, Helga.“
Beifall.
„Unsere Tagesordnung liegt vor: Hat jemand Einwände?“
„Ja“, meldete sich der Mützenträger, vor dem eine „Cola“ stand. „Ich hätt’ gern das Umweltthema vor dem Bericht des Vorstandes. Ist doch wichtiger! Vorstand is’ sowieso bloß Verwaltungskram.“
Der Vorsitzende wurde förmlich: „Ist das ’n Geschäftsordnungsantrag?“ – „Meinetwegen.“ – „Sie haben gehört, ein Antrag zur Geschäftsordnung. Spricht jemand dagegen?“
Sofort meldete sich ein korrekter Mitvierziger mit Schlips und Jackett: „Wir müssen erst den Bericht des Vorstandes diskutieren. Auf dem Landesparteitag wurde ein Misstrauensantrag gegen Parteifreund Rücker eingereicht, und dazu müssen auch wir Stellung beziehen. Sowas müssen wir doch besprechen, solange noch alle da sind.“
Der Kappenträger bemerkte, den Rücker kenne er sowieso nicht. – Eine dunkelhaarige Dame im blauen Kostüm giftete, der Rücker sei ein „Spinner“ und habe die Beschlüsse der Partei noch nie geachtet …
So ging es weiter, zwanzig Minuten lang – Rede und Gegenrede, bis der Vorsitzende über den Geschäftsordnungsantrag abstimmen ließ. Die Mehrheit schlug sich auf die Seite des Vorstandes. Helga enthielt sich, was der Vorsitzende offensichtlich missbilligend registrierte.
Danach trug er seinen Bericht weiter vor: Der Landesparteitag habe der Errichtung eines Gewerbeparks zugestimmt. Auch die Fraktion sei dafür, denn schließlich würden hier 85 Millionen investiert und Arbeitsplätze geschaffen. Das alles wäre im Falle einer Ablehnung in ein anderes Bundesland gegangen, wo man sich um das Projekt schon gerissen habe – „einschließlich unserer dortigen Parteifreunde! Der Rücker aber, der sture Hund, hat als einziger aus unserer Fraktion gegen das Projekt gestimmt, wahrscheinlich, weil er um seinen eigenen Kramladen in der Gegend fürchtet“. Der Gipfel sei, dass er sogar zu einer Protestversammlung der Grünen gegen das Projekt gegangen sei, dort auch noch das Wort ergriffen und gesagt habe, seine eigenen Parteifreunde wären so dumm, dass „sie die Schweine beißen“. Das hätten sie natürlich im Regionalfernsehen gebracht.
Der Vorstand vertrat die Auffassung, dass man dem Misstrauensantrag gegen Rücker zustimmen müsse. Die im „Bürgerstübchen“ Versammelten sollten das doch unterstützen!
Während sich unter den Mitgliedern die Debatte dahinschleppte, sich eine Minderheit für und eine Mehrheit gegen Rücker abzeichnete, dachte Helga: „Eigentlich hat dieser Rücker doch recht. So ein Gewerbepark würde bestimmt die althergebrachten Geschäfte kaputtmachen.“ – Aber sie traute sich nicht, etwas zu sagen. Denn über jeden Verteidiger Rückers fielen mindestens drei Gegner verbal her. Die Parteimitglieder diskutierten im Übrigen mit einer emotionalen Unerbittlichkeit, die Helga nicht verstand. Sie schwieg, und in der Schlussabstimmung enthielt sie sich.
„Kein Wort über die stinkenden Klos …“, resümierte sie im Innern.
Ein Umweltpunkt wurde vertagt, die Versammlung geschlossen: „Und nun gehen wir zum informellen Teil über.“ Die Neue dachte daran, dass sie am nächsten Morgen um sechs Uhr aufstehen müsse und verabschiedete sich beim Vorsitzenden. Der geleitete sie zur Tür: „Ich glaube, einiges siehst Du noch nicht richtig hier. Der Rücker macht uns die Partei kaputt. Da gibt es kein Pardon. – Ruf mich doch mal an!“
Helga rief den Vorsitzenden nicht an, und sie ging auch zu keiner weiteren Versammlung der Partei, weil sie fand, sie könne ihr Anliegen dort nicht so rabiat einbringen wie diejenigen, die da gesessen hatten.
Ihre Verbundenheit mit der Partei hatte sie allerdings mit einem Dauerauftrag für ihre Mitgliederbeiträge dokumentiert.1
Helga war eine durchschnittliche Bürgerin. Sie gehörte dabei zu den rund vier Prozent der Deutschen, die überhaupt Mitglied einer Partei wurden. Anderen Organisationen wie Gewerkschaften, Kirchen oder Vereinen ging es wie den Parteien: Die Mitgliederzahlen waren rückläufig, und von den eingeschriebenen Mitgliedern wollten oder konnten sich nur wenige engagieren. Das waren höchstens ein Viertel der Mitglieder. Diese wurden dann die „Funktionäre“ und Wortführer.
IV.
Nach ihrer ersten und letzten Mitgliederversammlung berichtete Helga ihrem Klaus, sie habe sich nicht wohl gefühlt unter der Fuchtel dieses Pulloverträgers, der den großen Vorsitzenden mimte. „Die haben da alle nur ihren Gewerbepark im Kopf. Und ihrem Parteigenossen Rücker würden sie allzu gerne einen überbraten. – Was interessieren die denn stinkende Klos in den Schulen?“
Doch Klaus hatte Feuer gefangen: „Da muss man hartnäckig sein! Immer wieder nachbohren. So machen die das bei uns im Amt ja auch, und in Potsdam war das ebenso.“
Klaus hatte ja zuvor einige Zeit im neu gegründeten Kulturministerium in Potsdam gearbeitet – als westlicher „Leihbeamter“. Ansonsten war Klaus Wirtschaftsreferent beim Bezirksamt Reinickendorf von Berlin. Er war zuständig für die Wochenmärkte. Oft war er „vor Ort“, inspizierte die Marktstände, prüfte die Waren und hielt Schwätzchen mit den Händlern und Kunden. Die Leute nannten ihn „Obameesta“, weil er über den jeweiligen Marktmeistern zu rangieren schien. Mit denen sprach er nämlich wie ein Vorgesetzter.
„Wenn ich im Amt dann von meinen Rundgängen berichte, fangen die lieben Kollegen oft an, von ihren Ladenzeilen, Kaufhäusern und Einkaufszentren zu reden. Die muss man dann einfach übertönen und hinterher dem Chef sagen, in der Runde sei es hauptsächlich um die Wochenmärkte gegangen.“
Klaus war sich sicher, dass es in den Parteien ähnlich zuginge wie in seinem Amt. Da platzte es aus ihm heraus: „Weißt Du was, Helga? Ich trete jetzt in Deine Partei ein. Ich werde diese Bonzen schon zum Jagen tragen! Ist doch wirklich nicht anders als bei uns im Amt!“
„Ach Du meine Backe“, kam der Kommentar vom Schüler Lars: „Da werden die Kumpels ganz schön lästern.“ – Helga warnte Klaus: „Tu Dir das bloß nicht an. Die sind total langweilig in ihrem ‚Bürgerstübchen‘, und eingebildet sind sie obendrein!“ Der aber ließ das nicht gelten: „Dann räum ich da eben auf!“
V.
Einen Monat später tagte der Ortsverband erneut. Klaus war aufgenommen worden. Als einem Verwaltungsangehörigen händigten ihm die Basispolitiker die Mitgliedschaft mit Handkuss aus.
Pünktlich zu Veranstaltungsbeginn betrat Klaus Mitt den Raum. Dort saßen sie alle: der Pulloverträger, die Biertrinker und der Jugendliche mit der Baseballkappe. Der Vorsitzende mit dem Pullover hatte Klaus sofort erspäht und spreizte sich: „Ich eröffne die Sitzung und begrüße als erstes wieder einen neuen Parteifreund: Klaus.“ Dann wandte er sich direkt an den Neuen: „Es ist uns eine Ehre, dass Du jetzt auch zu uns gehörst, nachdem Deine Frau schon vor einem Monat gekommen ist. Herzlich willkommen!“
Das Duzen war hier Usus.
Klaus nahm das Wort: „Lieber Vorsitzender, ich danke. Meine Frau – die heute leider verhindert ist – und ich haben vorab ein ziemlich profanes Anliegen: Im wahrsten Sinne des Wortes stinkt es uns, dass der Bezirk die Klos in den Schulen verkommen lässt. Die Bundeskanzlerin parliert fein im Oval Office zu Washington, und bei uns stinken die Klos! Unser Sohn Lars kann in der Schule nicht richtig austreten, wenn er mal muss. Es stinkt zu sehr auf’m Klo!“
Viele Anwesende klopften Beifall. „Das ist wirklich ein Skandal!“, beteuerte Klaus noch einmal. Doch der Vorsitzende wiegelte ab: „Ja richtig … – Aber jetzt beschließen wir erst einmal die Tagesordnung, – so ist das hier üblich! – Unter ‚Verschiedenes‘ können wir gerne über die Toiletten beraten“, fügte er süffisant lächelnd hinzu.
„Meinetwegen“, trötete der Kappenträger. „Aber recht hat er: Es stinkt an den Schulen!“ – Ihn traf ein kurzer, strafender Blick des Vorsitzenden.
Die Tagesordnung wurde beschlossen, so wie der Vorsitzende es gewollt hatte. Wieder ging es um den Gewerbepark. Klaus kannte das Thema schon aus den Erzählungen seiner Frau. Der Rücker ging dem Vorsitzenden noch immer auf die Nerven. – Der Neue ließ die gesamte Diskussion – zu Hause hatte er dazu „Gelaber“ gesagt – über sich ergehen.
Dann rief der Pulloverträger „Verschiedenes“ auf und wandte sich altväterlich Klaus zu: „Also Dir stinkt’s, dass es in den Schulen stinkt?“ – „Ja, besonders unser Bezirk kümmert sich nicht um den Zustand der Schultoiletten.“ – „Wer sagt das?“, fuhr der Vorsitzende dazwischen. Klaus ärgerte sich über die Arroganz und offensichtliche Unbelehrbarkeit dieses Herrn: „Meine Frau und mein Sohn: Helga ist Elternvertreterin, und Lars ist da Schüler. Beiden stinkt es gleichermaßen!“
Der Vorsitzende schaute auf seine Armbanduhr: „Oh, liebe Freunde, es ist ja schon nach zehn. Ich muss die Versammlung leider schließen. Die Sache mit den Klos kommt auf die nächste Tagesordnung. – Gute Nacht!“
Klaus fand hinterher, er sei abgebügelt worden. Wütend sagte er zu Helga, so etwas ließe er sich nicht gefallen. Er setzte sich zornig an seinen Schreibtisch und formulierte einen Antrag für die kommende Sitzung des Ortsverbandes:
„Der Ortsverband möge beschließen: Das Bezirksamt wird beauftragt, die Toiletten in den Schulen seines Zuständigkeitsbereiches zu sanieren, so dass diese jederzeit ohne Geruchsbelästigungen benutzt werden können und sich ständig in einem hygienisch einwandfreien Zustand befinden.“2
Mit einem Anschreiben versehen, sandte er diesen Antrag per Post an den Vorstand seines Ortsverbandes. Dieser bestätigte ihm – ebenfalls per Post – der Antrag werde auf der nächsten Tagesordnung stehen.
Vater Klaus fand, er habe einen ersten Sieg errungen und prahlte gegenüber Helga: „So macht man das!“
Einen Monat später ging es wieder ins „Bürgerstübchen“. Der Vorsitzende war diesmal mit einem etwas aus der Mode gekommenen Sakko angetan. Er hatte den Antrag tatsächlich auf die Tagesordnung gesetzt. Dazu brummte er: „Der Antragsteller bitte zur Begründung!“ Klaus unterstrich die Verantwortung des Bezirks und meinte, es sei doch wohl allen klar, dass es in den Schulen keine stinkenden Klos geben dürfe.
Da fragte der Vorsitzende, wie denn die Baumaßnahmen, die dem Antrag zur Folge an allen Schulen des Bezirkes erfolgen müssten, finanziert werden sollten. „Aus dem Haushalt natürlich“, war die kesse Antwort.
Der Kappenträger setzte einen drauf: „Ist doch egal: Der Gestank muss einfach weg.“ – „Schlag’ bitte einen Ausgleich vor!“, bohrte der Vorsitzende und sagte dann noch: „Es ist alles schon längst verplant.“
Nun meldete sich einer der Biertrinker: „Das ist unerhört, wie Du den Klaus mit seinem Antrag abbügeln willst. – Völlig richtig: Die Klos dürfen nicht mehr stinken! – Also ich stimme für den Antrag.“
„Meinetwegen“, konzedierte der Versammlungsleiter. „Aber der Beschluss muss seriös sein. Was sollen die im Rathaus denn von uns denken, wenn wir keinen Ausgleich anbieten?“
„Ausgleich, Ausgleich …“, äffte einer nach: Die Debatte wurde wüst. Am Ende stimmte eine knappe Mehrheit für Klaus. Dieser freute sich, und der Vorsitzende schien beleidigt zu sein.