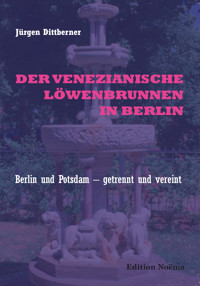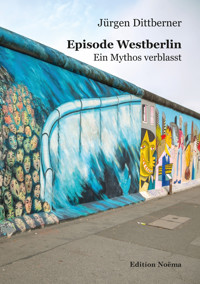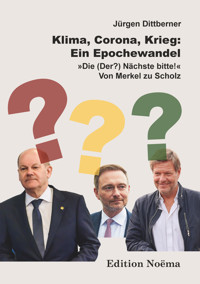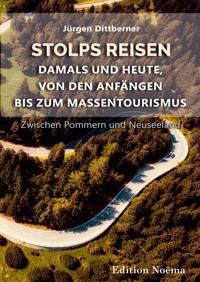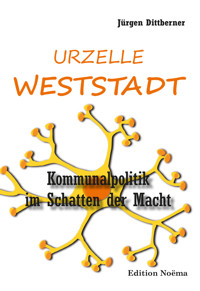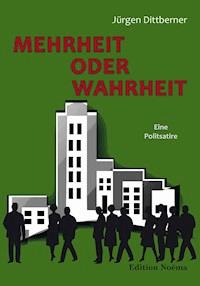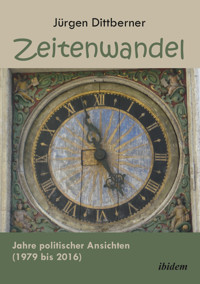
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Band legt Jürgen Dittberner eine Sammlung politischer und politologischer Essays und Aufsätze zu tagespolitischen Fragen vor, in denen er die Jahre 1979 bis 2016 reflektiert. Es werden die eklatanten weltpolitischen Veränderungen deutlich, die sich in diesem doch relativ kurzen Zeitraum finden: der Zusammenbruch des Ostblocks und seine Folgen, die Globalisierung, die Kriege im arabischen Raum und die modernen Völkerwanderungen. Wer glaubte, die „Wende“ der Jahre 1989 bis 1990 habe Ruhe und Verlässlichkeit gebracht, irrte. Die Menschheitsseuche des Krieges breitet sich immer wieder aufs Neue aus. Intoleranz und Terror – Dummheit und Rücksichtslosigkeit – verschwinden nicht. Als widerführe den Menschen durch Naturkatastrophen, Krankheiten, Seuchen und Unglücksfälle nicht schon genug Schlimmes, produzieren sie darüber hinaus selbst beständig Katastrophen. Die Geschichte geht weiter, aber sie schreitet nicht voran. Zwar werden Verfahren und Techniken immer raffinierter und effektiver, doch die menschengemachten Katastrophen passen sich dem an. Segen und Verderben laufen um die Wette. Sieger oder Verlierer gibt es nicht. Dittberners Buch spiegelt die Entwicklung Berlins und Brandenburgs um 1990 wider, reflektiert die politische Kultur, widmet sich dem Gedenken, untersucht die politischen Parteien, spricht die Situationen von Minderheiten sowie Folgen der Zuwanderung an – und stellt auch ein gedankenreiches, vielschichtiges und faszinierendes politisches Vermächtnis dar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
(Die Rechtschreibereform wird hier insoweit ignoriert, dass ältere Texte in der seinerzeit gültigen Schreibweise wiedergegeben werden.)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Bis zur deutschen Vereinigung
1965
1970
1975
1980
1985
1990
Deutsche Frage
1979 Die Verkettung der „Deutschen Frage“
2005 Verostet die Republik?
2014 Etwas komplizierter
Berlin
1990 Berliner Perspektiven: Die doppelte Einheit
1992 Wickelt Berlin ab!
1997 Ein Wechsel ist not
2001 Drei Davids gegen zwei Goliaths
2002 Über deutsche Legenden
2004 Neben dem Ministerpräsidenten
2005 „Theater in die Hauptstadt“ im Schiller-Theater
2006 Westberliner Dinosaurier ohne Trauer
2007 Träume und Schäume
2008 Weltstadt und Provinzler
2009 Die Show ist aus
2012 Deutsche Oper Berlin
2012 Nun geht alles schief
2013 Flughafenfrei
2014 Nicht nur Milliarden: Neuwahlen!
2014 Kurras
2015 Bürgermeister Müller
Brandenburg
1997 Landestheater in Potsdam
1997 Die Neuordnung der Wissenschaftslandschaft in Brandenburg nach der Wende
1997 Das Ende der neuen Zeit
1998 Potsdam auf dem Prüfstand
1999 Unheilbar unschuldig?
2000 Berlin bei Potsdam
2001 Brandenburg neu erfinden
2001 Brandenburgs Zukunft
2009 Der Osten ist Rot-Rot
2010 Stasiland?
2012 Aufgaben der Universität Potsdam
2012 Auf dem Sockel
Berlin-Brandenburg
1991 Auch Berlin ist eine Tochter Brandenburgs
1996 Hebt den Schatz der Geschichte
1996 Schwach und getrennt
Politische Kultur
1998 Das erste Sie
1998 The Games must go on
2000 Offenheit statt Multikulti und Leitkultur
2001 Stolz auf Ballermann
2001 Die 68 er
2006 VIP-Demokratie
2006 Häutungen über Grass
2008 Denkverbote
2012 Wörterakrobatik
2012 Armes Deutschland
2012 Wir Selbstgerechten
2014 Weg mit Grundsätzen!
2014 Früher war alles besser!
2015/2016 Krieg in Syrien / „Willkommenskultur“ in Deutschland
2016 Funktionäre, Populisten und Demokratie
Scientology
2007 Scientology
2007 NPD und Scientology nichts für Innenminister
Wann endlich?
2006 Wann endlich?
2009 Endlich!
Rechtsextremismus
2000 Therapie oder Administration?
2000 Der Bewegung die Spitze nehmen
2006 Nazis? Gibt’s nicht!
2008 Rechtsextremismus – liberale Antworten
2015 Dresden
Gedenken
1996 Susanne Lenz: „Vier Jahre Arbeit gegen die Entsorgung der Geschichte: Jürgen Dittberner verlässt die Gedenkstätten-Stiftung zum Jahresende“
1977 Auschwitz
1994 Holocaust-Museen in den USA
1996 Pessach in Jerusalem
1994 Annäherungen an Sachsenhausen
1994 Später Fluch der Naziherrschaft
2003 Lernen über den Kulturverfall
1997 Originalstätten erhalten
2001 Die Seelen kommender Generationen
2005 Flucht vor der Verantwortung
2005 Alltagskultur trifft Gedenkwesen
Repräsentative Demokratie
1997 Mehr oder weniger Demokratie
2005 Populistische Demokratie
2016 Vor der Wahl
Politiker
1999 Von Machtmenschen und Staatssekretären
2000 Wie schlechte Führung gute Politik schlecht macht
2001 Von Machern, Abweichlern und Schmeichlern
2004 Günter Rexrodt – Politik als Beruf
2008 Vesper, Clement, Bsirske
2016 Guido Westerwelle
Abgeordnete / Parlament
2003 Freies Mandat und politische Geschlossenheit
2003 Transparenz und Kontrolle Parlamentarische Mandate von Draufsattlungen befreien
2005 Abgeordnete fürs ganze Volk
2008 Mandat und Gewissen
2008 Abgeordnetenmobbing
Bundespräsident
2004 Wie Falschgeld im rot-grünen Lager
2012 Brauchen wir einen Bundespräsidenten?
2012 Demokratische Courage oder Majestätsbeleidigung?
2013 „Hosianna!“ – „Kreuzigt ihn!“
2014/2016 Pastor Gauck
Parteien
2015 (Allgemein) Die politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland
2002 (Allgemein) CDU und SPD statt RTL und SAT 1
2008 (Allgemein) Verstockte Kleinparteien
2012 (Allgemein) Volatilität
2002 (Union: CDU und CSU) Das Salz, das man in die Augen der Wähler streut
2015 (Union: CDU und CSU) Freunde oder Rebellen
2005 (SPD) Wer hat Heide Simonis ermordet?
2008 (SPD) Was ist los?
2001 (Grüne) Noch eine Chance für die Grünen
2008 (Grüne) Grüner Rudi?
2002 (FDP) Westerwelle oder die Liberalen
2010 (FDP) Ist die FDP eine Klientelpartei?
2016 (FDP) Wieder Funktionspartei?
2015 (Linkspartei) Es tut so weh
2015/16 (AfD) Alternative für Deutschland (AfD)
2012 (Piraten) Neue „Partei der Nichtwähler“: Die „Piraten“
2009 (Rechte) Gegen die NPD, aber ohne V-Leute!
Föderalismus
2002 Ein Exempel für die politische Bildung
2004 Junkies der Politikverflechtung
Kommunalpolitik
1999 Politik vor der Haustür – nur noch was für Funktionäre?
2002 Von „Luv“‘s und „Torten“-Modellen
2004 Kein Staat mit „Kiezpolizei“
2007 Ehrung für Clara von Simson
2007 Tod einer Mutter und eines Babys in der Berlin-Charlottenburger Rognitzstraße
2007 Krakau und Kracauer
Europa
2012 Eurokrise
2015 Das „Haus Europa“ und die Krämer
2015 Europäische Kalamitäten
2016 Brexit
Globales
1997 Sozialpolitische Global Players gesucht
2001 Wie ändert sich die Welt?
2003 Der Krieg ist da
2007 „The Germans to the Front“
2012 Griechenland – ein Stimmengewirr
Minderheiten / Zuwanderung
1989 Wir müssen noch viel lernen
1997 Die raue märkische Luft
2000 Offenheit statt Multikulti und Leitkultur
2010 Gott erhalte den weltlichen Staat
2015 Mal angenommen
2015/2016 Achtung: Gesinnungsethik!
2015/2016 Lockruf des Geldes
Nachwort
Aufbauen, erben, verderben
Frühere Publikationen
Biografie
Impressum
Vorwort
Hier sind einige meiner politischen Essays und Aufsätze zu tagespolitischen Fragen zusammengefasst. Die Texte stammen aus Jahren vor und nach der Jahrtausendwende. Wichtig sind die angegebenen Jahreszahlen: Mit ihrer Hilfe lassen sich die jeweiligen Aussagen einordnen. Um solche frühere Sichtweisen – die sich nachher manchmal als falsch erwiesen – zu erhalten, wurde so wenig wie möglich verändert.
Einige Texte wurden bereits anderswo publiziert, manche davon in Titeln des anliegenden Verzeichnisses. Hier erfolgen neue Zuordnungen und Erweiterungen durch bislang Unveröffentlichtes.
Es sind wenige Jahre, die reflektiert sind. Aber welche Veränderungen umfasst diese Zeit!
Der Zusammenbruch des Ostblocks und seine Folgen, die Globalisierung, die Kriege im arabischen Raum und die modernen Völkerwanderungen werden thematisiert. Wer glaubte, die „Wende“ der Jahre 1989 bis 1990 hätte Ruhe und Verlässlichkeit gebracht, irrt. Wer meint, es gäbe mit der Zeit Fortschritt und die Menschen würden aus Fehlern lernen, irrt ebenfalls.
Der Krieg, diese Pest, breitet sich immer wieder aus. Intoleranz und Terror – Dummheit und Rücksichtslosigkeit – verschwinden nicht. Als würde den Menschen durch Naturkatastrophen, Krankheiten, Seuchen und Unglücke nicht schon genug Schlimmes widerfahren, produzieren sie darüber hinaus selber Katastrophen.
Die Menschheitsgeschichte geht ständig weiter, aber sie schreitet nicht voran. Zwar werden Verfahren und Techniken fortwährend raffinierter und effektiver. Doch die menschengemachten Katastrophen passen sich dem an. Segen und Verderben laufen um die Wette. Sieger oder Verlierer gibt es nicht.
Manchmal kommt es zu glücklichen Momenten. In Deutschland war das zuletzt bei der Wiedervereinigung so. Doch bald danach kamen Katastrophen: der 11. September, die Kriege in der arabischen Welt, der hinterhältige Terrorismus. Schließlich – sind die modernen Völkerwanderungen für die „erste Welt“ Problem oder Chance?
Der Zeitenwandel ist weder gut noch schlecht. Er bringt Veränderungen.
Meiner Ehefrau Elke Dittberner danke ich für die Hilfe.
Jürgen Dittberner, Berlin 2016
Bis zur deutschen Vereinigung
Die Teilung Deutschlands schien endgültig zu sein. Das Berliner Problem war zwar noch ungelöst, aber kaum jemand glaubte wirklich, dass sich die nationale Frage durch die Entwicklung einer Stadt klären könnte.
In Ost wie in West hatten sich die meisten Deutschen mit der Zweistaatlichkeit abgefunden, wenn auch die Debatte über eine „Wiedervereinigung“ weiterging. Alle richteten sich ein: Es gab „Westdeutsche“ und „DDRler“. Erstere hatten es besser getroffen, denn ihnen stand unbeschränkter Konsum offen, und sie konnten aller Herren Länder bereisen. Bei letzteren gab es da Engpässe. Aber die meisten akzeptierten die Zweistaatlichkeit als Strafe der Geschichte für die Verbrechen der Nationalsozialisten.
Dann implodierte die UdSSR und als Folge davon auch die DDR. Urplötzlich wurden Ost- und Westdeutschland „vereint“, indem der Westen den Osten aufnahm. Eine neue Welt tat sich auf.
1965
Der Krieg war zwanzig Jahre vorbei. Die „Apo“1: die „68er“ – gab es noch nicht. Das Land war gespalten in die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Es war Frieden.
Bundeskanzler war Ludwig Erhard von der CDU und Vizekanzler Erich Mende von der FDP. Den Posten des „Generalsekretärs“ der SED bekleidete Walter Ulbricht. Später sollten unabhängig voneinander Erhard durch die CDU, Mende durch die FDP und Ulbricht durch die SED abgesetzt werden.
1965 wurde der SV Werder Bremen westdeutscher Fußballmeister.
Gegen Wolf Biermann verhängte die DDR ein Auftrittsverbot. Winston Churchill – der britische Kriegspremier – starb, und die britische Königin Elisabeth besuchte das westliche Deutschland.
Verdrängt waren die Schrecken des Krieges: die toten Soldaten, die Bombenalarme, die Trümmer. Verblasst waren die Bilder der Kriegskrüppel, die in Ost und West blind, bein- oder armamputiert die Straßen bevölkert hatten.
Der Hunger der Nachkriegszeit wurde vor allem im Westen unter einer „Fresswelle“ versenkt. Die Menschen labten sich am Essen, aber auch an neuen Häusern, Wohnungen und Autos. Die Welt öffnete sich – bis nach Italien und Griechenland.
Sonntags zog man sich fein an. Die Männer trugen Krawatten, die Frauen Röcke. Der Sonntagsbraten durfte nicht ausbleiben.
Es wurde immer deutlicher: Der Westen wurde reich, der Osten blieb arm. Reich war gut, arm böse. Die „DM“ wurde richtiges Geld; in der DDR gab es nur „Aluchips“. „VW’s waren in der ganzen Welt begehrt; Autos der Marke „Trabant“ wollte kaum einer der DDR haben. Die feinen Leute im Westen und die Aufschneider fuhren „Mercedes“.
Als Berlin-West in Tegel einen neuen Flughafen erhielt, wurde der Öffentliche Personennahverkehr („ÖPNV“) nicht direkt angebunden, denn – das schien damals klar zu sein – wer flöge, führe nicht mit der U-Bahn zum Flugplatz, sondern mit dem „Wagen“. Berlin erhielt Stadtautobahnen wie Städte in den USA. Straßenbahnen wurden ausgemustert – sie erschienen altmodisch. Das „Wirtschaftswunder“ hatte den Westen ergriffen. Der Osten kam nicht mit.
Aufreger war 1965 noch der Mauerbau von 1961 in Berlin. Westberlin versuchte, sich als „ganz normale“ Großstadt zu entwickeln. Dennoch blickten die Westberliner neidisch auf den Ostteil der Stadt, der „Hauptstadt“ – wenn auch nur der DDR – war. Viele Menschen und Firmen verließen Westberlin. Aus Vorsicht.
An die Wiedervereinigung glaubten im Innersten wenige – aller gegenteiligen nationalen Rhetorik zum Trotz.
Im Westen wurde viel über das „dreigeteilte Vaterland“2 geredet. Als böser Wicht galt, wer öffentlich an der Einheit zweifelte. Der Osten versuchte, sich allmählich aus dieser „gesamtdeutschen“ Sichtweise zu lösen.
Nicht nur die deutsche Jugend gehörte zur „Skeptischen Generation“3: Die meisten Menschen in West und Ost wollten von öffentlichen Dingen wenig wissen und waren auf ihr Privatleben fokussiert. So verarbeiteten sie im Westen die ideologische Aufheizung während der Nazi-Zeit. Viele Ostdeutschen legten sich „Datschen“ im Grünen zu und folgten allzu gerne der offiziellen DDR-Sicht, dass man als sozialistische Gesellschaft mit der NS-Vergangenheit nichts zu tun habe.
1970
Die Bundesrepublik Deutschland hatte eine innere Revolution erfahren. Die scheinbar „ewige Regierungspartei CDU/CSU“ war in die Opposition geraten. Der „Alleinvertretungsanspruch“ Westdeutschlands für die gesamte Nation schwand. Eine sozial-liberale Bundesregierung betrieb stattdessen eine Politik der Versöhnung mit Osteuropa („Neue Ostpolitik“) und wollte im Innern „mehr Demokratie“ wagen. Die „Außerparlamentarische Opposition“ (APO) mit dem Studenten Rudi Dutschke an der Spitze hatte die westdeutsche Gesellschaft in Bewegung gebracht. Aus der formalen Demokratie wurde eine inhaltliche.
Bundeskanzler war Willy Brandt von der SPD, Vizekanzler Walter Scheel von der FDP. „Erster Sekretär des ZK der SED, Staatsratsvorsitzender und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates“ in der DDR war (noch) Walter Ulbricht. Willy Brandt und der Ministerpräsident der DDR, Willy Stoph, trafen sich in Erfurt und Kassel. Die dortigen „Willy!“-Rufe galten dem Bundeskanzler – nicht Stoph.
Die vier Siegermächte handelten ein Abkommen über Berlin aus, das Reisemöglichkeiten zwischen der Bundesrepublik einschließlich Westberlins und der DDR brachte („Passierscheinregelung“).
Borussia Mönchengladbach wurde (west-)deutscher Fußballmeister.
Eine böse Nachgeburt der „APO“ war die „Rote Armee Fraktion“ („RAF“), eine Terrororganisation. Sie versetzte die Bundesrepublik in Angst und Schrecken. Im Unterschied dazu proklamierten Dutschke und andere den „Marsch durch die Institutionen“, der den Parteien – besonders der SPD – neue Mitglieder zuführte.
Nach dem Rücktritt von Willy Brandt 1974 veränderte sich die sozial-liberale Bundesregierung. Sie kam in ihre zweite, konsolidierende Phase. Der Terror im Innern und die Konjunktur sowie die Weltwirtschaftspolitik waren die beherrschenden Themen geworden.
1975
Bundeskanzler war nun Helmut Schmidt von der SPD, Vizekanzler Hans-Dietrich Genscher von der FDP. Schmidt galt als „Macher“ und wurde als solcher vom „Visionär“ Brandt unterschieden. – „Erster Sekretär des ZK der SED, Sekretär für Sicherheits- und Kaderfragen im ZK der SED und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates“ in der DDR war Erich Honecker geworden.
Eine „Bewegung 2. Juni“ entführte den Westberliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz, der „freigekauft“ wurde. Besonders der Bundeskanzler sah darin eine „Erpressbarkeit des Staates“, die er im späteren Fall des entführten Hanns Martin Schleyer vermied.
1975 starb der spanische Diktator General Franco, und König Juan Carlos bestieg den Thron. Er stoppte couragiert einen Militärputsch in Madrid. Spanien wandelte sich zu einer parlamentarischen Demokratie.
Borussia Mönchengladbach wurde (west-)deutscher Fußballmeister.
1980
Der Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD wurde 1980 wiedergewählt, und die Koalition mit der FDP Hans-Dietrich Genschers wurde fortgesetzt. Erich Honecker war 1980 „Generalsekretär des ZK der SED, Sekretär für Sicherheits- und Kaderfragen im ZK der SED, Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates und Staatsratsvorsitzender der DDR“.
Die XXII. Olympischen Sommerspiele in Moskau wurden von den USA, Japan, der Bundesrepublik u.a. wegen des militärischen Eingreifens der UdSSR in Afghanistan boykottiert.
Bayern München wurde (west-)deutscher Fußballmeister.
Eine neue Partei entstand – getragen aus einer nach 1945 in Westdeutschland aufgewachsenen Generation von Umweltfreunden und Basisdemokraten: die „Grünen“.
1985
Bundespräsident Richard von Weizsäcker (CDU) hielt am 8.Mai 1985eine vielbeachtete Rede zum Jahrestag der Kapitulation des deutschen NS-Staates und drückte Schuld und Verantwortung der Deutschen aus.
Helmut Kohl von der CDU war neuer Bundeskanzler, nachdem der Bundestag Helmut Schmidt 1982 mit einem Konstruktiven Misstrauensvotum abgewählt hatte. Vizekanzler war wieder Hans-Dietrich Genscher von der FDP. In der DDR war Erich Honecker immer noch „Generalsekretär des ZK der SED, Sekretär für Kaderfragen beim ZK der SED, Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates und Staatsratsvorsitzender“.
Bayern München wurde wiederum (west-)deutscher Fußballmeister.
1990
1990 war das Jahr der Vereinigung Deutschlands. Die Mauer wurde abgebaut. Helmut Kohl – dessen Herrschaft sich schon dem Ende zuzuneigen schien – galt jetzt als „Kanzler der Einheit“. Hans-Dietrich Genscher wurde umjubelt, als er in Prag die Ausreise von DDR-Flüchtlingen in die Bundesrepublik ankündigen konnte. Der Ostblock insgesamt brach zusammen, weil die UdSSR ihr Imperium nicht mehr beherrschen konnte.
Die DDR implodierte. Ihr letzter Ministerpräsident war der demokratisch gewählte Lothar de Maizière von der (Ost-)CDU.
Am 2. Dezember wurde bei der gesamtdeutschen Bundestagswahl Helmut Kohl als Kanzler bestätigt. Vizekanzler wurde wieder Hans-Dietrich Genscher von der FDP.
Bayern München schaffte es zum deutschen Fußballmeister.
Im neu vereinten Deutschland entstand ein Streit, welche Stadt seine Hauptstadt sein sollte: Bonn oder Berlin?
Am Ende wurde es Berlin.
Deutsche Frage
Die deutsche Vereinigung in den Jahren 1989/1990 war das Ereignis des Jahrhunderts. Jahre vorher und danach wurde dieser Vorgang anders bewertet als unmittelbar dabei. Während zuvor die Einheit als aktuell nicht absehbar eingeschätzt wurde, erfolgte hinterher die Klage über von mit der Einheit angeblich einhergehenden sozialen Verwerfungen.
1 „Außerparlamentarische Opposition“
2 Neben der „Ostzone“ und der Bundesrepublik gab es die „Gebiete jenseits von Oder und Neiße“.
3 Helmut Schelsky, Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend, Düsseldorf-Köln 1963
1979DIE VERKETTUNG DER „DEUTSCHEN FRAGE“1
Deutsche Fragen gibt es viele, gibt es auch deutsche Antworten? Zu Beginn dieses Monats kam der französische Staatspräsident nach Berlin, direkt aus Paris. Das war der erste Besuch eines französischen Staatsoberhauptes seit Napoleon. Im französischen Sektor von Berlin verhielt sich der Präsident wie auf französischem Hoheitsgebiet. Napoleon, der Bezwinger Preußens, und Giscard, der Repräsentant einer Schutzmacht in Berlin; – die Frage drängt sich auf: Wie lange währt der Augenblick des zweigeteilten Deutschlands und Berlins in der langen Perspektive der Geschichte?
Dass die „Wiedervereinigung“ in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren nicht zu haben ist, diese Feststellung ist bei uns mittlerweile zur Binsenweisheit geworden. „W i e d e r – Vereinigung wird es bei uns ohnehin nie geben. Die Bundesrepublik und die DDR – zusammen mit Berlin das Deutschland von heute, sind ja nie vereint gewesen. Auch lassen sich bürokratisch reglementierter Staatssozialismus und mit einem Netz der sozialen Sicherheit verwobener Kapitalismus nicht verschmelzen. Und wer will überhaupt eine „Vereinigung“? Die Nachbarn im Osten und Westen, die Polen und Franzosen zumal, empfinden derzeit überwiegend relative Sicherheit und fragen sich, wie es mit ihrer Sicherheit im Falle der Veränderung des Status quo in Europa aussehen würde. Die Bürger der Bundesrepublik sind zunächst an Konsum, an Wohlstand und an sozialer Sicherheit interessiert, aber nicht an unwägbaren Veränderungen in der „nationalen Frage“. Die Deutschen in der DDR und in Ostberlin wünschen sich vielleicht in der Mehrheit eine deutsche Vereinigung; sie glauben aber nicht daran, dass sie kommt und ziehen sich in Nischen des privaten Glücks zurück.
Stellt sich die deutsche Frage also nicht mehr? Sie stellt sich trotz allem in einer Vielzahl „deutscher Fragen“. „Deutschland“, das gibt es eben nach wie vor, obwohl sich das Leben von den meisten unter uns eigentlich nur um die Bundesrepublik dreht. „Deutschland“ hat es ja auch in der dunklen Zeit des 30-jährigen Krieges gegeben, als doch Fürstenhäuser und Kleinstaaten sowie ausländische Mächte die Szene beherrschten: Trotz des politischen wie militärischen Agierens der Habsburger, der Sachsen, der Bayern, der Schweden, der Spanier und der Franzosen. Wie oft schon ist darauf hingewiesen worden, dass Deutschland in der Form des einen Nationalstaates bisher nur ein kurzer Abschnitt der deutschen Geschichte geblieben ist. „Deutschland“ ist – historisch gesehen – noch nie fertig gewesen, sondern es ist immer im Wandel begriffen.
Was sind die deutschen Fragen heute? Die Gründung zweier deutscher Staaten leitet sich historisch aus dem verlorenen 2. Weltkrieg Nazideutschlands ab. Der Verlust des Staatsgebietes im Osten ebenfalls, dieser Verlust erfährt jedoch seine moralische Legitimation trotz allem damit verbundenen Unrechts an deutschen Menschen, aus den unfassbaren Verbrechen der Nazis an anderen Völkern, die Deutschland mit einer moralischen Schuld belasten. Ihren Existenzgrund, ihre innere Ausgestaltung leiten die beiden deutschen Staaten jedoch – wenn auch in unterschiedlicher Weise – aus der weltpolitischen Bipolarität der Supermächte USA und UdSSR und dem expansiven Charakter ihrer jeweiligen Gesellschaftsordnungen ab.
Die Zweistaatlichkeit Deutschlands also ist eine historische Tatsache, nicht revidierbar. Sie ist für Ausländer und sogar für Deutsche darüber hinaus zum Garanten der Sicherheit geworden. Aber unterhalb des zuletzt durch die KSZE-Schlussakte sanktionierten Institutionengebäudes der Staatsformen und Bündnisse, unterhalb des administrativ Trennenden, gibt es dennoch das durch Tradition, Kultur, Sprache und schichte räumliche Nähe Verbindende, aufeinander Zuweisende. Deutsche Frage: wird dieses Verbindende, Zuweisende infolge der Zeit blasser, weniger wirksam? Die Bande der Familien und der Freundschaften mögen in der Tat lockerer werden. Aber die Gemeinsamkeit der Sprache? Bewirken nicht die Massenmedien hüben wie drüben, dass sich „Deutsch-Ost“ und „Deutsch-West nicht zu gegenseitigen Fremdsprachen entwickeln? Und ist nicht die Geschichte etwas unwiderruflich Gemeinsames – wie zum Beispiel die gegenwärtige „Preußen-Renaissance“ Ost und West zeigt?
Da ist die räumliche Nähe. Nicht nur bei uns, auch im Wirtschaftsstaat DDR bestehen ökologische Probleme, die auf kleinem Raum nicht bewältigt werden können und überstaatlicher Lösungen bedürfen, zum Teil solchen schon zugeführt worden sind. Ich denke da nur an die Reinhaltung des Wassers oder der Luft. Die in einem internationalen System integrierte staatliche Zweiteilung Deutschlands steht in einem ambivalenten Verhältnis zur mannigfachen, kulturellen und infrakulturellen Verbindung zwischen den Staaten.
Hinzu kommt der komplizierte, beide deutschen Staaten wiederum verbindende Status Berlins.
So unrealistisch das zurzeit für die Mehrheit der Bevölkerung im Westen klingen mag: Aus der Quantität der zu regelnden Verbindungen könnte eines Tages die Qualität einer neuen Lage in Deutschland werden. Die diesbezüglichen Kulissengeräusche aus Moskau sowie fachkundige Kommentare aus dem östlichen wie aus dem westlichen Ausland machen deutlich, daß viele Kenner Deutschlands diese Möglichkeit des Umschlags von der Quantität in die Qualität ernster nehmen als die Mehrheit der Bundesbürger.
Verkürzt gesagt „Kapitalismus und Sozialismus“ teilen Deutschland nicht nur, sondern sie prallen hier aufeinander, und so entsteht Legitimationsdruck. Wenn die DDR wirklich den höchsten Lebensstandard im Ostblock haben sollte, so doch wohl auch deswegen, weil der Lebensstandard der Bundesrepublik noch höher ist. Auch hier wiederum wird im Trennenden das Verbindende sichtbar.
Das Verbindende: Über den Interzonenhandel, über die Besucher- und Transitregelungen, ja sogar über das Intershop-System sind Ost und West auch wirtschaftlich miteinander verkettet. In ihrem Bemühen, das wirtschaftliche Gefälle zwischen Ost und West nicht allzu sehr zu vertiefen, koppelt die DDR-Führung ihre eigene Wirtschaft an den Westen, spricht die Bundesrepublik, an. Über den Interzonenhandel hinausgehende gemeinsame Wirtschaftsinstitutionen sind möglich. Deutsche Fragen in diesem Zusammenhang: hat nicht das Bild vom American way of life bei uns an Strahlkraft verloren? Und: versuchen wir nicht schon seit langem dem archaischen Kapitalismus der USA einen sozial verantwortlichen Kapitalismus entgegenzusetzen? Umgekehrt: treten die Mängel des Wirtschaftssystems der UdSSR nicht bei jedem Weizenimport auch in der DDR hinlänglich zutage?
Gewiss, die Konvergenztheorien sind nicht mehr recht in Mode: Aber hat nicht, um noch einmal den 30jährigen Krieg zu bemühen, der Antagonismus der Konfessionen in dem Moment an politischer Wirkkraft verloren, da er in die heftigsten – damals kriegerischen – Auseinandersetzungen umschlug? Das Aufeinanderprallen der Systeme und der Wirtschaftsordnungen wird ganz gewiss nicht zu einer Mischform in Deutschland führen, möglich jedoch ist ein Interessenausgleich, eine Ergänzung, ein Arrangement, die ein institutionelles Miteinander erlaubt.
2005VEROSTET DIE REPUBLIK?
DIE POLITIK BRAUCHT QUEREINSTEIGER!
Das Publikum wundert sich: 15 Jahre nach der deutschen Vereinigung stehen an der Spitze der beiden deutschen Großparteien „Ossis“. CDU und SPD waren gleichermaßen 40 Jahre lang „Bonner Parteien“. Als solche – auch wenn mancher sich hier anfänglich dagegen gewehrt hatte – haben sie sich nach 1989 in der zu den „neuen Ländern“ mutierten DDR breit gemacht. In den Parteien galt wie in der gesamten Republik: Das Sagen hatten die „Wessis“: erstens, weil sie die Sieger waren und zweitens, weil sie sich die Mehrheiten gesichert hatten. Das System, die Erfahrung, das Geld und die Methoden kamen aus dem Westen, und es galt als ausgemacht, dass die Ossis im Eilverfahren alles erlernen sollten.
Die Parteivorsitze und die Regierungen blieben in westdeutscher Hand. Bei der SPD waren alle Nachlassverwalter des Erbes von Willy Brandt Wessis: Hans-Jochen Vogel, Björn Engholm, Rudolf Scharping, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder und schließlich Franz Müntefering. Bei der CDU herrschte Helmut Kohl acht Jahre weiter über die nach dem Lande auch vereinigte Partei. Ihm folgte nach dem Abgang 1998 der Baden-Württemberger und ehemalige „Kronprinz“ Wolfgang Schäuble. Soweit war alles „normal“. Da putschte Angela Merkel, die Generalsekretärin und das „Mädel aus dem Osten“, gleich gegen Kohl und Schäuble. Sie setzte sich zum Erstaunen der „Anden“-Netzwerker2 an die Spitze der alten Adenauer-Partei. Eine Ostdeutsche – geschieden, kinderlos und evangelisch: Das hielten viele der Unions-Karrieristen in den Ländern nicht aus. So wurde ihr 2002 der CSU-Bayer Edmund Stoiber als Kanzlerkandidat vorgesetzt – lieber einer aus der guten alten „Schwesterpartei“ und aus Wolfratshausen an der „K-Spitze“ als eine Pfarrerstochter aus Templin!
Aber Stoiber – der vom legendären „FJS“ geschulte – schaffte es nicht. Er zog sich halb schmollend, halb triumphierend angesichts heimischer Wahlergebnisse nach Bayern zurück. Da zögerte er weiter, ob er Präsident der EU-Kommission, Bundespräsident, noch einmal Kanzlerkandidat werden oder doch lieber Ministerpräsident in Bayern bleiben wollte – im „schönsten Amt auf der Welt“. Derweil rang ihm Angela Merkel – die kühle Physikerin – allmählich den Rang ab. Sie wurde die Nr. 1 im Unionslager, und Stoiber landete nach einem virtuellen Ausflug in die deutsche Hauptstadt am Ende als Kopie seiner selbst wieder in München, wo die Diadochen schon aus der Deckung gekommen waren.
Schröder wiederum – der aus Juso-Zeiten trainierte – behielt 2002 die Macht und setzte eine „Hartz IV“ genannte Veränderung des Sozialsystems durch, wodurch zuerst die eigene Partei erschüttert, dann die Betroffenenszene verwirrt und emotionalisiert und am Ende er selber verdrängt wurde: zuerst aus dem Amte des SPD-Vorsitzenden, dann aus dem Kanzleramt. Franz Müntefering, sein sozialdemokratischer Schatten, musste schließlich vor den führenden Sozialdemokraten für die ganze „Basta“-Politik büßen und war darüber so empört, dass er den SPD-Vorsitz – das „schönste Amt nach Papst“ – hinschmiss. Über die Glienicker Brücke rollte da Matthias Platzeck aus Potsdam an und setzte sich flugs an die Spitze der SPD. Kein Zweifel, dass der SPD-Parteitag ihn auch wählen wird.
Nun wird es mit der großen Koalition wohl so kommen, dass mit Angela Merkel aus Templin und Matthias Platzeck aus Babelsberg zwei Ossis an der Spitze der Politik in Deutschland stehen werden. Wie konnte das geschehen, und verostet die Republik?
Da sollte man nicht übertreiben. Zwar stehen „Angie“ und der „Deichgraf“ vorne in der politischen Riege, aber gleich danach gibt es noch genügend viele „Wessis“. Merkels Stützen in Berlin heißen Wolfgang Schäuble und Michael Glos – zwei alte Bekannte aus der Bundesrepublik vor 1989. Und hinter Platzeck stehen Kurt Beck, der Pfälzer und Ute Vogt, die sozialdemokratische Südwest-Hoffnung. Den Vizekanzler will „Münte“ aus dem Sauerland geben. Auch der Bundespräsident3 ist kaum ein Ossi – trotz seines Geburtsortes. Die FDP wird schlingernd vom „fröhlichen Rheinländer“ Guido Westerwelle geführt. Bei den Grünen teilen sich Renate Künast, die Westberliner Pflanze, und Fritz Kuhn aus Südwest die Führung. Sogar bei der ostdeutsch dominierten „Linkspartei“ PDS wird die Fraktion gleichberechtigt vom ehemaligen SEDler Gregor Gysi, dem Parade-Ossi, und vom ehemaligen SPDler von der Saar, dem Parade-Wessi aus dem Bundestagswahlkampf von 1990, Oskar Lafontaine, geführt.
Aber dennoch: Was haben Merkel und Platzeck, dass sie sich selber gegen eingeübteste Seilschaften durchsetzen und die ersten Plätze belegen konnten?
Dass sie beide in Brandenburg aufwuchsen, dürfte Zufall sein. Es hätte auch Thüringen oder Mecklenburg sein können.
Dass sie Naturwissenschaftler sind, sollte den Juristen und Lehrern aus dem Westen zu denken geben. Gebraucht wird in der Politik offenbar nicht nur die Kunst der Rechtsauslegung und die Fähigkeit zur Betroffenheitsrhetorik, sondern auch das positive analytische Denken.
Dass sie nach der Wende nicht gleich zu den Großparteien liefen, sondern zuerst zum „Demokratischen Aufbruch“ (Merkel) und zu „Bündnis 90“ (Platzeck) und dass sie jeweils von dort zu Quereinsteigern bei CDU und SPD wurden, hat ihnen offensichtlich genützt. Frisches politisches Denken, frischer politischer Stil waren in den Altparteien offenbar nicht weit verbreitet.
Geholfen hat den beiden auch, dass sie in der Anfangszeit ihrer Westkarrieren einflussreiche und evangelisch engagierte Förderer aus dem Osten hatten: Merkels Mentor war Rainer Eppelmann und Platzecks Ziehvater Manfred Stolpe. Diese haben Mut gemacht und vorgelebt, wie es gehen kann.
Was Merkel und Platzeck aber den jeweiligen westdeutschen Altnetzwerkern vor allem voraushaben: Sie hatten ein Leben gelebt ohne Politik, ohne die Bundesrepublik, bevor sie von der westdeutsch geprägten Politik vereinnahmt wurden. Das gibt ihnen Lebenserfahrung und eine Stärke, über die Juso- und JU-Sozialisierte nicht verfügen. Diese kennen nur ihre Partei, und sie waren ihr Leben lang nichts anderes als deren Funktionäre.
Was soll eigentlich Menschen befähigen, ein Land zu führen, wenn sie ihr ganzes Leben lang nichts anderes getan haben, als an ihrer Karriere zu basteln, Beziehungen zu knüpfen, die Partei als Ersatzwelt zu begreifen? Von allem, was – wie sie sagen: „draußen im Land“ – geschieht, wissen sie nur aus zweiter Hand – aus den Medien, aus den Umfragen, aus ihren internen „Runden“. Selbst die Korrektivfunktion der schlichten Mitgliederversammlung der Partei, wo noch schlichte Nichtpolitiker das Wort ergriffen – ist aus der Mode gekommen. So hat sich im Westen eine Politikergeneration nach oben gemauschelt, die zwar das politische Subsystem aus dem Effeff kennt, die Politik am Ende aber nicht kann.
Das ist noch nicht einmal ihre eigene Schuld: Die heutigen Politiker aus dem Westen können nicht dafür, dass sie keine Erfahrungen aus der Geschichte mitbringen konnten wie die ersten westdeutschen Politiker vom Format Konrad Adenauers, Kurt Schumachers oder Theodor Heuss’. Die Schuld der gegenwärtigen Politiker ist es natürlich auch nicht, dass kein Erlebnis wie der Krieg sie prägte. Das jedoch war bei Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher der Fall. Aus dem Kriegserlebnis hatten sie ihre politischen Ziele und Werte abgeleitet: dafür zu wirken, dass es nie wieder dazu kommen möge.
Dass die Netzwerkpolitiker an ihrer Sozialisation unschuldig sind, erspart ihnen nicht die Feststellung, dass sie im Kern ungeeignet sind für die Politik. Sie haben keinen inneren Kompass, sind – wie David Riesman es formulierte – „außengeleitet“ durch Umfragen, Quoten, Wahlen, Medien. Sie schaffen es nicht, den Sozialstaat zu reformieren. Dennoch müssen sie immer so tun, als könnten sie es. Darunter leiden sie, und sie stürzen sich mehr und mehr in ein von Terminen diktiertes Politikerleben.
Es ist ein Hundeleben. Zeit zum Nachdenken, Abwägen, in Zweifel ziehen gibt es nicht. Weiter, immer weiter. Und dann passiert es gelegentlich, dass sie auf dem falschen Fuß erwischt werden, dass es nicht so läuft, wie sie sich das gedacht haben. Dann laufen sie wie kleine Kinder einfach davon. So tat es Lafontaine, so taten es Gysi, Schröder, Müntefering und Stoiber. Alle Welt sieht plötzlich: Ihr Ego ist ihnen wichtiger als die Gemeinschaft.
Das Publikum muss sich also nicht wundern, wenn Leute wie Platzeck oder Merkel in solcher Lage nach vorne kommen: Diese kennen ein anderes Leben als die Politik, können eins und eins zusammenzählen und wissen, dass plötzlich ein ganzes System zusammenbrechen kann und dass dennoch die Welt nicht untergeht. Sie haben – dank ihrer Biographie – das von Max Weber für den Stand der Politiker geforderte „Augenmaß“. Ob sie freilich in der Lage sind, politische Konzepte für die Fortentwicklung des Landes zu definieren, ist eine andere Frage. Aber vielleicht sagt ihnen ihre Erfahrung, dass sie dazu die Größe aufbringen müssen, die jeweils besten Köpfe des Landes zusammen zu rufen. Und vielleicht wissen sie, dass die besten Köpfe nicht jene sind, die am lautesten schreien oder diejenigen, den Medien am publikumswirksamsten erscheinen.
Die politischen Parteien sollten die Erfolge von Angela Merkel und Matthias Platzeck zum Anlass nehmen, die Art der Rekrutierung der politischen Führung zu reformieren. Nicht wer nach dem Studium zu einer Stiftung geht, danach Referent einer Fraktion, dann selber Mandatsträger wird und irgendwann einmal von irgendwem als „ministrabel“ klassifiziert wird, hat den Marschallstab im Gepäck, sondern eher schon einer, der außerhalb der Politik sein Leben bestanden hat und danach in die Politik wechselt.
Die Politikfunktionäre klassischer westlicher Art sind zumeist Autisten. Sie meinen, wie sie denken, sei es richtig und fallen aus allen Wolken, wenn Widerspruch aus ihrer Scheinwelt kommt. Widerspruch aus der richtigen Welt dagegen stört sie nicht: Die da draußen wüssten es halt nicht besser, glauben sie. Solche Politiker braucht das Land immer weniger, und deshalb setzen sich ab und zu andere durch: innengeleitete Menschen.
Das Schicksal der Ostdeutschen hat ihnen die Chance gegeben, solche Alternativen anzubieten. Mindestens zwei von ihnen haben dabei derzeit Erfolg. Das eingefahrene westdeutsche politische System wird dadurch ein klein wenig aufgebrochen. Noch einmal wird die Geschichte eine derartige Chance nicht bieten. Deswegen müssen die Parteien selber Mechanismen schaffen, durch die „Quereinsteiger“ gefördert werden. Ob diese dann aus dem Osten oder aus dem Westen kommen, wird zweitrangig sein.
2014ETWAS KOMPLIZIERTER
In der Erinnerung wird vieles übersichtlicher. Jetzt, 25 Jahre nach dem Mauerfall, war es der heldenhafte Protest der Menschen in der DDR, der die Wende brachte. Da kommt die Analyse eines ehemaligen Bundeskanzlers nicht gut an, wenn er behauptet, alles habe seinen Ursprung im Misserfolg der UdSSR.
Im Fernsehen sind jetzt wieder glückliche Menschen zu sehen, die aus dem Osten in den Westen kommen und „Wahnsinn!“ rufen. Aber dass sie auch immer wieder beteuerten, sie würden abends wieder „zurück“ in ihre DDR gehen, wird heute seltener gesendet.
Einige Politiker gelten heute schon als „Väter der Einheit“. Dabei hatten viele von ihnen vor dem Beschluss der Volkskammer, der Bundesrepublik beizutreten, an Plänen gebastelt, Deutschland für die Zukunft zweistaatlich zu organisieren.
Dass 1989 friedlich ablief, war wirklich ein „Wunder“. Aber was eigentlich war das Wunder? Dass es in der DDR-Bevölkerung eine Opposition gab, die immer zahlreicher aber nicht gewalttätig wurde, dass die Menschen dieser Opposition mutig waren? Oder war es das Wunder, dass die „bewaffneten Organe“ – also Volkspolizei, Volksarmee und Rote Armee – keinen einzigen Schuss abgaben?
Die Legende besagt, die „Helden von Leipzig“ wollten die Freiheit. Sie riefen: „Wir sind das Volk!“ Aber sie drohten auch: „Wenn die D-Mark nicht zu uns kommt, gehen wir zu ihr.“ Daraus entstand der Witz: Nicht wegen der Freiheit haben die Ostler in den Westen gewollt, sondern wegen „Bananen, Video und VW“.
Heute scheint vergessen zu sein, dass viele Menschen in Westdeutschland die Vereinigung Deutschlands gar nicht wollten. „Doitschland halts Maul!“ wurde an die Wände gesprayt, und das Bürgertum in Düsseldorf oder München fürchtete sich vor einer „Verostung“. Derweil fürchteten die Funktionäre in der DDR um ihren Status und fragten im Westen an, wie es denn mit Verbeamtungen aussähe. Viele schlichte DDR-Bürger sorgten sich derweil um die Zukunft ihrer Kindergärten, Polikliniken und Arbeitsplätze. Dennoch verlor die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Oskar Lafontaine, der all die Bedenken gegen die deutsche Einheit artikulierte, die Bundestagswahl.
Viele „Freunde“ im Ausland waren ohnehin nicht begeistert von der Aussicht auf ein vereintes Deutschland. Der französische Staatspräsident veranstaltete eine Inspektion der ihm vermeintlich unterstellten Gebiete jenseits des Rheins, die britische Premierministerin bekämpfte die deutsche Einheit offen, und viele andere Europäer hofften klammheimlich, die Bundesrepublik werde sich an der Sanierung der maroden DDR kaputtzahlen. Die Sowjets wollten gestalten, was doch nicht zu verhindern war. Allerdings sagten die Amerikaner schlicht „Yes“ zu Gesamtdeutschland. Und sie hatten das Sagen.
Nun behaupten noch heutige Wirtschaftsleute, das sich vereinigende Berlin habe in jener Zeit „richtig geprasst“. Doch auch das stimmt nicht ganz. Es gab nämlich schon 1989 Menschen, die konnten 1 und 1 zusammenzählen. So rechnete man aus dem Hause des Wirtschaftssenators Peter Mitzscherling von der SPD vor, dass es in Westberlin 940.000, in Ostberlin 850.000 und in Brandenburg 400.000 Beschäftigte gäbe und dass hiervon jeder vierte infolge der Vereinigung arbeitslos werde. Also mindestens 500.000 Arbeitslose in der Region: Das war die Botschaft! Zwar kam vom Westen Deutschlands eine andere Meinung: Berlin werde nun boomen wie New York. Aber die Berliner erkannten bald, dass Berlin mit diesem „Argument“ nur die Hauptstadtambitionen ausgeredet werden sollten, und Eberhard Diepgen, der ehemalige Regierende Bürgermeister von der CDU, warnte damals: „Wenn Berlin nicht Hauptstadt wird, geht die Stadt vor die Hunde!“
Dennoch war 1989 ein Geschenk. Wer hätte je gedacht, dass der einstige Wunsch der Insulaner in Erfüllung gehen würde und die „Insel wieder ’n schönes Festland wird“? Ach, ist das schön ...
1 Vortrag als Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin im November 1979 bei einem Seminar des „Kuratoriums Unteilbaren Deutschland“ (Auszüge)
2 S. Jürgen Dittberner, Schwarz-Gelb in Berlin oder Die Krise der FDP, 2. Auflage, Berlin 2012, S. 110
3 Horst Köhler
Berlin
Nicht nur Deutschland wurde vereint, sondern auch Berlin. Ostberlin wurde Teil des Bundeslandes Berlin und kam zu Westberlin. In vielem erschien das größere Berlin überbesetzt: so in der Verwaltung und in der Kultur. Dass Berlin nach einer Abstimmung im Bundestag wieder deutsche Hauptstadt wurde, löste manche Probleme der Stadt, aber nicht alle. Alte Stadtkulturen waren nicht mehr gefragt, dadurch wurden viele Menschen auch ökonomisch freigesetzt. Berlin drohte das Armenhaus Deutschlands zu werden, und während allmählich hauptstädtische Strukturen entstanden, verharrten funktionslos gewordene „Provinzler“ an den Rändern. Das neue Berlin versagte obendrein mit eigenen Großprojekten und musste sich mit mancherlei DDR-Hinterlassenschaften herumschlagen. Das politische Personal der Stadt blieb hinter dem Hauptstadtanspruch zurück.
1990BERLINER PERSPEKTIVEN: DIE DOPPELTE EINHEIT1
(ÜBERLEGUNGEN ZUM KÜNFTIGEN STANDORT DER BUNDEHAUPTSTADT UND ZUR POLITISCHEN FUNKTION VON BERLIN)
I.
Nirgendwo wurde die Öffnung der Mauer so tiefbewegt bejubelt wie in Berlin, nirgendwo wird die deutsche Vereinigung das Leben der Menschen in Ost und West gleichermaßen so verändern wie in Berlin. Hier wachsen nicht nur die beiden Teile der Nation zusammen, hier wird aus zwei Städten wieder eine; eine doppelte Einheit steht bevor. Mehr noch: Westberlin, das seit 1948 eine „politische Insel“ war und seit 1961 vom SED-Staat eingemauert, gewinnt sein natürliches Umland wieder, und das Umland entdeckt den größeren Teil der Metropole zurück.
Das neue Berlin muss nun als Ganzes seine Funktion in einem geeinten föderativen deutschen Staat und in der geographischen Mitte des größeren Europas neu definieren. Ostberlin lebte bisher von seiner Aufgabe, Hauptstadt der DDR zu sein, Westberlin zu Ernst Reuters Zeiten „Fanal der Freiheit“, dann „Schaufenster des Westens“, schließlich über all die Jahre Hauptstadt im Wartestand für den allgemein als unwahrscheinlich erachteten Fall der Einheit der Nation.
Im Osten wie im Westen wurde die Urbanität der Stadthälften, ihr jeweiliger Rang in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und vor allem Kultur aus diffizilen nationalen Funktionen hergeleitet und auch alimentiert. Was wird in Zukunft sein?
II.
Da ist zunächst die ökonomische Perspektive: In dem Maß, wie der deutsche Vereinigungsprozess voranschreitet, steigt zweifellos der Wert des Standortes Berlin. Vor allem für überregional operierende Dienstleistungsbetriebe wird Berlin zunehmend interessanter. Die durch die größere Stadthälfte fest an den Westen gebundene Stadt liegt inmitten der „noch DDR“ und in unmittelbarer Nähe zu Polen, der CSFR und Ungarn. Dort versucht man überall, die Kommandowirtschaften zu Marktwirtschaften umzugestalten, und dieser wahrhaft historische Prozeß lässt sich gut von einer Stadt aus begleiten, die über moderne Infrastrukturen verfügt, Teil der EG und der bundesrepublikanischen Volkswirtschaft ist und einfach nahe liegt.
Das sind ideale Voraussetzungen für Messen, Tagungen, Kongresse sowie natürlich für den Tourismus. Schon sind neben Daimler-Benz weitere Dienstleister auf dem Wege nach Berlin, schon ist die Stadt stark im Messe- und Kongresswesen engagiert, schon sind die Hotels ausgebucht.
Da werden aber auch Hürden sichtbar, die genommen werden müssen, bevor Berlin seine Standortchancen auch voll wahrnehmen kann: In vielen Bereichen werden jetzt Kapazitätsgrenzen sichtbar. Mindestens, so sagen Experten, braucht Berlin kurzfristig 35 000 zusätzliche Hotelbetten. Die Ausstellungsfläche der Messegesellschaft AMK reicht bei weitem nicht aus, um etwa – was prinzipiell möglich wäre – die Internationale Automobilausstellung nach Berlin zu holen. Es gibt zu wenige und zu wenig hochwertige Wohnungen in Berlin, und die Flächen für Wirtschaftsansiedlungen aller Art sind heiß umkämpft.
Die Infrastruktur der Stadt ist überholungsbedürftig. Die mangelhaften Telefonmöglichkeiten in Ostberlin seien nur erwähnt. Darüber hinaus müssen das S- und das U-Bahnnetz mindestens wieder auf den Stand vor der Spaltung gebracht werden; auch das Autobahn- und Straßennetz ist – behutsam – erweiterungsbedürftig. Nach außen wird die Verbesserung vor allem der Bahn- und Flugverbindungen unumgänglich sein. Im Süden braucht Berlin einen neuen Flughafen, der im Jahre 2000 mindestens 20 Mio. Passagiere pro Jahr befördern kann. Die Kapazitäten von Schönefeld und Tegel zusammen reichen hierfür nicht aus.
Vor allem aber muss sich, will Berlin seine Standortchancen nutzen, eine weltoffene Grundstimmung in der innerstädtischen Öffentlichkeit herstellen, die die neue Entwicklung der Stadt befürwortet. Viele Bürger und ihre Repräsentanten haben sich nämlich in Westberlin an eine durch die Mauer geschützte Nischen-Existenz gewöhnt und wenden sich jetzt gegen Modernisierungen und Urbanisierung der Stadt. Im Ostberlin haben die Wahlergebnisse gezeigt, daß die Anhänger des ehemaligen Lügen- und Terrorregimes noch in erheblicher Zahl meinen, ihre Seinerzeit-Privilegien verteidigen zu müssen. Wer aber aus ideologischer Verbohrtheit oder selbstbezogenem Bonzendenken heraus die Ansiedlung großer Dienstleister oder die Fortentwicklung von modernen Forschungseinrichtungen in der Stadt verhindern will, gefährdet objektiv die künftige ökonomische Prosperität Berlins. Mit dem Fall der Mauer und dem Zusammenfügen beider Teile Berlins kommen neues Leben und neuer Wind in die Stadt, und es ist notwendig, dass dadurch mancher spießig-ideologischer Mief in Ost und West fortgeweht wird. Dazu gehört auch, dass die Menschen hier mehr noch als bisher Fremde und Fremdes als Chance und nicht immer gleich als Bedrohung ansehen. Sollte sich Berlin gegen die Welt, gegen Türken, Polen und andere abschotten wollen, so würde die Stadt selbst sehr bald verdorren, denn der unselige Geist der Abschottung überträgt sich auf alle Lebensbereiche, und ein internationales Kommunikationszentrum erfordert Weltgeist. Wer seine Gäste nach sozialem Status und nationaler Herkunft sortiert, der wird in einem angestrebten offenen Europa keinen Eindruck machen.
Der in der Stadt trotz aller Gegentendenzen jetzt erkennbare Wille zum neuen Berlin muß der Motor zur Überwindung schwieriger Probleme in einer Übergangszeit sein. Noch sind die großen Dienstleistungsfirmen nicht in der Stadt; weder Büros noch die geeigneten Wohnhäuser stehen. Wenn aber im Hinblick auf die erwartete Veränderung durch die neuen die ansässigen Unternehmen jetzt schon Ausschau halten nach flächen- und lohngünstigeren Standorten, so könnte der Berliner Arbeitsmarkt erheblichen Schaden erleiden. Die ansässigen Unternehmen müssen also gehalten werden, vor allem durch ein behutsames Herunterfahren und Einfügen der Berlinförderung in das Steuer- und Transfersystem im Berliner Umland sich anzupassen. Zudem werden durch den Einigungsprozess Lohn- und Preisdifferenzen auf engstem Raum zu sozialen Konflikten führen. Diese Konflikte können gemildert werden, wenn die Anpassung aller Löhne und Preise auf das „West“-Niveau so schnell wie möglich erfolgt und von vornherein darauf verzichtet wird, durch Kontingentierungen neue Zollgrenzen zu errichten. Genau das aber ist leider beabsichtigt.
Arbeitslose wird es im Raum Berlin-Brandenburg als Folge der gescheiterten Wirtschaftspolitik der SED ganz sicher geben. Die Stadt wird nicht umhin kommen, den mit Umschulung und anderen Maßnahmen und vor allem durch ein Beschäftigungsprogramm zu begegnen, das auf dem Kreditwege finanziert wird. Ein solches Programm könnte z.B. die Wiederherstellung des inneren S-Bahn-Ringes oder auch des ganzen Netzes sein. Dies ist eine Investition in die Zukunft, schafft Arbeitsplätze, bringt Löhne und Gewinne und erleichtert das Leben in der fast 4-Millionen-Stadt.
Die wirtschaftlichen Chancen Berlins sind gut. Aber einen Automatismus zu einer blühenden Dienstleistungs- und Handelsmetropole wird es nicht geben. Die Chance müssen durch Überwindung mancher Hürden genutzt werden. Kein Zweifel: Diese Chancen können ebenso verspielt werden. Denn als Wirtschaftsmetropole wird Berlin in Deutschland und Europa nicht konkurrenzlos sein: Mit Leipzig, Wien, Prag, Budapest, Frankfurt und anderen Orten wird Berlin sich messen müssen. Sollte das Klima der grünen Nischengesellschaft oder der Mief ehemaliger SED-Bonzen in der Stadt dominant werden, werden andere Regionen blühen. Der Weg zur Metropole kann nicht im Schlafwagen zurückgelegt werden.
III.
Aber was wird die politische Funktion der Stadt sein? Ohne die tatsächliche Hauptstadtfunktion wird auch bei günstigem Investitionsklima Berlin wirtschaftlich große Schwierigkeiten haben. Die hier gewachsenen Rahmenbedingungen einer Dienstleistungs- und Kommunikationsmetropole in der Mitte Europas – drei Universitäten, zahlreiche Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen, drei Opernhäuser, viele prominente Theater, eine große Messegesellschaft usw. – können von einer Kommune oder einem mittleren Bundesland gar nicht erhalten werden. Diese Rahmenbedingungen aber sind für die Wirtschaftsmetropole konstitutiv. Einer urbanen Hauptstadt auch eines föderalen Deutschlands sind sie angemessen. Niemand will ja, dass in diesem Deutschland alle Kultur, Wissenschaft und Politik in einer Zentrale zentriert sein sollten, aber das vielfältige geistige Leben des Landes kann und muss doch an einem Ort kulminieren, an einem Ort, der vergleichbar ist mit Moskau, Warschau, London, Paris, Rom und Madrid. In Deutschland ist als ein solcher Ort nur Berlin denkbar, weil nur hier die nationalen Infrastrukturen vorhanden sind. Dass Westberlin Hauptstadt im Wartestand war und Ostberlin Hauptstadt der DDR, hat eben Fakten geschaffen, Fakten, die nur in einem Akt der nationalen Barbarei zu vernichten wären. Welches Opernhaus – die Staatsoper, die Deutsche Oper, die Komische Oper –, welche Universität – die Humboldt-, die Freie oder die Technische – welches Theater – das Berliner Ensemble, das Schillertheater, das Deutsche Theater oder die Schaubühne –, welches Museum schließlich wollte man denn schließen?2
Gegen Berlin als Hauptstadt werden die verschiedensten Argumente hervorgebracht – natürlich auch Gefühle ausgedrückt. Da ist von der östlichen Randlage, von der ehemaligen NS-Hauptstadt die Rede oder – ganz krämerhaft – von den Kosten eines Umzugs.
Das Argument der östlichen Randlage ist abgründig. Da klingen Ängste von der „Heidenstadt“ Berlin an, da soll mit dem armen, unkultivierten Osten anstelle des reichen und kultivierten Westens gedroht werden; auch dass altes deutsches Kernland zugunsten öden Koloniallandes verlassen wird, soll angedeutet werden. Eines vorab: Im Zeitalter der Flugzeuge, der Telekommunikation usw. dürfte die rein geographische Randlage jedenfalls kein Argument sein, träfe im übrigen Bonn ebenso wie Berlin.
Tatsache ist – um das Thema „Heidenstadt“ aufzunehmen –, dass gerade in der DDR die Kirchen offensichtlich erheblichen Einfluss auf das Leben haben, dass die Lutherstadt Wittenberg eine Autostunde von Berlin entfernt liegt, dass die Bekennende Kirche mit dem Namen Berlins verbunden ist, dass die katholische Konfession in der Stadt erheblich an Boden gewinnt, was der jüngste Katholikentag beeindruckend gezeigt hat. Als gottlos lassen sich auch die hier ansässigen zahlreichen Moslems nicht gerade bezeichnen. Dass in dieser Lage andererseits eine Identität von Staat und Kirche nicht aufgekommen ist, entspricht nun allerdings dem Geist des Grundgesetzes und ist einer pluralistischen Gesellschaft angemessen.
Berlin liegt zwar geographisch östlicher als Aachen, Köln oder Mainz, ist gleichwohl geistig-kulturell alles andere eine östliche Stadt. Es liegt – wie Wien, Budapest oder Prag – in der Mitte Europas. Spätestens seit der Hugenottenzeit gibt es hier z.B. feste Bindungen zur französischen Kultur. Über Jahrhunderte existiert eine bedeutende Französische Gemeinde, ein hervorragendes Französisches Gymnasium, am Gendarmenmarkt steht der Französische Dom neben dem Deutschen Dom; der Platz schließlich, auf dem das Brandenburger Tor errichtet wurde, trägt den Namen von Paris.
Das preußische Königshaus war vielfach verwoben mit dem britischen und dem niederländischen; ähnliche traditionsreiche Beziehungen – die alle noch heute weiterleben – gibt es freilich auch zu Russland. Berlin ist eine europäische Stadt, die Anziehungskraft hat für alle vier Himmelrichtigen des Kontinents. In der Nachkriegszeit sind spätestens seit der Blockade wahrhaft herzliche Beziehungen zwischen Berlin und vor allem den USA entstanden. Ohne zu übertreiben: Der Name „Berlin“ hat in den USA einen besseren Klang als der Name „Deutschland“.
Perfide – aus dem Munde Deutscher – klingt der Vorwurf, Berlin sei die NS-Zentrale gewesen. Berlin war deutsche Hauptstadt, als die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen. Anders als viele andere deutsche Regionen war Berlin selber niemals eine Nazistadt oder „Stadt der Bewegung“. Überhaupt ist den Berlinern eine Distanz gegen pompöse Potentaten zu Eigen. Schon der Soldatenkönig wollte wegen der Renitenz der Berliner eine andere Residenz; 1848 musste sich ein späterer Preußenkönig vor den gefallenen Revolutionären verneigen, und die SED siedelte ihre meist aus dem Sächsischen stammenden Parteigänger – als „5. Besatzungsmacht“ verspottet – in der widerborstigen Hauptstadt an. Eine Stadt der Claqueure ist Berlin nicht, aber das passt auch nicht zu einer Demokratie. Identifizieren konnten sich die Berliner mit Persönlichkeiten wie Ernst Reuter oder John F. Kennedy – Idolen der Freiheit. Hitler, aber auch Ulbricht und Honecker, waren Potentaten, in die Stadt gekommen waren.
Schließlich die Kosten der Hauptstadt Berlin. Es war wohl ein Fehler, Parlaments- und Regierungsbauten in Bonn zu errichten, als sei es für die Ewigkeit. Aber Berlin und Bonn sind überhaupt nicht vergleichbar.
Berlin war bis 1945 deutsche Hauptstadt, es ist jetzt Hauptstadt der DDR und kann von daher schon eine Menge von Regierungs-, Parlaments- und Botschaftseinrichtungen aufnehmen. Die meisten Länder der Welt sind bei der DDR akkreditiert, und sogar Länder wie etwa Estland können auf alte Gebäude von vor dem 2. Weltkrieg zurückgreifen. Italien hat darüber hinaus den Senat bitten lassen, deutscherseits von Planungen für die Nutzung seiner ehemaligen Botschaft in Berlin-Tiergarten abzusehen. Vielleicht manchmal mehr schlecht als recht sind weiterhin dem Vernehmen nach alle Ministerien der DDR behaust, so dass man zweifellos in vorhandenen Dienstgebäuden anfangen kann. Der Reichstag steht in Berlin dem Parlament zur Verfügung ebenso wie der „Palast der Republik“. Der Bundespräsident hat mit dem Schloss „Bellevue“ einen präsentablen Amtssitz. Sicher werden hier für die Hauptstadt überall Investitionen nötig sein, aber das ließe sich in Maßen und mit Weile machen. Schließlich muss es im Berliner Interesse liegen, dass Bonn auch Hauptstadt-Institutionen behält, wenn erst einmal die Grundentscheidung für Berlin gefallen ist. Der Umzug des West-Teils der deutschen Hauptstadt wird sich darüber hinaus über Jahre hinziehen. Es kann überhaupt kein Zweifel bestehen, dass der künftige deutsche Bundesstaat dies wird alles bewältigen können.
Auf das politische Zentrum, also die Hauptstadt Deutschlands, Berlin, werden schwierige internationale Aufgaben im Osten Europas zukommen. Polen muss eine florierende Marktwirtschaft werden, wenn Deutschland stabil bleiben will. Zwischen Deutschen und Polen muss ein ähnliches besonderes Verhältnis aufgebaut werden wie zwischen Deutschland und Frankreich. Mit dem sich neu formierenden Rußland sind darüber hinaus Beziehungen zu entwickeln, die den Frieden in Europa stabilisieren. Von wo anders als von Berlin aus lassen sich diese europäischen Aufgaben besser in Angriff nehmen?
1992WICKELT BERLIN AB!3
Zugestanden: Nach dem Hauptstadtbeschluss des Bundestages vom Sommer 1991 hat die Bundesregierung mit ihrer Hauptstadtplanung vom Herbst schon den richtigen Weg gewiesen. Nicht alle, nur ein Teil der Ministerien sollen nach Berlin kommen – aber erst, wenn hier alles tipp topp ist.
Mir scheint allerdings, der Beschluss der Bunderegierung ist nicht konsequent genug. Wichtig für eine richtige bundesrepublikanische Lösung wäre es, Berlin erst abzuwickeln, bevor es Hauptstadt wird. Alle Einrichtungen des Bundes sollten daher aus Berlin abgezogen und an die künftig notleidenden Regionen im Westen und Südwesten gegeben werden. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, das Umweltbundesamt, das Bundesgesundheitsamt, das Bundesverwaltungsgericht und die anderen Behörden müssen Platz machen in der Hauptstadt, um hier Planungsfreiheit zu schaffen. Durch Alliierte und Sowjets freiwerdende Liegenschaften dürfen auf keinen Fall genutzt werden, weil die Hauptstadt Planungsreserven braucht. Jeglicher steuerliche Standortvorteil Berlins muss verschwinden, denn in der Hauptstadt sollen sich nur die Starken durchsetzen. Der „Palast der Republik“ muss weiter vor sich hindämmern, damit hier ja nichts durch zügige Entscheidungen präjudiziert wird.
Auf keinen Fall dürfen jetzt Bundestag, Bundesrat oder andere Verfassungsorgane in Berlin tagen. Die Schäbigkeit des Umfeldes würde Schatten auf die neue deutsche Hauptstadt werfen. Der Tag der Deutschen Einheit schließlich sollte überall gefeiert werden, nur nicht in Berlin. So wird der deutsche Föderalismus der Restwelt sinnfällig vor Augen geführt.
Wichtig ist es auch, den Moloch Berlin zu entflechten. Spandau, Köpenick, Charlottenburg sollten wieder eigenständige märkische Gemeinden, und Berlin muss auf seinen alten Kern in Mitte zurückgeführt werden. Sodann wird man prüfen müssen, ob die Doppelstadt Berlin wiederhergestellt werden kann. Eine Folge der Kommunalreform wäre, dass die Landesbehörden Berlins nach Potsdam – wo viel Platz ist und gutes Management waltet – verlegt werden. Natürlich darf die ehemalige Rolle Berlins als Schaufenster der Freiheit nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb sollte das Rathaus Schöneberg eine Außenstelle des Bonner Museums für Deutsche Geschichte werden.
Bevor Bundestag und Bundesregierung in Berlin mit ihren Planungen beginnen, müssen dann die vielen störenden Autos, die altmodischen U- und S-Bahnen beseitigt werden. Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung wichtig und eröffnet die Chance für Verkehrstechnologien des nächsten Jahrtausends, etwa für die M-Bahn oder auch den Transrapid. Das ganze Völkergewimmel in der Stadt sollte man behutsam strukturieren: Ausländer dürften nur in Berlin leben, wenn sie 100 000 DM oder mehr Steuern im Jahr zahlen. Schließlich muss erkennbar sein, dass dies eine deutsche Hauptstadt ist. Die vielen Mitsprachemöglichkeiten der Berliner selber werden am besten dadurch eliminiert, dass diese die Region verlassen. Sie haben sowieso allesamt eine viel zu große Schnauze für die schöne, anheimelnde deutsche Hauptstadt, die wir in Zukunft bauen werden.
Sehr gefährlich ist diesem Zusammenhang auch die Forderung, Bundesgerichte von Karlsruhe nach Leipzig zu verlegen. Abgesehen davon, dass Karlsruhe auch im vereinten Deutschland der Ort des Rechts bleiben muss, wäre ein Umzug nach Leipzig auch in der Hauptstadtfrage das falsche Signal. Richtig dagegen hat der Bundesgesetzgeber gehandelt, als er gleich mit der Wiedervereinigung Berlin als Sitz der Bundesbank aus dem Gesetz gestrichen hat. Das war wichtig für die Zukunft Berlins.
Im Übrigen scheint es ganz im Sinne des Hauptstadtbeschlusses des Bundestags zu sein, mit dem Umzug nach Berlin so lange zuwarten, bis die innere Einheit perfekt ist. Der Zustand der Vollendung der Einheit sollte durch Volksabstimmung von mindestens zwei Dritteln der Deutschen festgestellt werden.
Bis dahin lässt sich alles sowieso viel besser von Bonn aus erledigen…
1997EIN WECHSEL IST NOT
1981 war in Westberlin die Zeit des Wechsels gekommen. Die „rote“, sozialdemokratische Stadt – einst von so überragenden Bürgermeistern wie Ernst Reuter und Willy Brandt regiert – erhielt einen christdemokratischen Regierenden Bürgermeister, Richard von Weizsäcker. Als sein auch parteipolitischer Nachfolger regiert die nunmehr wieder vereinte Stadt bis auf den heutigen Tag Eberhard Diepgen. Die Episode der rot-grünen Regierung unter Walter Momper 1989 und 1990 ist fast schon vergessen.
Seit Berlin wieder eine Stadt ist, haben sich die beiden großen Parteien CDU und SPD zur ungeliebten Großen Koalition zusammengefunden. In den ersten fünf Jahren der Vereinigung war das nach Auffassung der allgemeinen Öffentlichkeit die angemessene Konstellation, um die großen Aufgaben zu bewältigen. Doch nach den Wahlen des Jahres 1995 ging zumindest ein großer Teil der SPD nur widerwillig, der Arithmetik des Wahlergebnisses folgend, erneut in das Bündnis. Leider war die Abneigung bei den störrischen Sozialdemokraten mehr parteipolitisch motiviert und nicht staatspolitisch. Weil die SPD aus der Konstellation der Großen Koalition heraus eine herbe Wahlniederlage erlitten hatte, wollte man diese Konstellation nicht mehr aufleben lassen.
Was damals schon sichtbar wurde, ist heute evident: Die Große Koalition kann für die Stadt nichts mehr bewirken. Sie ist ausgelaugt an der Spitze, zermürbt und zerrieben im mittleren Management und verfeindet an der Basis.
Selbst Zweitrangigkeiten wie das verlorene parlamentarische Vertrauen in den Präsidenten Haase4 bringen das Bündnis und seine Akteure aus der Contenance. Der Grund ist wohl, dass diese Koalition in den wichtigen Dingen bisher eine negative Bilanz hat und dass niemand erwartet, hier würde sich etwas ändern. Die Bewerbung um die Olympischen Spiele endete – im Übrigen folgenlos für die Berliner Propagandisten – mit einer internationalen Blamage für Berlin. Das so hochgezogene Projekt der Vereinigung Berlins mit Brandenburg scheiterte nach dilettantischen Werbekampagnen – von Berlin und Potsdam mit Steuermitteln bezahlt – an der kalten Schulter der Brandenburger – wiederum ohne jede Konsequenzen für irgendeinen Akteur. Die innere Einigung der Stadt ist nicht erreicht, nirgendwo meckern die Wessis so viel über die Ossis und umgekehrt wie hier. Die Arbeitslosigkeit erreicht Spitzenwerte in Deutschland. Mit der barbarischen Schließung des Schillertheaters hat der Senat der eigentlich als Erbe für das ganze Berlin wichtigen Stadtkultur des Westens fast die Seele ausgehaucht, und den Gammelzustand des „Palastes der Republik“ empfinden viele Ossis als Ausdruck der Arroganz ihrer Geschichte gegenüber. Natürlich hat es der Senat nicht geschafft, in der Frage „Palast oder Schloss“ eine Antwort zu geben. Dabei wäre es unabhängig von Realisierungschancen schon wichtig, wenn die Nation wüsste, was denn die Stadt selber mit ihrer einstigen Mitte, dem Ort ihres Quells, vorhat. Die Bezirksreform dümpelt vor sich hin, niemand würde sich wundern, wenn die Koalition auch dieses Projekt nicht hinkriegt.
Dass der Bundestag sich für Berlin als Hauptstadt entschied, ist positiv, aber kein Verdienst der Berliner Koalition. Vielmehr hat der Senat nach dem Votum für Berlin den Umzugsverzögerern zugespielt, indem er großtuerische Foren, Wettbewerbe und Auslobungen veranstaltete – so als solle eine neue Stadt in einer Wüstenei errichtet werden. Der Minister Töpfer war es, der die überdrehten Berliner Lokalmatadore aus den Wolkenkuckucksheimen holte und einen Umzugsplan durchsetzte, der überwiegend von der Nutzung bestehender Gebäude ausgeht.
Wenn der Koalition etwas daneben geht, wundert es niemanden mehr. Nichts anderes wird erwartet. Spöttern selbst ist die Lust zum Lästern vergangen. Was gut gegangen ist in dieser Stadt, geht im wahrsten Sinne des Wortes auf Kosten anderer: Die Basketballtitel wurden aus den Profiten der Stadtentsorgung finanziert, und Hertha BSC wird Schaufenster eines westdeutschen Medienkonzerns. Die Büros und Hotels in der Friedrichstadt wurden vom Prinzip Hoffnung initiiert. Die geschmacklerischen Interventionen des Bausenats beim Aufbau des Pariser Platzes entlocken dem Beobachter nur ein angestrengtes Stöhnen.
Wenn es nicht mehr geht, dann soll Schluss sein. Das Tabu, welches dem entgegensteht, ist die PDS. Was ist eigentlich logisch daran, dass PDS-Bürgermeister in der Stadt akzeptiert werden, ein PDS-Senator aber als etwas Unanständiges gesehen wird? In Ostberlin hat die SED-Nachfolgepartei eine Mehrheit. Mündige Bürger wollen es so. Mit den alten Westberliner Konzepten lässt sich die Stadt offensichtlich nicht regieren. Dass Berlin nach seinen tapferen Jahren doch noch im roten Meer versinken könnte, ist ein dummer Spruch, denn das rote Meer existiert nicht mehr. Ganz unklug ist es im Übrigen ja auch nicht – einmal allgemein gesprochen, wenn die Sieger den Nachfolgern der Verlierer nach ihren Spielregeln – hier der parlamentarischen Demokratie – eine Chance geben. Ob das der Weg zur inneren Einheit sein könnte, wird sich zeigen.
Der Wechsel ist not an der Spree. Ein Wechsel ist ein demokratischer Wert an sich. Die Ausgewechselten erhalten die Chance der Regeneration und die Neuen die Chance, es besser zu machen. Die Not ist so groß, dass auch alte Westberliner über ihren Schatten springen sollten. Selbst wenn im Roten Rathaus ein PDS-Senator neben solchen der SPD und der Grünen sitzen würde, würde die Rote Armee nicht wieder einmarschieren, und auch das Grundgesetz würde weiter gelten. Aber vielleicht könnten in der Stadtpolitik Wege gefunden werden weg von der derzeitigen Misere Berlins.
Vielleicht würde der Wechsel helfen. Sicher dagegen ist: Die Große Koalition kann der Stadt nicht mehr helfen.
2001DREI DAVIDS GEGEN ZWEI GOLIATHS
In der Stadt Berlin steht zurzeit bekanntlich einiges aus dem Spiel: Die politische Zukunft Eberhard Diepgens, die Bankgesellschaft, die Hoheit über den eigenen Etat und das Schicksal der Großen Koalition. Da haken die Oppositionsparteien Grüne und PDS sowie die außerparlamentarische FDP ein, schmieden ein Bündnis und wollen mit einer Volksabstimmung CDU und SPD aus dem Sattel stoßen. Zwei Davids und ein Davidlein wollen zwei Goliaths das Fürchten lehren. Somit steht in Berlin zusätzlich etwas Altvertrautes auf dem Prüfstand: Die Vorherrschaft der beiden Großparteien.
Seit Bestehen der Bundesrepublik sind die CDU/CSU – die „Union“ – und die SPD die Großen unter den Parteien. Alle anderen sind demgegenüber klein. „Volkspartei“ nannte sich die Union schon unter Konrad Adenauer in den fünfziger Jahren. 1959 legte die SPD im Godesberger Programm ihre ideologischen Fesseln ab und präsentierte sich 1961 mit Willy Brandt als die andere, jüngere Volkspartei. Nach den CDU-Politikern Adenauer, Ludwig Erhard und Kurt-Georg Kiesinger wurde Brandt 1969 der erste sozialdemokratische Bundeskanzler und konnte als solcher „Mehr Demokratie wagen“.
Fortan wurden Union und SPD als „Großparteien“ bezeichnet. Nur sie stellten die Kanzler und – von zwei Ausnahmen in der Gründungszeit der Republik abgesehen – die Ministerpräsidenten der Länder. Nach Brandt kamen Helmut Schmidt, Helmut Kohl und schließlich Gerhard Schröder in das wichtigste politische Amt Deutschlands.
Die Großparteien erfanden das in der Verfassung nicht vorgesehene „Amt“ des Kanzlerkandidaten. Es passte und – wie das Scheitern des entsprechenden Versuchs Jürgen W. Möllemanns gezeigt hatte – und passt nicht zu den kleinen Parteien.
Von denen hatte zunächst ohnehin nur die FDP überlebt, als Partei der zweiten Wahl: Sie lebte von der Zweitstimme, mit der Anhänger sowohl der „schwarz-gelben“ als auch der „rot-gelben“ Koalition die Mehrheiten sichern wollten.
Bis 1983 hatte die Bundesrepublik ein Zweieinhalb-Parteiensystem. Die Union und die Sozialdemokraten waren die Hauptparteien und die Freidemokraten „Mehrheitsbeschaffer“, „Gelenkpartei“ oder „Zünglein an der Waage“. Weil Kleine dazu neigen, sich zu überschätzen, bezeichnete sich die FDP gerne als „dritte Kraft“. Aber das war sie nie.
In einer bunten Prozession zogen 1983 die Grünen – noch mit dem nicht realisierbaren Anspruch, „Antiparteien-Partei“ zu sein – in den Bundestag ein. Die FDP hatte ihre Monopolstellung als Mehrheitsbeschaffer verloren. Erst in Hessen, dann in Berlin-West, später sogar in Nordrhein-Westfalen und schließlich im Bund bildeten sich „rot-grüne“ Regierungen. Wie die FDP kamen auch die Grünen nicht über den Status des Juniorpartners hinaus. Die Goliaths blieben groß, nur zu dem blau-gelben David hatte sich ein zweiter – grüner – gesellt.
An der Vorherrschaft der Großparteien änderte auch die Wiedervereinigung nichts. Zwar erwuchs im Osten Deutschlands aus der alten Staatspartei SED eine regional kräftige PDS. Die fand noch in jedem der neuen Bundesländer jeweils ihren Meister: Entweder war dort mindestens eine der beiden Großparteien stärker oder beide. Die Besetzung der Positionen von Ministerpräsidenten blieb auch in den fünf hinzugekommenen Ländern Sache entweder der CDU oder der SPD.
Heute agieren im Bundestag drei kleine Parteien. Die politischen Schwergewichte jedoch heißen SPD und CDU/CSU. „Die“ Regierungspartei ist zunächst die Sozialdemokratie der neuen Mitte, und wenn von „der“ Opposition die Rede ist, ist zuerst die Union gemeint – trotz der Diadochenkämpfe zwischen Angela Merkel, Friedrich Merz und Edmund Steuber.
Kanzlerkandidat für die SPD ist Gerhard Schröder, das ist doch klar. Denn „auf den Kanzler kommt es an“, wie wir schon lange wissen. So bleibt unter diesem Stichwort nur noch die Frage, wer wird der Kandidat bei der Union – wer wird gegen Schröder verlieren dürfen? Bei den Kleinen hingegen erhebt sich für das Wahljahr 2002 zunächst einmal die Frage, wer von ihnen über die 5-%-Grenze kommt.
Doch nun richten die vereinten Kleinen die Waffen gegen die beiden Großen. Sie tun das nicht auf dem Hauptschlachtfeld, der Bundespolitik, sondern in dessen Vorfeld auf dem äußerst aparten Terrain der Innenpolitik in der Hauptstadt Berlin.
Das hat Modellcharakter.
Die Unterschiede zwischen parlamentarisch und außerparlamentarisch sind nicht so groß, dass das Bündnis daran scheiterte. Die nicht im Berliner Abgeordnetenhaus vertretene FDP darf mitmachen beim Angriff gegen die SPD und CDU, die Berlin gemeinsam tief ins Tal geführt haben. Und bei der Ideologie heißt es: „Was schert mich mein Geschwätz von gestern?“ Auf einmal kommen die Liberalen mit den gestern noch verhassten Grünen klar, und der „Altkommunist“ Gregor Gysi verständigt sich locker mit dem „Manchesterliberalen“ Günter Rexrodt.
Wird die Attacke erfolgreich sein?
Der Erfolg hängt von der Stimmung des Wahlvolkes ab, und die ist wetterwendig. Auch hat der alte Taktiker Diepgen noch ein paar Monate Zeit, das Volk zu besänftigen, Probleme zu lösen oder es Glauben zu machen, dass er sie löse.