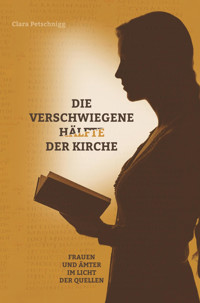
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
„Die verschwiegene Hälfte der Kirche – Frauen und Ämter im Licht der Quellen“ Wer waren Junia, Phoebe und Priska wirklich? Und warum gerieten so viele Frauen aus der frühen Kirche in Vergessenheit? Dieses Buch geht der Spur der Frauen in der Geschichte der Kirche nach – von den ersten Zeuginnen der Auferstehung über Diakoninnen und Presbyterinnen bis hin zu verborgenen Amtsverständnissen des Mittelalters. Es lässt die Originalquellen sprechen und zeigt: Die Frage nach der Berufung von Frauen ist keine moderne Erfindung – sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Kirchengeschichte. In klarer Sprache, mit theologischer Tiefe und spiritueller Weite lädt dieses Buch dazu ein, bekannte Texte neu zu lesen und überkommene Grenzen zu hinterfragen – jenseits aktueller Polarisierungen, aber mit Liebe zur Wahrheit. Ein Buch für alle, die glauben, dass Geschichte Veränderung möglich macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Verfasserin und Herausgeberin:Sr. M. Clara PetschniggPottenmühlenweg 2852064 AachenDeutschland
© Sr. M. Clara Petschnigg, 2025Alle Rechte vorbehalten.„Die verschwiegene Hälfte der Kirche – Frauen und Ämter im Licht der Quellen“
1. Auflage, 2025ISBN: 9783819419942
Covergestaltung: Michael PetschniggCover-Hintergrund: „Ende Johannesevangelium“ (Seite 260r aus dem Codex Sinaiticus),gemeinfrei – Wikimedia Commons, Datei: Ende_Johannesevangelium.jpg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Buch erzählt die Geschichte der Frauen in der Kirche neu – und lässt dabei nicht Spekulationen, sondern die Quellen sprechen.
In klarer, zugänglicher Sprache verbindet es theologische Reflexion mit spiritueller Tiefe und lädt ein, die Frage nach den Ämtern von Frauen in einem neuen Licht zu betrachten. Jenseits aktueller Polarisierungen geht es um eine Rückbindung an die Anfänge – und um die Hoffnung, dass der Heilige Geist auch heute in der Kirche Neues wirken kann.
Ein Buch für alle, die nach Wahrheit suchen, ohne die Treue zur Kirche aufzugeben.
Dieses Buch erzählt die Geschichte der Frauen in der Kirche neu – und lässt dabei nicht Spekulationen, sondern die Quellen sprechen.
In klarer, zugänglicher Sprache verbindet es theologische Reflexion mit spiritueller Tiefe und lädt dazu ein, die Frage nach den Ämtern von Frauen in einem neuen Licht zu betrachten.Jenseits aktueller Polarisierungen geht es um eine Rückbindung an die Anfänge – und um die Hoffnung, dass der Heilige Geist auch heute in der Kirche Neues wirken kann.Ein Buch für alle, die nach Wahrheit suchen, ohne die Treue zur Kirche aufzugeben.
Sr. Clara Petschnigg, geboren 1968, ist Diplomtheologin und klassische Philologin. Sie unterrichtet Religion, Latein, Mathematik und Informatik an einem privaten Gymnasium in Aachen.
Viele Jahre war sie als Lehrerin und in der kirchlichen Berufungspastoral tätig. Als stellvertretende Direktorin leitete sie ein Vorseminar für Geistliche Berufe – und war damit vermutlich eine der ersten Frauen in der Priesterausbildung in Deutschland.
In ihrer Arbeit verbindet sie wissenschaftliche Präzision mit spiritueller Tiefe.
„Die verschwiegene Hälfte der Kirche“ ist ihre erste Buchveröffentlichung.
Die verschwiegene Hälfte der Kirche
Frauen und Ämter im Licht der Quellen
Inhalt
Einleitung
Vorgehensweise der Untersuchungen
I. Frauen im Neuen Testament
1. Jesu Umgang mit Frauen
2. Frauen in der Apostelgeschichte und in den Paulusbriefen
3. Frauen in den Pastoralbriefen
4. Frauen im Neuen Testament – Zusammenfassung
II. Frauen in der Kirchengeschichte
1. Frauen in der Frühen Kirche
2. Die ersten Kirchenordnungen
3. Die Kirchenväter der ersten drei Jahrhunderte
4. Frauen in der Spätantike und im Mittelalter
5. Die Kirchenväter des 4. und 5. Jahrhunderts
6. Weitere Zeugnisse aus dem 5. Jahrhundert
7. Die westliche Entwicklung im 5. Jahrhundert
8. Das 6. bis 9. Jahrhundert in der Ostkirche
9. Das 6. bis 9. Jahrhundert in der Westkirche
10. Das 9. bis 12. Jahrhundert in Ost und West
11. Die Entstehung der kanonistischen Wissenschaft
12. Die Scholastik
13. Entwicklungen vom 13. bis 19. Jahrhundert
14. Entwicklungen im 20. und 21. Jahrhundert
15. Entwicklungen in den 1980er Jahre
16. Entwicklungen in den 1990er Jahren
17. Entwicklungen in den 2000er Jahren
18. Entwicklungen seit 2010
19. Jüngere Entwicklungen in den Schwesterkirchen
III. Argumentationsgrundlagen
1. Eine Wiederbelebung des Amts der Diakonin?
2. Zugang von Frauen zu allen Ämtern?
Schluss
Literaturverzeichnis
Bibeltexte
Wörterbuch
Bibelkommentare
Primärliteratur
Sekundärliteratur
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
An einem ruhigen Abend mache ich mich auf den Weg zur Messe – ein liebgewonnenes Ritual, um den Tag in Stille ausklingen zu lassen und mich bewusst Gott zuzuwenden. Die Straßen sind still, die Luft mild. Als ich die Kirche fast erreicht habe, höre ich plötzlich Stimmen.
Vor der Kirchentür steht eine Gruppe von Frauen. Sie halten Schilder in den Händen, ihre Gesichter sind entschlossen. Auf mich wirken sie verhärtet und konfrontativ – nicht weil sie laut wären, sondern weil ich das Gefühl habe, ihr Protest richtet sich auch gegen mich. Eine Woche lang, so erfahre ich später aus den Medien, wollen sie keine Kirche betreten, um den Zugang von Frauen zu allen Ämtern zu fordern.
Ich bleibe einen Moment stehen, spüre Irritation und auch Enttäuschung. Ich bin nicht gekommen, um zu streiten oder zu diskutieren, sondern um zu beten. Für mich ist der tägliche Besuch der heiligen Messe und die Anbetung zusammen mit dem Stundengebet der Kirche die Kraftquelle, aus der heraus ich meinen Alltag als Lehrerin bestreite.
Ich betrete das Gotteshaus, lasse die Stimmen draußen zurück, doch ihre Botschaft hallt in mir nach. Während ich in der Stille sitze, frage ich mich: Warum wirkt ihr Protest wie ein Gegensatz zu meinem Wunsch nach Einkehr? Warum fühlt es sich an, als müsste ich mich für mein Bedürfnis nach Stille und Gebet rechtfertigen? Warum muss es in der Kirche überhaupt zwei so gegensätzliche Lager geben: die einen, die leidenschaftlich für Gleichberechtigung und Reformen streiten, die anderen, die ebenso entschieden für den Erhalt der überlieferten Ordnung kämpfen, aus Sorge, dass Angleichung an den Zeitgeist die Botschaft Christi verwässert?
Dieses Erlebnis hat mich zum Nachdenken gebracht. Die Irritation über den Protest wich nach und nach einer tieferen Frage: Wie sah die Rolle der Frau in der Kirche historisch eigentlich aus? Gibt es wirklich eine durchgehende Tradition, die Frauen von kirchlichen Ämtern ausschließt? Oder hat es in der Geschichte auch andere Stimmen und Praktiken gegeben, die in Vergessenheit geraten sind? Ich wollte es genauer wissen. Die Fragen ließen mich nicht mehr los. Die Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche ist keine rein akademische. Sie betrifft das Selbstverständnis von Kirche, die Art, wie wir miteinander Glauben leben, und sie berührt auch das Bild von Gott, das wir weitergeben. Immer mehr wurde mir klar: Es geht nicht nur um historische Fakten, sondern auch um Deutungen, um Macht, um Traditionen – und darum, wie wir heute Kirche gestalten wollen.
Ich bin mir bewusst: Noch vor einem Jahrhundert hätte ich nicht so selbstverständlich Theologie studiert oder gemeinsam mit einem Priester ein Vorseminar für Priesteramtskandidaten leiten können, wie ich es vor über 20 Jahren bereits getan habe. Aber müssen solche Veränderungen derart aggressiv, wie es mir vorkommt, und teilweise unreflektiert erkämpft werden? Geht es in der Kirche nicht im Gegenteil um etwas ganz anderes? Gibt es nicht schon ausreichend viele Betätigungsfelder für Frauen in der Kirche? Sind solche Protestaktionen nicht einfach nur ein Machtstreben, das der christlichen Botschaft zutiefst widerstrebt? Müssen wir nicht vor allem für die Kirche und ihre Leitung beten, anstatt aus Protest keine Kirche zu betreten?
Um den gegensätzlichen Positionen in der Frage auf den Grund zu gehen, habe ich beschlossen, vor allem einen Blick auf die biblischen und historischen Quellen zu werfen, um mir ein eigenes fundiertes Urteil bilden zu können. Bei der Untersuchung dieser Quellen kam es mir zugute, dass ich nicht nur Theologin bin, sondern auch Griechisch und Latein studiert habe und mir so die meisten Quellen im Urtext zugänglich sind. Meine Recherchen wurden zu einer abenteuerlichen Reise durch die Bibel und durch die Kirchengeschichte – voller Spannung, Überraschung und manchmal auch Widerspruch. Ich lade Sie, liebe Leser und Leserinnen, ein, mich auf diesem Weg zu begleiten.
In diesem Buch möchte ich keine fertige Antwort vorlegen, sondern eine Grundlage für die eigene Urteilsbildung schaffen. Ich werde biblische und historische Zeugnisse analysieren, die Rolle von Frauen in der frühen Kirche und in kirchlichen Ämtern untersuchen, bedeutende Texte des kirchlichen Lehramts analysieren und Entwicklungen der Gegenwart einordnen. Ziel ist es nicht, zu „beweisen“, was sein darf oder nicht, sondern zu verstehen, wie es war, und zu fragen, was daraus folgen könnte.
Zur besseren Verständlichkeit werden griechische Begriffe gelegentlich zusätzlich in eckigen Klammern [ ] in lateinischer Umschrift angegeben. Dies dient der Lesbarkeit und Orientierung auch für Leserinnen und Leser ohne Griechischkenntnisse.
Wenn es der Kirche heute gelingt, auf ihre Ursprünge zu hören, könnte sie den Mut finden, ihre bestehenden Strukturen im Licht des Evangeliums neu zu überdenken.
Wenn ich in diesem Buch über Ämter in der Katholischen Kirche schreibe, ist mir eines besonders wichtig: Die Zukunft der Kirche entscheidet sich nicht an ihren Strukturen, sondern an der Tiefe und Echtheit des gelebten Glaubens. Diese Überzeugung möchte ich gleich zu Beginn deutlich machen.
Vorgehensweise der Untersuchungen
Die Frage nach der Stellung der Frau in der Kirche – insbesondere mit Blick auf kirchliche Ämter – berührt theologische, gesellschaftliche, kirchenrechtliche und spirituelle Dimensionen. Sie lässt sich weder ausschließlich historisch noch rein dogmatisch beantworten.
In diesem Buch soll deshalb ein mehrstufiger und interdisziplinärer Zugang gewählt werden, der sowohl die historische Tiefe als auch die aktuelle Relevanz dieser Thematik berücksichtigt.
Im ersten Teil des Buchs möchte ich den Blick auf die biblischen Zeugnisse des Neuen Testaments werfen. Hier steht die Frage im Zentrum, wie Frauen von Anfang an in den Gemeinden mit Verantwortung betraut wurden und welche Rollen sie in der Nachfolge Jesu und in den frühen Gemeinden einnahmen. Dabei soll es nicht vorrangig um die Konstruktion späterer Ämter gehen – denn zu Lebzeiten Jesu existierten weder das kirchliche Amtsverständnis noch die institutionalisierte Kirche –, sondern um die Haltung Jesu gegenüber Frauen. Wie hat Jesus Frauen behandelt? Wie hat er mit ihnen kommuniziert? Und wie spiegeln sich diese Begegnungen in den Evangelien wider? Solche Fragen helfen, ein theologisches und menschliches Gespür für die Grundausrichtung der christlichen Botschaft zu entwickeln.
Im zweiten Teil der Untersuchung wird das Augenmerk auf die Stellung der Frau im Laufe der Kirchengeschichte gelegt. Besonders das Amt der Diakonin, das in den Quellen vielfach belegt ist, steht exemplarisch für weibliche Mitwirkung an liturgischen, pastoralen und sozialen Aufgaben. Durch die Analyse von zentralen Texten unterschiedlicher Art und von wenigen archäologischen Zeugnissen sollen die Aufgaben und die Stellung, die mit diesem Amt verknüpft waren, aufgezeigt werden.
Der dritte Teil widmet sich der Betrachtung bedeutender lehramtlicher und kirchlicher Dokumente der jüngeren Vergangenheit, insbesondere seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Texte wie Inter Insigniores (1976), Ordinatio Sacerdotalis (1994) oder die Aussagen des kirchlichen Lehramts im Rahmen des Synodalen Wegs bieten einen Einblick in die Spannungen zwischen Traditionsbewusstsein, kirchlichem Recht und dem Wunsch nach Erneuerung. In diesem Zusammenhang werde ich vor allem die Argumente, mit denen Frauen von kirchlichen Ämtern ausgeschlossen werden, analysieren.
Diese drei Untersuchungsebenen – biblisch-exegetisch, kirchengeschichtlich und gegenwartsorientiert – werden durch eine hermeneutische Grundhaltung miteinander verbunden: Der Blick in die Geschichte soll nicht bloß rückwärtsgewandt, sondern wegweisend sein. Es geht darum, aus der Geschichte zu lernen, um für die Gegenwart Orientierung zu gewinnen. Gerade der Blick auf die Anfänge des Christentums kann eine inspirierende Kraft entfalten, wenn es um die Frage nach Teilhabe und Mitgestaltung in der Kirche heute geht.
Viele biblische und kirchliche Texte lassen sich nicht eindeutig lesen. Immer wieder bin ich bei der Arbeit an diesem Buch auf Stellen gestoßen, die ganz unterschiedlich verstanden werden, je nachdem, aus welcher Perspektive man sie betrachtet, mit welchem Vorverständnis man herangeht oder welche Erfahrungen man selbst gemacht hat. Diese Vielfalt möchte ich nicht glätten, sondern sichtbar machen. Deshalb stelle ich an vielen Stellen verschiedene Deutungen einander gegenüber: Was sagen alte und neue Ausleger dazu? Welche Gedanken öffnen mir einen Zugang – und welche lassen mich eher ratlos zurück?
Die methodische Leitlinie dieser Arbeit ist eine theologisch verantwortete und historisch fundierte Spurensuche. Sie folgt den Spuren bedeutender Frauen der Bibel und der Kirchengeschichte, um aus der Vielfalt der Zeugnisse heraus eine ehrliche und offene Diskussion über kirchliche Berufung und Autorität zu ermöglichen. Das Buch ist dabei nicht rein linear oder ausschließlich sachlich aufgebaut: Neben der chronologischen Darstellung kirchengeschichtlicher Entwicklungen füge ich immer wieder persönliche Reflexionen ein. Diese Abschnitte sind kursiv gesetzt und leicht eingerückt – sie geben meiner eigenen Auseinandersetzung mit den Themen Raum. Sie sollen keine endgültige Antwort geben, sondern zeigen, wie ich mich im Ringen um Wahrheit und Gerechtigkeit in der Kirche orientiere: offen für unterschiedliche Stimmen, aber auch bereit, eine eigene Position zu wagen.
Außerdem finden sich zwischen den historischen Kapiteln vereinzelt grau hinterlegte Abschnitte, in denen Hintergrundinformationen zur jeweiligen Epoche gegeben werden. Diese Einschübe sind thematisch notwendig, um das Gesagte im jeweiligen historischen Kontext besser verstehen und einordnen zu können.
Nun lade ich Sie ein, liebe Leserinnen und Leser, sich mit mir gemeinsam auf die Reise durch die Kirchengeschichte zu begeben, um die verborgene Hälfte der Kirche aufzuspüren und zu betrachten: im Geist des Evangeliums, der Gerechtigkeit und der Würde aller Getauften.
I. Frauen im Neuen Testament
Im Neuen Testament begegnen uns Frauen in sehr unterschiedlichen Rollen: als Begleiterinnen Jesu, als Gastgeberinnen und Gemeindeleiterinnen, als Prophetinnen und Diakoninnen, als Unterstützerinnen und als erste Zeuginnen der Auferstehung. Doch neben diesen starken Bildern stehen auch Aussagen, die Frauen eine zurückhaltende, stille oder gar untergeordnete Rolle zuschreiben. Dieses Spannungsfeld macht deutlich, wie vielschichtig und teilweise widersprüchlich das Bild der Frau bereits in den frühesten christlichen Schriften war – und wie eng sich daran bis heute zentrale Fragen kirchlicher Identität und Autorität knüpfen.
Die entstehende Kirche formierte sich in einem kulturellen Umfeld, das sowohl vom hellenistisch-römischen Denken als auch von den Traditionen des Judentums geprägt war. Diese Einflüsse prägten nicht nur das gesellschaftliche Leben, sondern schlugen sich auch in der theologischen Sprache, im Amtsverständnis und in den Erwartungen an die Geschlechterrollen innerhalb der Gemeinden nieder.
Gerade in dieser frühen Phase des Christentums zeigt sich: Frauen waren keine Randfiguren. Sie nahmen aktiv Anteil am Gemeindeleben, wirkten als Missionarinnen, Lehrerinnen und spirituelle Begleiterinnen. Namen wie Lydia, Priska, Phoebe oder Junia stehen exemplarisch für diese Realität weiblicher Präsenz und Mitverantwortung. Ihre Erwähnung in den neutestamentlichen Texten ist kein Zufall, sondern ein Hinweis darauf, dass Frauen in den ersten christlichen Gemeinden wichtige Aufgaben übernahmen, auch wenn diese später in der kirchlichen Erinnerung oft übersehen oder gezielt marginalisiert wurden.
Gleichzeitig sind die neutestamentlichen Texte nicht widerspruchsfrei. Neben den Schilderungen von Frauen in öffentlich-wirksamen Rollen stehen Passagen, in denen ihnen das Lehren oder Sprechen in der Gemeinde untersagt wird. Solche Anweisungen – oft als „Schweigebefehle“ bezeichnet – werfen Fragen auf: War Paulus ein Förderer weiblicher Mitwirkung oder Ausdruck seiner Zeit? Sind diese Aussagen theologisch begründet – oder waren sie Reaktionen auf konkrete Konflikte innerhalb einzelner Gemeinden?
Eindeutige Antworten gibt es darauf nicht. Doch gerade das Nebeneinander gegensätzlicher Aussagen lädt zu einer genauen, differenzierten Lektüre ein. Es zeigt: Es gab im frühen Christentum kein einheitliches Frauenbild, keine allgemeingültige Rollenverteilung. Vielmehr spiegeln sich in den Schriften des Neuen Testaments unterschiedliche theologische Perspektiven, regionale Besonderheiten und kulturelle Prägungen wider.
Dieses Kapitel beginnt daher mit einem Blick auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen jener Zeit. Es folgt eine Analyse der Begegnungen Jesu mit Frauen, der Rolle von Frauen in der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen sowie eine Auseinandersetzung mit den Aussagen der Pastoralbriefe und weiterer neutestamentlicher Schriften. Ziel ist es, historische Entwicklungen sichtbar zu machen und zugleich theologische Grundlagen für die heutige Debatte um die Rolle der Frau in der Kirche herauszuarbeiten.
Diese Spurensuche beginnt mit der Frage: Wie lebten Frauen im antiken Mittelmeerraum und wie hat sich ihre Lebenswirklichkeit in den biblischen Texten niedergeschlagen?
Frauen in der antiken Welt
Wer die Rolle der Frau im Neuen Testament verstehen will, muss die gesellschaftlichen Verhältnisse jener Zeit kennen. Denn die biblischen Texte spiegeln eine Welt wider, die in vielem von patriarchalen Strukturen geprägt war, aber zugleich komplexer und widersprüchlicher, als man es lange angenommen hat.
Die mediterrane Gesellschaft des ersten Jahrhunderts nach Christus war ein Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen: Griechisch-hellenistische Bildungstraditionen, römisches Rechtsdenken und jüdische Religionspraxis überlagerten sich, und mit ihnen auch die Vorstellungen davon, was Frauen durften, konnten und sollten.
Die weitverbreitete Vorstellung, Frauen hätten in der Antike ausschließlich im häuslichen Bereich agiert, während öffentliche, wirtschaftliche und religiöse Aufgaben nahezu ausschließlich den Männern vorbehalten waren, erweist sich bei näherer Betrachtung als ideologisch geprägte Konstruktion späterer Zeiten. Neuere Forschungen – etwa von Ute E. Eisen1, Joan Breton Connelly2, Mary Beard3 und Sarah B. Pomeroy4 – belegen eindrucksvoll, dass Frauen in den antiken Gesellschaften weit häufiger öffentlich sichtbar waren, als lange angenommen wurde.
So dokumentieren Quellen eine bemerkenswerte Präsenz von Frauen im wirtschaftlichen und politischen Leben, insbesondere im östlichen Mittelmeerraum: Als Händlerinnen, Tempelpriesterinnen, Philosophinnen, Gymnasiarchinnen, Mäzeninnen oder gar als Stadtvorsteherinnen wirkten sie aktiv an der Gestaltung ihrer Gesellschaft mit. Auch innerhalb der römischen Provinzverwaltung lassen sich Hinweise auf weibliche Beteiligung finden – ein Befund, der das gängige Bild der rein häuslichen Frau der Antike nachhaltig infrage stellt.
Für die Relativierung dieses Bildes ist vor allem eine kritische Analyse der Überlieferung notwendig. Die Quellenlage zu aktiven Frauenfiguren ist in der Regel fragmentarisch – nicht, weil diese Frauen nicht existiert hätten, sondern weil Geschichtsschreibung über Jahrhunderte primär von Männern betrieben wurde. Diese männlichen Autoren von Aristoteles bis Cicero prägten das kulturelle Gedächtnis durch normative Idealbilder von Frauen als sittsame Mütter und Hausfrauen.
Im römischen Reich war die rechtliche Stellung der Frau ambivalent. Einerseits unterstand sie formal der patria potestas, der Gewalt des Vaters oder Ehemanns. Andererseits konnte sie unter bestimmten Bedingungen wirtschaftlich selbstständig handeln, Vermögen besitzen, Verträge abschließen und öffentlich als Stifterin oder Bauherrin auftreten. In Grabinschriften werden Frauen als matrona, benefactrix oder als Leiterinnen von Kollegien geehrt. Ihre gesellschaftliche Wirksamkeit blieb jedoch stark von ihrer sozialen Stellung abhängig. Politische Ämter oder Rederecht in der Öffentlichkeit blieben ihnen verwehrt.
Im Judentum war die Rolle der Frau stärker auf das Haus und die Familie konzentriert. Die religiöse Praxis im öffentlichen Raum – insbesondere in Synagogen und im Tempel – war Männern vorbehalten. Frauen nahmen religiöse Pflichten im häuslichen Bereich wahr, lehrten Kinder das Gebet, verwalteten das Familienvermögen und hielten viele Regeln des Glaubens ein. In den Schriften des Alten Testaments erscheinen auch Frauen mit geistlicher oder politischer Autorität, wie Deborah oder Ester, doch sie bleiben Ausnahmen. Im jüdischen Alltag war weibliche Leitung selten und institutionell kaum vorgesehen.
In der klassischen griechischen Tradition galt die Zurückgezogenheit der Frau als Zeichen ihrer Würde. Öffentliche Auftritte galten als ungehörig. Frauen hatten keine juristischen oder politischen Rechte, waren in vielen Stadtstaaten rechtlich auf das Haus beschränkt. Gleichzeitig existierte besonders in hellenistisch geprägten Städten eine Gegenrealität: Dort begegnet man gebildeten Frauen, die als Philosophinnen, Dichterinnen, Heilerinnen oder Priesterinnen auftraten. Auch religiöse Ämter wie das der Pythia in Delphi zeigen, dass Frauen in bestimmten Kontexten spirituelle Autorität zugesprochen wurde.
Zur Zeit der Abfassung des Neuen Testaments lebten Frauen also in einer komplexen Welt: Ihre Möglichkeiten und Rechte waren regional, kulturell und sozial stark unterschiedlich ausgeprägt. Manche waren sichtbar, gebildet, wirtschaftlich unabhängig, andere vollständig dem männlichen Familienoberhaupt untergeordnet. Es gab keine einheitliche Frauenrolle, sondern ein weites Spektrum zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit.
Wir werden bei der Analyse der neutestamentlichen Texte sehen, dass auch im frühen Christentum Frauen eine weit bedeutendere Rolle spielten, als es die spätere kirchliche Überlieferung lange erkennen ließ. Die Vorstellung von der Frau als rein häuslichem Wesen erweist sich nicht als historisches Faktum, sondern als Ergebnis nachträglicher Deutungen.
1. Jesu Umgang mit Frauen
Die Evangelien bezeugen zahlreiche Begegnungen Jesu mit Frauen: oft überraschend, manchmal provozierend. Der erste Teil dieses Buches widmet sich der Frage, wie Jesus mit Frauen sprach, sie in seine Sendung einbezog und welche Wertschätzung er ihnen damit entgegenbrachte.
Seine Mutter Maria
Die Evangelien überliefern mehrere Schlüsselstellen, in denen Jesus in markanter Weise mit seiner Mutter interagiert.
Die erste Szene findet sich im Lukasevangelium, das als einziges Evangelium einen Blick auf die Kindheit Jesu wirft. In der Erzählung vom zwölfjährigen Jesus im Tempel (Lk 2,41–52) wird Maria als diejenige dargestellt, die gemeinsam mit Josef ihren Sohn verzweifelt sucht. Als sie ihn nach drei Tagen im Tempel wiederfindet, wendet sie sich an ihn mit einem klaren Vorwurf:
Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich schmerzerfüllt gesucht. (Lk 2,48)
Jesus antwortet nicht entschuldigend, sondern mit einer doppelten Gegenfrage:
Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? (Lk 2,49)
In dieser Perikope offenbart sich die wachsende Eigenständigkeit Jesu, aber auch die Spannung zwischen seiner göttlichen Sendung und den Erwartungen seiner Familie. Er distanziert sich nicht aus Lieblosigkeit, sondern um seine Berufung in den Vordergrund zu stellen. Dennoch heißt es am Ende der Szene:
„Und er ging mit ihnen hinab, kam nach Nazareth und war ihnen (dauerhaft) gehorsam. (Lk 2,51)5
Maria muss lernen, dass Jesu Berufung auch ihre Erwartungen übersteigt – ein Prozess, der für viele Mütter prophetischer Gestalten der Heilsgeschichte bezeugt ist. Und dennoch: Jesus bleibt ihr Sohn, auch wenn seine Sendung ihn auf Wege führt, die sie nicht immer versteht. Im Partizip ὑποτασσόμενος („gehorchend“) in Verbindung mit dem Imperfekt ἦνwird deutlich, dass sich Jesus trotz dieser Szene wieder auf Dauer seinen Eltern unterordnet.
Ein besonders bemerkenswerter Moment im Umgang Jesu mit seiner Mutter Maria ist die Szene der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1–12). Als der Wein ausgeht, spricht Maria ihn an:
Sie haben keinen Wein mehr. (Joh 2,3).
Jesu Antwort wirkt auf den ersten Blick überraschend schroff:
Was (ist) zwischen mir und dir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. (Joh 2,4)
Der griechische Ausdruck „Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι;“ lässt sich wörtlich übersetzen mit: „Was mir und dir, Frau?“ – ein idiomatischer Ausdruck, der im biblischen Sprachgebrauch häufig eine Abgrenzung oder Distanz ausdrückt. Dieselbe Wendung begegnet uns auch in Mk 5,7, wo der Besessene von Gerasa Jesus mit den Worten anschreit: „Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes?“: ein Ausdruck der Abwehr, fast des Widerstands.6
Auch im Alten Testament finden sich ähnliche Formulierungen, wo sie ebenfalls eine klare Trennung oder ein Missverständnis zwischen zwei Gesprächspartnern markieren.7 Diese Parallelen lassen erkennen, dass Jesu Worte nicht als Unhöflichkeit, sondern als bewusstes theologisches Statement zu verstehen sind: Er macht deutlich, dass er selbst seiner Mutter gegenüber nicht aus menschlicher Beziehung heraus handelt, sondern ausschließlich aus der Sendung des Vaters.
Zugleich verweist Jesus auf seine „Stunde“: ein Begriff, der im Johannesevangelium durchgehend auf seinen Tod und seine Auferstehung hinweist. Wenn er sagt, „meine Stunde ist noch nicht gekommen“, dann verschiebt er die Perspektive weg vom gegenwärtigen Hochzeitsfest hin zur eschatologischen Vollendung. Die Verwandlung des Wassers in Wein wird so zum symbolischen Vorausbild seiner Verherrlichung und macht diese Szene zu weit mehr als einer Wundererzählung: Sie markiert den Übergang vom alten Bund zum neuen, vom Alltäglichen zur eschatologischen Vollendung.
Trotz dieser scheinbaren Zurückweisung bleibt Maria präsent, nicht gekränkt, sondern vertrauend. Sie sagt zu den Dienern:
Was er euch sagt, das tut! (Joh 2,5)
Damit nimmt sie gewissermaßen die Rolle einer ersten Glaubenden ein, die sich – auch ohne alles zu verstehen – auf das Handeln Gottes verlässt. Jesus wiederum reagiert nicht mit weiterer Abgrenzung, sondern handelt: Er lässt Wasserkrüge füllen, verwandelt das Wasser in Wein und wird so vom Gast zum Gastgeber.8 Maria wird auf diese Weise zur Wegbereiterin des ersten Zeichens, das seine Herrlichkeit offenbar macht (Joh 2,11).
Eine weitere bedeutsame Szene, die oft unter dem Titel „Die wahren Verwandten Jesu“ diskutiert wird, findet sich in den synoptischen Evangelien, etwa bei Markus:
Siehe, deine Mutter und deine Brüder (und Schwestern) draußen fragen nach dir. (Mk 3,32)
Jesu Antwort darauf ist wiederum eine Gegenfrage:
Wer sind meine Mutter und meine Brüder? (Mk 3,33)
Und er fährt fort:
Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. (Mk 3,35)
Auch hier stellt Jesus seine geistliche Berufung über seine familiäre Bindung. Das bedeutet jedoch keine Abwertung seiner Mutter, sondern vielmehr eine neue Definition von Nähe: Sie gründet sich nicht in biologischer Verwandtschaft, sondern im Tun des göttlichen Willens.
Diese geistliche Verwandtschaft schließt Maria ausdrücklich mit ein, denn sie ist es, die in den Evangelien als glaubende Frau erscheint, die „alles in ihrem Herzen bewahrt“ (Lk 2,19) und Jesu Weg mitträgt – bis ans Kreuz.
Gerade am Kreuz, im Moment der größten Einsamkeit, spricht Jesus noch einmal zu seiner Mutter, und wieder nennt er sie „Frau“:
Frau, siehe, dein Sohn! (Joh 19,26)
Und zu Johannes sagt er:
Siehe, deine Mutter! (Joh 19,27)
Hier steht Maria nicht mehr als Mutter des Kindes, sondern als Vertreterin der Gemeinschaft der Glaubenden. Jesus übergibt sie dem „geliebten Jünger“, traditionell mit Johannes identifiziert, und stellt damit eine neue geistliche Familie her. Dieser Akt symbolisiert Fürsorge, Solidarität und Verantwortung: ein Vermächtnis des Gekreuzigten an seine Nachfolger.9
Jesus verwendet auch in diesem letzten Akt die Anrede „Frau“, nicht, um auf Distanz zu gehen, sondern um sie als eigenständige, würdevolle Person anzusprechen. Maria ist nicht nur Mutter Jesu, sie wird zur Mutter der Kirche.
Persönliches Fazit
Die Szenen, in denen Jesus seiner Mutter begegnet, sind geprägt von Tiefe und Spannung zugleich. Sie zeigen Maria nicht als schweigende Nebenfigur, sondern als aufmerksame, glaubende Frau, die Fragen stellt, mitdenkt, mitgeht. Jesus begegnet ihr in einer Weise, die seine Sendung und ihre Eigenverantwortung gleichermaßen ernst nimmt. Maria steht in diesen Szenen für eine Haltung des Glaubens, der nicht alles versteht, aber alles mitträgt.
Was mich besonders bewegt: Beide, Jesus und Maria, sind in diesen Szenen Lernende. Maria muss ihre Vorstellungen loslassen und Jesu Berufung Raum geben. Jesus, auf der anderen Seite, nimmt Marias Bitte ernst und handelt, obwohl seine Stunde „noch nicht gekommen“ ist. Das zeigt: Auch er wächst in seinem Weg. Diese wechselseitige Bewegung ist für mich ein starkes Bild für die Kirche von heute. Wir sind eingeladen, wie Maria und Jesus zu lernen: voneinander, vom Leben, von Gott. Glaube heißt nicht, schon alles zu wissen, sondern bereit zu sein, sich verwandeln zu lassen.
Maria Magdalena
Maria von Magdala wird in den Evangelien fast ausschließlich im Kontext des Todes und der Auferstehung Jesu genannt. Eine wichtige Ausnahme bietet das Lukasevangelium, das von Frauen in der unmittelbaren Gefolgschaft Jesu berichtet. Wörtlich heißt es in dieser Bibelstelle:
Und es geschah danach, dass er [Jesus] durch Stadt und Dorf wanderte, während er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte, und die Zwölf waren mit ihm, und auch einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren: Maria, genannt Magdalena, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere, welche ihm (αὐτῷ) dienend (διηκόνουν) waren mit den ihnen gehörenden [Dingen]. (Lk 8,1-3)
Den letzten Halbsatz könnte man auch folgendermaßen übersetzen: „die für ihn einen Dienst versahen aus dem heraus,10 was ihnen zur Verfügung stand oder wozu sie fähig waren.“11
Diese Formulierung legt nahe, dass nicht bloß materielle Güter gemeint sind, sondern auch persönliche Fähigkeiten und aktives Mitwirken.
Für das gesellschaftliche Empfinden der damaligen Zeit war es äußerst ungewöhnlich, dass Frauen ihre gewohnten familiären Bindungen verließen, um einem Wanderprediger zu folgen.12 Dass Frauen Jesus auf seiner Missionsreise begleiteten, verweist nicht nur auf ihre persönliche Bindung zu ihm, sondern auch auf eine strukturelle Nähe zur Jesusbewegung, die weit über das traditionelle Rollenverständnis hinausging.
Von besonderer Bedeutung ist hierbei das verwendete Verb διακονεῖν [diakoneín], das die Einheitsübersetzung mit „unterstützen“ wiedergibt. Das Verb und seine Ableitungen bedeuten im Neuen Testament (im Gegensatz zu δουλεύειν) nicht einfach niedrige Sklavendienste oder Alltagstätigkeiten. Sie gehören einer gehobenen Sprachebene an und bezeichnen verschiedene Tätigkeiten, die aus einer konkreten Beauftragung hervorgehen – oft im Namen eines anderen. Tischdienst wird insbesondere nicht von Sklaven, sondern von eigens beauftragten Personen übernommen, um besondere Ehre zu zeigen.
Traditionell wurde diakonía als Dienst am Nächsten verstanden (z.B. karitative Nächstenliebe nach Jesu Vorbild, wie Mk 10,45), aber neuere Forschungen zeigen: Im ursprünglichen griechischen Verständnis geht es primär um einen Auftrag und die Ausführung im Namen eines Auftraggebers, nicht um Demut oder reine Nächstenliebe. Ein diákonos handelt also mit Autorität und Pflichtbewusstsein, nicht als bloßer Diener. Männer und Frauen konnten gleichermaßen diákonoi sein.13
Dabei ist auch textkritisch interessant, ob sich der Dienst auf Jesus selbst oder auf die Zwölf bezieht. Die älteren Handschriften bezeugen die Lesart αὐτῷ [autó] – „welche ihm (nämlich Jesus) dienten“ –, während spätere Handschriften αὐτοῖς [autoís] lesen – „welche ihnen (nämlich den Aposteln) dienten“.14 Die spätere Textänderung könnte der Tendenz entspringen, den aktiven Beitrag der Frauen zugunsten der Autorität der Zwölf zu relativieren. Möglicherweise sollte dadurch bewusst vermieden werden, den Eindruck zu erwecken, dass Frauen in der Nachfolge Jesu eine offizielle Beauftragung erhalten hatten. Stattdessen sollten sie eher als Gehilfinnen der Zwölf erscheinen – und damit in eine eindeutig untergeordnete Rolle gerückt werden. Dass ihre Tätigkeit sich auf das „Dienen“ beschränken sollte, scheint dabei weniger der Absicht Jesu zu entsprechen als vielmehr einer frühen kirchlichen Tendenz, weibliche Mitwirkung zu begrenzen.15
Auch in der frühen Kirche wurde das Verb διακονεῖν [diakoneín] mit offiziellen kirchlichen Diensten verbunden, insbesondere mit dem Amt des Diakons. Dass gerade dieses Verb hier verwendet wird, deutet auf die Möglichkeit hin, dass den Frauen innerhalb der jesuanischen Bewegung mehr zugetraut wurde, als ihnen später zugestanden wurde.
Von „Maria, die Magdalena genannt wurde“ (Lk 8,2) heißt es außerdem, dass aus ihr sieben Dämonen ausgefahren seien. Was sich hinter dieser Formulierung konkret verbirgt, bleibt unklar: Ein entsprechender Exorzismus Jesu an ihr wird in den Evangelien nicht geschildert. Der Zusatz findet sich jedoch auch bei Markus, in der erweiterten Ostererzählung:
…erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. (Mk 16,9)
Daraus lässt sich zumindest ableiten, dass ein entsprechendes Heilungsgeschehen in der urchristlichen Erinnerungstradition verankert war. Zugleich wird dadurch deutlich: Maria Magdalena ist nicht mit der Sünderin aus Lk 7,36–50 zu identifizieren, auch wenn diese Gleichsetzung in späterer Zeit oft vorgenommen wurde.16
Im Kontext des Todes und der Auferstehung Jesu wird Maria Magdalena in allen vier Evangelien genannt. Im ältesten Evangelium, dem des Markus, heißt es:
Es waren aber auch Frauen da, die von weitem zusahen, unter ihnen Maria Magdalena, und Maria, die Mutter des Jakobus des Kleinen und des Joses, und Salome. Diese waren, als er in Galiläa war, ihm gefolgt (ἠκολούθουν αὐτῷ) und hatten ihm gedient (διηκόνουν). Und viele andere waren mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen. (Mk 15,40f.)17
Auch hier wird für „dienen“ wieder das Verb διακονεῖν [diakoneín] verwendet, ein Hinweis auf die langjährige, aktive Jüngerschaft dieser Frauen. Ähnliche Beschreibungen finden sich bei Matthäus (Mt 27,55f.) und Lukas (Lk 23,49), ebenfalls mit dem Begriff διακονεῖν. Johannes nennt Maria Magdalena sogar unter den Frauen, die direkt beim Kreuz Jesu standen (Joh 19,25).
Wenig später berichtet Markus, dass Maria Magdalena gemeinsam mit Maria, „der Mutter des Joses“, beobachtet, wohin Jesus gelegt wird (Mk 15,47). Nach dem Sabbat kauft sie mit einer weiteren Maria, „der Mutter des Jakobus“, wohlriechende Öle zur Salbung des Leichnams (Mk 16,1).18 Am Grab angekommen, finden sie dieses leer vor. Ein junger Mann in weißem Gewand spricht sie an:
Er aber sagt zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden; er ist nicht hier. Seht, die Stelle, wohin sie ihn gelegt haben. Aber geht und sagt seinen Jüngern und Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. (Mk 16,6f.)
Die Reaktion der Frauen ist von Furcht geprägt:
Und sie gingen hinaus und flohen vom Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.“ (Mk 16,8)
Mit diesen Worten endet das ursprüngliche Markusevangelium. Im 2. Jahrhundert wurde es jedoch um eine Erscheinung des Auferstandenen vor Maria Magdalena ergänzt:
Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging hin und verkündete (ἀπήγγειλεν) es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. (Mk 16,9–11)
Auch Matthäus überliefert, dass die Frauen den Auftrag zur Verkündigung erhielten:
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und verkündet (ἀπαγγείλατε) meinen Brüdern (ἀδελφοί), sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. (Mt 28,10)
Die Einheitsübersetzung verwendet das Wort „sagt“ statt „verkündet“, doch im griechischen Urtext steht das Verb ἀπαγγεῖλαι (apangeílai) – ein klares Indiz für einen Verkündigungsauftrag. Schon zwei Verse zuvor heißt es ausdrücklich, dass die Frauen „liefen, um es den Jüngern zu verkünden“ – wiederum mit ἀπαγγεῖλαι. Und mit ἀδελφοί (adelphoí) – „Brüder“ – sind im Neuen Testament nicht nur Männer gemeint, sondern alle Jüngerinnen und Jünger Jesu.
Bei Lukas ist die Gruppe der Frauen, die die Osterbotschaft überbringen, sogar noch größer (Lk 24,9f.). Auch hier wird das gleiche Verb verwendet. Während die Apostel in Jerusalem bleiben, überbringen die Frauen die erste Nachricht – doch ihre Worte werden nicht geglaubt. Lukas betont zugleich die Erscheinung vor Simon Petrus (Lk 24,34) als entscheidend für den Auferstehungsglauben. Offenbar gab es in der frühen Kirche einen Konflikt darüber, wer als erster Zeuge der Auferstehung galt: Maria Magdalena oder Petrus? Lukas hebt Petrus hervor und betont später in Apg 1,22, dass ein Apostel ein „Zeuge der Auferstehung“ sein müsse. Die Frauen scheinen in der späteren kirchlichen Erinnerung bewusst zurückgedrängt worden zu sein – vermutlich, weil ihr Zeugnis rechtlich und gesellschaftlich nicht als gleichwertig anerkannt wurde.19
Im Johannesevangelium kommt Maria Magdalena auch allein zum Grab, entdeckt es leer und ruft Petrus und den „anderen Jünger“ herbei (Joh 20,1–9). Danach erscheint Jesus ihr persönlich. Zunächst hält sie ihn für den Gärtner – doch als er sie mit Namen anspricht, erkennt sie ihn. Auch hier erhält sie den Auftrag zur Verkündigung:
Maria! (…) Geh zu meinen Brüdern (ἀδελφούς) und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala kommt und verkündet (ἀγγέλλουσα [angéllousa]) den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. (Joh 20,16–18)
Diese Szene macht deutlich: Maria Magdalena ist nicht nur Zeugin, sondern Verkünderin der Auferstehung – mit Autorität und Sendung. Hippolyt von Rom nennt sie daher bereits im 3. Jahrhundert apostola apostolorum – „Apostelin der Apostel“.20 Er betont, Christus sei den Frauen erschienen, „damit auch Frauen Christi Apostel werden“.21 Auch Gregor von Nyssa sieht darin eine bewusste Umkehrung der Heilsgeschichte: Wo Eva fiel, bezeugt Maria die Auferstehung.22 Hieronymus schreibt im 4. Jahrhundert:
Als Jesus auferstanden war, erschien er zuerst den Frauen. Jene wurden „Apostelinnen der Apostel“. Und die Männer sollten schamrot werden, weil sie den nicht suchten, den das zartere Geschlecht schon gefunden hatte.23
Dieser Titel wurde auch von Hrabanus Maurus und Thomas von Aquin übernommen und bestätigt.24
Zusammenfassend kann gesagt werden: Maria Magdalena gehörte zum inneren Kreis der Jüngerinnen Jesu. Sie unterstützte ihn mit ihren Fähigkeiten und begleitete ihn bis zum Kreuz. Nach seiner Auferstehung wurde sie zur ersten Zeugin und Verkünderin der Osterbotschaft – eine Rolle, die ihr von Jesus selbst übertragen wurde. Nach Lukas jedoch hielten die Jünger ihre Botschaft für λῆρος [léros] – „leeres Geschwätz“ (Lk 24,11). Ob diese Abwertung mit dem Geschlecht der Überbringerinnen zusammenhing, bleibt offen. Doch Leonhard Swidler bringt es auf den Punkt: „Dieses bedeutendste Ereignis seiner Laufbahn von Frauen bezeugen zu lassen muss wohlüberlegte Absicht gewesen sein: Es war ein ungeheuer deutlicher Hinweis darauf, dass er mit der Mitte seiner Frohbotschaft, der Auferstehung, die untergeordnete Rolle der Frauen eindeutig zurückwies.“25
In den gnostischen Evangelien und Schriften der ersten Jahrhunderte wird Maria Magdalena als zentrale Zeugin und Vertraute Jesu dargestellt. Auch Kirchenordnungen aus dem 3. und 4. Jahrhundert erwähnen die Existenz von Jüngerinnen. Diese Hinweise wurden allerdings durch einen Zusatz relativiert: Jesus habe die Frauen zwar gelehrt, aber nicht beauftragt, zu lehren – eine nachträgliche Anpassung im Sinne eines sich verfestigenden kirchlichen Lehrverbots für Frauen.26
Am 10. Juni 2016 würdigte Papst Franziskus die besondere Rolle Maria Magdalenas erneut: Er erhob ihren liturgischen Gedenktag am 22. Juli in der katholischen Kirche zu einem Fest27 – und stellte ihn somit den Festen der übrigen Apostel gleich.28 Damit ehrte er ihre Rolle als apostola apostolorum – Apostelin der Apostel –, die sie in Schrift und Tradition eindeutig innehat.
Persönliches Fazit
Mich berührt an Maria Magdalena besonders, dass sie trotz aller späteren Ausblendung nicht aus dem Zentrum des Ostergeschehens verdrängt werden konnte. Sie ist nicht nur Zeugin – sie wird zur ersten Verkünderin. Ihre Treue bis unter das Kreuz, ihre Suche am Grab, ihr Erkennen des Auferstandenen – all das ist kein Nebenschauplatz, sondern tiefes Evangelium. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott nicht auf gesellschaftliche Anerkennung schaut, sondern auf das Herz.
Dass Frauen als erste Zeuginnen eingesetzt wurden, war kein Versehen – es war eine bewusste Umkehrung der Erwartungen. Für mich bedeutet das, neu wahrzunehmen, wie konsequent Jesus Frauen geachtet und eingebunden hat – als Berufene, als Glaubende, als Handelnde auf Augenhöhe. Wenn Jesus ihnen diese Rolle anvertraut hat, darf die Kirche das heute nicht länger relativieren. Daran zu erinnern, ist für mich eine Frage der Treue zum Evangelium.
Johanna
Neben Maria Magdalena und Susanna nennt das Lukasevangelium auch eine Frau namens Johanna, die Jesus gemeinsam mit den Zwölf begleitete (Lk 8,1–3). Interessanterweise wird auch ihr Ehemann Chuzas erwähnt, ein hoher Beamter am Hof des Herodes. Dass Johanna ihre angesehene gesellschaftliche Stellung und ihren familiären Rahmen hinter sich ließ, um Jesus nachzufolgen, unterstreicht die Entschiedenheit ihres Glaubensweges. Auch sie begegnet uns später erneut – sowohl in der Passions- als auch in der Osterüberlieferung.29
Susanna
Auch Susanna wird in der Aufzählung der Frauen genannt, die Jesus und die Zwölf begleiteten (Lk 8,1–3). Über sie erfahren wir im Neuen Testament nichts weiter – ihr Name erscheint einzig an dieser Stelle. Und doch spricht ihre Nennung dafür, dass sie Teil des engeren Kreises war, der Jesu Weg aktiv mittrug.
Die Schwiegermutter des Petrus
Im Markusevangelium wird die Schwiegermutter des Petrus erwähnt – und das in einem bemerkenswerten Zusammenhang:
Und sofort, als sie aus der Synagoge herausgegangen waren, kamen sie in das Haus des Simon und Andreas, zusammen mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag fiebernd da, und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er kam heran, während er ihre Hand ergriff und sie aufrichtete; und das Fieber verließ sie, und sie diente (διηκόνει) ihnen. (Mk 1,29–31)
Nach der Feststellung des Heilungswunders („das Fieber verließ sie“) heißt es im griechischen Text: καὶ διηκόνει αὐτοῖς [kai diēkónei autois] – „und sie diente ihnen“. Hier begegnet uns erneut das Verb διακονεῖν [diakoneín], das – wie schon bei Maria Magdalena und den anderen Frauen – auf eine aktive und bewusste Teilhabe am Wirken Jesu hinweist. Dass gerade dieses Wort verwendet wird, legt nahe, dass ihre Rolle nicht einfach die einer dankbaren Hausfrau war, sondern die einer Frau, die nach ihrer Heilung in den Kreis der Jesusbewegung eintritt und sich in ihren Dienst stellt. Auch wenn der Text knapp ist, lässt er Raum für die Deutung, dass diese Frau mehr war als nur Gastgeberin – sie wird zur handelnden Person in der Nachfolge.30
Maria und Marta
Zwei Frauen, denen Jesus in besonderer Weise begegnet, sind die Schwestern Maria und Marta. Die Szene, in der sie auftreten, findet sich ausschließlich im Lukasevangelium (Lk 10,38–42). Dort heißt es, dass Marta Jesus in ihr Haus aufnimmt – ein Vorgang, der innerhalb des Judentums höchst ungewöhnlich war. In der damaligen jüdischen Gesellschaft galt es als undenkbar, dass eine Frau eigenständig ein Haus führt und einen männlichen Gast empfängt. Im griechischen Kulturraum hingegen hatten Frauen in dieser Hinsicht mehr gesellschaftliche Freiheiten. Lukas positioniert Marta in eine Rolle, die stark an Lydia erinnert, die nach der Apostelgeschichte Paulus in ihr Haus aufnimmt (Apg 16,15).
Das für Martas Handlung verwendete Verb ὑποδέχομαι [hypodéchomai] – „aufnehmen“ – steht für eine umfassende Gastfreundschaft, die in der antiken Welt hohe Bedeutung hatte.31 Marta übernimmt damit nicht nur eine praktische, sondern auch eine repräsentative Aufgabe – sie ist Gastgeberin Jesu.
Während Marta „περὶ πολλὴν διακονίαν“ [perì pollḗn diakonían] – „mit viel Dienst“ – (Lk 10,40) beschäftigt ist, setzt sich ihre Schwester Maria zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Diese Geste ist alles andere als selbstverständlich. Zwar war es im Judentum durchaus vorgesehen, dass Frauen glaubten und religiös gehorsam waren, doch dass sich eine Frau wie ein Schüler zu Füßen eines Lehrers – insbesondere eines rabbinischen Gesetzeslehrers – setzte, war eher unüblich. Lukas deutet hier an, dass Maria nicht nur zuhört, sondern sich dem Lernen, vielleicht sogar dem theologischen Studium widmet.32
In der Aufnahme von Frauen in den Jüngerkreis Jesu liegt eine provokante Botschaft. Einige Theologen leiten aus dieser Szene ab, dass Frauen grundsätzlich zur Ausbildung für kirchliche Aufgaben befähigt sind.33 Auch wenn sich aus dieser Perikope nicht unmittelbar ein Amtsverständnis ableiten lässt, macht sie deutlich, dass Frauen entgegen der damaligen jüdischen Praxis das Recht haben, die Lehre Jesu zu hören – und sich ihr in vollem Umfang zu widmen. Ob dies auch die Weitergabe der Lehre umfasst, muss anhand anderer biblischer Zeugnisse diskutiert werden.
Marta hingegen ist – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – „ganz in Anspruch genommen“. Das hierfür verwendete griechische Verb περισπᾶμαι [perispámai] ist selten und bedeutet so viel wie „nach allen Seiten gezerrt werden“, „absorbiert sein“, „in Anspruch genommen sein“ oder „zerstreut sein“.34Es bedeutet hier, sich einer Wirklichkeit zu entziehen und durch eine oder mehrere andere Wirklichkeiten völlig in Anspruch genommen zu sein.35
Als Marta Jesus bittet, er möge Maria auffordern, ihr zu helfen, reagiert Jesus mit einem liebevollen, aber klaren Hinweis:
Nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil erwählt, der nicht von ihr genommen werden wird. (Lk 10,42)
Jesus kritisiert Marta nicht dafür, dass sie mit hauswirtschaftlichen Aufgaben beschäftigt ist – vielmehr tadelt er, dass sie sich darin verliert und auch Maria in diesen geschäftigen Aktivismus hineinziehen will.
Martas Sorge führt zu einer Zerstreuung, die sie daran hindert, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Für Jesus ist entscheidend, dass der Mensch sich auf ihn ausrichtet – durch Hören, durch Beziehung, nicht allein durch Dienst.
Was Jesus hier betont, ist revolutionär: Er möchte nicht bedient, sondern gehört werden. Er begegnet Frauen nicht als Objekte der Fürsorge oder Helferinnen im Hintergrund, sondern als vollwertigen Gesprächspartnerinnen, als Hörerinnen und Glaubenden, auf Augenhöhe. In der Haltung Jesu wird eine Haltung sichtbar, die deutlich von der Gleichwürdigkeit aller Menschen ausgeht – unabhängig von ihrem Geschlecht.
Persönliches Fazit
Für mich steckt in dieser Szene eine klare Einladung an jede und jeden, die eigene Berufung zu leben – nicht aus Pflichtgefühl oder Aktivismus, sondern aus der Liebe zu Christus heraus.36 Es geht nicht um Leistung, sondern um Beziehung.
Was mich besonders bewegt: Jesus würdigt das Hören. Er nennt es den „guten Teil“ – nicht, um den Dienst abzuwerten, sondern um daran zu erinnern, dass echtes Tun aus dem Zuhören erwächst. Gerade heute, in einer Kirche, die vom Funktionieren oft erschöpft wirkt, ist das eine heilsame Perspektive.
Die Erzählung macht mir deutlich, dass auch Frauen uneingeschränkt zur Jüngerschaft berufen sind – zum Hören, zum Glauben, zum Dienen, zum Leben in der Nähe Jesu. Marta und Maria zeigen zwei Seiten dieser Nachfolge: beide notwendig, beide bedeutsam. Entscheidend ist nicht die Form, sondern die Ausrichtung – und die beginnt für mich immer im Hinhören auf ihn.
Die beiden Schwestern begegnen uns ein weiteres Mal im Johannesevangelium (Joh 11,1–44), und zwar in einer der dramatischsten Szenen des vierten Evangeliums: dem Tod und der Auferweckung ihres Bruders Lazarus. Maria und Marta lassen Jesus holen, weil Lazarus schwer erkrankt ist. Doch Jesus lässt sich Zeit mit seiner Ankunft und sagt zunächst, dass diese Krankheit „nicht zum Tod führe, sondern zur Verherrlichung Gottes“. (vgl. Joh 11,4) Die Evangelien betonen ausdrücklich, dass Jesus eine enge emotionale Beziehung zu dieser Familie hatte – er hatte die drei Geschwister „lieb“ (Joh 11,5).
Als Jesus schließlich eintrifft, ist Lazarus bereits vier Tage tot. Marta geht ihm entgegen, während Maria zu Hause bleibt. Ihre erste Reaktion ist eine Mischung aus Schmerz und Vorwurf:
Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. (Joh 11,21)
Doch unmittelbar danach fügt sie einen Satz tiefen Vertrauens hinzu:
Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. (Joh 11,22)
Diese Aussage ist Ausdruck eines unerschütterlichen Glaubens – wenn auch bislang nicht im vollen Verständnis der kommenden Auferweckung. Jesus spricht mit Marta über die Auferstehung und fragt sie offen:
Glaubst du das? (Joh 11,26)
Marta bekennt ihren Glauben – allerdings ohne ihn schon unmittelbar mit der gegenwärtigen Situation und dem Tod ihres Bruders zu verbinden. Als Maria schließlich dazukommt, sagt auch sie:
Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. (Joh 11,32)
Die Klage der Schwestern berührt Jesus zutiefst. Er zeigt Mitgefühl – nicht nur in Worten, sondern in einer Geste tiefer Menschlichkeit:
Jesus weinte. (Joh 11,35)
Gemeinsam mit den Schwestern geht er zum Grab, lässt den Stein wegrollen und ruft Lazarus heraus – aus dem Grab, in dem er bereits vier Tage lag. Das Wunder geschieht: Der Tote kommt heraus. Diese Szene ist nicht nur ein Zeichen göttlicher Macht, sondern auch eine Bestärkung des Glaubens der Jünger und der beiden Schwestern. Jesus führt Maria und Marta auf sehr behutsame Weise Schritt für Schritt zu einem tieferen, tragfähigen Glauben – ohne sie zu überfordern oder herabzusetzen.
Auffällig ist dabei, wie respektvoll Jesus mit beiden Schwestern umgeht. Ihre Fragen, ihre Trauer, ihre Reaktionen nimmt er ernst – ohne danach zu fragen, ob sie Frauen sind. Er spricht mit ihnen auf Augenhöhe, stellt ihnen theologische Fragen, hört ihnen zu und begleitet sie in ihrem Glaubensprozess. Seine Haltung ihnen gegenüber unterscheidet sich in keiner Weise von der gegenüber männlichen Jüngern. Auch darin zeigt sich die radikale Gleichwertigkeit, mit der Jesus Frauen in sein Wirken einbezieht.
Marias Liebe zu Jesus wird besonders bei der Salbung in Betanien deutlich. Eine Woche vor seinem Tod ist Jesus erneut zu Gast im Haus der Geschwister Maria, Marta und Lazarus (Joh 12,1–8). Marta dient – wie schon bei früheren Begegnungen –, während Maria eine Geste voll tiefer Hingabe vollzieht: Sie salbt die Füße Jesu mit einem überaus kostbaren Öl.
Im antiken Judentum war es üblich, einem Gast beim Betreten des Hauses die Füße mit Wasser zu waschen – eine Aufgabe, die meist den niedrigsten Dienern zukam. Zusätzlich wurde der Kopf des Gastes mit einem Tropfen Öl oder Parfüm gesalbt – ein Ausdruck der Wertschätzung. Maria hingegen weicht bewusst von diesem Brauch ab: Sie nimmt ein ganzes Pfund echten, kostbaren Nardenöls, um Jesu Füße zu salben. Damit betont sie: Für ihn ist das Beste gerade gut genug – sogar für den niedrigsten Teil seines Körpers.
Ihre Handlung ist nicht nur Ausdruck tiefster Liebe, sondern auch einer demütigen Unterordnung unter Jesus. Die Fußpflege war im damaligen Kontext Ausdruck niedrigster Dienstbereitschaft – sie war Sklavenarbeit. Maria übernimmt diesen Dienst freiwillig und aus freiem Herzen. Sie verwendet dafür ein Öl, das nach Judas Iskariot 300 Denare wert ist – was etwa dem Jahreslohn eines gewöhnlichen Arbeiters entsprach. Kein Wunder, dass Judas ihr Verhalten als Verschwendung kritisiert.
Maria aber lässt sich nicht beirren. Sie trocknet die gesalbten Füße Jesu sogar mit ihrem Haar und bricht damit wiederum eine gesellschaftliche Norm. Jüdische Frauen trugen ihr Haar in der Öffentlichkeit in der Regel bedeckt. Offenes Haar galt als unschicklich, ja sogar als moralisch fragwürdig. Doch Maria stellt ihre Liebe zu Jesus über gesellschaftliche Konventionen. Ihre Geste ist radikal – in ihrer Hingabe ebenso wie in ihrer öffentlichen Sichtbarkeit.37 Auf den Einwand des Judas reagiert Jesus deutlich:
Lass sie; sie hat das für den Tag meines Begräbnisses getan. (Joh 12,7)
Damit deutet er die Handlung Marias als prophetisches Zeichen. Ihre Salbung verweist auf seinen bevorstehenden Tod. Sie salbt ihn nicht als Ehrengast, sondern als den, der sterben wird – sie nimmt, ohne es vollständig zu verstehen, das Begräbnisritual vorweg. Jesus erkennt in ihrer Handlung eine Tiefe, die den Jüngern in ihrer rationalen Sichtweise verborgen bleibt. Maria handelt intuitiv – aber getragen von Liebe und Glauben.
Auch in den synoptischen Evangelien wird von der Salbung Jesu berichtet, allerdings bleibt dort der Name der Frau unerwähnt. Markus schildert, dass Jesus „in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen“ (Mk 14,3) zu Gast war, als eine Frau mit einem Alabastergefäß kostbaren Nardenöls eintritt und ihm das Öl über das Haupt gießt. Die Handlung ist öffentlich, auffällig – und provozierend.
Wie im Johannesevangelium gibt es auch hier kritische Stimmen, die den Akt als Verschwendung betrachten. Doch erneut verteidigt Jesus das Handeln der Frau mit großer Deutlichkeit:
Sie hat meinen Leib im Voraus für das Begräbnis gesalbt. (Mk 14,8)
Er erkennt in ihrer Geste ein prophetisches Zeichen, das weit über eine spontane Handlung hinausreicht. Und er fügt hinzu:
Amen, ich sage euch: Überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat. (Mk 14,9)
Diese Aussage hat Gewicht. Jesus verleiht der Frau damit eine bleibende Bedeutung in der christlichen Verkündigung. Ihre Tat – eine Salbung mit Nardenöl – verweist auf zweierlei: auf den Begräbnisritus und zugleich auf eine messianische Salbung. Damit erhält ihr Tun eine doppelte prophetische Dimension. Das Zerbrechen des Salbgefäßes wird zum Symbol für Jesu Tod – seine Hingabe, seine Aufopferung, seine königliche Sendung.
Erneut ist es eine Frau, durch die zentrale christologische Aussagen zur Sprache kommen – und das unmittelbar vor dem Beginn der Passion. Ihre Handlung ist mehr als eine rituelle Geste: Sie übernimmt eine Rolle, die in der Tradition Männern vorbehalten war – die eines Salbenden, eines, der erkennt, wer Jesus wirklich ist. Dass sie genau in diesem Moment eine messianische Salbung vornimmt, ist hochsymbolisch – und in seiner Zeit zutiefst herausfordernd.
Die anwesenden Männer – darunter Judas – sehen in ihrem Tun lediglich Verschwendung. Sie erfassen die Tiefe der Handlung nicht.38 Die Frau dagegen zeigt ein Gespür für Jesu Sendung, das den Jüngern trotz mehrfacher Leidensankündigungen fehlt. Monika Fander bringt es prägnant auf den Punkt:
Die Frau zeigt durch ihr Tun ein Verständnis der Sendung Jesu, das den Jüngern trotz der dreifachen Leidensankündigung fehlt.39
Der Evangelist Matthäus übernimmt diese Erzählung fast wortgleich (Mt 26,6b–13). Auch dort wird das Handeln der Frau gewürdigt – als prophetisch, visionär, zutiefst bedeutungsvoll. Ihre Geschichte wird damit zum festen Bestandteil des Evangeliums – obwohl ihr Name ungenannt bleibt.
Seit der Auslegung durch Gregor den Großen im 6. Jahrhundert wurde in der lateinischen Kirche die in den Evangelien salbende Frau mit der namenlosen Sünderin aus Lk 7,36–50 gleichgesetzt. Grundlage dieser Deutung war unter anderem die Bemerkung in Lk 8,2, dass aus Maria Magdalena „sieben Dämonen ausgefahren“ seien – was man später als Hinweis auf eine besonders schwere Sünde deutete. Ein weiteres Argument war die Tatsache, dass in beiden Perikopen ein Simon als Gastgeber erwähnt wird – einmal Simon der Pharisäer, einmal Simon der Aussätzige.40
Diese Gleichsetzung führte dazu, dass Maria Magdalena in der westlichen Tradition lange Zeit als Büßerin und reuige Sünderin verstanden wurde. Dabei vermischten sich drei Frauenbilder: die namentlich nicht genannte „Sünderin“ bei Lukas, Maria von Bethanien und Maria aus Magdala. Die Ostkirche hingegen ging schon früh einen anderen Weg: In der griechischen Tradition wurden diese drei Frauen immer klar voneinander unterschieden – eine Differenzierung, die heute auch in der Exegese breite Zustimmung findet.
Lukas überliefert die Geschichte der Salbung durch eine Sünderin in besonders ausführlicher Form (Lk 7,36–50). Anders als bei Markus und Matthäus salbt die Frau hier nicht den Kopf Jesu, sondern seine Füße – mit Tränen, Haaren und Salböl. Von Anfang an wird sie als „eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war“ bezeichnet – wahrscheinlich, aber nicht mit Sicherheit, eine Prostituierte.41 Als sie erfährt, dass Jesus im Haus eines Pharisäers namens Simon eingeladen ist, bringt sie ein Gefäß mit Salböl, tritt von hinten an Jesus heran, weint über seine Füße, trocknet sie mit ihrem Haar, küsst sie immer wieder und salbt sie mit dem Öl. Indem Lukas aus der markinischen Hauptsalbung eine Fußsalbung macht und die Frau ausdrücklich als Sünderin bezeichnet, verschiebt sich der Deutungshorizont der Szene: Aus dem königlichen Zeichen wird ein zutiefst persönliches Zeichen der Vergebung.42
Diese Szene ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich. Schon allein die Tatsache, dass eine Frau – dazu noch mit zweifelhaftem Ruf – ohne Einladung eintritt und sich Jesus nähert, bricht sämtliche gesellschaftlichen Konventionen. Dass sie dabei ihr Haar offen trägt, unterstreicht den Skandal. Ihre Sehnsucht nach Nähe zu Jesus ist größer als alle äußeren Schranken.
Die Frau nähert sich Jesus von hinten – ganz so, wie es für Diener üblich war. Zur Zeit Jesu saß man bei Tisch nicht auf Stühlen, sondern lag halbseitig auf Polstern, während die Füße nach hinten ausgestreckt waren. Die Dienenden standen in der Regel am Fußende, bereit, Anweisungen entgegenzunehmen oder ihre Aufgaben zu erfüllen. Auch diese Frau reiht sich bewusst unter die Dienenden ein – nicht, um bedient zu werden, sondern um Jesus zu dienen und zu ehren.
Doch in dem Moment, in dem sie Jesus dienen will, überwältigen sie ihre Emotionen. Sie bricht in Tränen aus – Tränen, die auf Jesu Füße fallen. Ein Tuch hat sie nicht dabei, also verwendet sie das, was ihr zur Verfügung steht: ihr eigenes Haar. Sie scheut sich nicht, damit die Füße Jesu abzutrocknen – ein Akt tiefer Demut und persönlicher Hingabe.
Hinzu kommt: Sie küsst Jesu Füße – nicht nur einmal, sondern unablässig. Ihre Gesten sind Ausdruck tiefster Anbetung43 – sie sagt nichts mit Worten, aber alles mit ihrem Tun. Es ist eine stille, aber kraftvolle Predigt: aus Tränen, aus Berührung, aus Demut und Liebe.
In Israel wurden traditionell Könige, Priester und Propheten rituell mit Öl gesalbt – insbesondere am Haupt. Eine Kopfsalbung war zudem Bestandteil höfischer Empfangsrituale und diente der Körperpflege.44 Lukas hingegen schildert eine Fußsalbung – ein Akt, der im religiösen und gesellschaftlichen Kontext höchst ungewöhnlich war. Ihre Handlung bewegt sich im Grenzbereich zwischen intimer Zuwendung und gesellschaftlicher Tabuverletzung.45
Und doch: Jesus weist sie nicht zurück. Im Gegenteil – er nimmt die Geste an, deutet sie theologisch und verteidigt die Frau vor den kritischen Blicken der Umstehenden. Was andere als anstößig empfinden, wird von ihm als Ausdruck einer tiefen inneren Wahrheit erkannt: einer liebenden, glaubenden und heilenden Beziehung zu ihm.
Der Pharisäer Simon ist sichtlich irritiert über das Verhalten Jesu. Innerlich empört denkt er:
Wenn dieser ein Prophet wäre, wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. (Lk 7,39)
Simon zweifelt an der prophetischen Autorität Jesu – gerade wegen dessen Offenheit gegenüber dieser Frau. Für ihn steht fest: Ein wahrer Prophet würde eine solche Berührung nicht zulassen. Simon denkt in klaren Kategorien von rein/unrein, von gut/sündig. Und da Jesus diese Grenzen nicht zieht, zieht Simon den Schluss, dass er kein echter Prophet sein könne.
Jesus jedoch kennt die Gedanken seines Gastgebers – und antwortet nicht mit direkter Konfrontation, sondern mit einem Gleichnis: Er erzählt von zwei Schuldnern, von denen beiden erlassen wird – dem einen viel, dem anderen wenig. Die zentrale Frage lautet: Wer liebt mehr? Dann wendet sich Jesus Simon direkt zu und fragt:
Siehst du diese Frau? (Lk 7,44)
Diese Frage ist mehr als eine rhetorische Einleitung. Wahrscheinlich hat Simon die Frau bislang überhaupt nicht wirklich angesehen – er hat in ihr nur „die Sünderin“ gesehen, nicht den Menschen. Jesus zwingt ihn, genau hinzuschauen:
Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen – Wasser für meine Füße hast du mir nicht gegeben; sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihrem Haar abgewischt. Einen Kuss hast du mir nicht gegeben; sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße (intensiv) zu küssen. Mit (gewöhnlichem) Öl hast du mein Haupt nicht gesalbt; sie aber hat meine Füße mit (kostbarem) Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden – denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. (Lk 7,44–47)
Mit diesen Worten stellt Jesus das Verhalten der Frau dem Verhalten Simons gegenüber. Die Frau hat all das getan, was Simon unterlassen hat – mit einer Zärtlichkeit, einer Großzügigkeit und einer Liebe, die aus ihrer tiefen Umkehr heraus erwächst. Anschließend spricht Jesus sie direkt an:
Deine Sünden sind dir vergeben. (Lk 7,48)
Die Frau schweigt – und in diesem Schweigen liegt Würde, vielleicht Erleichterung, vielleicht auch Staunen. Jesu Verhalten ihr gegenüber ist konsequent gegen alle Konventionen gerichtet. Er lässt sich berühren, salben, küssen – und wertet diese Gesten nicht als unangemessen, sondern erkennt in ihnen die Tiefe ihrer Liebe. Was andere als skandalös empfinden, deutet er als Offenbarung des Herzens. Die Anwesenden sind irritiert:
Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? (Lk 7,49)
Denn im jüdischen Verständnis konnte nur Gott selbst Sünden vergeben. Dass Jesus diesen Schritt vollzieht, stellt seinen Anspruch in den Raum: Er handelt mit göttlicher Vollmacht – eine Provokation, die später zur Anklage der Gotteslästerung führen wird. Beate Kowalski beschreibt die Szene so:
Der unangenehme Dialog Jesu mit Simon setzt sich fort. Jesus lenkt den Blick Simons auf die Frau und ihre Handlungen in dessen Haus. Allein das ist eine Provokation: den Blick auf eine Sünderin lenken und diese nicht zu ignorieren. Er stellt die Sünderin in den Mittelpunkt und verlangt von Simon eine neue Sehweise. Er soll genau hinsehen und die Frau – aber auch sich selbst – richtig wahrnehmen. Die Provokation wird aber noch schärfer, indem Jesus die Handlungen der Frau mit denen des Pharisäers vergleicht und dabei fortwährend das richtige Verhalten der Frau herausstellt. In drei Argumentationsgängen, die je aus dem Vorwurf („Du hast...“: V 44: οὐκ ἔδωκας; V 45: οὐκ ἔδωκας; V 46: οὐκ ἤλειψας) und der Darstellung der Gesten der Sünderin („sie aber“/ αὕτη δὲ: V 44.45.46) bestehen, hält Jesus seinem Gastgeber einen Spiegel vor Augen.46
Durch Simons vorherige Zustimmung zur Aussage im Gleichnis ist er nun in eine Lage gebracht, die ihn zwingt, seine eigene Haltung zu überdenken. Jesus entlarvt die verborgenen Motive seines Gastgebers – nicht um ihn bloßzustellen, sondern um ihn für die Heilsbedürftigkeit eines jeden Menschen zu sensibilisieren.47 Zum Schluss sagt Jesus erneut zur Frau:
Dein Glaube hat dich (endgültig) gerettet. Geh in Frieden. (Lk 7,50)
Diese Worte schließen den Erzählbogen. Die Reaktion Simons bleibt offen – ebenso die der übrigen Gäste. Doch der Blick Jesu auf die Frau ist eindeutig: Ihre Liebe zählt. Ihre Reue zählt. Ihre Würde zählt. Gegen jede gesellschaftliche Erwartung erlaubt Jesus diese Nähe – und macht sie fruchtbar zur Offenbarung einer göttlichen Wahrheit: Die Liebe ist stärker als jede Schuld. Sie vermag selbst das Unaussprechliche zu heilen.
Persönliches Fazit
Die Begegnung Jesu mit der salbenden Frau im Haus Simons ist für mich eine Schlüsselstelle im Neuen Testament – nicht nur, weil sie Jesu Umgang mit gesellschaftlichen Außenseiterinnen sichtbar macht, sondern weil sie beispielhaft zeigt, wie er mit Sünde, Umkehr und der Würde des Menschen umgeht. Es bewegt mich, wie er diese Frau sieht: nicht mit dem Blick auf ihre Vergangenheit, sondern auf ihre Liebe.
Jesus bricht mit sozialen Erwartungen, indem er Zärtlichkeit zulässt, Anklagen übergeht und Vergebung zuspricht – öffentlich, nicht versteckt. Die Frau wird nicht beschämt, sondern erhoben. Ihre Handlung wird nicht als Skandal, sondern als Zeichen gedeutet. Für mich wird diese Szene so zu einem theologischen Lehrstück: Vergebung geschieht dort, wo sich Liebe entfalten darf.
Zugleich sehe ich, wie Jesus die religiöse Selbstsicherheit des Pharisäers herausfordert – nicht durch schroffe Ablehnung, sondern durch die Einladung zur Selbstreflexion. In dieser doppelten Bewegung – der Zuwendung zur Sünderin und der Provokation des Gerechten – liegt für mich der Kern seiner Botschaft: Jesus eröffnet einen Raum, in dem Liebe, Reue und Gnade größer sind als jedes moralische Urteil.
Besonders nachdenklich machen mich die Überlieferungen der Evangelien, in denen Frauen Jesus salben. Diese Handlungen sind tiefgründig – nicht nur als persönliche Geste, sondern als theologisch aufgeladene Zeichen. Die Salbung hatte im alttestamentlichen Kontext einen hohen kultischen Rang: Sie bedeutete Beauftragung – von Königen, Priestern, Propheten. Dass in den Evangelien Frauen Jesus salben, lange bevor seine Jünger seine Sendung wirklich verstehen, ist für mich keine Nebensächlichkeit.
Es sind Frauen, die ihn als den Gesalbten – als Christus – deuten. Sie übernehmen symbolisch-kultische Akte, die sonst Männern vorbehalten waren, und werden von Jesus nicht korrigiert, sondern ausdrücklich anerkannt. Für mich zeigt das: Diese Salbungen sind keine emotionalen Gesten, sondern prophetische Handlungen.
Ich sehe darin ein starkes Gegengewicht zur späteren kirchlichen Argumentation, nur Männer könnten „in persona Christi“ handeln. Denn in den Evangelien selbst sind es Frauen, die Jesu Sendung auf priesterliche Weise deuten – öffentlich, sichtbar und mit seiner Zustimmung. Diese Erzählungen werfen ein neues Licht auf die Frage nach Ämtern in der Kirche. Sie stellen nicht die Tradition infrage, sondern führen tiefer hinein in das, was von Anfang an war.
Die „blutflüssige“ Frau
In allen drei synoptischen Evangelien findet sich die Geschichte einer Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen leidet und von Jesus geheilt wird – eingebettet in die Erzählung von der Auferweckung der Tochter des Jaïrus (Mk 5,25–34; Mt 9,20–22; Lk 8,43–48). Es ist eine dichte, vielschichtige Szene, die nicht nur von körperlicher Heilung berichtet, sondern auch eine tiefgreifende soziale und religiöse Dimension offenbart.
Die Frau leidet an einem chronischen Blutfluss – eine Erkrankung, die sie nach jüdischem Reinheitsgesetz dauerhaft als „unrein“ kennzeichnete (vgl. Lev 15,25–27; Ez 36,17). Ihre Berührung – sei es von Menschen, Gegenständen oder gar eines Mannes – galt kultisch als verunreinigend. In diesem Zustand durch eine Menschenmenge zu drängen und bewusst einen Mann zu berühren, ist aus damaliger Sicht ein Tabubruch. Umso erstaunlicher ist ihr Mut – und der Glaube, aus dem heraus sie handelt. Sie sagt sich:
Wenn ich auch nur seine Kleidung berühre, werde ich geheilt werden. (Mk 5,28)
Und tatsächlich – in dem Moment, in dem sie den Saum seines Gewandes berührt, spürt sie: Sie ist geheilt. Auch Jesus merkt, dass „eine Kraft von ihm ausgegangen“ ist. Er dreht sich um, hält inne und fragt:
Wer hat meine Kleidung berührt? (Mk 5,30)





























