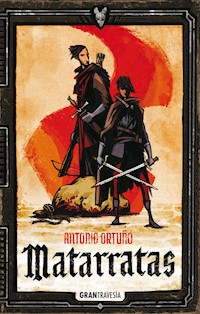15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie ein skrupelloser Bauunternehmer mit Bestechung, Erpressung und Mord seine Ziele durchzusetzen versucht und in Kauf nimmt, dass die eigene Familie daran zerbricht: In seinem grandiosen Roman zeichnet Ortuño ein erschütterndes Sittenbild des heutigen Mexiko, in dem Korruption und Gewalt allgegenwärtig sind. Der Bauunternehmer Don Carlos Flores plant in Guadalajara eine luxuriöse Wohnanlage, für die er schon einen Namen hat, Olinka, und auch Investoren. Er muss sich für dieses Projekt, das ihn und seine Familie noch reicher machen soll, nur noch den Grund und Boden aneignen. Und die Leute vertreiben, die dort wohnen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. Viele gehen nach Schikanen freiwillig, aber zwei Familien lassen sich nicht vertreiben und die sind plötzlich verschwunden. Gleichzeitig wird Don Carlos der Geldwäsche für die Drogenbosse aus dem Norden Mexikos beschuldigt und Journalisten recherchieren, wo die Verschwundenen geblieben sind. Alle Spuren weisen auf Don Carlos, der den Kopf aus der Schlinge zieht und seinen Schwiegersohn, Aurelio Blanco, als Bauernopfer den Behörden ausliefert. Ohne zu ahnen, wofür er eigentlich benutzt wird, deckt ihn Aurelio bereitwillig. Doch mit 15 Jahren Haft hat er nicht gerechnet. Als man ihn freilässt, sucht er Gerechtigkeit. Wird es sie für ihn geben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Wie ein skrupelloser Bauunternehmer mit Bestechung, Erpressung und Mord seine Ziele durchzusetzen versucht und in Kauf nimmt, dass die eigene Familie daran zerbricht: In seinem grandiosen Roman zeichnet Ortuño ein erschütterndes Sittenbild des heutigen Mexiko, in dem Korruption und Gewalt allgegenwärtig sind.
Der Bauunternehmer Don Carlos Flores plant in Guadalajara eine luxuriöse Wohnanlage, für die er schon einen Namen hat, Olinka, und auch Investoren. Er muss sich für dieses Projekt, das ihn und seine Familie noch reicher machen soll, nur noch den Grund und Boden aneignen. Und die Leute vertreiben, die dort wohnen. Dazu ist ihm jedes Mittel recht. Viele gehen nach Schikanen freiwillig, aber zwei Familien lassen sich nicht vertreiben und die sind plötzlich verschwunden. Gleichzeitig wird Don Carlos der Geldwäsche für die Drogenbosse aus dem Norden Mexikos beschuldigt und Journalisten recherchieren, wo die Verschwundenen geblieben sind. Alle Spuren weisen auf Don Carlos, der den Kopf aus der Schlinge zieht und seinen Schwiegersohn, Aurelio Blanco, als Bauernopfer den Behörden ausliefert. Ohne zu ahnen, wofür er eigentlich benutzt wird, deckt ihn Aurelio bereitwillig. Doch mit 15 Jahren Haft hat er nicht gerechnet. Als man ihn freilässt, sucht er Gerechtigkeit. Wird es sie für ihn geben?
Über den Autor
Antonio Ortuño wurde 1976 in Guadalajara geboren. Sein Debütroman wurde von der Zeitung Reforma zum besten mexikanischen Roman 2006 gewählt, 2010 kürte ihn das Magazin Granta zu einem der besten jungen spanischsprachigen Autoren der Gegenwart. Auf Deutsch erschienen bei Kunstmann Die Verbrannten (2015) und Madrid, Mexiko (2017).
ANTONIO ORTUÑO
DIE VERSCHWUNDENEN
Roman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
Verlag Antje Kunstmann
Für OliviaFür meine TöchterFür die Superschurken-LigaFür die Clique von El Amaretto,auch bekannt als der Orden der Kapuzineräffchen
Möge das ferne Grollen der Zwietracht uns nie erreichen.Inschrift auf der Fassade des Teatro Degollado in Guadalajara
Gerechtigkeit, Weisheit und Standhaftigkeit wachenüber diese loyale Stadt.Inschrift auf dem Sockel der Minerva-Statue in Guadalajara
Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten veröffentlicht regelmäßig eine Liste von Unternehmen weltweit, die beschuldigt werden, für das organisierte Verbrechen Geld zu waschen. Mehr als die Hälfte der auf dieser Liste verzeichneten mexikanischen Unternehmen befindet sich in Guadalajara.Ein reizender Ort
DAS FERNE GROLLEN DER ZWIETRACHT
»Die Flores werden dich kaltmachen.« Während Rechtsanwalt Piña im Vorraum der Krankenstation des Gefängnisses darauf wartete, dass die Stichwunde, die man einem anderen seiner Mandanten zugefügt hatte, desinfiziert und genäht wurde, konfrontierte er Aurelio Blanco mit der Gewissheit, dass er umgebracht werden würde. »Mach dir keine Illusionen. Wenn du rauskommst, werden sie zwei, drei Monate warten und dich dann abknallen.« In den fünfzehn Jahren Knast hatte Blanco keine Zeit und keine Kraft gehabt, diese simple Überlegung anzustellen, oder er war nicht in der Geistesverfassung gewesen. Doch er wusste, dass das, was er soeben gehört hatte, stimmte. Die Flores, seine angeheiratete Familie: Wegen ihnen saß er im Gefängnis. Und sie würden ihn abmurksen. Das Gespräch hatte an einem der kleinen Aluminiumtische im Besucherraum des Gefängnisses begonnen, im Licht von Neonlampen, zwischen Trennseiten, inmitten verstreuter Zettel mit Notizen, in Gesellschaft der üblichen Armee von Fliegen. Mürrische Häftlinge, bedrückte Ehefrauen, schläfrige Rechtsreferendare. Es roch nach Reinigungsmitteln, Zigaretten, halb verdautem Essen. Der Wärter kam, um seine Aussage zu der Messerattacke zu machen. Der Verwundete konnte natürlich nicht zur Unterzeichnung des obligatorischen Protokolls erscheinen. Blanco unterschrieb seine eigenen Formulare mit dem vergoldeten Füllfederhalter des Anwalts, und dieser stopfte die Dokumente rasch in seine Aktenmappe. Dann wurden beide in den Raum neben dem Operationssaal geführt. Piña wollte mit seinen Warnungen fortfahren, aber er brauchte auch noch die Unterschrift des Geschädigten oder musste gegebenenfalls dessen Tod feststellen. Blanco trug die milchkaffeebraune Sträflingsuniform, aber keine Handschellen oder Fußketten. Dieser Gefängnistrakt hatte die geringste Sicherheitsstufe, bestimmt für Kleinkriminelle mit dem nötigen Geld, um für gewisse Annehmlichkeiten zu zahlen, und es stand nicht zu befürchten, dass Blanco auszubrechen versuchen würde. An einer Biegung des Korridors, der dritten, korrigierte er die Route des Wachpersonals. Er kannte sich hier aus. Er hatte die letzten fünfzehn Jahre in diesem Labyrinth von gesicherten Fluren verbracht. »Du hörst mir nicht zu, Yeyo.« Der Anwalt war ein Kommilitone seiner Schwester gewesen und sprach mit der Autorität und der Gereiztheit eines Vormunds zu ihm. »Das hab ich mir nicht ausgedacht, und es stammt auch nicht aus einer beschissenen Fernsehserie, die ich gesehen habe, um dir jetzt Vorschriften zu machen. Den Flores geht es finanziell nicht gut, sie werden dir keinen Centavo geben. Und wenn es mit den Leuten bergab geht, werden sie gefährlich, wie Comandante Cuervo sagt. Du musst was tun, Yeyo, oder du bist am Ende der Dumme. Wir haben schon Anfang November. Vor den Weihnachtsferien unterschreibt der Richter die Entlassungspapiere ganz bestimmt nicht, aber ich schätze, im Januar werden sie dich rauslassen. Mitte Januar, denke ich. Und im Mai oder so bist du tot.« Der, den der Anwalt »Comandante« nannte, war einer seiner Berater, ein ehemaliger Polizist in den Sechzigern, der sich damit brüstete, ein Spezialist in Sachen lokaler Kriminalität zu sein. Trotz seiner Angeberei kannte sich der verfluchte Comandante tatsächlich bestens aus. Unter seiner Anleitung erreichte Blanco zur gegebenen Zeit seine Verlegung in den Trakt mit der geringsten Sicherheitsstufe, den einzigen, der vom Staat und nicht von einer der Banden kontrolliert wurde, was bedeutete, dass die Verkommenheit hier zwar dieselbe, der Terror aber fast beherrschbar war. Die »Casita« nannten die anderen den Trakt voller Verachtung oder mit einem gewissen Neid: »In der Casita passiert nichts, sie essen, was sie wollen, man lässt ihnen ihr Telefon, versorgt sie sogar mit Weibern. Und ohne die Prügeleien wie bei uns.«
»Komisch, dass sie Marquitos attackiert haben«, sagte Blanco, ohne auf das Thema einzugehen, das der Anwalt ihm aufdrängen wollte. »Hier passiert so was nie.« »Marquitos?« »Dein Mandant, du Blödmann.« Er zeigte auf die Tür zum OP. »Ja, Marquitos.« Piña lächelte entschuldigend. »Es ist im Hof passiert«, mischte sich der Wärter ein. Die drei zuckten mit den Achseln, denn diese Information brachte kein Licht in die Angelegenheit. »Nein, sie wissen nicht, wer. Sie haben ihn in einer Ecke gefunden, hinter den Müllcontainern. Sie haben ein Jammern gehört und gedacht, es wär ’ne Katze. Aber er hat dichtgehalten, jawohl, hat hartnäckig geschwiegen, hat niemanden beschuldigt.« Piña blies die Backen auf und schnaubte, damit der Wärter endlich den Mund hielt. Dem Anwalt schien es ziemlich egal zu sein, was Marquitos, der fünf Meter weiter verarztet wurde, zugestoßen war. Seine Gleichgültigkeit ärgerte Blanco. Und wenn sie mich abgestochen hätten? Aber sein Fall lag anders.
Der Anwalt war ein stattlicher Mann gewesen, damals, als er ihn vor Gericht vertreten hatte. Doch die Jahre hatten ihm zugesetzt, er war fett geworden, hatte ein aufgedunsenes Gesicht, und seine Hände zitterten wie bei einem Trinker. Blanco nahm an, dass er ein Freund oder sogar der Liebhaber seiner Schwester Anita gewesen war oder es noch war und sich deshalb bereit erklärt hatte, seinen Fall zu übernehmen: aus Solidarität. Und gegen das entsprechende Honorar natürlich, das er pünktlich erhielt. Dennoch hatten sie mit der Zeit so etwas wie Zuneigung zueinander gefasst. Piña machte ihm Mut. »Du bist kein verdammter Krimineller. Was du gemacht hast, war ein Wirtschaftsdelikt«, versicherte er ihm immer wieder. »Es ist ein Fehlurteil. Fünfzehn Jahre hast du gebrummt, Yeyo. Du musst mir zuhören, sonst machen sie dich so richtig fertig. Denk nach, denk nach, verdammt noch mal, denn bald hast du deine Strafe abgesessen. Wenn die Feiertage vorbei sind, werden sie dich freilassen. Und dass die Flores dich hier reingebracht haben, dass sie dich gezwungen haben, dich scheiden zu lassen, und dich nicht ein einziges Mal deine Tochter haben sehen lassen, haben sie bestimmt nicht getan, um sich jetzt bei dir zu entschuldigen, du Blödmann. Sie werden dich kaltmachen. Ich an deiner Stelle würde mich so schnell wie möglich aus dem Staub machen. Zu einem Verwandten oder einem Freund, so weit weg wie möglich, zu dem musst du gehen. Oder über die Grenze in die Staaten. Ab durch die Mitte.« Blanco hörte ihm zu, ohne zu begreifen, was Piña sagte. Er hatte Angst vor den Flores, aber er respektierte sie auch. In der ersten Zeit seiner Haft war er davon überzeugt gewesen, dass sein Schwiegervater ihn in ein paar Monaten rausholen würde. Spätestens in ein paar Jahren. Das hatten sie ihm versprochen. Ich werde rauskommen, werde zu meiner Familie zurückkehren, zu meiner Frau, meiner Tochter, werde in wenigen Monaten so viel verdient haben wie sonst vielleicht in den vergangenen fünfzehn Jahren. Das dachte er. Den anderen Häftlingen gegenüber war er einsilbig oder sprach nur in kurzen Sätzen, denn er war sicher, dass es überflüssig war, Freundschaften zu schließen. »Ich habe eine Abmachung«, sagte er zu dem Einzigen, der ihn zu fragen wagte, wie lange er sitzen müsse. Und saß die ganzen fünfzehn Jahre ab, auf gepackten Koffern, hinter tausend Türen, die niemand öffnete.
Vielleicht war der Wärter verärgert darüber, dass er von dem Gespräch ausgeschlossen war, jedenfalls ging er hinaus, ohne einen Vorwand zu murmeln. Doch als gäbe es die Anweisung, Blanco und den Anwalt nicht unbeaufsichtigt zu lassen, kam eine Minute später ein Krankenpfleger mit Aknepickeln im Gesicht herein. Er schob einen blutbespritzten Rollstuhl vor sich her und setzte sich neben die Tür des Operationssaals. Mit starrem Blick und gespitzten Ohren. So schien es Blanco jedenfalls. Denn in einem Gefängnis weiß jeder am Ende alles. Die Häftlinge hören zu, geben ihren Kommentar ab und käuen immer dieselben Geschichten wieder, die so verdreht sind, dass sie unmöglich noch weiter verfälscht werden können. Gerüchte, Beobachtungen und Getuschel anstatt Offenheit. »Beobachte und lerne«, murmelte Piña, und Blanco zog es vor, den Pseudo-Aphorismus des Anwalts nicht auf etwas Konkretes zu beziehen. »Halte dich fern und lass die Zeit vergehen, wer weiß, was passiert, und vielleicht regelt sich ja alles von selbst. Deine Tochter wird größer werden und schon wissen, ob sie nach dir suchen soll oder was auch immer. Aber jetzt ist erst mal wichtig, Land zu gewinnen, Yeyo.« Die Tür öffnete sich, ein Arzt trat in das Neonlicht des Warteraums. Runde Schweißflecken zeichneten sich unter den Achseln ab und färbten den himmelblauen Arztkittel dunkel. »Der Patient ist außer Lebensgefahr«, sagte der Chirurg in offiziellem Ton. Aber mit der Unterschrift müsse man auf jeden Fall noch warten, denn Marquitos, der Verwundete, sei ruhiggestellt worden und das müsse noch eine Weile so bleiben. »Er ist über den Berg? Dann wollten sie ihn nicht umbringen, sondern nur warnen«, zischte der Pfleger, wie um zu zeigen, dass er wusste, was die Diagnose zu bedeuten hatte. »Wenn sie gewollt hätten, hätten sie ihn kaltgemacht…« Der Anwalt nickte Blanco zu. »Siehst du? So, genau so läuft das. Marquitos hat auch eine Abmachung, wie du. Und du siehst ja, was es ihm genützt hat: einen Dreck. Denk darüber nach, Yeyo. Du hast noch etwas über einen Monat. Denk nach. Du holst dir doch eh keinen mehr runter, du vögelst nicht, du machst nichts Anständiges mehr in deinem Scheißleben. Denk nach. Denk nach.«
»Leck mich doch am Arsch«, brummte Blanco. Bei einem früheren Treffen, in einem schwachen Moment der Niedergeschlagenheit, hatte er Piña anvertraut, wie verzweifelt er war wegen seiner endlosen Enthaltsamkeit, ohne damit zu rechnen, dass sein Geständnis schließlich die Runde machen würde. Eine von vielen Geschichten, die inzwischen über ihn in der Casita erzählt wurden. Eine lächerliche Anekdote, die dazu führte, dass er von niemandem mehr ernst genommen wurde. Er war von oben bis unten blamiert. Man hatte ihn nicht rausgeholt, und draußen erwartete ihn kein glückliches Leben. Nicht mal einen Körper hatte er zur Verfügung, um sich daran zu reiben wie die anderen. »Fünfzehn Jahre sind eine lange Zeit«, fügte der Anwalt hinzu. »Ganz ohne Vögeln, ohne ein Leben, Yeyo. Und von der Kohle, die sie dir schulden, will ich gar nicht reden. Aber sieh mal, sobald wir von dem Richter hören, geben wir dir Bescheid, was mit dem Entlassungstermin ist. Bis dahin, denk nach, du Blödmann, denk nach.«
Blanco ging in seine Zelle zurück, wo ihn der übliche Uringestank empfing. Sein Zellennachbar lag nicht auf der oberen Pritsche, trieb sich wohl auf dem Hof oder im Esssaal herum. Der Gefängnistrakt, in den verlegt zu werden ihm im ersten Monat seiner Haft gelungen war, unterschied sich sehr von den Kreisen der Hölle, die er bei seiner Verhaftung so gefürchtet hatte. Hier hatte er das Gefühl, auf unbestimmte Zeit in einer Schule eingesperrt zu sein, zusammen mit den langweiligsten Klassenkameraden der Welt. Und ohne Frauen. Das machte ihm zu schaffen. Er legte sich auf seine durchgelegene Pritsche, und wie immer spürte er sogleich den Schmerz im Rücken. Wie er sich auch drehte und wendete, die Matratze bohrte sich ihm unerbittlich in den Rücken, wie die Lanze, die sich Christus in die Seite bohrte, auf dem Bild in der Gefängniskapelle, die zu besuchen er schon seit Langem nicht mehr die gerings te Lust verspürte. Blanco war versucht, auf den Boden zu spucken, entschied sich dann aber dafür, es sein zu lassen. Seit er kein Sex leben mehr hatte, verkniff er sich alles. Erstens, weil er keine Lust auf die Zärtlichkeiten in den Zellen hatte und niemand in der Casita sich wie ein Wolf auf einen Mithäftling stürzte. Hier holte man sich seine Streicheleinheiten wie in einem Büro oder einem Fitnessraum, und man musste den Verführer spielen, nie den wilden Mann, sonst bestand die Gefahr, dass jemand sauer wurde und den Wärtern Geld zusteckte, damit sie einen windelweich prügelten. Doch Blanco stießen seine Mithäftlinge ab, von niemandem fühlte er sich angezogen, nicht mal aus Langeweile. Zweitens, weil er sich in den fünfzehn Jahren nicht hatte dazu durchringen können, die Dienste von Huren in Anspruch zu nehmen, die von einem der Wärter vermittelt wurden und auf die die anderen zurückgriffen. In der ersten Zeit vielleicht aus Treue zu seiner Frau, dann, nachdem sie ihm mitgeteilt hatte, dass sie ihn nicht mehr besuchen würde und sie vor mehr als zehn Jahren geschieden worden waren, aus Enttäuschung, Lustlosigkeit und Trägheit.
So blieb ihm nichts anderes übrig, als sich einen Kaffee zu kochen. Der Wasserkessel und das Glas mit dem löslichen Kaffee waren sein einziger Trost. Und die Zigaretten. Seine Freuden waren die eines Einsiedlers: hin und wieder ein bitterer Geschmack im Mund, ein träges, einsames Leben. Wie immer schmeckte der Kaffee nach trockener Erde. Die Marter, die die stinkende Matratze für ihn darstellte, und die drei Mal fünf Jahre auf dieser Folterbank vergällten ihm jede Lust. Obwohl Blanco, wie jedes andere mensch liche Wesen, gerne masturbierte, hatte er das Bedürfnis, es an einem geheimen Ort zu tun, was sich wegen der Menschenmassen in Strafanstalten nur schwer bewerkstelligen ließ. Und schon gar nicht hier in der Zelle. Er teilte sie mit einem dicken, gutmütigen, schwitzenden Hünen, der sich zwei oder drei Mal in der Woche nachts auf seiner Pritsche über Blanco einen runterholte, um gleich darauf einzuschlafen und zu schnarchen. Ihm kam das Onanieren des Typen immer schmutzig vor, vielleicht aus Neid darüber, dass er selbst keinen geeigneten Ort dafür fand. Die Gemeinschaftstoiletten standen allen offen und wurden von Kameras überwacht. Und nur die Gefangenen, die nach ein paar Jahren des Eingesperrtseins durchdrehten, legten in den Gemeinschaftsräumen Hand an sich, sogar in diesem braven Gefängnistrakt, wo nur selten etwas passierte, um das man sich ernsthaft hätte Sorgen machen müssen. Alle lachten über diese Verrückten. Und normalerweise war ihr Schicksal besiegelt: Eines Morgens wachten sie mit schwarzem, aufgedunsenem Gesicht auf, das Laken um den Hals, von eigener Hand an den Eisengittern aufgehängt.
Obwohl Blanco mit den Jahren die Fähigkeit perfektioniert hatte, sich in die Welt seiner Träume zurückzuziehen, die sich mangels eines Fernsehers jede Nacht wiederholten, gab er sich heute Mühe, sich auf den wesentlichen Punkt zu konzentrieren. Er machte es sich auf der Matratze bequem, so gut es ging, und lenkte seine Gedanken auf die Flores, das unlösbare Problem. Was tun? Er war eine unverbesserliche treue Seele. Er dachte immer noch an sie wie an seine Familie. Niemals hatte er es Piña erlaubt, auch nur eine der Absprachen, die ihn ins Gefängnis gebracht hatten, zu hinterfragen oder dagegen Einspruch zu erheben, selbst dann nicht, als sie Blanco kaputt gemacht hatten, indem sie ihn daran hinderten, seine Tochter zu sehen. Er stand zu dem gegebenen Wort: Er hatte die Schuld auf sich genommen. Und die Jahre im Gefängnis. Man hatte nicht unbedingt davon ausgehen können, dass es so kommen würde, aber so war es gekommen. Wie lange war er so vermessen gewesen, zu glauben, dass sein Aufenthalt im Gefängnis nur vor über gehend und sogar von Vorteil sein würde? Vielleicht in den ersten Monaten. Dann blieben die Briefchen von seiner Tochter aus, seine Frau hörte auf, ihn zu besuchen, und die Flores waren wie vom Erdboden verschluckt. Außer dass sie dem Anwalt Geld zukommen ließen, damit der Aufenthalt in der Casita pünktlich bezahlt wurde, vergaßen sie ihn. Ein Pullover, den man im Lager einer Wäscherei zurücklässt und den niemand abholt, weil es einfacher ist, einen neuen zu kaufen, als extra wegen ihm noch einmal wiederzukommen. Es wurde bereits kühl. Er bedeckte sich mit einer staubigen Decke, die ihn, wie immer, anekelte, weil sie stank, obwohl sie frisch gewaschen war. In der Zelle war es generell kalt, zwar nicht übermäßig, aber eben andauernd, und das setzte ihm zu. Es fühlte sich fünf Grad kälter an, als ihm lieb war. Und nur die Mittagssonne, die er in den immer häufigeren Momenten der Verzweiflung auf dem Hof in sich aufsog wie ein Büschel Portulak, konnte ihn ein wenig wärmen. Dabei war die ursprüngliche Idee so einfach gewesen, sagte sich Blanco, während er sich die größte Mühe gab, sich nicht in den Fantasien zu verlieren, die er heraufbeschwor, wenn er alleine war: Indem er die Ver antwortung für den vermeintlichen Betrug in Olinka, einem Bauprojekt seines Schwiegervaters, auf sich nahm, würde das Verschwinden einiger Pächter vertuscht und die Familie Flores vor Strafverfolgung geschützt werden. Und ja, er würde ein paar Jahre im Gefängnis verbringen, aber nur, um den Schein zu wahren. Und als Gegenleistung würde er eine fantastische Entschädigung erhalten. Zwei Millionen jährlich, vier Mal so viel wie das, was er als Buchhalter des Familienbetriebs verdiente, dazu eine Villa auf seinen Namen in Olinka, sobald sie fertiggestellt sein würde. Das hatten sie vereinbart. Und sie würden ihm den besten Anwalt von Guadalajara zur Seite stellen und ihm eine monatliche Summe für alle entstehenden Kosten überweisen.
Doch die Flores hielten sich nicht an die Abmachungen. Keine renommierte Kanzlei wolle den Fall übernehmen, sagten sie, und so kam es, dass Blanco Piña in die Hände fiel, einem Freund seiner Schwester, den man in letzter Sekunde verpflichten konnte. Und Piña legte alle erdenklichen Rechtsmittel ein, wurde aber vor Gericht in der Luft zerrissen. Immerhin wurden ihm die monatlichen Gebühren überwiesen, aber ob die Entschädigung irgendwann einmal gezahlt werden würde, stand in den Sternen. Fünfzehn Jahre waren eine sehr lange Zeit, das wusste Blanco nur zu gut, und seine Forderung stieg ins Unermessliche. Immer wieder zählte er mithilfe seiner Finger die oft errechnete und aktualisierte Summe zusammen: Dreißig Millionen schuldeten sie ihm. Dreißig Millionen verdammte Pesos. Und niemand schien es eilig zu haben, sie zu bezahlen. In unzähligen schlaflosen Nächten hatte Blanco sich vorgestellt, was er mit dem Geld machen würde, wenn er es denn bekäme. Sein größter Wunsch, musste er erkennen, beschränkte sich auf bodenständige Dinge. Er gestand es sich nicht gerne ein. Mal dachte er an ein weißes Haus direkt am Meer, mal an eine Blockhütte hoch oben in den bewaldeten und, wenn möglich, schneebedeckten Bergen. Das waren nicht die Träume eines Häftlings, sondern die eines Angestellten. Doch immer stellte er sich vor, dass er mit seiner Tochter spielen würde. Das war absurd, denn Carlita würde bereits über zwanzig Jahre alt sein und ganz sicher nicht mit ihrem Vater spielen wollen. Und noch trauriger war es, wenn Blanco sich in seinen Fantasien vorstellte, Alicia würde zu ihm zurückkehren, seine Frau. Wenn er sich solch süßen Träumereien hingab, konnte ihn kein handfestes Argument davon abbringen. Aber zu mehr fehlte ihm, der mit jeder Woche, jedem Monat einsamer wurde, der Mut.
Er schloss die Augen und streckte sich auf der Pritsche aus, die, wie bei ihrem jämmerlichen Zustand nicht anders zu erwarten, mit einem Knarren antwortete. Die Einsamkeit war so sichtbar wie seine Hände, die er mindestens dreißig Mal am Tag anschaute, um sich zu vergewissern, dass es noch seine waren. Er war allein. Ein Kaktus. Ein Autoreifen im Straßengraben. Ein Ziegelstein ohne Haus drum herum. Alicia hatte ihn ein knappes Dutzend Mal besucht, aber nie in einem der für Eheleute vorgesehenen Räume. Gleich bei ihrer ersten Begegnung an einem Aluminiumtisch im großen Besuchersaal hatte sie klargestellt, dass es für sie nicht infrage komme, in einer Zelle mit einem Wärter vor der Tür zu vögeln, auch nicht mit dem Mann, mit dem sie durch das Gesetz verbunden war. Anfangs zumindest hatte sie verweinte Augen und sie wirkte niedergeschlagen, aber nach einigen Monaten, vor allem nachdem das Urteil gesprochen worden war – fünfzehn Jahre ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Kaution –, wurde deutlich, dass sie es satthatte. Carla, seine Tochter, ließen sie nicht ein einziges Mal zu ihm. Alicia brachte Blanco zwei oder drei Briefchen mit der ungelenken Handschrift des Mädchens, dann aber sorgte sie dafür, dass der Kontakt abbrach. Und als Blanco sie auf sein Recht aufmerksam machte, seine Tochter sehen zu dürfen, antwortete sie, dass Carlita darunter leide und es besser sei, sie von ihm fernzuhalten. Und auch sie selbst hielt sich fortan von ihm fern. »Kann dein Vater nicht etwas tun?«, fragte Blanco sie bei ihrem letzten Besuch, doch statt zu antworten, spuckte Alicia auf den Boden und sagte, sie werde seine Sachen in Kisten verpacken und er solle sie abholen lassen, wenn er wolle.
Er war also allein. Er rollte sich unter seiner Decke zusammen wie ein Wurm. Die Kälte schwächte ihn. Seine Widerstandsfähigkeit nahm im selben Maße ab, wie seine Haare silbern wurden. Jedes graue Härchen auf Blancos Unterarmen war ein weiterer vertrockneter Baum im Wald. Seine Schläfen grau meliert. Er erwischte sich dabei, wie er sich seiner Lieblingsfantasie hingab – Berg, Spiel, Familie –, und er wusste, dass seine Konzentration gleich wieder nachlassen würde. Ich lebe zwischen Mauern, und das Einzige, das mir noch bleibt, ist, zu fantasieren, sagte er sich resigniert. Doch es gelang ihm, sich an noch etwas anderes zu erinnern: das honorige Profil von Carlos Flores, dem Patriarchen der Familie, von dem Blanco ebenfalls nichts gehört hatte seit dem Tag, als er die Verantwortung für das Debakel von Olinka übernommen und anstelle seines Schwiegervaters ins Gefängnis gewandert war. »Er macht sich bestimmt in die Hose bei dem Gedanken, dass du ihm nur den Platz anwärmst«, hatte Piña zu ihm gesagt, bevor er gegangen war. »Don Carlos wird um keinen Preis in den Knast gehen. Eher lassen dich die Flores verschwinden oder machen dich fertig oder reißen dir die Haut in Streifen vom Leib. Darum musst du nachdenken. Denk darüber nach, Yeyo.
Denk nach.
Denk nach.«
Die Krankenstation roch nach Desinfektionsmitteln, doch bald bahnte sich der Gestank menschlicher Ausdünstungen den Weg in die Nase und überlagerte alles andere. Das Licht einer Straßenlaterne fiel in einem Winkel von fünfundvierzig Grad durch die halb hochgezogene Jalousie auf das Bett, in dem Marquitos lag. Eine ungeschickte Hand hatte darauf verzichtet, die Jalousie, die sich verklemmt hatte, wieder in Ordnung zu bringen. Laut dem Krankenpfleger machte die Gesundheit des Patienten Fortschritte. Er hatte nur eine Nacht Fieber gehabt, und als die Wirkung des Sedativums nachließ, erlangte Marquitos sein volles Bewusstsein wieder. Nach zwei Wochen ging es ihm schon so gut, dass er Blanco, der sich auf den Plastikstuhl neben seinem Bett setzte, den Kopf zuwenden und sich mit seiner Chamäleonzunge über die Lippen lecken konnte. Sein Magen rebelliere, und die Wunde brenne beim Trinken, erzählte Marquitos, darum ziehe er es vor, weiter am Tropf zu hängen und sich durch die Nadel im Unterarm Flüssigkeit zuführen zu lassen, anstatt zu trinken. Das Essen, das sie ihm servierten, Huhn mit Gemüse und weißer Soße, verursache ihm Brechreiz, doch da sei nichts zu machen: Der Arzt sei nicht bereit, einem Patienten eine Magensonde zu legen, wenn der es nicht unbedingt benötige, und das sei bei ihm nicht mehr der Fall. Die Haare hingen Marquitos in Strähnen herunter, und seine Schultern waren mit Schuppen übersät. Offenbar hatte ihn in der Woche, die er zur Genesung hier herumlag, niemand mit einem nassen Schwamm abgerieben, denn er stank. Blanco stellte sich dumm und wollte nichts von dem blutigen Vorfall hören, der Marquitos hergebracht hatte. Er wollte nicht, dass ihm jemand den Moment der Messerattacke in allen Einzelheiten schilderte. Er würde nur in Panik geraten, und seit man ihm eingeredet hatte, dass die Flores ihn möglicherweise lieber umbringen wollten, als ihn zu bezahlen, hatte er eine Heidenangst vor der Angst. Er bot dem Verletzten mit einer scherzhaften Geste eine Zigarette an, die dieser ablehnte, ohne zu merken, dass es ein Scherz sein sollte, ein Versuch, das Thema zu wechseln. Trotzig das Schild missachtend, das in Augenhöhe an der Wand hing, fing Blanco an zu rauchen. Normalerweise tat er das nicht vor den anderen, denn die Zigaretten waren seine einzige Freude hier drin und er wollte nicht von denjenigen angeschnorrt werden, die sich für ihr Geld lieber andere Freuden kauften – Frauen oder einen guten Fernseher. Sie entschieden sich für beides und kriegten das Beste ab, was Blanco unentschuldbar fand. Die können mich mal, dachte er. Und er setzte es in die Praxis um, indem er sich weigerte, mit ihnen zu teilen.
»Die wollten mich nur warnen, mehr nicht«, sagte Marquitos, nachdem er ein paar Mal gehustet hatte, ohne dass der Besucher Anstalten machte, die Zigarette auszudrücken. »Sie haben mich gewarnt und, na ja, jetzt bin ich im Arsch. Sie: meine Chefs.« »Du bist ihnen was schuldig, oder«, sagte Blanco vorsichtig. Der Verwundete leckte sich erneut über die Lippen, die immer wieder trocken wurden, rissig, wie eine ausgetrocknete Mauer. »Ich verdanke ihnen mein Scheißleben, Yeyo. Sie zahlen dafür, dass ich hierbleiben kann, einigermaßen in Sicherheit. Du weißt schon.« Ja, sie wussten es beide, die Casita stellte auf jeden Fall eine Erleichterung dar. Im restlichen Gefängnis war es gefährlicher. Wenn sie hörten, was in anderen Blöcken passierte, unter dem Kommando der jeweiligen Anführer, bekamen sie weiche Knie. »Und du hast ihnen nicht gehorcht, oder die haben noch eine andere Rechnung mit dir offen.« Marquitos schnaubte, aber er war nicht sauer. Er klang eher wie jemand, der tief Luft holt, bevor er ins Wasser springt. »Ich hab sie gebeten, Edith ein wenig Kohle zu geben, für das Haus. Die Scheißhypotheken fressen uns auf. Ich bin jetzt fünf Jahre hier drin, und sie hat getan, was sie konnte, hat die Autos verkauft und ihren Schmuck.« »Dann schulden sie dir also was.« »Nein, im Moment nicht. Wenn ich rauskomme, dann ja. Die Abmachung gilt für danach, wenn ich draußen bin, so ist es abgesprochen. Aber Edith braucht das Geld jetzt, und ich hab noch sechs Monate, alles in allem. Sechs verfluchte Monate. Wegen sechs verfluchten Monaten wollen sie mir das Haus wegnehmen. Leck mich doch am Arsch.«
Der Pfleger kam grußlos herein und fummelte am Tropf herum, um sich zu vergewissern, dass die Flüssigkeit in Marquitos’ Venen floss. Anschließend ging er aber nicht wieder hinaus, sondern lehnte sich gegen Blancos Rückenlehne und beugte sich zu ihm vor, als wollte er ihm etwas ins Ohr flüstern. Er war korpulent, sehr jung und sanft wie ein Haustier. Blanco spürte sein Becken im Nacken und rückte ärgerlich ab. Doch der Kerl blieb dort stehen und presste sein Gemächt gegen seinen Rücken, bis Blanco begriff und ihm die Schachtel und das orangefarbene, durchsichtige Feuerzeug hinhielt, beides Dinge, die im Gefängnis natürlich verboten waren und ihm eigentlich sofort hätten weggenommen werden müssen. Als Dankeschön bekam er nur einen Klaps auf die Schulter. Aber zumindest hatte er erreicht, dass der Pfleger sich entfernte. Sogar in der friedlichen Casita musste für jede Annehmlichkeit prompt bezahlt werden. »Und, hat Piña dir was erzählt?« Marquitos schnaubte wieder, als er den Namen des Anwalts hörte. Diesmal war es ein sarkastisches Pusten. »Dieser Arsch… Er will ihnen sagen, dass sie sich beruhigen sollen. Mal sehen, vielleicht kann er ihnen etwas Kohle für Edith abschwatzen, zumindest für die Zinsen.« »Ist schon heftig, dass sie dir einen Messerstecher geschickt haben«, bemerkte Blanco. »Nein, Alter, nicht wirklich. Ich hab Scheiße gebaut. Hab ihnen durch Edith ausrichten lassen, dass ich sie reinreiten werde, wenn sie nichts rausrücken. Und zwar so richtig: mit dem Bluff um die Grundstücke in Lomas del Roble, den Namen ihrer verdammten Investoren, mit allem. Damit kriegen sie sie dran, ihre Investoren haben nämlich keine Genehmigung, hier Geld zu investieren. Die kommen von außerhalb und dürften sich gar nicht in der Stadt aufhalten. Sie gehören zu einer anderen Bande, und das wissen sie. Aber ich hab’s vergeigt, weil, so läuft das nicht. Hätte sie bitten müssen, aber ich wollte sie unter Druck setzen. Deswegen die Attacke. Und im Grunde bin ich billig davongekommen. Sie hätten mich leicht kaltmachen können, und Edith gleich mit.« »Nein, auch das wird sie teuer zu stehen kommen«, widersprach Blanco, denn er begriff zwar, in welcher Lage sich Marquitos befand, gab aber die Hoffnung auf die Abmachungen, die man jeweils mit ihnen getroffen hatte, nicht auf. »Sie können es sich nicht erlauben, überall Leichen zu hinterlassen, so viel Aufmerksamkeit können sie nicht gebrauchen.« Marquitos biss sich unwillkürlich auf die Unterlippe, ließ es aber sogleich wieder: Die Lippen taten ihm weh, sie waren rissig und dünn wie Zigarettenpapier, am Ende würden sich noch Geschwüre bilden. »Die können machen, was ihnen in den Kram passt. Und lieber ist mir der Ärger mit Edith, wenn sie uns das Haus wegnehmen, als dass die Chefs uns fertigmachen.« Blanco seufzte. Er konnte die Überlegungen nachvollziehen. »Aber mit ihr verstehst du dich gut, oder?« »Mit Edith? Klar, sie liebt mich. Ich wenigstens komm zum Vögeln, Alter«, sagte der Patient mit einem erstickten Lachen, was Blanco wie ein Schlag ins Gesicht traf. Es gab nur eine Möglichkeit, wie der Verwundete von seiner Enthaltsamkeit hatte erfahren können, und zwar von Piña, ihrem gemeinsamen Anwalt. Und wenn Marquitos es wusste, dann wusste es wahrscheinlich das ganze Gefängnis.
Sie wechselten das Thema, weil auf dem Korridor Schritte zu hören waren. Der Krankenpfleger kam zurück, diesmal mit Marquitos’ Frau am Arm. Sie lachten über irgendetwas Lustiges, das sie sich zugeflüstert hatten, und schwiegen, als sie das Zimmer betraten. Wie immer, wenn Blanco Edith sah, lief ihm vor Neid das Wasser im Mund zusammen. Sie hatte ein breites Gesicht und eine dunkle Haut, und immer trug sie ein eng anliegendes Kleid, das ihre Rundungen betonte. Sie ließ keinen der wöchentlichen Besuchstermine für Ehepaare aus und verlor, zumindest vor Fremden, keine Zeit mit Beschwerden: Sie fiel ihrem Mann um den Hals, sobald sie ihn sah. Ihre Anwesenheit war für Blanco wie ein unbeabsichtigter Vorwurf. Seit dem Abend, an dem er ins Gefängnis gegangen war, hatte Alicia, seine Ex, ihn nicht mehr angerührt, und nach ein paar Monaten hatte sie die Scheidung von ihm verlangt. Marquitos hatte seine Liebe, er dagegen nichts als die Erinnerung an eine Katastrophe. Blanco verabschiedete sich, damit sie sich in Ruhe abschlecken und küssen konnten. Er ging mit dem Pfleger hinaus. Bevor dieser sich entfernte, hielt er Blanco mit einer beinahe zärtlichen Geste an der Schulter zurück. »Noch eine Zigarette, Kumpel?« Es war die vorletzte in der Schachtel, und er überließ sie ihm besser ganz. Er wartete, bis der Pfleger das Feuerzeug benutzt hatte, um es zurückzuverlangen. Es war neu und wurde ihm hier drin vier Mal so teuer wie draußen verkauft. Er würde es ihm nicht einfach so schenken.
Wer warnt, ist kein Verräter, sagte Piña, der Redewendungen liebte. Und Blanco musste lachen, denn die Flores hatten ihn bis jetzt noch nicht gewarnt. Marquitos zumindest hatte seine Strafe und damit die Gelegenheit bekommen, zu bereuen. An dem Tag, an dem man mir ein Messer schickt, wird man mich gleich umbringen. Das dachte er. Den restlichen Weg zu seiner Zelle legte er in Gedanken versunken zurück.
»Der Richter wird nach den Feiertagen an der Bandscheibe operiert und hat vorgearbeitet. Im Ernst. Man hat uns gestern Abend informiert, aber Piña ist nach Anaheim geflogen und wird dort die Feiertage verbringen. Weihnachten fällt auf einen Sonntag, nicht wahr? Morgen, Freitag, beginnen die Gerichtsferien. Deswegen also heute. Wir kommen heute raus. Es blieb keine Zeit mehr, irgendetwas daran zu ändern, also bin ich hergekommen, um dir behilflich zu sein.« Mit diesen Worten teilte Estrella Paredes Blanco mit, dass er einen Monat früher als vorgesehen aus der Haft entlassen wurde. Piña hatte seine Angestellte im Laufe der Jahre immer dann geschickt, wenn er selbst keine Lust hatte, den Weg ins Gefängnis auf sich zu nehmen. Oder nichts Dringenderes auf den verdammten Tisch legen konnte als ein Papier, das zu unterschreiben war, oder eine der »Annehmlichkeiten«, die die monatlichen Zahlungen der Flores ermöglichten, wie zum Beispiel Zigaretten oder Kaffee. Estrella redete so schnell, dass Blanco ihr kaum folgen konnte. Sie war eine hübsche, unauffällige Frau von weit über dreißig Jahren. Ihr blond gefärbtes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trug ein Kostüm (der Rock war für die antiquierten Ansichten des Häftlings immer zu kurz) und war dezent geschminkt. Sie roch nach Seife. Sie war professionell. Er hatte zu viel Zeit fern von Frauen verbracht, und so hatte er sich von Besuch zu Besuch mehr für die Anwältin selbst als für das interessiert, was sie zu sagen hatte. Diesmal jedoch war die Situation eine andere, und er wusste, dass er etwas dazu sagen musste. Er schloss die Augen, und ihm wurde schwindlig. Er hatte einen bitteren Geschmack im Mund und spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Atme, verdammt noch mal, atme, ermahnte er sich.
»Hier der Stapel Dokumente, die du unterschreiben musst«, unterbrach sie seine Gedanken. »Ich nehme an, dass sie dir einen Karton für deine Sachen geben werden. Ich muss noch darauf warten, dass sie alles abstempeln und ins System eingeben, aber die Entlassungspapiere sind fertig und unterschrieben. Am besten suchst du jetzt deine Sachen zusammen.« Die Anwältin gab ihm Anweisungen, während sie ihr Handy konsultierte und dann mit spitzen Fingernägeln auf ihr Display tippte. Sie sah nicht das verstörte Gesicht Blancos, der die Hand zum Mund geführt hatte und mit Zeigefinger und Daumen die Lippen zu einer Schnute zusammenschob wie ein kleiner Junge. Trotz Piñas eindringlicher Aufforderung, nachzudenken, hatte Blanco den Moment hinausgezögert, sich die ersten Schritte nach seiner Entlassung zu überlegen, und jetzt hatte er nicht die geringste Ahnung, was er tun sollte. Auf der Pritsche in seiner Zelle hatte er geträumt und fantasiert, hatte sich alle möglichen Szenarien ausgemalt und die wichtigen Entscheidungen auf die Zeit nach Weihnachten verschoben. Doch bis dahin waren es noch drei Tage, und das Gefängnis wollte ihn vorzeitig loswerden. Er fühlte sich so verloren, als wäre es der Tag seiner Geburt.
»Wie lange kann das dauern? Tage?« Blanco wollte sich lieber an die Möglichkeit klammern, dass es sich um einen Irrtum handelte, und stellte die Frage in der Hoffnung, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Die Anwältin lächelte ihn an, vielleicht gerührt. »Nein, nicht mal zwei Stunden. Der Richter muss wohl Druck gemacht haben in den Büros, denn es ist alles fertig. Deine Akten, das Entlassungsurteil, die unterschriebenen Papiere, die Formulare. Hat Anwalt Piña dir nichts gesagt?« »Na ja, dass ich mich bereithalten soll, aber ich hab nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde.« »Na, und dann?« Estrella fragte Blanco aus, ohne sich über seine Verwirrung lustig zu machen. Sie stand mit verschränkten Armen da, ein schwaches Lächeln um den Mund, auf dem Gesicht einen Ausdruck von Geduld, den sie in all den Jahren immer aufgesetzt hatte, wenn Piña sie bat, ins Gefängnis zu gehen und die Unterschrift des Mandanten für irgendein Schriftstück einzuholen oder ihm neue Informationen über seinen Prozess mitzuteilen. Oder ihm zu versichern, dass die Kanzlei ihn nicht im Stich lassen werde, solange die Anwaltskosten beglichen würden. Obwohl Blanco die Anwältin attraktiv fand, ärgerte er sich immer über ihr Auftauchen, weil er wusste, dass es nur um Routineangelegenheiten ging und nicht um die Hauptsache. Sie zu sehen hieß normalerweise, dass es keine Neuigkeiten gab. Doch jetzt brachen die Neuigkeiten über ihn herein wie ein Hagelsturm, und er fand nicht die Kraft, Estrella seine Sorgen anzuvertrauen, die in seinem Kopf schwirrten und von Sekunde zu Sekunde höher stiegen. »Wenn du willst, fülle ich die Formulare aus, während du deine Sachen in eine Kiste packst«, schlug sie vor. »Ich bringe dich in die Stadt, aber ich kann nicht den ganzen Morgen hierbleiben. Im Büro wartet noch Arbeit auf uns, und später habe ich ein Essen mit der Familie. Ab morgen ist Weihnachten!« Es war weniger ein Angebot als die Bekanntgabe der Tagesordnung. Blanco hatte weder Kleidung noch Geld, Handy oder andere Dinge, die nötig waren, um wie ein normaler Mensch draußen herumzulaufen. Er musste gehorchen. Linkisch erhob er sich von dem Aluminiumtisch, den er beinahe umstieß, nickte wie ein Golem und eilte fort, um zu tun, was ihm aufgetragen worden war. Er war blass. Sein Gehirn arbeitete nicht. Trotz der fünfzehn Jahre Erfahrung bog er im Gewirr der Flure falsch ab und musste einen Umweg machen, um in seine Zelle zu gelangen. Die Wärter, die ihm entgegenkamen, grüßten ihn, ohne zu wissen, dass der Mann, der hier herumstolperte, kurz davorstand, ihrem Einflussbereich zu entkommen.
Auf der oberen Pritsche lag sein Zellennachbar. Er war damit beschäftigt, mit seinen wulstigen, aber geschickten Fingern eine Weihnachtsgirlande zu basteln. Blanco blieb wie angewurzelt stehen, als er sah, dass man eine Kiste aus verstärktem Karton auf die untere Pritsche gestellt hatte. Er schaute hinein, als enthielte sie etwas Bedrohliches. Eine Hand, einen Finger, seinen eigenen Kopf. »Du wirst vorzeitig entlassen«, sagte der Dicke. »Ein Wärter hat den Karton vor fünf Minuten gebracht und mir erzählt, dass du uns verlässt.« Er hob den Blick nicht von seiner Girlande, schien aber gekränkt zu sein, so als hätte Blanco vor der entscheidenden Schlacht die gemeinsame Sache verraten. »Und, bist du jetzt glücklich? Wie man hört, wollten sie dich schon vor dreizehn Jahren oder mehr rausholen, stimmt’s? Das heißt, sie haben sich endlich an dich erinnert.« Blanco fühlte sich gedemütigt und wusste nicht, was er antworten sollte. Dem Dicken rann ein Schweißtropfen über die Schläfe. Trotz seiner Stichelei schien er vollkommen in seine Bastelarbeit vertieft zu sein. Er biss sich auf die Zungenspitze. »Ich wusste nichts davon«, antwortete Blanco schließlich. »Angeblich soll der Richter operiert werden, darum musste er das Verfahren vorziehen…« Noch ehe ihm klar wurde, dass es Schwachsinn war, dem Dicken Erklärungen abzugeben, begann Blanco, seine Habseligkeiten in der Kiste zu verstauen. Die Kochplatte. Das Glas mit dem Kaffee. Zwei Schachteln Zigaretten und das orangefarbene, durchsichtige Feuerzeug. Auch den Bleistift mit der stumpfen Spitze, dessen Besitz und Gebrauch ihm erlaubt waren. Das Notizbuch, in dem er im Laufe der Jahre seine Überlegungen festgehalten und kleine Zeichnungen angefertigt hatte. Ein gerahmtes Bild von Carlita, seiner kleinen Tochter. Ein weiteres, ziemlich verschlissenes von Alicia am Tag vor ihrer Hochzeit, charmant lächelnd. Die Kiste wurde natürlich nicht voll, höchstens zu einem Drittel. Er ließ sie dort stehen, so als könnte im nächsten Moment ein Dienstmann kommen und ihm anbieten, sie zum Ausgang zu bringen. Weil das aber nicht geschehen würde, hob er sie schließlich auf und ging zögernd zur vergitterten Tür, bevor der Dicke sich unwirsch zu ihm umdrehte. »Nicht mal eine Umarmung, nicht mal ein Küsschen. Du fühlst dich superwichtig, weil du gehst. Was soll’s, dir ist ja alles egal. Nicht mal vögeln tust du.« Die letzten Worte stieß er genüsslich hervor. Blanco zwang sich, nicht stehen zu bleiben, und beschleunigte seine Schritte, während sein Nachbar leise loslachte und an den roten Enden seiner Girlande zog, die jetzt fertig war und die Aufschrift »Fröhliche Weihnachten« trug. »Nicht mal ein Küsschen.« Das Lachen erstarb, hallte aber in Blancos Ohren nach. Der Dicke ekelte ihn an. Er hatte ihn nie mit einem Mann oder einer Frau oder sonst jemandem zusammen gesehen, nur gehört, wie er sich jede Nacht auf seiner Pritsche hin und her gewälzt und wie ein Teekessel geschnauft hatte. Sogar dieses dicke Arschloch lacht über dich, dachte er. Und wieder verfluchte er den Augenblick der Schwäche, in dem er Piña von seiner Enthaltsamkeit erzählt hatte.
Im Besucherraum saß Marquitos am Nebentisch von Estrella, die mit tausend Formularen auf Blancos Unterschrift wartete. Deprimiert, abgemagert, halb genesen von der Messerattacke von vor ein paar Wochen, ließ er sich von seiner Frau Edith trösten, die wie immer frisch gebadet und zum Anbeißen aussah. Blanco schüttelte unwillig den Kopf. Er hasste es, dass die Begierde, die in ihm brannte, ihn dazu brachte, alle Frauen appetitlich zu finden. Er wollte nicht begehren. Er wollte nur zurück in seine Zelle und sich auf die Pritsche werfen, wollte die Rückenschmerzen spüren und auf diese Weise Weihnachten verbringen. Nicht nachdenken, sondern sich in Fantasien verlieren. Am Weihnachtsabend, hatte man ihm gesagt, würde es Schweinefilets in Salzkruste geben, eines seiner Lieblingsessen. Er hätte die fünf oder sechs Tequilas getrunken, zu denen ihn die anderen Häftlinge oder ein gerührter, betrunkener Wärter eingeladen hätten, und noch vor Mitternacht wäre er eingeschlafen, den Kopf voller leichter und bekannter Träume. Das Meer, die Berge, Alicia, sein Töchterchen. Er wollte Marquitos fragen, was ihm diesmal zugestoßen war, doch er ahnte es und zog es vor, sich ihm nicht zu nähern. Keinen Schritt. Seine Chefs werden sich weiß Gott welche Demütigungen für ihn ausgedacht haben, um nicht gleich endgültig mit ihm abzurechnen oder sich die Frau vorzunehmen, dachte er. Trotz ihrer verdammten Abmachung. Und was haben sich die Flores für mich ausgedacht? Einen Tritt in den Hintern, wenn ich Glück habe. Das dachte er. Er stellte den Karton mit seinen Sachen auf den Boden, wischte sich die schwitzenden Hände an der Hose ab und setzte sich auf den freien Stuhl an Estrellas Aluminiumtisch, um seine Unterschrift unter die unzähligen Dokumente zu setzen.
Am Abend seiner Verhaftung, erinnerte sich Blanco, wurde ein Gefängniswagen mit Blaulicht zu Piñas Kanzlei geschickt, um ihn abzuholen. Weder wurden besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen, noch war Blanco, aufgrund seiner Abmachung mit den Flores und der Übereinkunft der Flores mit den Behörden, in Untersuchungshaft genommen worden. Während der Fahrt ins Gefängnis saß Blanco auf dem Rücksitz. Rechts und links neben ihn hatte man je einen Polizeibeamten gesetzt, beide so fett wie Schweine, die zum Schlachten geführt werden. Sie stanken nach Schweiß und nach etwas noch Schärferem, Säuerlicherem, vielleicht Urin, eine Geruchsnote, die sich in den Polizisten eingenistet hatte. Kaum waren sie losgefahren, bot ihm einer von ihnen eine Mentholzigarette an, die nach Scheiße schmeckte. Irgendwann, nach einer lang gezogenen