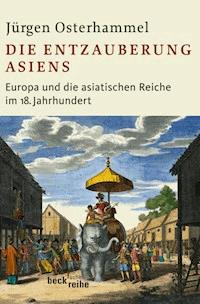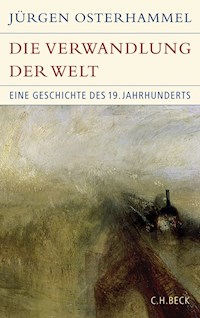
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Mit dem 19. Jahrhundert beginnt die Vorgeschichte der Gegenwart. Es war das Zeitalter der großen politischen Ideologien und der Verwissenschaftlichung des Daseins, der Eisenbahn und der Industrie, der Massenemigration zwischen den Kontinenten und der ersten Welle wirtschaftlicher und kommunikativer Globalisierung, des Nationalismus und der imperialen Expansion Europas in alle Teile der Erde. Zugleich ist das 19. Jahrhundert aus heutiger Sicht fern und fremd geworden: eine faszinierende Welt von gestern. Dieses Buch porträtiert und analysiert die Epoche in weltgeschichtlicher Sicht: als eine Zeit dramatischer Umbrüche in Europa, Asien, Afrika und Amerika und als eine Ära entstehender Globalität.
Jürgen Osterhammel erzählt kundig und facettenreich die Geschichte einer Welt im Umbruch. Aus einer Fülle an Material und einer Vielzahl unterschiedlicher Blickwinkel entsteht das Porträt einer faszinierenden Epoche. Osterhammel fragt nach Strukturen und Mustern, markiert Zäsuren und Kontinuitäten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Seine kulturübergreifenden, thematisch aufgefächerten Darstellungen und Analysen verbinden sich dabei zu einem kühnen Geschichtspanorama, das nicht nur traditionelle eurozentrische Ansätze weit hinter sich lässt, sondern auch erheblich mehr bietet als die gängigen historiographischen Paradigmen wie Industrialisierung oder Kolonialismus. Die Herausbildung unterschiedlicher Wissensgesellschaften, das Verhältnis Mensch- Natur oder der Umgang mit Krankheit und Andersartigkeit kommen darin ebenso zur Sprache wie Besonderheiten der Urbanisierung, verschiedene Formen von Bürgerlichkeit oder die Gegensätze von Migration und Sesshaftigkeit, Anpassung und Revolte, Säkularisierung und Religiosität. Zugleich stellt Osterhammel immer wieder Bezüge zur Gegenwart her. Auf der Höhe der Forschung, engagiert geschrieben und zugleich wohltuend unideologisch, ist sein Werk nicht nur ein Handbuch für jeden Historiker. Seine plastischen Schilderungen ziehen auch den interessierten Laien in den Bann eines Jahrhunderts, dessen Bedeutung in dieser welthistorisch angelegten Epochengeschichte ganz neu ausgelotet wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Historische Bibliothek der GERDA HENKEL STIFTUNG
Die Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung wurde gemeinsam mit dem Verlag C.H.Beck gegründet. Ihr Ziel ist es, ausgewiesenen Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, grundlegende Erkenntnisse aus dem Bereich der Historischen Geisteswissenschaften einer interessierten Öffentlichkeit näherzubringen. Die Stiftung unterstreicht damit ihr Anliegen, herausragende geisteswissenschaftliche Forschungsleistungen zu fördern – in diesem Fall in Form eines Buches, das höchsten Ansprüchen genügt und eine große Leserschaft findet.
Bereits erschienen:
Hermann Parzinger: Die frühen Völker Eurasiens
Roderich Ptak: Die maritime Seidenstraße
Hugh Barr Nisbet: Lessing
Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt
Werner Busch: Das unklassische Bild
Bernd Stöver: Zuflucht DDR
Christian Marek/Peter Frei: Geschichte Kleinasiens in der Antike
Jörg Fisch: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker
Willibald Sauerländer: Der katholische Rubens
Manfred Hildermeier: Geschichte Russlands
Stefan M. Maul: Die Wahrsagekunst im Alten Orient
Friedrich Lenger: Metropolen der Moderne
Heinz Halm: Anti-Judaismus
David Nirenberg: Anti-Judaismus
Wolfgang Reinhard: Die Unterwerfung der Welt
Werner Plumpe: Carl Duisberg
Jörg Rüpke: Pantheon
Manfred Hildermeier: Geschichte der Sowjetunion 1917–1991
Bernd Roeck: Der Morgen der Welt
Hartmut Leppin: Die frühen Christen
Frank Rexroth: Fröhliche Scholastik
Dieter Langewiesche: Der gewaltsame Lehrer
Mischa Meier: Geschichte der Völkerwanderung
Jill Lepore: Diese Wahrheiten
Jürgen Osterhammel
Die Verwandlung der Welt
Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts
C.H.Beck
Zum Buch
Mit dem 19. Jahrhundert beginnt die Vorgeschichte der Gegenwart. Es war das Zeitalter der großen politischen Ideologien und der Verwissenschaftlichung des Daseins, der Eisenbahn und der Industrie, der Massenemigration zwischen den Kontinenten und der ersten Welle wirtschaftlicher und kommunikativer Globalisierung, des Nationalismus und der imperialen Expansion Europas in alle Teile der Erde. Zugleich ist das 19. Jahrhundert aus heutiger Sicht fern und fremd geworden: eine faszinierende Welt von gestern. Dieses Buch porträtiert und analysiert die Epoche in weltgeschichtlicher Sicht: als eine Zeit dramatischer Umbrüche in Europa, Asien, Afrika und Amerika und als eine Ära entstehender Globalität.
Jürgen Osterhammel erzählt kundig und facettenreich die Geschichte einer Welt im Umbruch. Aus einer Fülle an Material und einer Vielzahl unterschiedlicher Blickwinkel entsteht das Porträt einer faszinierenden Epoche. Osterhammel fragt nach Strukturen und Mustern, markiert Zäsuren und Kontinuitäten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Seine kulturübergreifenden, thematisch aufgefächerten Darstellungen und Analysen verbinden sich dabei zu einem kühnen Geschichtspanorama, das nicht nur traditionelle eurozentrische Ansätze weit hinter sich lässt, sondern auch erheblich mehr bietet als die gängigen historiographischen Paradigmen wie Industrialisierung oder Kolonialismus. Die Herausbildung unterschiedlicher Wissensgesellschaften, das Verhältnis Mensch- Natur oder der Umgang mit Krankheit und Andersartigkeit kommen darin ebenso zur Sprache wie Besonderheiten der Urbanisierung, verschiedene Formen von Bürgerlichkeit oder die Gegensätze von Migration und Sesshaftigkeit, Anpassung und Revolte, Säkularisierung und Religiosität. Zugleich stellt Osterhammel immer wieder Bezüge zur Gegenwart her. Auf der Höhe der Forschung, engagiert geschrieben und zugleich wohltuend unideologisch, ist sein Werk nicht nur ein Handbuch für jeden Historiker. Seine plastischen Schilderungen ziehen auch den interessierten Laien in den Bann eines Jahrhunderts, dessen Bedeutung in dieser welthistorisch angelegten Epochengeschichte ganz neu ausgelotet wird.
Über den Autor
Jürgen Osterhammel war bis 2018 Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Konstanz. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur europäischen und asiatischen Geschichte seit dem 18. Jahrhundert. Für seine Arbeiten wurde er u.a. mit dem Gerda Henkel Preis und dem Balzan Preis ausgezeichnet.
Meinem Sohn
Philipp Dabringhaus gewidmet
| Inhalt
|
Einleitung
|
ANNÄHERUNGEN
I
|
Gedächtnis und Selbstbeobachtung:
Die mediale Verewigung des 19. Jahrhunderts
1
|
Sichtbarkeit und Hörbarkeit
2
|
Erinnerungshorte, Wissensschätze, Speichermedien
3
|
Beschreibung, Reportage, «Realismus»
4
|
Statistik
5
|
Nachrichten
6
|
Photographie
II
|
Zeit:
Wann war das 19. Jahrhundert?
1
|
Chronologie und Epochencharakter
2
|
Kalender und Periodisierung
3
|
Zäsuren und Übergänge
4
|
Sattelzeit – Viktorianismus –
Fin de Siècle
5
|
Uhr und Beschleunigung
III
|
Raum:
Wo liegt das 19. Jahrhundert?
1
|
Raum/Zeit
2
|
Metageographie: Die Namen der Räume
3
|
«Mental maps»: Die Relativität von Raumvisionen
4
|
Interaktionsräume: Land und Meer
5
|
Raumordnungen: Macht und Raum
6
|
Territorialität, Diaspora, Grenze
|
PANORAMEN
IV
|
Sesshafte und Mobile
1
|
Größenordnungen und Tendenzen
2
|
Demographische Katastrophen und demographischer Übergang
3
|
Das Erbe frühneuzeitlicher Fernmigrationen: Kreolen und Sklaven
4
|
Strafkolonie und Exil
5
|
Massenfluchten und ethnische Säuberungen
6
|
Interne Wanderungen und die Transformationen des Sklavenhandels
7
|
Migration und Kapitalismus
8
|
Globale Motive
V
|
Lebensstandards:
Risiken und Sicherheiten materieller Existenz
1
|
«Lebensstandard» und «Qualität des Lebens»
2
|
Lebensverlängerung und «Homo hygienicus»
3
|
Seuchenangst und Prävention
4
|
Mobile Gefahren, alt und neu
5
|
Naturkatastrophen
6
|
Hunger
7
|
Revolutionen der Landwirtschaft
8
|
Armut und Reichtum
9
|
Globalisierter Konsum
VI
|
Städte:
Europäische Muster und weltweiter Eigensinn
1
|
Die Stadt als Normalität und Ausnahme
2
|
Urbanisierung und städtische Systeme
3
|
Zwischen De-Urbanisierung und Superwachstum
4
|
Spezielle Städte, allgemeine Städte
5
|
Die goldene Zeit der Hafenstädte
6
|
Kolonialstädte, «Treaty ports», imperiale Metropolen
7
|
Binnenräume und Untergründe
8
|
Symbolik, Ästhetik, Planung
VII
|
Frontiers:
Unterwerfung des Raumes und Angriff auf nomadisches Leben
1
|
Invasionen und Frontier-Prozesse
2
|
«Wilder Westen» in Nordamerika
3
|
Südamerika und Südafrika
4
|
Eurasien
5
|
Siedlungskolonialismus
6
|
Natureroberung: Invasionen der Biosphäre
VIII
|
Imperien und Nationalstaaten:
Die Beharrungskraft der Reiche
1
|
Tendenzen: Großmachtdiplomatie und imperiale Expansion
2
|
Wege zum Nationalstaat
3
|
Imperien: Was sie zusammenhält
4
|
Imperien: Typen und Vergleiche
5
|
Imperien: Fälle und Grenzfälle
6
|
Pax Britannica
7
|
Imperien: Wie man darin lebt
IX
|
Mächtesysteme, Kriege, Internationalismen:
Zwischen zwei Weltkriegen
1
|
Der kurvenreiche Weg zum Weltstaatensystem
2
|
Ordnungsräume
3
|
Kriege: Friedliches Europa, friedloses Asien und Afrika
4
|
Diplomatie: Politisches Instrument und interkulturelle Kunst
5
|
Internationalismen und normative Universalisierung
X
|
Revolutionen:
Von Philadelphia über Nanjing nach St. Petersburg
1
|
Revolutionen – von unten, von oben und woher sonst?
2
|
Der revolutionäre Atlantik
3
|
Die Konvulsionen der Jahrhundertmitte
4
|
Eurasische Revolutionen nach 1900
XI
|
Staat:
«Minimal government», Herrscherpomp und «Hörigkeit der Zukunft»
1
|
Ordnung und Kommunikation: Der Staat und das Politische
2
|
Neuerfindungen der Monarchie
3
|
Demokratie
4
|
Verwaltung
5
|
Mobilisierung und Disziplinierung
6
|
Selbststärkung: Politik aus der peripheren Defensive
7
|
Staat und Nationalismus
|
THEMEN
XII
|
Energie und Industrie:
Wer entfesselte wann und wo Prometheus?
1
|
Industrialisierung
2
|
Energieregime: Das Jahrhundert der Kohle
3
|
Pfade wirtschaftlicher (Nicht-)Entwicklung
4
|
Kapitalismus
XIII
|
Arbeit:
Die physischen Grundlagen der Kultur
1
|
Vom Gewicht der Landarbeit
2
|
Orte der Arbeit: Fabrik, Baustelle, Kontor
3
|
Pfade der Emanzipation in der Arbeitswelt: Sklaven, Leibeigene, befreite Bauern
4
|
Die Asymmetrie der Lohnarbeit
XIV
|
Netze:
Reichweite, Dichte, Löcher
1
|
Verkehr und Kommunikation
2
|
Handel
3
|
Geld und Finanzen
XV
|
Hierarchien:
Vertikalen im sozialen Raum
1
|
Eine globale Sozialgeschichte?
2
|
Aristokratien im (gebremsten) Niedergang
3
|
Bürger und Quasi-Bürger
XVI
|
Wissen:
Vermehrung, Verdichtung, Verteilung
1
|
Welt-Sprachen: Großräume der Kommunikation
2
|
Alphabetisierung und Verschulung
3
|
Die Universität als europäischer Kulturexport
4
|
Wissensmobilität und Übersetzung
5
|
Humanwissenschaften vom Eigenen und vom Fremden
XVII
|
«
Zivilisierung» und Ausgrenzung
1
|
Die «zivilisierte Welt» und ihre «Mission»
2
|
Sklavenemanzipation und «Weiße Vorherrschaft»
3
|
Fremdenabwehr und «Rassenkampf»
4
|
Antisemitismus
XVIII
|
Religion
1
|
Begriffe und Bedingungen des Religiösen
2
|
Säkularisierungen
3
|
Religion und Imperium
4
|
Reform und Erneuerung]
|
Schluss:
Das 19. Jahrhundert in der Geschichte
ANHANG
|
Nachwort
|
Abkürzungen
|
Anmerkungen
|
Verzeichnis der zitierten Literatur
|
Register
|
Personenregister
|
Ortsregister
|
Sachregister
| Einleitung
Alle Geschichte neigt dazu, Weltgeschichte zu sein. Soziologische Theorien der Weltgesellschaft sagen uns, die Welt sei die «Umwelt aller Umwelten», der letzte mögliche Kontext allen historischen Geschehens und seiner Darstellung. Die Tendenz zur Überschreitung des Örtlichen nimmt im langfristigen Verlauf der historischen Entwicklung zu. Eine Weltgeschichte des Neolithikums könnte noch nicht von intensiven Fernkontakten berichten, eine solche des 20. Jahrhunderts findet die Grundtatsache eines dicht gesponnenen planetarischen Netzes von Verbindungen bereits vor, eines «human web», wie John R. und William H. McNeill es genannt haben, oder besser noch: einer Vielzahl solcher Netze.[1]
Weltgeschichte wird dann für den Historiker besonders gut legitimierbar, wenn sie an das Bewusstsein der Menschen in der Vergangenheit anschließen kann. Selbst heute, im Zeitalter von Satellitenkommunikation und Internet, leben Milliarden in engen, lokalen Verhältnissen, denen sie weder real noch mental entkommen können. Nur privilegierte Minderheiten denken und agieren «global». Doch schon im 19. Jahrhundert, oft und mit Recht als das Jahrhundert des Nationalismus und der Nationalstaaten bezeichnet, entdecken nicht erst heutige Historiker, auf der Suche nach frühen Spuren von «Globalisierung», Handlungszusammenhänge der Überschreitung: transnational, transkontinental, transkulturell. Bereits vielen Zeitgenossen erschienen erweiterte Horizonte des Denkens und Handelns als eine besondere Signatur ihrer Epoche. Angehörige europäischer und asiatischer Mittel- und Unterschichten richteten Blicke und Hoffnungen auf gelobte Länder in weiter Ferne. Viele Millionen scheuten Fahrten ins Ungewisse nicht. Staatsführer und Militärs lernten in Kategorien von «Weltpolitik» zu denken. Das erste wahre Welt-Reich der Geschichte, das nun auch Australien und Neuseeland umfasste, entstand: das British Empire. Andere Imperien maßen sich ehrgeizig am britischen Muster. Handel und Finanzen verdichteten sich noch stärker als in den Jahrhunderten der frühen Neuzeit zu einem integrierten Weltsystem. Um 1910 wurden wirtschaftliche Veränderungen in Johannesburg, Buenos Aires oder Tokyo unverzüglich in Hamburg, London oder New York registriert. Wissenschaftler sammelten Informationen und Objekte in aller Welt; sie studierten die Sprachen, Bräuche und Religionen entlegenster Völker. Die Kritiker der herrschenden Weltordnung begannen sich ebenfalls auf internationaler Ebene – oft weit über Europa hinaus – zu organisieren: Arbeiter, Frauen, Friedensaktivisten, Anti-Rassisten, Gegner des Kolonialismus. Das 19. Jahrhundert reflektierte seine eigene werdende Globalität.
Jede andere Geschichte als Weltgeschichte ist für jüngere Epochen – und gerade für das 19. Jahrhundert – nichts als ein Notbehelf. Mit solchen Notbehelfen hat sich freilich die Geschichtsschreibung zur Wissenschaft gebildet; Wissenschaft nach den Maßstäben einer überprüfbaren Rationalität ihrer Verfahren ist sie durch das intensive und im Rahmen des Machbaren erschöpfende Studium von Quellen geworden. Dies geschah im 19. Jahrhundert, und deshalb überrascht es nicht, dass Weltgeschichtsschreibung in eben dieser Epoche in den Hintergrund trat. Sie schien mit dem neuen professionellen Selbstverständnis der Historiker nicht vereinbar zu sein. Wenn sich das heute zu ändern beginnt, dann bedeutet dies keineswegs, dass alle Historiker Welthistoriker werden wollen oder werden sollten.[2] Geschichtswissenschaft verlangt das intensive, in die Tiefe bohrende Studium umgrenzbarer Fälle. Das Ergebnis solchen Studiums wird immer wieder den Stoff für umfassende Synthesen bilden. Der übliche Rahmen für solche Synthesen ist, jedenfalls für die Neuzeit, die Geschichte einer einzelnen Nation oder eines Nationalstaates, vielleicht auch eines ganzen Kontinents, etwa Europas. Weltgeschichte bleibt eine Minderheitsperspektive, aber eine, die sich nicht länger als abseitig oder unseriös beiseite schieben lässt. Die fundamentalen Fragen sind freilich auf allen räumlichen und logischen Ebenen dieselben: «Wie verbindet der Historiker in der Interpretation eines einzelnen historischen Phänomens die quellenmäßig vorgegebene Individualität mit dem allgemeinen, abstrakten Wissen, das erst die Interpretation des Einzelnen möglich macht, und wie gelangt der Historiker zu empirisch gesicherten Aussagen über größere Einheiten und Prozesse der Geschichte?»[3]
Die Professionalisierung der Geschichtswissenschaft, hinter die man nicht zurückgehen kann, hat dazu geführt, dass «Big History» den Sozialwissenschaften überlassen wurde. Für die großen Fragen der historischen Entwicklung wurden jene Soziologen und Politologen zuständig, die sich ein Interesse für die Tiefe der Zeit und die Weite des Raumes bewahrten. Historiker schrecken von ihrem gelernten Habitus her vor kühnen Verallgemeinerungen, griffigen Universalformeln und monokausalen Erklärungen zurück. Unter dem Einfluss postmodernen Denkens halten es einige von ihnen für prinzipiell unmöglich, «Meistererzählungen» oder Interpretationen langfristiger Prozesse zu entwerfen. Dennoch: Weltgeschichte zu schreiben ist auch ein Versuch, dem Spezialistentum der kleinteilig arbeitenden Fachhistorie ein wenig öffentliche Deutungskompetenz abzuringen. Weltgeschichte ist eine Möglichkeit der Geschichtsschreibung, ein Register, das gelegentlich ausprobiert werden sollte. Das Risiko liegt beim Autor, nicht beim Publikum, das von einer wachsamen Kritik vor leichtsinnigen Zumutungen und Scharlatanerie geschützt wird. Dennoch bleibt die Frage, warum Weltgeschichte aus einer Hand? Warum begnügt man sich nicht mit den vielbändigen Kollektivprodukten aus der «gelehrten Fabrik» (Ernst Troeltsch)? Die Antwort ist einfach: Nur eine zentrale Organisation von Fragestellungen und Gesichtspunkten, von Stoffen und Interpretationen kann den konstruktiven Erfordernissen von Weltgeschichtsschreibung gerecht werden.
Die wichtigste Eigenschaft des Weltgeschichtsschreibers ist nicht seine Allwissenheit. Niemand verfügt über genügend Kenntnisse, um die Korrektheit jedes Details zu gewährleisten, allen Regionen der Welt die gleiche Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und aus jedem von zahllosen Forschungsständen den jeweils bestmöglichen zusammenfassenden Schluss zu ziehen. Die wichtigsten Eigenschaften des Weltgeschichtsschreibers sind zwei andere: Auf der einen Seite braucht er ein Gespür für Proportionen, für Größenverhältnisse, für Kraftfelder und Beeinflussungen, einen Sinn auch für das Typische und Repräsentative. Auf der anderen Seite muss er sich ein demütiges Abhängigkeitsverhältnis zur Forschung bewahren. Der Geschichtsschreiber, der vorübergehend in die Rolle des Welthistorikers schlüpft (er sollte immer auch Experte für etwas Spezielles bleiben), kommt nicht umhin, die mühselige und zeitraubende Forschungsarbeit Anderer, sofern sie ihm sprachlich zugänglich ist, in wenigen Sätzen «auf den Punkt zu bringen». Dies ist seine eigentliche Aufgabe, und es sollte ihm so oft wie möglich gelingen. Zugleich wäre seine Arbeit wertlos, würde er sich nicht um eine möglichst große Nähe zur besten Forschung bemühen, die nicht unbedingt stets die neueste zu sein hat. Lächerlich ist eine Weltgeschichtsschreibung, die mit dem Gestus pontifikalen Besserwissens längst widerlegte Legenden unwissend und unkritisch wiederholt. Als Synthese von Synthesen würde sie sich selbst missverstehen, als «the story of everything»[4] wäre sie langweilig und grobschlächtig.
Dieses Buch ist ein Epochenportrait. Es praktiziert Darstellungsweisen, wie sie grundsätzlich auch bei anderen Zeitaltern verwendet werden könnten. Ohne den vermessenen Ehrgeiz, ein Jahrhundert Weltgeschichte vollständig und enzyklopädisch abhandeln zu wollen, versteht es sich als ein materialsattes Interpretationsangebot. Diese Haltung teilt es mit Sir Christopher Baylys Die Geburt der modernen Welt («The Birth of the Modern World»), einem 2004 im Original, zwei Jahre später in deutscher Übersetzung erschienenen, zu Recht hochgelobten Buch, einem der wenigen Beispiele gelungener weltgeschichtlicher Synthese aus dem Bereich der späten Neuzeit.[5] Mein Buch ist kein Anti-Bayly, sondern eine Alternative aus verwandtem Geist – so wie es mehr als eine Deutung des Deutschen Kaiserreiches oder der Weimarer Republik geben kann. Beide Darstellungen verzichten auf eine regionale Gliederung nach Nationen, Zivilisationen oder kontinentalen Großräumen. Beide halten Kolonialismus und Imperialismus für so wichtig, dass sie dafür keine besonderen Kapitel vorsehen, sondern diese Dimension ständig mit bedenken. Beide setzen auch keinen scharfen Gegensatz zwischen dem voraus, was Bayly in seinem englischen Untertitel «global connections and comparisons» nennt.[6] Beziehungsanalyse und Vergleich können und müssen geschmeidig miteinander kombiniert werden, und nicht alle Vergleiche bedürfen der vollen Absicherung durch die strenge historische Methodenlehre. Das kontrollierte Spiel mit Assoziationen und Analogien bringt manchmal – keineswegs immer – mehr als ein Vergleich, der pedantisch überfrachtet wird.
Manche Akzente werden in den beiden Büchern unterschiedlich gesetzt: Bayly kommt von Indien her, ich von China; das wird man merken. Bayly interessiert sich besonders für Nationalismus, Religion und «bodily practices», die Themen seiner vielleicht besten Abschnitte. In meinem Buch werden Migration, Ökonomie, Umwelt, internationale Politik und Wissenschaft breiter behandelt. Ich bin vielleicht etwas «eurozentrischer» eingestellt als Bayly, sehe das 19. Jahrhundert noch stärker als ein Jahrhundert Europas und kann zudem eine wachsende Faszination von der Geschichte der USA nicht verbergen. Was die theoretischen Bezüge betrifft, so dürfte meine Nähe zur historischen Soziologie rasch deutlich werden. Der wichtigste Unterschied zwischen Christopher Bayly und mir liegt in zwei anderen Punkten. Erstens ist das vorliegende Buch an den chronologischen Rändern noch offener gehalten als Baylys Darstellung. Es ist keine abgeschottete Binnengeschichte einer durch Jahreszahlen eindeutig demarkierbaren Epoche. Deshalb fehlen solche Jahreszahlen im Titel, und deshalb widmet sich ein besonderes Kapitel (II) den Fragen von Periodisierung und temporaler Struktur. Das Buch verankert das 19. Jahrhundert auf wechselnde Weise «in der Geschichte», und es leistet sich bewusst scheinbar anachronistische Rückgriffe weit hinter 1800 oder 1780 zurück oder Vorgriffe bis nahe an die Gegenwart heran. Auf diese Weise soll der Stellenwert des 19. Jahrhunderts in längeren Abläufen gleichsam trianguliert werden. Manchmal ist es uns fern, manchmal sehr nah; oft ist es die Vorgeschichte der Gegenwart, zuweilen versunken wie Atlantis. Das lässt sich von Fall zu Fall bestimmen. Das 19. Jahrhundert wird weniger von scharfrandigen Zäsurbegrenzungen her gedacht als von einem inneren Schwerpunkt her, der ungefähr in den 1860er bis 1880er Jahren liegt, als sich Innovationen von weltweiter Wirkung verdichteten und manche unabhängig voneinander verlaufenden Prozesse zu konvergieren schienen. Daher wird der Beginn des Ersten Weltkriegs auch nicht, wie bei Bayly, der hier ausnahmsweise der Konvention folgt, als ein plötzliches und unerwartetes Fallen des Vorhangs auf der historischen Bühne inszeniert.
Zweitens wähle ich eine andere narrative Strategie als Christopher Bayly. Es gibt eine Art von Weltgeschichtsschreibung, die man konvergent-zeitbetont nennen könnte. In dieser Manier ist es einigen Historikern mit abwägender Urteilskraft, immenser Erfahrung und viel common sense gelungen, ganze weltgeschichtliche Epochen mit ihren Haupt- und Nebenlinien in zügiger Dynamik darzustellen. John M. Roberts’ Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts ist ein Musterbeispiel dafür. Roberts versteht unter Weltgeschichte «das Allgemeine, das die Geschichte (the story) zusammenhält».[7] Er sucht daher nach dem jeweils epochal Wichtigen und Charakteristischen, das er ohne ein vorgefasstes Schema oder eine große Richtungsthese im Hintergrund zu einem kontinuierlichen Erzählfluss formt. Eric J. Hobsbawm, mit einer Prise marxistischer Striktheit und daher mit einem Kompass versehen, hat Ähnliches in seiner dreibändigen Geschichte des 19. Jahrhunderts geleistet.[8] Von jeder Abschweifung findet er letztlich wieder zu den großen Tendenzen seiner Epoche zurück. Bayly praktiziert einen zweiten Weg, den divergent-räumlichen. Das ist ein eher de-zentrierender Ansatz, der sich nicht so ungehemmt durch den Strom der Zeit vorantragen lässt. Eine solche Geschichtsschreibung kommt weniger leichtfüßig vom Fleck. Sie geht in die Breite der Gleichzeitigkeit und des Querschnitts, fahndet nach Parallelen und Analogien, zieht Vergleiche und spürt verborgene Wirkungszusammenhänge auf. Dabei ist sie chronologisch eher unscharf, kommt schon äußerlich mit wenigen Jahreszahlen aus und sichert den narrativen Fortgang durch eine nicht allzu insistent beachtete Binnengliederung der Gesamtepoche in Phasen, bei Bayly die drei Blöcke 1780–1815, 1815–1865, 1865–1914. Während Roberts in der Dialektik von Haupt- und Nebenentwicklungen denkt und unablässig danach fragt, was denn jeweils die Geschichte – ob im Guten, ob im Schlechten – maßgebend vorangebracht habe, wendet sich Bayly einzelnen Phänomenen zu und beleuchtet sie in weltweiter Perspektive.
Ein Beispiel ist der Nationalismus. Immer wieder liest man, es handele sich dabei um eine europäische «Erfindung», die dann in vergröberter Form und mit mancherlei Missverständnissen von der übrigen Welt übernommen worden sei. Bayly nun wirft einen genaueren Blick auf die «übrige Welt», der er als Indienspezialist näher steht als manch anderer, und gelangt zu der plausiblen These von einer Polygenesis nationalistischer Solidaritätsformen: In vielen Teilen der Welt gab es bereits vor dem Import nationalistischer Doktrinen aus Europa eigenständige «patriotische» Identitätsbildungen, die dann im Laufe des späteren 19. und des 20. Jahrhunderts nationalistisch uminterpretiert werden konnten.[9] Baylys Geschichtsschreibung ist primär horizontal – er selbst nennt sie «lateral»[10] – und raumbestimmt, diejenige, die John M. Roberts oder Eric J. Hobsbawm repräsentieren, eher «vertikal» und zeitbetont. Alle drei Autoren würden darauf bestehen, die horizontale und die vertikale Dimension kombiniert zu haben. Das ist sicher richtig, doch es scheint eine Art Unschärferelation zu walten, wie man sie auch in der bekannten Spannung zwischen narrativer und struktureller Darstellung findet: Kein Versuch ihrer Verbindung erreicht die vollkommene Harmonie.
Die Machart des vorliegenden Buches geht in Baylys Richtung, radikalisiert sie aber und gelangt dabei zu einem dritten Weg. Ich zweifle daran, dass es mit den Erkenntnismitteln des Historikers möglich ist, die Dynamik einer Epoche in einem auf Ganzheitlichkeit zielenden Schema zu erfassen. Die Weltsystemtheorie, der Historische Materialismus oder der soziologische Evolutionismus mögen sich das zutrauen. Da es das Geschäft der Historie ist, Veränderung zu beschreiben, bevor sie Erklärungen vorzuschlagen wagt, stößt sie jedoch schnell auf widerständige Reste, Eigensinniges, Nicht-Integrierbares. Bayly weiß dies selbstverständlich, doch setzt er sich über solche Skrupel hinweg, wenn er dennoch die Signatur der Epoche zu bestimmen versucht: Die Welt, dies ist seine Hauptthese, sei zwischen 1780 und 1914 uniformer, aber auch in sich differenzierter geworden.[11] Die «Geburt der Moderne» sei ein langsamer Prozess gewesen, der erst nach 1890 mit einer «großen Beschleunigung» (die Bayly dann gar nicht mehr analysiert) zum Abschluss gekommen sei.[12] Das klingt ein wenig trivial und ist eine enttäuschende Quintessenz eines Buches, das auf jeder Seite mit originellen Einsichten überrascht. Weil Bayly auf eine einigermaßen klare Abgrenzung zwischen Teilbereichen der historischen Wirklichkeit verzichtet, kann er deren jeweilige Eigenlogik schlecht erfassen. Allein Industrialisierung, Staatsbildung und religiöses revival treten in seiner Darstellung als einzelne Prozesse profiliert hervor. Eine allzu generelle «Meistererzählung» für die Welt des 19. Jahrhunderts erhebt sich unvermittelt aus einem Kosmos partikularer Beobachtungen und Deutungen, die allesamt geistreich und zumeist überzeugend sind.
Ich experimentiere mit einer anderen Lösung: «Meistererzählungen» sind legitim. Die postmoderne Kritik an ihnen hat sie nicht obsolet, sondern bewusster erzählbar gemacht. Man kann solche grand narratives freilich auf unterschiedlichen Ebenen ansiedeln: Auch eine Geschichte der weltweiten Industrialisierung oder der Urbanisierung im 19. Jahrhundert wäre «grand» genug. Diese Ebene der immer noch sehr allgemeinen, aber doch als Teilsysteme eines kaum fassbaren Ganzen erkennbaren Ordnungen menschlichen Gemeinschaftslebens gibt dem Buch seine Grundstruktur, die nur auf den ersten Blick enzyklopädisch anmutet, eigentlich aber eine konsekutive Umkreisung ist. Fernand Braudel hat ein ähnliches Verfahren beschrieben: «Der Historiker öffnet zunächst die ihm vertrauteste Tür zur Vergangenheit. Versucht er aber, so weit wie möglich zu schauen, wird er zwangsläufig an die nächste, dann an die übernächste klopfen. Und jedes Mal wird sich eine neue oder doch leicht veränderte Szenerie vor ihm auftun. […] Die Geschichte aber vereint sie alle, sie schließt diese Nachbarschaften, diese Grenzgemeinschaften mit ihren Wechselwirkungen ohne Ende zum Ganzen zusammen.»[13] Auf jedem der Teilgebiete wird nach dessen eigenen Bewegungsmustern («Logiken») und nach dem Verhältnis zwischen eher allgemeinen Entwicklungen und eher regionalen Varianten gefragt. Jeder Teilbereich hat seine eigene Zeitstruktur: einen besonderen Beginn, ein besonderes Ende, spezifische Tempi, Rhythmen, Binnenperiodisierungen.
Weltgeschichte will «Eurozentrismus» ebenso wie jede andere Art von naiver kultureller Selbstbezogenheit überwinden. Dies geschieht nicht durch die illusionäre «Neutralität» eines allwissenden Erzählers oder die Einnahme einer vermeintlich «globalen» Beobachterposition, sondern durch ein bewusstes Spiel mit der Relativität von Sichtweisen. Dabei kann nicht übersehen werden, wer für wen schreibt. Dass sich ein europäischer (deutscher) Autor an europäische (deutsche) Leser wendet, wird den Charakter des Textes nicht unberührt lassen: Erwartungen, Vorwissen und kulturelle Selbstverständlichkeiten sind nicht standortneutral. Diese Relativität führt auch zu dem Schluss, dass die Zentrierung von Wahrnehmungen nicht von realen Gewichtsverhältnissen – anders gesagt: von Zentrum-Peripherie-Strukturen – gelöst werden kann. Dies hat eine methodische und eine sachliche Seite. Methodisch gesehen, vereitelt Mangel an Quellen so manchen guten Willen zu historischer Gerechtigkeit. Sachlich gesehen, verschieben sich in langen Wellen geschichtlicher Entwicklung die Proportionen zwischen den verschiedenen Teilen der Welt. Macht, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und kultureller Innovationsgeist sind von Epoche zu Epoche unterschiedlich verteilt. Deshalb wäre es Ausdruck kapriziöser Willkür, eine Geschichte ausgerechnet des 19. Jahrhunderts zu entwerfen, die von der Zentralität Europas absähe. Kein anderes Jahrhundert war in einem auch nur annähernden Maße eine Epoche Europas. Es war, wie der Philosoph und Soziologe Karl Acham treffend formuliert hat, eine «Epoche übermächtiger und übermächtigender europäischer Initiativen».[14] Nie zuvor hatte die westliche Halbinsel Eurasiens derart große Teile des Globus beherrscht und ausgebeutet. Niemals hatten Veränderungen, die von Europa ausgingen, eine solche Durchschlagskraft in der übrigen Welt. Niemals wurde auch die europäische Kultur – weit jenseits der Sphäre kolonialen Zugriffs – dermaßen begierig aufgenommen. Das 19. Jahrhundert war also auch deshalb ein Jahrhundert Europas, weil die Anderen Maß an Europa nahmen. Europa übte in der Welt dreierlei aus: Macht, die es oft gewaltsam zum Einsatz brachte; Einfluss, den es sich über die zahllosen Kanäle kapitalistischer Expansion zu sichern verstand; und eine Vorbildwirkung, gegen die sich sogar viele von Europas Opfern nicht sperrten. Diese multiple Übermacht hatte es in der frühneuzeitlichen Phase der europäischen Expansion nicht gegeben. Weder Portugal, noch Spanien, noch die Niederlande, noch England vor etwa 1760 hatten ihre Macht in entfernte Winkel der Erde projiziert und die «Anderen» kulturell so beeindruckt, wie es Großbritannien und Frankreich im 19. Jahrhundert taten. Die Geschichte des 19. Jahrhunderts wurde in einem Maße in und von Europa gemacht, wie sich dies weder für das 18. noch für das 20. Jahrhundert sagen lässt, von früheren Epochen ganz zu schweigen. Niemals hat Europa einen ähnlichen Überschuss an Innovationskraft und Initiative, gleichzeitig auch von Überwältigungswillen und Arroganz freigesetzt.
Dennoch steht in diesem Buch nicht die große Frage «Warum Europa?» im Mittelpunkt, wie sie von den Aufklärern über Max Weber bis zu David S. Landes und Michael Mitterauer immer wieder neu formuliert worden ist. Noch vor zwei oder drei Jahrzehnten hätte eine neuzeitliche Weltgeschichte Europas unbesorgt unter dem Motiv des «europäischen Sonderwegs» daherkommen können. Heute versucht man, diese Frage jenseits europäischer (oder «westlicher») Selbstgefälligkeit zu studieren und nimmt dem Sonderweggedanken durch Verallgemeinerung und Relativierung seine Schärfe. «Es gibt viele Sonderwege von Kulturräumen», stellt Michael Mitterauer fest, «der europäische ist nur einer unter ihnen.»[15] Das 19. Jahrhundert verdient in dieser Diskussion deshalb neue Aufmerksamkeit, weil eine starke Strömung unter vergleichend arbeitenden Historikern die sozialökonomischen Unterschiede zwischen Europa und den übrigen Teilen der Welt während der frühen Neuzeit für weniger dramatisch hält, als ältere Generationen dies taten. Damit wird das Problem der «Weltschere» oder «Großen Differenz» (great divergence) zwischen Armen und Reichen zeitlich in das 19. Jahrhundert verschoben.[16] Wir werden uns ihm stellen müssen. Gleichwohl soll es nicht die leitende Frage für das gesamte Buch bilden. Mit der Exzeptionalismusbrille an das historische Material heranzugehen bedeutet, von Anfang an mehr das Unterschiedliche im Verhältnis Europas zu anderen Zivilisationen zu sehen als die Gemeinsamkeiten. Damit besteht die Gefahr eines kontrastiven Apriori, des extremen Gegensatzes zu einem nicht minder einseitigen ökumenischen Apriori, das nur die menschheitliche conditio humana gelten lässt. Sinnvoller ist es, über die unersprießliche «West/Rest»-Dichotomie hinauszufinden und die Abstände zwischen «Europa» (was immer das jeweils sein mag) und anderen Teilen der Welt im Einzelfall neu zu vermessen. Dies kann nur auf Teilgebieten der historischen Wirklichkeit geschehen.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Die drei Kapitel des ersten Teils («Annäherungen») umreißen die Voraussetzungen, die allgemeinen Parameter für alles Folgende: Selbstreflexion, Zeit und Raum. Indem Zeit und Raum gleichberechtigt behandelt werden, wird dem Eindruck begegnet, Weltgeschichtsschreibung sei notwendig an zeitliche Entdifferenzierung und eine «Wende zum Raum» (spatial turn) gebunden. Dann wird in acht Kapiteln jeweils ein «Panorama» eines Wirklichkeitsbereichs aufgerollt. «Panorama» weist darauf hin, dass zwar nicht pedantisch auf Repräsentanz aller Weltgegenden geachtet wird, aber doch eine zu große Lückenhaftigkeit des weltweiten Überblicks vermieden werden soll. Im dritten Teil – den sieben Kapiteln der «Themen» – tritt an die Stelle panoramatischer Umschau die zuspitzende, entschiedener auswählende und stärker essayistisch formulierte Diskussion einzelner Aspekte, die bewusst auf vieles verzichtet und besondere Beispiele vor allem deshalb heranzieht, um allgemeinere Argumente zu veranschaulichen. Wären diese Themen in «panoramatischer» Breite ausgeführt worden, hätte der nötige Umfang die Arbeitskraft des Verfassers ebenso wie die Geduld der Leser unmäßig strapaziert. Man kann es auch anders sagen: Das Buch verlagert das Gewicht von der Synthese zur Analyse, zwei Untersuchungs- und Darstellungsweisen, zwischen denen kein schroffer Gegensatz besteht. Die Kapitel des Buches bilden ein zusammenhängendes Ganzes. Dennoch können sie einzeln gelesen werden. Um der Abrundung der Kapitel willen wurden geringfügige Überschneidungen und Wiederholungen in Kauf genommen. Zahl und Umfang der Anmerkungen mussten beschränkt werden. Das Literaturverzeichnis nennt nur Literatur, die in den Anmerkungen zitiert wird. Es ist weder als Bibliographie von Standardwerken gemeint, noch spiegelt es den vollen Umfang des herangezogenen Materials. Aus der großen Fülle hervorragender Zeitschriftenaufsätze konnten nur wenige erwähnt werden. Die Grenzen seiner Sprachkenntnisse sind dem Autor schmerzlich bewusst.
| ANNÄHERUNGEN
I | Gedächtnis und Selbstbeobachtung:
Die mediale Verewigung des 19. Jahrhunderts
Was bedeutet das 19. Jahrhundert heute? Wie stellt es sich denjenigen dar, die sich nicht als Historikerinnen und Historiker professionell mit ihm befassen? Die Annäherung an die Epoche beginnt bei den Repräsentationen, in denen sie der Nachwelt gegenübertritt. Damit ist nicht allein an unser «Bild» vom 19. Jahrhundert zu denken, an die Art und Weise, wie wir es gerne sehen möchten, wie wir es uns konstruieren. Solche Konstruktionen sind nicht ganz beliebig, nicht ausschließlich unmittelbare Produkte von Vorlieben und Interessen der Gegenwart. Heutige Wahrnehmungen des 19. Jahrhunderts sind immer noch stark von der Selbstbeobachtung jener Zeit geprägt. Die Reflexivität des Zeitalters, vor allem die neue Medienwelt, die es schuf, bestimmt fortdauernd die Art und Weise, wie wir es sehen. Für keine frühere Epoche ist dies in ähnlichem Maße der Fall.
Seit kurzem erst ist das 19. Jahrhundert, durch ein volles kalendarisches Säkulum von der Gegenwart getrennt, hinter dem Horizont des persönlich Erinnerbaren versunken: spätestens seit im Juni 2006 in einem australischen Zoo die Schildkröte Harriet das Zeitliche segnete, die schon 1835 auf den Galapagos-Inseln den jungen Naturforscher Charles Darwin kennengelernt hatte.[1] Niemand lebt mehr, der sich noch an den chinesischen Boxeraufstand vom Sommer 1900, an den Südafrikanischen Krieg («Burenkrieg») der Jahre von 1899 bis 1902 oder an die feierlichen Leichenbegängnisse von Giuseppe Verdi und Queen Victoria erinnern könnte, die beide im späten Januar des Jahres 1901 gestorben waren. Selbst von der feierlichen Totenprozession für Japans Meiji-Kaiser im September 1912 und von der Stimmung des August 1914, als der Erste Weltkrieg begann, bleiben keine mitteilbaren Erinnerungen mehr. Im November 2007 verstarb der vorletzte britische Überlebende des Titanic-Unglücks vom 14. April 1912, zum Zeitpunkt der Havarie ein Säugling, im Mai 2008 der letzte deutsche Veteran des Ersten Weltkriegs.[2] Die Erinnerung an das 19. Jahrhundert ist keine des persönlichen Gedächtnisses mehr. Sie ist eine der medial vermittelten Information und der gelesenen Spuren. Spuren findet man in wissenschaftlichen und volkstümlichen Geschichtsbüchern, in den Sammlungen historischer Museen, in Romanen, Gemälden, alten Photographien, musikalischen Klängen, in Stadtbildern und Landschaften. Das 19. Jahrhundert wird nicht länger aktiv erinnert, es wird nur noch repräsentiert. Dies hat es mit früheren Epochen gemeinsam. In der Geschichte der Repräsentation von kulturellem Leben nimmt es jedoch einen einzigartigen Platz ein, der es schon im Verhältnis zum 18. Jahrhundert unverwechselbar macht. Die meisten der Formen und Institutionen solcher Repräsentation sind Erfindungen des 19. Jahrhunderts selbst: das Museum, das Staatsarchiv, die Nationalbibliothek, die Photographie, die wissenschaftliche Sozialstatistik, der Film. Das 19. Jahrhundert war eine Epoche organisierter Erinnerung und zugleich gesteigerter Selbstbeobachtung.
Dass das 19. Jahrhundert im Bewusstsein der Gegenwart überhaupt eine Rolle spielt, versteht sich keineswegs von selbst. Dies gilt nicht nur für den ästhetischen Kanon, sondern auch für politische Traditionsstiftung. China kann als Gegenbeispiel dienen. Das 19. Jahrhundert war für China politisch wie wirtschaftlich eine katastrophale Zeit und hat sich mit dieser Wertung im allgemeinen Bewusstsein der Chinesen gehalten. Man erinnert sich ungern an dieses peinliche Zeitalter der Schwäche und Erniedrigung, und die amtliche Geschichtspropaganda tut nichts, um es aufzuwerten. Sogar die Anklagen gegen den «Imperialismus» des Westens sind heute schwächer geworden, denn ein wieder aufstrebendes China erkennt sich nicht in der Opferrolle einer früheren Zeit. Auch in kultureller Hinsicht gilt das 19. Jahrhundert als dekadent und steril. Kein Kunstwerk und kein philosophischer Text dieser Zeit nimmt es hier im heutigen Urteil mit den klassischen Werken der ferneren Vergangenheit auf. Das 19. Jahrhundert ist heutigen Chinesen viel weiter entrückt als manche ältere dynastische Glanzperiode bis hin zu den großen Kaisern des 18. Jahrhunderts, die in populären Geschichtsbüchern und historischen Fernsehserien unentwegt beschworen werden.
Der Gegensatz zwischen China und Japan könnte nicht größer sein. In Japan genießt das 19. Jahrhundert ein unvergleichlich viel höheres Prestige. Die Meiji-Renovation (oft auch Meiji-Restauration genannt) von 1868 und den Jahren danach wurde zum Gründungsakt nicht nur des japanischen Nationalstaates, sondern überhaupt einer eigentümlichen japanischen Modernität stilisiert und spielt bis heute im japanischen Bewusstsein eine Rolle, die derjenigen der Revolution von 1789 für Frankreich vergleichbar ist.[3] Auch der ästhetische Stellenwert des 19. Jahrhunderts ist ein anderer als in China. Während dort von einem modernen Neuansatz in der Literatur erst für die 1920er Jahre gesprochen werden kann, beginnt die neuere japanische Literatur mit der «Generation von 1868», die in den 1880er Jahren produktiv wurde.
Unter einem ähnlichen Bann des 19. Jahrhunderts wie in Japan steht die historische Erinnerung in den USA. Hier gilt der Bürgerkrieg der Jahre 1861 bis 1865 im gleichen Rang wie die Bildung der Union im späten 18. Jahrhundert als Gründungsereignis des Nationalstaates. Die Nachfahren der siegreichen weißen Nordstaatler, der unterlegenen weißen Südstaatler und der bei Kriegsende befreiten Sklaven haben diesem Ereignis seither ganz unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben und sich jeweils ihre eigene «nützliche Vergangenheit» zurechtgelegt. Einigkeit besteht darüber, dass der Bürgerkrieg eine gemeinsame «gefühlte Geschichte» ist, wie der Dichter Robert Penn Warren schrieb.[4] Der Bürgerkrieg wirkte lange als ein Kollektivtrauma nach; im Süden der USA ist es bis heute nicht überall überwunden. Wie stets bei historischer Erinnerung handelt es sich nicht bloß um eine naturwüchsige Identitätsbildung, sondern auch um Instrumentalisierung zugunsten benennbarer Interessen: Südliche Propagandisten gaben sich alle Mühe zu vertuschen, dass es beim Bürgerkrieg zentral um Sklaverei und Emanzipation ging, und schoben die Verteidigung von «staatlichen Rechten» in den Vordergrund. Die Gegenseite scharte sich um die Mythisierung Abraham Lincolns, des 1865 ermordeten Bürgerkriegspräsidenten. Kein einziger deutscher Staatsmann, auch nicht der eher respektierte als geliebte Bismarck, kein britischer und kein französischer, selbst nicht der umstrittene Napoleon I., genießt bei der Nachwelt solche Verehrung. Noch 1938 stellte Präsident Franklin D. Roosevelt öffentlich die Frage «What would Lincoln do?» – der Nationalheld als Nothelfer der Nachgeborenen.[5]
1 | Sichtbarkeit und Hörbarkeit
| Das 19. Jahrhundert als Kunstform: die Oper
Ein vergangenes Zeitalter lebt fort in der Wiederaufführung, im Archiv und im Mythos. Heute ist das 19. Jahrhundert dort vital, wo seine Kultur neu in Szene gesetzt und konsumiert wird. Seine in Europa charakteristischste Kunstform, die Oper, ist für solche Wiederaufführung ein gutes Beispiel. Die europäische Oper entstand um 1600 in Italien, nur Jahrzehnte nach dem ersten Aufschwung des städtischen Musiktheaters in Südchina, dem Beginn einer ganz eigenständigen, von europäischen Einflüssen unberührten Entwicklung, die nach 1790 in der Peking-Oper gipfeln sollte.[6] Trotz herausragender Meisterwerke war der kulturelle Status der Oper außerhalb Italiens lange nicht unanfechtbar gesichert. Erst mit Christoph Willibald Gluck und Wolfgang Amadeus Mozart wurde sie zur vornehmsten Gattung auf dem Theater. In den 1830er Jahren stand sie nach allgemeinem Urteil an der Spitze der künstlerischen Hierarchie.[7] Ähnliches gilt für den synchronen Parallelfall der Peking-Oper, die um die Mitte des Jahrhunderts in die Phase ihrer künstlerischen und organisatorischen Konsolidierung eintrat. Seither hat sich die europäische Oper triumphal behauptet, während ihre ferne Schwester, die Peking-Oper, nach radikalen Traditionsbrüchen und nach dem Eindringen einer westlich gefärbten Medienkultur nur noch in folkloristischen Nischen überdauert.
Zwischen Lissabon und Moskau sind die im 19. Jahrhundert erbauten Opernhäuser heute noch in vollem Betrieb und spielen ein Repertoire, das überwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammt. Die Oper globalisierte sich früh. In der Mitte des 19. Jahrhunderts besaß sie einen weltweit ausstrahlenden Mittelpunkt: Paris. Pariser Musikgeschichte um 1830 war Weltgeschichte der Musik.[8] Die Pariser Oper war nicht allein die erste Bühne Frankreichs. Paris zahlte Komponisten die höchsten Honorare und stach damit alle Konkurrenten um den Rang der führenden Magnetstadt der Musik aus.[9] Ruhm in Paris bedeutete Weltruhm, das Scheitern dort, wie es Richard Wagner, immerhin einem arrivierten Meister, 1861 mit seinem Tannhäuser widerfuhr, eine tief verletzende Schmach.
Schon die 1830er Jahre sahen Aufführungen europäischer Opern im Osmanischen Reich. Giuseppe Donizetti, der Bruder des gefeierten Komponisten Gaetano, erlangte 1828 den Rang eines Hofmusikdirektors beim Sultan in Istanbul und baute dort ein Orchester europäischen Typs auf. Im unabhängigen Kaiserreich Brasilien, vor allem nach 1840 unter Pedro II., wurde die Oper zur offiziellen Kunstform der Monarchie. Vincenzo Bellinis Norma wurde viele Male aufgeführt, die wichtigsten Opern von Rossini und Verdi wurden auf die Bühne gebracht. Als Brasilien Republik geworden war, ließen steinreiche Kautschukunternehmer in Manaus, damals mitten im Amazonasdschungel gelegen, zwischen 1891 und 1896 ein üppiges Opernhaus errichten. Der Bau war ein Resultat globaler Kombination: Edelhölzer aus der Nachbarschaft, Marmor aus Carrara, Leuchter aus Murano, Stahl aus Glasgow und Gusseisen aus Paris.[10] Auch durch Kolonialherrschaft verbreitete sich die Oper weit über Europa hinaus. Die Überlegenheit der französischen Zivilisation sollte in den Kolonien durch prächtige Theaterbauten unter Beweis gestellt werden. Besonders wuchtig geriet das 1911 eingeweihte Opernhaus in Hanoi, der Hauptstadt Französisch-Indochinas, das wie so viele andere der Pariser Garnier-Oper, nach ihrer Fertigstellung 1875 mit 2200 Sitzen der größte Bühnenraum der Welt, nachempfunden war. Mit 870 Plätzen für die etwa viertausend Franzosen in der Stadt stellte es das Musiktheater mancher französischen Provinzmetropole in den Schatten.[11]
Früher verwurzelte sich die Oper in Nordamerika. Das 1859 eröffnete French Opera House in New Orleans galt lange als eine der besten Musiktheaterbühnen der Neuen Welt. In San Francisco, damals eine Stadt von 60.000 Einwohnern, brach eine solche Opernbegeisterung aus, dass bereits 1860 insgesamt 217.000 Eintrittskarten verkauft wurden. Die 1883 eröffnete Metropolitan Opera in New York wurde nach der Jahrhundertwende zu einem der führenden Häuser der Welt, zu einem Schauplatz auch der Selbstinszenierung der amerikanischen high society in Formen, die sich von europäischen kaum unterschieden. Architektonisch und bühnentechnisch verbanden die Schöpfer der «Met» Elemente von Covent Garden in London, La Scala in Mailand und selbstverständlich der Opéra in Paris.[12] Nahezu das gesamte Repertoire stammte aus Europa, denn nicht vor George Gershwins Porgy and Bess (1935) leisteten amerikanische Komponisten weithin beachtete Beiträge zum Musiktheater. Operamania brach an unerwarteten Orten aus. Chile war in den 1830er Jahren von einem Rossini-Fieber erfasst worden.[13] In Japan, wo die Regierung seit den 1870er Jahren die Verbreitung westlicher Musik förderte, fand 1894 die erste Aufführung einer europäischen Oper statt, einer Szene aus Charles Gounods Faust. War 1875, als eine italienische Primadonna in Tokyo Station gemacht hatte, die Vorstellung noch so schwach besucht gewesen, dass man die Mäuse quieken hörte, so bildete sich nach der Jahrhundertwende ein stabiles Operninteresse heraus, das 1911 im ersten großen Theaterbau westlichen Stils seinen örtlichen Fixpunkt fand.[14]
Auch der in mehreren Erdteilen tätige Bühnenstar wurde im 19. Jahrhundert als Typus geboren.[15] Schon 1850 hatte Jenny Lind, die «schwedische Nachtigall», am Beginn einer Tournee, während der sie 93 Auftritte absolvieren sollte, in New York vor siebentausend Zuhörern gesungen. Die Sopranistin Helen Porter Mitchell, die sich nach ihrer Heimatstadt Melbourne Nellie Melba nannte, stieg seit ihrem europäischen Debut 1887 zu einer der ersten wahrhaft interkontinentalen Diven des Musiklebens auf, ab 1904 auch per Grammophonplatte stimmlich vervielfältigt, und wurde zur Ikone kulturellen Selbstbewusstseins in ihrem als ungehobelt beleumundeten Heimatland. Die europäische Oper des 19. Jahrhunderts war ein Weltereignis und ist es geblieben. Das Opernrepertoire des 19. Jahrhunderts hat sich gehalten und beherrscht die Spielpläne: Rossini, Bellini, Donizetti, Bizet, vor allem Verdi, Wagner und Puccini. Aber eben nur weniges bleibt aus dem Gesamtfundus des Komponierten und früher einmal Geschätzten. Gaspare Spontini oder Giacomo Meyerbeer, bejubelte Meister ihrer Zeit, werden selten gespielt, anderes ist unwiederbringlich im Archiv verschwunden. Wer kennt noch die zahlreichen Mittelalteropern, die neben und nach Wagner entstanden? Ähnliche Überlegungen könnte man über das Sprechtheater anstellen oder über ein anderes typisches Genre des 19. Jahrhunderts, den Roman. Vermutlich liest das Publikum aus der gesamten deutschen Prosa des Realismus nur noch Theodor Fontane.[16] Wilhelm Raabe, Adalbert Stifter und selbst Gottfried Keller sind Pflegefälle der Germanistik geworden, von Autoren minderen Ranges ganz zu schweigen. Für jedes andere Land lässt sich auf ähnliche Weise Lebendiges und Totes aus der Hochkultur des 19. Jahrhunderts voneinander trennen. Sie ist in der Gegenwart intensiv präsent, jedoch in strikter Auswahl, die den Gesetzen von Geschmack und Kulturindustrie gehorcht.
| Stadtbilder[17]
Eine ganz andere Art der Präsenz des 19. Jahrhunderts ist die Sichtbarkeit seiner Versteinerung zu Stadtbildern. Hier kann es zu Kulisse und Arena heutigen urbanen Lebens werden. London, Paris, Wien, Budapest oder München sind Städte, deren Physiognomien von Planern und Architekten des 19. Jahrhunderts geprägt wurden, zum Teil in klassizistischen, neo-romanischen und neo-gotischen Bausprachen, die auf ältere Muster zurückgriffen. Von Washington D. C. bis Kalkutta benutzten politische Repräsentationsbauten das Idiom der europäischen Antikenimitation. Insofern bietet der architektonische Historismus des 19. Jahrhunderts eine zeitraffende Zusammenschau der europäischen Bautradition. In manchen Metropolen Asiens hingegen ist kaum noch identifizierbare Bausubstanz des 19. Jahrhunderts erhalten. In Tokyo etwa, das mehrere Jahrhunderte lang (zunächst unter dem Namen Edo) die Hauptstadt Japans war, haben Erdbeben, Brände, amerikanische Bomben und unentwegter Neubau fast alle architektonischen Spuren, die älter als ein paar Jahrzehnte sind, getilgt und sogar viele Meiji-Relikte beseitigt. Zwischen den Extremen solch geschlossener Stadtlandschaften wie der Wiener Ringstraße auf der einen und der physischen Auslöschung des 19. Jahrhunderts auf der anderen Seite reihen sich auf einer Skala die Metropolen der Welt. Der Zahn der Zeit nagt freilich selektiv: Die Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts ist schneller untergegangen als die Baukunst der Mittelalters. Kaum noch vermag man sich einen sinnlichen Eindruck von der industriellen «Revolution» zu verschaffen, vom plötzlichen Auftauchen einer riesigen Fabrik in einem engen Tal oder vom Neuigkeitswert hoher Schornsteine in einer Welt, in der nichts den Kirchturm überragt hatte.
2 | Erinnerungshorte, Wissensschätze, Speichermedien
Archive, Bibliotheken, Museen und konservierende Sammlungen überhaupt könnte man, an die bekannteren «Erinnerungsorte» angelehnt, Erinnerungshorte nennen. Neben den Erinnerungsorten als den Kristallisationskernen kollektiver Einbildungskraft verdienen solche Horte der Erinnerung unsere besondere Aufmerksamkeit. Man kann sie nicht abstrakt und unhistorisch klassifizieren. Die Abgrenzung zwischen den heute eindeutigen Unterformen entwickelte sich erst mit der Zeit. Bibliotheken ließen sich lange nicht säuberlich von Archiven trennen, insbesondere wenn sie über große Bestände an Handschriften verfügten. Im 18. Jahrhundert wurden in Europa mediale Räume für jede Art von antiquarischem Studium und Gedankenaustausch unter Privatleuten «Museum» genannt, auch Zeitschriften, die sich die Vorstellung historischer und ästhetischer Quellen zum Ziel gesetzt hatten. Die Bedeutung des Öffentlichen und allgemein Zugänglichen trat erst im 19. Jahrhundert hinzu. Erinnerungshorte bewahren die Vergangenheit im Aggregatzustand der Möglichkeit auf, als virtuelle Gegenwart. Nur gehortet, also ungelesen und unangeschaut, bleibt die kulturelle Vergangenheit tot; allein im Akt des Nachvollzugs wird sie lebendig. Die Bereitschaft zu solchem Nachvollzug nennt man Bildung.
| Archive
Keinem früheren Jahrhundert war das Archiv wichtiger als dem neunzehnten. In Europa war dies die Epoche, als der Staat sich überall der Erinnerung bemächtigte. Staatsarchive wurden als zentralisierende Lagerstätten der Überreste von Verwaltungshandeln gegründet. Mit ihnen entstanden der Beruf und Sozialtypus des Archivars und derjenige des aus den Akten arbeitenden Historikers. Dieser bediente sich nun auch der früheren Sammlungen der Fürsten und der Republiken: in Venedig, in Wien, im spanischen Simancas. In den konstitutionellen Ländern übernahm der Staat die Einrichtung öffentlicher Archive als hoheitliche Aufgabe. Die Französische Republik erklärte im September 1790 das zunächst noch bescheidene Archiv der Nationalversammlung zu den «Archives nationales». Die Konfiskationen, vor allem von kirchlichem Besitz, während der Revolution vermehrten rasch die Bestände. Napoleon betrieb Archivpolitik größten Stils. Er wollte die französischen Nationalarchive zu einem Zentralarchiv Europas machen – «la mémoire de l’Europe» – und ließ riesige Mengen von Dokumenten aus Italien und Deutschland nach Paris bringen. Großbritannien schuf 1838 die gesetzlichen Grundlagen für ein Public Record Office. 1883 wurden die sagenumwobenen Archive des Vatikans zugänglich gemacht. Die «neue Geschichtswissenschaft», die sich seit den 1820er Jahren bei Leopold Ranke und seinen Schülern herauskristallisierte, stellte sich unter den Imperativ der Textnähe. Geschichte war aus Schriftquellen, zumal den unveröffentlichten, rekonstruierbar. Damit wurde die Historie wissenschaftlicher, also überprüfbarer, in ihrer Haltung auch mythenkritischer. Zugleich begab sie sich in eine gewisse Abhängigkeit von der Archivpolitik der Regierungen, die den Zugang zu den Quellen steuerten, auf welche die Historiker nun angewiesen waren. Die systematische Organisation des Speicherns trug auch zur Herausbildung eines neuen Gelehrtenhabitus bei. Gelehrsamkeit wurde von persönlicher Gedächtnisleistung entkoppelt, der Wissen akkumulierende Polyhistor wurde vom Leitbild zur bedauerten Kuriosität, und auch Geisteswissenschaftler konnten sich nun dem Imperativ der Ursachenforschung unterstellen.[18]
Archive waren zwar keine ausschliesslich europäische Erfindung, doch gab es anderswo im 19. Jahrhundert kein vergleichbares Interesse am Konservieren von Dokumentarmaterial. In China hatte der Staat sich von Anfang an die Kontrolle über die Aufbewahrung der schriftlichen Überlieferung vorbehalten; ein privater Sammelwille fehlte. Es gab und gibt daher nur wenige Archive nichtstaatlicher Körperschaften: von Tempeln, Klöstern, Gilden oder Clans. Üblich war es, dass eine neue Dynastie in dem Moment die Dokumente ihrer Vorgängerin zerstörte, wenn deren offizielle Dynastiegeschichte fertiggestellt war. 1921 verkaufte das staatliche Historische Museum in Peking (Beijing) 60.000 Kilogramm Archivmaterial an Altpapierhändler. Nur dass der bibliophile Gelehrte Luo Zhenyu eingriff, rettete die Sammlung, die sich heute in der Academia Sinica auf Taiwan befindet. Bis in die 1930er Jahre wurden amtliche Druckschriften und Manuskripte der Qing-Dynastie (1644–1911) als Makulatur entsorgt. Trotz einer ehrwürdigen historiographischen Tradition besaß man in China auch im 19. Jahrhundert noch kein archivalisches Bewusstsein. Die 1925 gegründete Dokumentenabteilung des Palastmuseums war die erste Einrichtung, die das regelgeleitete, konservierende Ethos eines modernen Archivs auch an die Überlieferung der Kaiserzeit herantrug.[19] Im Osmanischen Reich, wo ebenso wie in China die entwickelte Schriftlichkeit der Verwaltung schon früh zum Zusammenhalt eines riesigen Flächenstaates beitrug, wurden Dokumente in einem solchen Umfang produziert und aufbewahrt, dass Forschungen, anders als im Falle Chinas, fast nur noch als Archivstudien denkbar sind. Neben den Akten des Hofes und der Zentralregierung sind etwa Steuerregister und Gerichtsakten (Kadi-Register) aus vielen Teilen des Reiches erhalten.[20] Vor dem 19. Jahrhundert wurden in Europa, im Osmanischen Reich und an einigen anderen Stellen der Welt Aufzeichnungen gesammelt. Erst seit dem 19. Jahrhundert werden sie systematisch archiviert, geschützt und ausgewertet.
| Bibliotheken
Zu den Erinnerungshorten als verwalteten Sammlungen kultureller Hinterlassenschaft gehören auch die Bibliotheken. Hier waren in Europa bereits das 17. und das 18. Jahrhundert ein großes Gründerzeitalter gewesen. Leibniz ordnete zwischen 1690 und 1716 als Bibliothekar die grandiose herzogliche Sammlung in Wolfenbüttel und richtete sie unter dem Gesichtspunkt der Dienstleistung für die Gelehrsamkeit ein. In dieser Hinsicht ging wenig später die Universitätsbibliothek im benachbarten Göttingen noch weiter. Eine Weile galt sie als die am besten organisierte Bibliothek der Welt. Die Sammlung des Britischen Museums, 1753 gegründet, war von Anfang an als Nationalbibliothek gedacht. 1757 wurde die Königliche Bibliothek inkorporiert und die Pflicht zur Abgabe eines Exemplars von jedem im Vereinigten Königreich gedruckten Buch eingeführt. Antonio (später Sir Anthony) Panizzi, ein italienischer Exilant, der seit 1831 für das British Museum arbeitete und zwischen 1856 und 1866 sein Chefbibliothekar war, schuf hier die Grundlagen für das wissenschaftliche Bibliothekswesen: einen vollständigen Katalog, nach Regeln systematisch angelegt, und einen Lesesaal, der nach den Bedürfnissen wissenschaftlicher Benutzer gestaltet war und in seiner überkuppelten Rundform als einer der prächtigsten Räume der Welt galt.[21]
Im 19. Jahrhundert entstanden auf allen Kontinenten Nationalbibliotheken nach britischem Vorbild. In den USA, Kanada und Australien gingen sie aus Parlamentsbüchereien hervor.[22] Manchmal waren sie mit wissenschaftlichen Akademien verbunden. Sie hüteten, dem respektablen Publikum und allen ernsthaft Studierenden frei zugänglich, das gedruckte Gedächtnis der eigenen Nation, sammelten aber auch Wissen überhaupt. Es wurde nun zum Merkmal der vornehmsten Bibliotheken, dass sie universell ausgriffen, das Wissen aller Völker und aller Zeiten zusammentrugen. Wichtige Voraussetzungen dafür waren ein Buchhandel mit weltweiten Geschäftskontakten und die Verfügbarkeit privater Bibliotheken auf dem Antiquariatsmarkt. Orientalische Abteilungen wurden eingerichtet, Bücher in den seltensten Sprachen gesammelt, manchmal von Emissären der Erwerbungsabteilungen. Bibliotheken symbolisierten den Anspruch auf kulturelle Gleich- oder Erstrangigkeit. Die junge amerikanische Republik erhob ihn 1800 mit der Gründung der Kongressbibliothek. Dass die Library of Congress seit Beginn der 1930er Jahre den größten Bücherbestand der Welt aufwies, vollendete die kulturelle Emanzipation Amerikas. Spät geeinte Nationen hatten es schwerer. Die Preußische Staatsbibliothek erhielt nicht vor 1919 nationalen Status, und in Italien hat es nie eine einzige umfassende Zentralbibliothek gegeben. Städtische Bibliotheken bedienten eine bildungsbegierige Öffentlichkeit und signalisierten Bürgerstolz. Es dauerte allerdings nach der Mitte des 19. Jahrhunderts noch eine Weile, bis es nicht nur rechtlich möglich, sondern auch politisch selbstverständlich wurde, für sie Steuergelder aufzuwenden. Privates Mäzenatentum war in den USA wichtiger als überall sonst. Die New York Public Library, seit 1895 mit Stiftungsmitteln aufgebaut, wurde zur berühmtesten unter zahlreichen städtischen Bibliotheken von ehrgeizigem Anspruch. Im 19. Jahrhundert wurden die westlichen Bibliotheken zu Tempeln des Wissens. Panizzis Britisches Museum, dessen Kern die Nationalbibliothek war, machte dies mit seiner monumentalen klassizistischen Front auch architektonisch sinnfällig. Der Neubau der Library of Congress übernahm in den 1890er Jahren diese Symbolsprache und steigerte sie noch durch Wandgemälde, Mosaiken und Statuen. Die riesigen Wissensspeicher waren national und kosmopolitisch zugleich: Exilanten bereiteten hier ihre Verschwörungen vor, unter ihnen der chinesische Revolutionär Sun Yatsen, der 1896/97 in der Bibliothek des Britischen Museums Pläne zum Sturz der Qing-Dynastie schmiedete, an jenem Ort, an dem zuvor Karl Marx seinen Kampf gegen das kapitalistische System wissenschaftlich untermauert hatte.
Trotz früher Anfänge (Alexandria, Pergamon) ist die Bibliothek kein westliches Monopolprodukt. In China wurde die erste kaiserliche Bibliothek im Palast des Han Wudi (r. 141–87 v. Chr.) eingerichtet. Bereits für diese Sammlung entwickelten Gelehrte ein lange benutztes Klassifikationssystem. Chinesische Bibliotheken führten jedoch eine prekäre Existenz. Zwischen dem 3. Jahrhundert v. Chr. und dem 19. Jahrhundert wurden die kaiserlichen Buch- und Manuskriptsammlungen mindestens vierzehn Mal zerstört. Immer wieder wurden die Gebäude neu errichtet und die Bestände neu aufgebaut. Vor allem nach der Verbreitung des Holzblockdrucks im 11. Jahrhundert legten auch private Akademien (shuyuan), Gelehrtenzirkel und einzelne Bibliophile große Bibliotheken an. Für die Qing-Zeit (1644–1911) kennt man Details über mehr als 500 Sammler und ihre Kollektionen. Die Menge gedruckter und im Privatgebrauch zirkulierender Literatur war so groß, dass das Bibliographieren zu einer der vornehmsten Aufgaben des Gelehrten wurde.[23] In China waren die Bibliothek und ihr Katalog also kein Kulturimport aus dem Westen. Westlichen Ursprungs war allerdings die Idee einer öffentlichen Bibliothek, zum ersten Mal 1905 in Changsha, der Hauptstadt der mittelchinesischen Provinz Hunan, verwirklicht. Die heute größte Bibliothek Chinas, die chinesische Nationalbibliothek, wurde 1909 gegründet und 1912 für das Publikum geöffnet. 1928 erhielt sie den Status einer Nationalbibliothek. Die moderne Bibliothek war in China keine ungebrochene Fortsetzung der eigenen Tradition. Der doppelte Gedanke der Bibliothek als öffentlichem Bildungsraum und Instrument der Wissenschaft kam aus dem Westen und wurde im China des frühen 20. Jahrhunderts unter schwierigen äußeren Umständen aktiv aufgenommen.
Im traditionalen Japan war der Staat viel seltener als Sammler von Schriftgut aufgetreten. Es fehlte an den großen verbindlichen Ordnungssystemen, die für China charakteristisch waren. Lange waren die japanischen Bestände nach China hin orientiert. Noch die seit dem frühen 18. Jahrhundert aufgebaute nicht-öffentliche Bibliothek der Shōgune, der Militärhegemone aus dem Hause Tokugawa, war primär antiquarischsinologisch und verzichtete darauf, die zur damaligen Zeit steigende japanische Buchproduktion zu erfassen. Ebenso wie in China traten bald nach der Öffnung des Landes (1853) westliche Büchersammler auf den Plan. Die riesigen sinologischen und japanologischen Sammlungen in Europa und den USA verdankten sich dem Zusammentreffen eines solchen westlichen Interesses, einer momentanen asiatischen Vernachlässigung der eigenen Bildungstraditionen und niedrigen Bücherpreisen. Das Konzept der öffentlichen Bibliothek wurde in Japan nach 1866 durch den Publizisten und Erzieher Fukuzawa Yukichi bekannt gemacht, der 1862 in diplomatischer Mission den Westen bereist hatte. Es dauerte allerdings auch im modernisierungswilligen Japan bis zum Ende des Jahrhunderts, bis sich die Modelle der publikumsnahen Bücherei und der Forschungsbibliothek durchsetzten.[24]
Die arabische Welt lag Europa geographisch näher als China, stand ihm aber buchgeschichtlich ferner. In China waren Texte seit langem per Blockdruck reproduziert worden. Entsprechend hatte der Berufsstand der Schreiber und Kopisten dort eine geringere Bedeutung als in der arabischen Welt, die erst im frühen 19. Jahrhundert ihre eigene Druckrevolution erlebte; bis zum frühen 18. Jahrhundert waren arabische und türkische Bücher vorwiegend im christlichen Europa gedruckt worden. An ihr waren neben Muslimen auch arabische Christen und Missionare beteiligt. Im Osmanischen Reich gab es private und halböffentliche Bibliotheken, die auch vereinzelt europäische Titel enthielten. Bis zur Einführung der lateinischen Schrift in der Türkischen Republik waren aber im Osmanischen Reich und der es ablösenden Türkei während eines Zeitraums von fast zwei Jahrhunderten nur etwa 20.000 Bücher und Broschüren gedruckt worden – viele in sehr kleinen Auflagen. Der vergleichsweise geringe Umfang der osmanischen und arabischen Buchproduktion führte dazu, dass sich auch das öffentliche Bibliothekswesen später und langsamer entwickelte als in Ostasien.[25]
| Museen
Auch das Museum verdankt seine bis heute maßgebende Form dem 19. Jahrhundert. Trotz mancher museumspädagogischer Neuerung kommt man in der Gegenwart immer wieder auf die Anordnungen und Programme des 19. Jahrhunderts zurück. Die ganze Typenbreite des Museums entfaltet sich in dieser Zeit: Kunstsammlungen, ethnographische Kollektionen, Technikmuseen. Aus der fürstlichen Sammlung, die manchmal auch der Untertanenschaft zugänglich gemacht worden war, wurde im Zeitalter der Revolution das öffentliche Museum.
Im Kunstmuseum kam Verschiedenes zusammen: die Idee der autonomen Kunst, wie Johann Joachim Winckelmann sie als erster formuliert hatte; der Gedanke eines «Wertes» des Kunstwerks, der seinen handwerklichen Materialcharakter übersteigt; das «Ideal einer ästhetischen Gemeinschaft», in der sich Künstler, Sachverständige, Laienkenner und im besten Falle auch der vorübergehend vom Thron gestiegene fürstliche Mäzen (etwa König Ludwig I. von Bayern) zusammenfanden.[26] Das Museum gedieh in einer Atmosphäre zunehmend ausdifferenzierter Öffentlichkeit. Hier konnte bald auch die Frage gewagt werden, ob die Kunst dem Staat oder dem Fürsten gehöre – im frühen 19. Jahrhundert ein heikles Problem, denn die Französische Revolution hatte durch die Beschlagnahmung und Verstaatlichung privater Kunstschätze, die den Louvre als erstes öffentliches Museum Europas ermöglichten, einen radikalen Präzedenzfall geschaffen. In den USA stellte es sich anders dar, denn hier war es vor allem die private Munifizenz von Reichen und Superreichen des von Mark Twain so bezeichneten «vergoldeten Zeitalters» (gilded age), die seit den 1870er Jahren den Aufbau von Museen vorantrieb. Viele Gebäude wurden in öffentlich-privaten Mischformen finanziert, die Kunstsammlungen allerdings meist von privaten Sammlern auf dem Markt angekauft. Amerika hatte nur wenige alte Bestände. Seine Sammlungen entstanden in enger Symbiose mit der Entwicklung des Kunstmarktes auf beiden Seiten des Atlantiks. Dieser Markt ermöglichte auch den Aufbau neuer Sammlungen in Europa.
Die im Laufe des Jahrhunderts immer deutlicher werdende Monumentalität von Museumsbauten (Alte Pinakothek in München, Kunsthistorisches Museum Wien, Victoria and Albert Museum in London) zog wachsende Beachtung im Stadtbild auf sich. Seit in Städten kaum noch Paläste gebaut wurden, konnten nur Opernhäuser, Rathäuser, Bahnhöfe und Parlamentsgebäude, etwa die zwischen 1836 und 1852 im neo-gotischen Stil neu errichteten Houses of Parliament am Themse-Ufer oder die Parlamente von Budapest und Ottawa, mit Museumsbauten konkurrieren. Auch der Nationalismus bemächtigt sich der Kunst. Viele der Beutestücke, die Napoleon nach Paris verschleppt hatte, wurden nach 1815 im Triumph zurückgeholt – damals verlor der Louvre rund vier Fünftel seiner Bestände – und bedurften nun repräsentativer Ausstellungsorte. Die Malerei erschloss sich historische Sujets mit nationaler Tendenz, deren großformatige Gestaltungen, vor allem aus den mittleren Dekaden des 19. Jahrhunderts, als die Historienmalerei den Höhepunkt ihrer Geltung in Europa erreichte, auch heute noch die Nationalgalerien vieler Länder schmücken.
Schließlich materialisierte sich im Museum und seiner inneren Gestaltung ein Bildungsprogramm, das nun erstmals von professionellen Fachleuten, den Kunsthistorikern, bestimmt wurde. Kultivierte Kenner und Liebhaber hatten in Europa, in China, in der islamischen Welt und andernorts seit Jahrhunderten solche Programme für sich und ihre kleinen Zirkel entworfen; man denke nur an den Kunst- und Naturaliensammler Goethe. Durch den Aufstieg der Experten in Europa wurde das Museum nun zum Ort angeleitet begehbarer Kunstgeschichte. Mit der Einrichtung staatlicher Museen für zeitgenössische Kunst wie des Musée du Luxembourg in Paris entstand zudem für die Künstler der Anreiz, in den Genuss öffentlicher Kunstpatronage und zugleich des damit verbundenen Ruhmes zu gelangen. Das Museum konservierte und «musealisierte» nicht nur im Sinne einer Trennung von Kunst und Leben. Es stellte auch Neues aus.
Historische Museen unterschieden sich in ihrem Grundgedanken von Sammlungen antiker Überreste. Das erste Museum dieser Art, das von Alexandre Lenoir 1791 schon während der Revolution geschaffene Musée des Monuments Français, ordnete in chronologischer Reihenfolge Statuen, Grabmäler und Portraits von Persönlichkeiten an, die Lenoir für national bedeutsam hielt.[27] Seit der Zeit der Napoleonischen Kriege wurden neue Museen mit historischer Orientierung vielfach als Nationalmuseen entworfen: in Ungarn, wo man mangels einer herrscherlichen Sammlung von Adelsstiftungen ausging, bereits 1802 unter diesem Namen, wenig später in den skandinavischen Ländern. In Großbritannien diente die 1856 vom Parlament ins Leben gerufene National Portrait Gallery dem Zweck nationaler und imperialer Gesinnungsstärkung. Das historische Museum beruhte auf einem neuen Verständnis von «historischen Gegenständen». Es genügte nicht, dass ein Objekt bloß «alt» war. Zum einen musste es eine erkennbare Bedeutung tragen, die sich dem Betrachter spontan vermittelte, zum anderen sollte es der Rettung und Bewahrung bedürftig und wert sein. In Deutschland, wo nach 1815 an vielen Orten Geschichts- und Altertumsvereine zur Rückbesinnung auf die «vaterländische» Vergangenheit gegründet worden waren, ließ man sich mit einem Nationalmuseum Zeit. Es wurde erst 1852 beschlossen und danach in Nürnberg als Germanisches (nicht «Deutsches») Nationalmuseum aus dem Geiste eines schwärmerischen Patriotismus mit starker Mittelalterfixierung aufgebaut.[28] An ein hauptstädtisches Zentralmuseum wurde niemals gedacht, auch nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 nicht.
In Asien und Afrika entstanden historische Museen zumeist erst nach der politischen Unabhängigkeit. Zu diesem Zeitpunkt war in vielen Fällen ein großer Teil der einheimischen Kunstschätze, Manuskripte und archäologischen Relikte in den Museen der kolonialen Metropolen verschwunden.[29] In Ägypten hatte ein solcher Abfluss bereits mit der französischen Invasion von 1798 begonnen. Muhammad Ali, der Herrscher Ägyptens zwischen 1805 und 1848, erließ zwar 1835 eine Art Exportverbot für Objekte aus dem Altertum, verschenkte solche Wertstücke aber selbst mit großer Freigiebigkeit. Das Ägyptische Museum in Kairo entstand im Wesentlichen aus einer privaten Initiative des Archäologen Auguste Mariette, der 1858 zum Konservator der ägyptischen Altertümer ernannt worden war. Die muslimischen Machthaber der Zeit hatten ein gespaltenes Verhältnis zu einer Einrichtung wie Mariettes im neopharaonischen Stil gebautem Museum: Die Welt heidnischer Mumien war ihnen fremd, andererseits merkten sie, wie die wachsende europäische Begeisterung für die vorislamische Antike dem Ruf Ägyptens in der Welt zugute kam.[30] Für die Museen in Istanbul (Konstantinopel)[31] war es wichtig, dass das Osmanische Reich 1874 die Fundteilung bei archäologischen Ausgrabungen unter ausländischer Ägide erreichte. In China wurde die damals verfallende Riesenanlage des ehemaligen Kaiserpalastes, die aus tausend einzelnen Tempeln, Hallen und Pavillons bestehende Verbotene Stadt, 1925 als ganze zum Museum erklärt und in großen Teilen für das Publikum freigegeben, aber erst 1958 gründete der Staat ein Geschichtsmuseum mit nationalistischer Programmatik.
Ethnologische Museen standen mit patriotischen oder nationalistischen Bestrebungen nur in einem gebrochenen Zusammenhang.[32] Sie entwickelten sich erst seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts, manchmal als Fortsetzung fürstlicher Kuriositätenkabinette und privater Gelehrtensammlungen. 1886 wurde in Berlin das Königliche Museum für Völkerkunde gegründet, das bald als das reichhaltigste ethnologische Museum der Welt galt. Die deutsche ethnologische Forschung war kein Geschöpf des Kolonialismus, sondern entstammte einer vorkolonialen liberal-humanistischen Tradition in den frühen deutschen Kulturwissenschaften.[33] Deutsche Reisende und Ethnologen sammelten auf allen Kontinenten. Von Anfang an wurden hohe Ansprüche gestellt. Es sollte ausdrücklich nicht die Aufgabe des Museums sein, bloß die rohe Schaulust der «Menge» zu befriedigen. Die Verwandlung der Objekte in Material der Wissenschaft sollte im Museum geschehen, das auch der Forschung und der Ausbildung von Experten diente.[34] Die ethnologischen Museen präsentierten Beutestücke, die durch Raub oder raubähnlichen Ankauf, nicht aber durch Überlieferung in europäischen Besitz gelangt und kein Teil eines nationalen Erbes waren.[35] Ziel war es, die Vielfalt menschlicher Lebensformen, aber nur die der – wie es damals hieß – «Primitiven», vorzustellen. Jedes einzelne Museum war Teil einer nun entstehenden transnationalen Welt des Sammelns und Ausstellens. Ebenso wie bei Gemäldegalerien hatten die Kenner bald einen Überblick über die Bestände weltweit. Die Museen wetteiferten miteinander und waren zugleich Elemente einer globalen Bewegung zur Repräsentation materieller Kultur. Subversiv wirkten sie durch die Inspiration, die sich avantgardistische Künstler hier suchen konnten. Man musste nicht, wie der Maler Paul Gauguin es 1891 tat, in die Südsee reisen, um sich der erneuernden Kraft des «Primitiven» auszusetzen.[36]
Nicht nur Objekte, sondern auch Menschen wurden nach Europa und Nordamerika verschleppt und öffentlich zur Schau gestellt, um in «wissenschaftlicher» und zugleich kommerzieller Absicht die Andersartigkeit und «Wildheit» von Nicht-Okzidentalen zu demonstrieren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gehörten solche Menschenschauen in den großen Metropolen des Westens zum Vergnügungsalltag, und mobile Schaustellungen erreichten auch Kleinstädte, zum Beispiel Konstanz. Das war eine Besonderheit dieser Zeit schnellen kulturellen Umbruchs.[37] Vor etwa 1850 war dergleichen sehr selten zu sehen, und nach dem Ersten Weltkrieg legte sich bereits wieder ein humanitäres Tabu über solche Exhibitionen. Die kommerzielle Zurschaustellung von nicht-weißen ebenso wie von behinderten Menschen wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts weltweit geächtet und als Delikt kriminalisiert. Das Prinzip