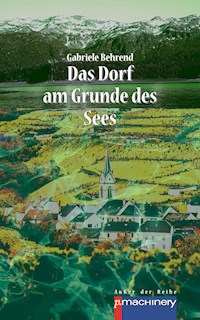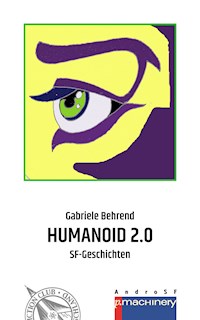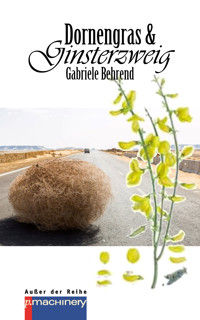4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 2041 versorgen die Vertical Farming Units die Bürger Basingstokes, einer südenglischen Stadt, mit Nahrungsmitteln. Plötzlich wird ihnen Wasser abgegraben. Bald stellt sich heraus, dass die Guerilla Gardeners dafür verantwortlich sind. Doch wer verbirgt sich hinter diesen Wildgärtnern? Wer sind die Guerilla Gardeners, die im Volksmund "Die vom Glück Verdorbenen" genannt werden? Rufus Orer macht sich daran, das Geheimnis zu lüften, wodurch er zwischen zwei Fronten gerät. Am Ende trifft er eine Entscheidung, für die er ein großes Opfer bringen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gabriele Behrend
Die vom Glück Verdorbenen
Roman
Gabriele Behrend
DIE VOM GLÜCK VERDORBENEN
Roman
Zwischen den Stühlen 7
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: März 2023
Zwischen den Stühlen @ p.machinery
Kai Beisswenger & Michael Haitel
Titelbild: Gabriele Behrend
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat: Kai Beisswenger
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Zwischen den Stühlen
im Verlag der p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.zds.li
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 327 7
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 776 3
Kapitel 1
Ein Anfang
Da war schon wieder die von denen. Eine, die lächelte, einfach so, grundlos, aus dem Nichts heraus. Sie saß ihm schräg gegenüber, die In-Ear-Kopfhörer halb von einer Lockensträhne verdeckt, die sich aus einem farbenfrohen Turban herausgestohlen hatte. Ein Turban, der bei den Arbeitsameisen so fehl am Platz schien. Die waren auf dem Weg vom Büro nach Hause, um dort ihren glanzlosen Arbeitsalltag gegen einen ebenso gleichförmigen Familienalltag einzutauschen. Aber da saß sie also. Sie war schon da gewesen, als er eingestiegen war, vor fünf Stationen.
Er sah sie nun schon seit drei Wochen, jeden Dienstag und Donnerstag. Sie trug immer Turban, Haarband, Fascinator oder Ähnliches im Haar. Sie schien Federn zu lieben, Farben sowieso. Selbst wenn ihre Kleidung manchmal zurückhaltend war, was selten genug vorkam – irgendetwas Besonderes war ihr immer zu eigen. Und das, was am meisten an ihr herausstach, war der Zauber ihres Lächelns. Sie war eigentlich nicht übermäßig schön oder hübsch, aber wenn sich ihre Mundwinkel hoben und die Lippen sich zu einem Lächeln formten, dann verwandelte sich dieses Gesicht in eine Quelle der Heiterkeit und Wärme. Und sie lächelte viel, oft und aus tiefstem Herzen. Er sah an ihren Augen, dass dieses Lächeln echt war.
Er kannte schon andere Grimassen, aus der Arbeitswelt, aus der Familie. Da wurden die Lefzen hochgezogen, Zähne entblößt und unwillkürlich musste er daran denken, dass das Lächeln ursprünglich eine Unterwerfungsgeste gewesen war, eine Grimasse, die der Angst entsprang. Die Turbanfrau schien aber vor nichts Angst zu haben. Im Gegenteil.
Ihm war aufgefallen, dass sie häufig Fremden den Platz neben sich anbot. Wann immer sie ein Gespräch mit ihrem Nachbarn anfing, schien sie zu spüren, dass er dazu bereit war.
Er fragte sich in solchen Situationen immer wieder einmal, was wohl passieren würde, wenn er dort Platz nähme? Würde sie das Wort an ihn richten? Würde er darauf eingehen? Oder würde er die Chance ungenutzt davonziehen lassen? So viele Fragen. Er seufzte und rieb sich die Stirn mit der rechten Hand. Außerdem mochte er doch gar nicht, was sie da so trieb. Einfach so lächeln. Einfach so den Waggon mit Licht fluten. Ohne Rücksicht auf die anderen. Wer weiß, wie viele sich noch an ihrer Art stießen? Oder an dem Lebenskonzept, das sie verkörperte. Es waren die vom Glück Verdorbenen, eine Handvoll Existenzen, die keiner geregelten Arbeit nachgingen und ständig grenzdebil vor sich hin grinsten, als ob sie dauernd stoned waren. Man wusste gar nicht mehr, wann man sie so zum ersten Mal betitelt hatte. Während einer langen Pub-Nacht vielleicht oder morgens in der überfüllten U-Bahn, wo es jeder hören konnte. Er grunzte leise in seiner selbstgeschaffenen Ablehnung, sah dann wieder zu der Turbanfrau hinüber und stutzte. Der Platz war leer. Dabei stieg sie doch stets nach ihm aus. Das Muster war immer gleich: Er stieg ein, sie war schon da. Er beobachtete sie siebzehn Stationen lang, stieg dann aus und ließ sie in der Bahn zurück. Und nun war sie weg? Er reckte den Hals, drehte den Kopf und erschrak. Sie stand neben ihm und blickte mit einem verschmitzten Lächeln auf ihn herunter.
»Darf ich mich setzen?« Sie deutete mit dem Kinn auf den freien Platz neben ihm.
»Wie kommst du darauf?«
»Nun, ich kann auch hier stehen bleiben, aber irgendwas sagt mir, dass so eine Unterhaltung schnell beendet ist, wenn sie nicht auf Augenhöhe geführt wird.«
Er rückte auf den Fensterplatz und fragte: »Warum denkst du, dass ich eine Unterhaltung will?«
»Weil du mich seit Wochen schon ins Visier genommen hast? Ich bin nicht blind, weißt du? Und heute dachte ich mir, ich verrate dir den Namen zu dem Gesicht.« Wieder dieses verschmitzte Lächeln. Dann hielt sie ihm ihre Hand entgegen. »Stella. Stella Wayfare. Und du bist?«
Er ergriff überrumpelt ihre Hand und schüttelte sie kurz. »Rufus Orer.«
»Fein, Rufus. So lange, wie du mich schon beobachtet hast, kann man ja glatt schon von einer gewissen Vertrautheit ausgehen.«
»Aber wir kennen uns doch noch gar nicht.« Er konnte sich gerade noch vor einem Stottern retten, indem er sich in seinen eintönigen und irgendwie maschinell anmutenden Arbeitsjargon flüchtete.
Stella sah ihn forschend an, ihr Lächeln war geschrumpft, glomm aber noch in den Mundwinkeln.
»Dann lass uns das ändern. Jetzt. Wir haben noch zehn Stationen Zeit dazu. Dann musst du aussteigen.« Sie lächelte zufrieden.
»Woher kennst du meine Station?«
»Vielleicht weil ich dich ebenso im Auge hatte, wie du mich? Weil du mir aufgefallen bist?« Sie lehnte sich in den Sitz, sah ihn an und schmunzelte. »Ich wollte dich kennenlernen.«
»Warum?«, fragte er verblüfft.
»Weil du den Funken in dir trägst.«
Er runzelte die Stirn. »Du spinnst«, wiegelte er ab.
»Ich glaube nicht. Aber ich stelle fest, dass ich mal wieder vorpresche, ohne Rücksicht auf Verluste. Vielleicht sollte ich dir erst mal etwas von mir erzählen, damit du weißt, auf wen du dich einlässt.«
»Ich weiß doch schon alles Nötige. Du gehörst zu denen, nicht wahr?«
»Zu welchen?« Sie krauste die Nase.
»Na, die Guerilla Gardeners, oder nicht?«
»Wächst mir Hanf aus den Taschen?« Jetzt kicherte sie. »Schwebt ein Leuchtschild über mir?«
»Nein, aber du bist so bunt und lächelst die ganze Zeit. Du scheinst immer glücklich zu sein. So sehen nur die Guerilla Gardeners aus.«
Sie hob ihre Hände, die Handflächen nach außen gedreht und lachte. »Du hast mich erwischt. Ja, wenn das so ist, dann bin ich wirklich eine von denen.« Dann ließ sie die Hände sinken und schob etwas leiser hinterher: »Aber lass uns jetzt nicht weiter darüber reden. Nicht hier.« Dann sah sie auf die Stationsanzeige an der Waggondecke. »Du musst gleich aussteigen. Oder du begleitest mich. Dann kann ich dir mehr über uns erzählen.« Sie drehte den Kopf zu ihm und fasste ihn ins Auge. »Willst du? Deinen Horizont erweitern und ein bisschen Farbe in dein Leben lassen?«
»Lass mich noch überlegen.« Noch drei Stationen.
Stella hatte sich so in ihren Sitz gekuschelt, dass sie Rufus milde beobachten konnte. Sanftmut hatte sich auf ihr Gesicht gesetzt und Rufus konnte sich diesem Zauber kaum entziehen. Noch zwei Stationen.
»Ich weiß nicht«, brach es aus ihm heraus. »Was passiert denn mit meinem Leben, wenn sich der Horizont erweitert? Bleibt alles, wie es war?«
»Das wäre aber sehr schade, nicht wahr?« Noch eine Station.
Er lehnte sich in den Sitz zurück und betrachtete die vorbeiziehende Dunkelheit des U-Bahn-Tunnels. »Und wenn ich keine Änderungen wünsche?«
»Dann solltest du jetzt aussteigen.«
Rufus sah aus dem Fenster, seine Station war in funzeliges Licht getaucht, noch standen die Türen offen. Dann sah er zu Stella hinüber und blieb sitzen. »Dann soll es so sein. Zeig mir deinen Horizont.«
Stella lächelte, beugte sich vor und küsste ihn unvermutet auf die Stirn. Dann zog sie sich zurück, strahlte ihn an und griff nach seiner Rechten. Ihre Finger verflochten sich mit seinen und mit ihrem Daumen strich sie über seine Hand. Während der Fahrt schwieg sie, zog die Knie an und schaukelte auf dem Sitz im Rhythmus des ratternden Zuges.
Rufus genoss die Fahrt, auch wenn er sich bisweilen fragte, was ihn erwartete, wo er landen würde und ob er sein Zuhause lebend wiedersehen könnte. Ob er vielleicht gerade den größten Fehler seines Lebens machte. Wer wusste schon, wie friedlich die Guerillas wirklich waren? Und ob sie einfach jeden Dahergelaufenen akzeptierten? Aber nichts von all dem ließ er verlauten. So sehr wie Stella schwieg, so tat er dies auch.
Nach weiteren elf Stationen zog Stella ihn aus der U-Bahn, die in den Randbezirken oberirdisch fuhr. Als sie aus dem Waggon gestolpert waren, wandte sich Stella einem Trampelpfad zu, der von der Station zu einer Brache führte, auf der man von Weitem kleine Gewächshäuser sehen konnte sowie dunkle, frisch aufgeworfene Krumen von zahllosen Hochbeeten. Dazu Rankhilfen, einen kleinen Verschlag. Auf der Fläche konnte Rufus vier Menschen erkennen, die sich um die Beete und den Garten kümmerten.
Stella gab seine Hand frei und sprintete los. Die letzten Meter lief sie wie ein Hase im Zickzack über den unebenen Boden, stoppte plötzlich und warf die Arme um eine brünette Frau. Als Rufus näherkam, sah er, dass die Frau wohl schon in ihren Vierzigern war. Nachdem sie Stellas Überraschungsangriff herzlich erwidert hatte, sah sie über Stellas Schulter und bemerkte Rufus, der inzwischen gänzlich aufgeschlossen hatte.
»Wer ist das, Süße?« Sie löste sich von Stella und trat einen Schritt zurück.
»Ein Funke.« Stella drehte sich zu Rufus um. »Er weiß es nur noch nicht.«
»Du bist dir sicher?«
Stella nickte heftig. Dann streckte sie ihre Hand nach Rufus aus. »Ich möchte dir Janet vorstellen. Sie ist unsere Gaja. Das heißt, sie weiß alles über den Anbau von Obst, Gemüse und Wildblumen. Und sie kann bei ganz anderen Fragen auch weiterhelfen.«
Rufus sah zu Janet. »Freut mich, dich kennenzulernen.«
Die nickte leicht. »Und wer bist du?«
»Rufus.«
Janet lächelte. Und es war ein ebenso umwerfendes überwältigendes Lächeln, wie Rufus es schon an Stella gesehen hatte. »Willkommen, Rufus. Willst du dich mal umsehen?«
Als er seine Wohnung erreichte, war es schon spät. Der Besuch auf der Parzelle von Sektion D hatte sich bis in den frühen Abend hingezogen. Rufus hatte alle Mitglieder kennengelernt. Einige persönlich, die anderen vom Hörensagen. Da war zunächst die Gaja, Janet Wilkins. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Trust Rudd bildete sie den Mittelpunkt der Sektion. Sie war der Hort und Quell von Gartenkunst und Philosophie – und sie schien einen feinen Sinn für Humor zu haben.
Jules und Mia Coltrane gehörten zu den jüngsten Mitgliedern, Mia, ein Mädchen aus der privilegierten Oberschicht, war vor zwei Jahren von der Schule abgegangen, hatte sich gegen ein Studium entschieden und von ihrer Familie abgesetzt. Statt ein Leben in Saus und Braus zu führen, hatte sie sich für Jules Coltrane entschieden, einen Mann in seinen frühen Zwanzigern, der den Kopf voll mit Visionen, Utopien und Philosophien hatte und mit seinen langen Locken und dem Bart wie ein Messias aussah.
Den Gegenpol bildeten Ben Riley und Bono Brower, ein schwules Pärchen, das seit dreißig Jahren eine On-Off-Beziehung führte, die sich erst stabilisiert hatte, als sie die Guerilla Gardeners entdeckt und sich der Gruppierung angeschlossen hatten. Sie feierten ihre Ernten, liebten die Pflanzen und wühlten sich mit Feuereifer durch die Erde und den Kompost.
Louisa Standford stand dem Erdreich nicht ganz so enthusiastisch gegenüber. Dafür liebte sie es, das Wasser für die Parzelle zu organisieren. Neben der Beschaffung und Überwachung der Regentonnen krochen sie und ihr Ehemann Sam am liebsten durch den Untergrund, in die Versorgungsschächte, wo sie die Ableitungen des Brauchwassers anzapften und über Schläuche zu den Beeten transportierten. Janet erwähnte, dass jede Sektion so ein Spezialistenpärchen habe. Ohne die sei die Parzelle aufgeschmissen, denn wo es kein Wasser gebe, da könne man auch keine Ernte einfahren.
Schließlich stellten sich auch die beiden Frauen vor, die bislang schweigsam in der Runde gesessen hatten. Nur ihre Hände waren die ganze Zeit in Bewegung – sie strickten. Sissy Landon und Liz Hover hatten sich bereits in ihrer Kindheit kennengelernt und waren irgendwie aneinander kleben geblieben. Aus Freundschaft war Liebe geworden. Aus Liebe eine liebevolle Routine. Sie waren sich selbst genug. Sie strickten übrigens auch die Stulpen, die sie über einzelne Straßenschilder zogen, die so als Wegweiser zu den einzelnen Parzellen dienten. Ihre Kunst brachte den Guerilla Gardeners Geld ein, um das Saatgut zu erwerben, und wenn sie einmal nicht strickten, kümmerten sie sich um die Verteilung der Ernte an die Bedürftigen, die sie zum Selbstkostenpreis kauften.
Stella war quasi das Mädchen für alles. Sie half mit, wo eine Hand oder zwei gebraucht wurden, sie grub die Erde um, pflanzte, wässerte, hegte und pflegte und erntete. Sie verbrachte viel Zeit mit Janet und philosophierte mit ihr über Gott und die Welt sowie über die Hege und Pflege von wilden Bienen.
Er wunderte sich selbst, wie offen ihn die Gruppe empfangen hatte und wie viel sie von sich preisgaben. Stella hatte ihn des Öfteren taxiert, so als fragte sie sich, ob sie das Richtige getan hatte, als sie ihn in die Gruppe einlud. Er hatte ihr beruhigend zugelächelt und aufmerksam den Geschichten gelauscht und die Mitglieder der Gruppe beobachtet. Er hatte mit ihnen gelacht und geschmunzelt. Etwas, das ihm anfangs schwerfiel, mit der Zeit aber immer leichter wurde.
Als er sich schließlich verabschiedete, murmelte Stella noch einmal den Satz, der ihn schon einmal an diesem Tag irritiert hatte: »Du bist der Funke.«
Rufus schloss die Tür seines neuen Appartements auf, dass so ganz anders aussah als die Wohnung, in der seine Mutter ihn alleinstehend großgezogen hatte, und die er auch mit seinen zweiunddreißig Jahren noch nicht verlassen hatte. Er war einfach bei seiner Mutter geblieben, die trotz ihres und seines Alters ihm immer noch alles hinterhertrug, die Wäsche machte, das Essen kochte und ihn umsorgte, als ob er nicht längst schon erwachsen gewesen wäre. Dann kam der Krebs, erschreckend schnell raffte er Margret Orer vom Antlitz der Erde, und ließ ihren Sohn allein zurück.
Rufus stand im Flur und sah sich um. Hier war alles modern und clean, skandinavischer Stil, mutmaßte er. Nicht so angemufft wie die alte Wohnung. Hier roch es nicht nach Weißkohl oder Rouladen, Zigarettenqualm und dem billigen Parfüm seiner Mutter. Aber wenn er jetzt daran dachte, dann wollte er genau dorthin zurück. Dort, wo Margaret aus dem Nebenzimmer rief: »Lass mal liegen, Jung’, ich mach das gleich.« Die Einsamkeit kroch ihm den Nacken hinunter, breitete sich eisig über den Rücken aus, weshalb er einmal schlucken musste. Rufus wischte sich über die Augen, holte tief Luft und straffte die Schultern. Margaret hatte ihm zu diesem Appartement verholfen. Deswegen sollte er es schätzen und sich hier verdammt noch mal wohlfühlen. Das war er ihr schuldig.
Er ging in die Küche, die minimalistisch eingerichtet war und steril glänzte. Der Vorteil dieses Appartements war die Zugehfrau, die den Laden in Schuss hielt. Sozusagen eine Ersatz-Margaret. Er ging an den Kühlschrank und entnahm ihm eine Dose Karotten-Ingwer-Suppe. Isobel, besagte Zugehfrau, hatte am Montag für die Woche gekocht und ihm seine Mahlzeiten etikettiert in den Kühlschrank gestellt. Das war schon praktisch. Nachdenklich stellte er den Topf in die Mikrowelle und erhitzte die Suppe. Danach nahm er immer noch abwesend den Topf wieder heraus, verbrannte sich die Finger, griff zu einem Handtuch, das er um den Topf schlang, und wanderte ins Wohnzimmer, wo er seine Mahlzeit auf den Couchtisch stellte und sich selbst auf das Sofa warf. Da saß er nun, die Beine breit auseinandergeklappt, die Arme auf der Rückenlehne ausgebreitet, und wartete darauf, dass die Suppe abkühlte.
Er sah sich in dem Raum um. Neben dem riesigen Fernseher, der an der gegenüberliegenden Wand hing, stand das Equipment – über Spielekonsolen, Tablet, Notebook und anderem Schnickschnack stand dort auch der Kommunikationswürfel. Er runzelte die Stirn. Dann rief er: »Power on – wähle die Nummer 82 66 71 99 640 – Lautsprecher aktivieren.«
Der Apparat tat wie ihm geheißen und schon einen Moment später meldete sich eine tiefe Männerstimme.
»Ja?«
»Viggo? Können wir reden?«
»Ja, sicher, Rufus. Hast du Neuigkeiten?«
»Ich habe mit einer von denen gesprochen. Sie hat mir ihre Parzelle gezeigt.«
»Das sind hervorragende Neuigkeiten. Ich hätte schon fast gedacht, dass die Aufgabe zu groß für dich ist. Aber du enttäuschst mich nicht. Gut gemacht.«
»Bleibt es bei dem Treffen morgen?«
»Auf jeden Fall. Du musst mir alles erzählen, was du herausgefunden hast.«
»Ich muss das Ganze noch sortieren, mir dröhnt der Schädel. Aber keine Sorge, ich werde pünktlich sein.«
»Das habe ich auch nicht anders erwartet, Junge.« Ein sonores Lachen, kurz und präzise, dann klickte es und das Gespräch war beendet.
Rufus wandte sich seiner Suppe zu, stellte fest, dass sie nur noch lauwarm war, und schaufelte die cremige, orangefarbene Konsistenz in sich hinein. Danach blieb er auf dem Sofa sitzen, schloss die Augen und schlief ein. Es war ein langer Tag gewesen. In seinen Träumen wechselten sich Tomatenpflanzen ab mit Fällen, die er bis vor Kurzem als Kundendienstmitarbeiter zu bearbeiten hatte. Dabei erschienen ihm immer wieder die Gesichter der Guerilla Gardeners. Und im Mittelpunkt strahlte das Lächeln ihrer Gaja. Irgendwie erinnerte Janet ihn an seine Mutter. Rufus lächelte, bevor er in den Tiefschlaf fiel. Dann umgab ihn eine wohltuende Schwärze.
Kapitel 2
Sinneswandel
Die ›Evergreen Terrace‹ war eine von sieben Vertical Farming Units in Basingstoke and Deane, eines Bezirkes in den North Downs, der in den letzten Jahrzehnten derart gewachsen war, dass er inzwischen den Fluss Loddon überquert hatte. Inzwischen schlängelte der sich durch das Herz der Stadt und stellte somit nicht mehr die einstige Begrenzung in Richtung London dar. Es würde sicherlich nicht mehr lange dauern, bis Basingstoke sich noch weiter gen Osten reckte und sich den Ausläufern der Hauptstadt anschließen würde. Die neuen Pläne wurden bereits seit Jahren in der Town Hall geschmiedet.
…Evergreen Terrace‹ war der größte Komplex seiner Art. Das dazugehörige Stadtviertel war das größte Gebiet in Basingstoke. Es handelte sich hier um das von der Stadtplanung neu kartografierte Herz der Stadt, und so musste es nicht nur viele Mäuler stopfen, sondern gleichzeitig seine Rolle als Prestigeobjekt erfüllen. …Evergreen Terrace‹ war im Gegensatz zu den sechs jüngeren achtzehnstöckigen VFUs der restlichen Stadtteile, eine alte Reihenhaussiedlung – wie sein Name schon sagte. …Evergreen Terrace‹ nahm einen ganzen Straßenzug ein. Es hatte sich wie ein wuchernder, grüner Pilz über die Häuser gelegt, die ursprünglich Wohnhäuser waren. Sie waren nun entkernt, saniert und mit neuester Technik versehen. Dieser Komplex sollte die Grundversorgung der Bürger mit Obst und Gemüse, Single-Protein-Fleisch und Algen sicherstellen. Und so gab es neben den einzelnen Themenkomplexen auch ein Verwaltungshaus, in dessen zweiten Stock ein Mann die Produktion, das Gedeihen und Bestreben von …Evergreen Terrace‹ konzertierte.
Viggo Carver war ein Mann, dessen Alter nicht auf den ersten Blick zu bestimmen war. War er fünfzig, sechzig oder schon siebzig? Das war schwer zu sagen. Sein Haar war noch voll und nur an den Seiten von einigen silbernen Strähnen durchzogen. Ansonsten war es dunkel, fast schwarz. Er trug einen sorgfältig gestutzten Bart, der ebenfalls so ebenmäßig dunkel war, dass man im Geheimen munkelte, ob er sich seinen Bart würde färben lassen. Dabei kam aber niemand auf die Idee, Viggo für einen eitlen Stutzer zu halten. Der ein Meter neunzig große Mann, breit gebaut, aber nicht dick, strahlte derart viel Männlichkeit aus, dass die Frauen sich hingezogen fühlten und die Männer ihn sich lieber zum Freund wünschten. Seine Stimme war tief und volltönend, je leiser sie wurde, desto gefährlicher wurde es. Ja, Viggo war ein wandelndes Klischee und es war ihm egal, was sein Gegenüber von ihm hielt. Sein Selbstbewusstsein reichte stets über die Tischkante hinaus.
Und hinter diesem Tisch saß er auch an dem Tag, an dem er Rufus Orer erwartete, der Junge, der ihm gestern bereits die frohe Kunde gebracht hatte, auf die er seit Wochen wartete.
Viggo lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück, legte die Fingerspitzen vor der Brust aneinander und dachte nach. Dabei besah er sich die Sukkulente, die auf seinem Tisch stand. Ihre fleischigen grünen Blätter mit dem mehligen Beschlag regten seine Gedanken an. Wenn er sich auf das Herz der Pflanze fokussierte, konnte er dabei Pläne schmieden wie in keiner anderen Situation.
Nun sollte er aber beim Denken gestört werden. Ein Klopfen an der Tür ertönte und Susan Herzog schob ihren rot gelockten Schopf ins Zimmer.
»Sig ist hier. Er muss dich sprechen. Hast du Zeit für ihn?«
Viggo richtete sich auf. »Ja, er soll hereinkommen.«
Susan nickte, lächelte und ließ die Tür ganz aufschwingen. »Rein mit dir, Sig.«
Sig trat in das Büro des Bosses, stellte sich vor den Schreibtisch und verschränkte die Finger seiner Hände hinter dem Rücken.
»Setz dich doch, Sig.« Ein gepflegter, manikürter Zeigefinger an dessen Wurzel ein Siegelring prangte, deutete auf den Stuhl vor dem Tisch. »Mach es dir gemütlich.«
Sig setzte sich und streckte die Beine von sich.
»Was hast du auf dem Herzen?«
Der leitende Wachmann fuhr sich mit der Rechten durch das Gesicht, massierte sich kurz die Nasenwurzel und richtete sein Käppi. Dann räusperte er sich und sah Viggo an. »Die Wasserrationen fallen wieder einmal geringer aus als vorgesehen. Mercer hat es mir erzählt, nachdem die Stadtwerke ihm gesagt haben, dass sie alles Wasser nach dem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt hätten. Aber, Sir, es ist langsam nicht mehr zu übersehen. Einige Pflanzen beginnen schon, zu verkümmern.«
»Und das hat dir alles Mercer erzählt?«
Sig nickte. Viggo lehnte sich zurück.
»Mercer ist ein Angsthase. Sobald ein Blatt fällt, sieht er die gesamte Produktion in Gefahr.«
»Wehret den Anfängen!«, erlaubte sich Sig, einzuwerfen.
Viggo strich sich über den Bart. »Nun, dann solltest du hierbleiben. Gleich kommt der junge Orer. Er scheint seine Aufgabe inzwischen zu meistern. Interessiert an seinen Informationen?«
Sig zog die Beine an und setzte sich ordentlich hin. Er lehnte sich leicht nach vorne und verengte die Augen. »Worum geht es hier?«
»Ach, Sig, Sig« Viggo lachte leise. Dann richtete er sich auf und stützte seine Hände an der Schreibtischkante ab. »Schon mal was von den Guerilla Gardeners gehört?«
Sig schüttelte den Kopf.
»Dann vielleicht von den vom Glück Verdorbenen?«
»Ach, die Hippies?« Sig sah fragend zu Viggo.
»Genau die. Ich will wissen, was die genau treiben. Was? Wann? Wie? Womit?«
»Aber warum, Sir?«
»Nun, Mercer stellt fest, dass das Wasser verknappt wird. Ich stelle fest, dass uns die Unterprivilegierten als Einnahmequelle wegbrechen. Noch nicht besorgniserregend, aber«, er lächelte wölfisch, »wehret den Anfängen!«
»Die sollen schuld sein? Aber wie?«
»Stellen wir uns mal ganz dumm. Was machen Gärtner? Richtig, sie bauen Gemüse, Obst und alles Mögliche an, vielleicht auch Drogen. Dafür brauchen sie Wasser – unseres vielleicht? Und was machen sie mit ihrer Ernte? Bauen sie nur für den Eigenbedarf an? Was wenn nicht, und sie verkaufen es an die armen Schweine? Wem schaden sie dann?«
Sig nickte langsam. »Uns.«
»Genau.« Viggo erhob sich und wanderte um den Schreibtisch herum. Schließlich lehnte er sich gegen dessen Vorderfront, schob die Hände in die Taschen und wartete.
Sig wusste nicht, ob er sich auch erheben sollte oder nicht, da ertönte erneut ein leises Klopfen und Susanns rote Locken tauchten im Türrahmen auf.
»Rufus Orer ist hier. Soll er noch warten?«
»Nein, nein, schick ihn zu uns. Sig soll bei der Besprechung dabei sein.«
Susan lächelte, öffnete die Tür und winkte Rufus zu, einzutreten.
Rufus, nur ein wenig kleiner als Viggo, aber sehr viel schmaler und bei Weitem nicht so eindrucksvoll, betrat das Büro. Er war nun schon öfter hier gewesen, allerdings schüchterten ihn das altersdunkle Holz, die schweren Chesterfield-Clubsessel und die beiden Sofas der gleichen Bauart mit ihrem knarzenden Leder immer noch ein. So stand er verloren da. Als er Viggo sah, kroch ein zögerliches Lächeln über sein Gesicht und er nickte dem Älteren zu.
»Guten Tag, Sir. Da bin ich, wie besprochen.«
»Deine Pünktlichkeit beeindruckt mich. Aber sag, wollen wir uns nicht rübersetzen? Da lässt es sich doch viel besser reden. Und wir haben doch etwas zu besprechen, nicht wahr, Rufus?«
Der nickte erneut und eilte zu dem Sofa, das dem Fenster zugewandt war. Einen Moment später bereute er seine Wahl, denn die Sonne schien ihm ins Gesicht. Die Gesichter der ihm gegenübersitzenden Viggo und Sig lagen dagegen im Gegenlicht. Sie waren in Schatten gehüllt und kaum lesbar.
Viggo lehnte sich vor. »Willst du mir jetzt ausführlich erzählen, was du mir gestern Abend angedeutet hast?«
Rufus schluckte. »Warum ist er hier?« Rufus kannte Sig bereits, zwar nicht vom Namen her, aber er war schon einmal von ihm aus dem Gebäude befördert worden, als er Viggo das erste Mal aufgesucht und den rechten Zeitpunkt zum Gehen nicht gefunden hatte.
»Sig ist meine rechte Hand. Leiter der Security. Und bevor ich alles zweimal erzähle, kann er auch mithören. Zeit ist Geld, verstehst du?«
Rufus nickte. Dann lehnte er sich zurück und erzählte von den letzten drei Wochen. Wie er Stella zum ersten Mal gesehen hatte. Als er intuitiv spürte, dass sie sein Schlüssel werden würde. Wie er sie ausgespäht hatte. Und wie sie ihn gestern dann in ein Gespräch verwickelt und zu ihrer Gruppe mitgenommen hatte.