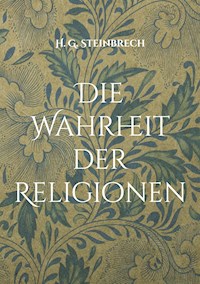
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Solange der Mensch existiert, fragt er nach dem Sinn seiner Existenz und kleidet seine Erkenntnisse und Erfahrungen in Lehraussagen. Dabei konkurriert der Glaube an einen Schöpfer des Kosmos - mit dem rein auf die Materie ausgerichteten atheistischen Lebensprinzip. Welche Auffassung jedoch der Wahrheit in der Welt entspricht und ob wir sie überhaupt begreifen können, das versucht der Autor durch Betrachtung verschiedener Lebensbereiche und der bekanntesten religiösen Lehrmeinungen zu erläutern. Vom Wesen des Menschen ausgehen, wird anhand etlicher Zitate der Begriff der Religion aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und der Leser an eine eigene Meinungsbildung herangeführt. Wie schwer eine Meinungsbildung aber ist, zeigen die Ausführungen in Bezug auf Dialektik, Weltbilder, Rechtsnormen und Naturgesetze, einschließlich der Auswirkung auf die Philosophie. Dem All so gegenübergestellt, wird das Fenster zu dem Bereich geöffnet, der hinter dem physikalischen Sein gelegen ist. Eine Betrachtung der Welt des Geistes und der Geistererläuterung nicht nur die Frage nach dem Vorhandensein von Engeln und Teufeln, sondern setzt sich auch mit den außerkörperlichen Existenzmöglichkeiten des Menschen auseinander. Eine Rückkoppelung dieser Gedankengänge ermöglicht nunmehr einen verständnisvolleren Einblick in das Wesen der großen Weltreligionen. Die neben transzendenten Lehrmeinungen auch stets kulturpolitische Züge aufweisen, ohne jedoch, aus unserem heutigen Wissen erklärt. Von ihren großen Bedeutungen für uns Menschen etwas verloren zu haben. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die menschlichen Unzulänglichkeiten wie Machtgier und Egoismus gerichtet. Die letztlich auch zu den bekannten Auseinandersetzungen zwischen den monotheistischen Religionsformen wie Judentum, Christentum und Islam geführt und darüber hinaus noch die Spaltungen dieser Religionen verursacht haben. Soweit dies nicht durch den Einfluss fremder Kulturformen ausgelöst wurde. Die Lektüre dieses Buches wird den Leser bald zu der Auffassung bringen, dass es erst die Beschäftigung mit den heiligen Schriften ermöglicht, den eigentlichen Wahrheitsgehalt aus den einzelnen Religionsformen herauszuschälen. Der damit mobilisierte Glaube lässt uns Menschen die Freiheit im Lichte des absoluten Seins erleben und ermöglicht das Ja zur Schöpfung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Mensch und Religion
Wahrheit und Dialektik
Religion, Weltbild und Weltanschauung
Recht, Gesetz und Strafe
Meilensteine in der Entdeckung von Naturgesetzen und ihre Auswirkung auf die Philosophie
Bedeutende Wissenschaftler (Zeittafel)
Mensch und Kosmos
Im Bereich der Metaphysik
Von Engeln, dem Teufel und anderen Geistern
Leben und Tod
Monotheismus und Polytheismus in den frühen Religionen
Der Einfluß Persiens auf das monotheistische Gedankengut
Die geistige Konzeption des Fernen Ostens
Vom Brahmanismus zum Hinduismus
Der Yoga
Buddha und seine Lehre
China
Der Shintoismus
Das Judentum
Das Christentum
Der Islam
Wert und Bedeutung des Kultes
Freiheit durch Glauben
VORWORT
Karl Jaspers hat einmal gesagt, daß niemand die Wahrheit hat, und daß wir alle die Wahrheit suchen. Obgleich in ihren Lehraussagen verschieden, behaupten alle Religionsgemeinschaften von sich, als einzige diese Wahrheit zu besitzen und zu lehren. Das impliziert aber einen Widerspruch, und wenn man Wahrheit nicht relativieren will, stellt sich die Frage, ob es wirklich eine Religion gibt, die ihrem Anspruch voll gerecht wird, oder ob man aus den einzelnen religiösen Lehrgebäuden jeweils nur bestimmte Sätze herausnehmen und zu einem Mosaik der Wahrheit zusammenstellen muß. Eine solche Möglichkeit wie die zuletzt genannte darf nicht ausgeschlossen werden, wenn man davon ausgeht, daß alle Religionen den gleichen Ursprung haben, jedoch falsche Überlieferungen, Fehlinterpretationen und Übersetzungsfehler zu Unterschieden in den Aussagen der einzelnen Religionen geführt haben.
Lohnt es sich aber überhaupt für den einzelnen Menschen, nach dieser Wahrheit des Seins zu forschen? Ein volles Ja kann nur die einzig mögliche Antwort sein, weil wir schließlich alle wissen wollen, welcher Sinn unserem
Leben zugrunde liegt und zu welchem Ziel wir streben. Die hier vorliegende, freilich begrenzte Bestandsaufnahme soll dem nach Wahrheit suchenden Menschen Wege zu einer Erklärung des Lebenssinnes und einer Begründung für seine Existenz aufzeigen. Wer sich mit diesem Thema beschäftigt, muß jedoch auch bereit sein, sich zunächst von aller religiösen Autorität zu lösen; nicht, um sich grundsätzlich gegen sie zu stellen, sondern um zu prüfen, ob die Aussagen und Lehrmeinungen einer betreffenden Religion auch für jedermann zu jeder Zeit und in jeder Situation akzeptabel sind.
Da wir aber auch Religionsgemeinschaften begegnen, die sich trotz scheinbarer Unausgewogenheit ihres Lehrgebäudes und offensichtlich Widersprüche gegenüber anderen Religionen auf eine göttliche Offenbarung berufen, muß auch der Frage nach der Existenz Gottes und der Möglichkeit, ihn zu erkennen, nachgegangen werden.
Die Auswirkungen der Religionen auf das alltägliche Leben konnten bei den vorliegenden Betrachtungen genauso wenig ausgeschlossen werden wie die Wesenheit des Menschen.
Vorwort des Herausgebers
Viele Jahre habe ich mit mir gerungen und die Tragik erkannt. Dieses unbekannte Werk wird ohne Zutun in den Antiquariaten verschwinden und die Erkenntnisse des Verfassers in Vergessenheit. Somit spielt die Vergangenheit merklich immer eine Große Rolle in unsere Gegenwart. Die Zusammenstellung dieses Buchs basiert, nach meinen Ansichten, aus dem störrischen Verhalten eines gelangweilten Ingenieurs, dem mehr Zuzutrauen war als diese materialistische Welt zu vermessen oder Bewertungen abzugeben.
Der klassische Dilettant zeigt hier Zusammenhänge, die auch für die ausführenden Arbeiter verständlich werden, die gerade die Grube graben, in die Ihr Auftraggeber bald selbst hineinfällt.
Ein weiteres Verlangen in mir ist es, keine weiteren Anmerkungen zu geben. Das Buch spricht für sich selbst und die Freude zur Liebe die Erkenntnisse zu teilen.
Viel Erfolg.
Peter Boge
MENSCH UND RELIGION
Die Beziehungen des Menschen zur Religion sind nicht ohne Problematik, weil dabei Seinsformen angesprochen werden, die sich außerhalb der Reichweite unserer Sinnesorgane befinden. Religionen wollen und sollen uns aber den Weg zu dem weisen, was noch außerhalb der materiellen Umwelt vorhanden ist. Denn nur, wenn wir die sinnhafte, erfaßbare Welt mit dem Außersinnlichen verbinden, können wir zum universellen Kosmos und damit auch zu uns selbst finden.
Die Schwierigkeit aber, etwas ohne unsere fünf Sinne zu erkennen, bringt eine Unsicherheit zum Vorschein, die - sehen wir einmal von einer echten metaphysischen oder jener oft zur Schau gestellten heuchlerischen Frömmigkeit ab - unsere Einstellung gegenüber einer Religion durch Angst, Gleichgültigkeit oder Gegnerschaft bestimmt. Ich wage zu behaupten, daß dem nicht so wäre, wenn wir uns die eigentliche Bedeutung des Begriffes Religion bewußt machten. Wir würden nämlich dann wahrscheinlich sowohl unsere Einstellung zur Religion des eigenen Kulturkreises revidieren, als auch fremde Religionen besser verstehen. Weil wir Menschen aber allzu oft dazu neigen, Begriffsinhalte durch Schlagworte zu erläutern und damit zu verkürzen, gelangen wir zu falschen Vorstellungen und folglich auch zu falschen Urteilen.
Karl Marx (1818-1883) schrieb in seinem Aufsatz „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ (1843), der ein Jahr später in den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ abgedruckt wurde:
„Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.“
Entgegen dieser totalen Negation des Religionsbegriffes äußerte sich Kaiser Wilhelm I. (1797-1888) am 23. August 1876 auf dem Bahnhof zu Züllichau vor der dort versammelten protestantischen Geistlichkeit dahingehend, daß Religion dem Volke erhalten bleiben müsse. Zur Begründung dieses Satzes könnte man sich Arthur Schopenhauers (1788- 1860) Auffassung anschließen, daß Religion die Krücke für eine schlechte Staatsverfassung sei.
Doch sollte man sich auch überlegen, ob nicht Immanuel Kants (1 7241804) Darstellung der Religion als die Erkenntnis aller unserer Pflichten als göttliches Gebot die moralische Belebung der Schopenhauerschen „Krücke“ darstellt, oder ob wir in einer Religion die aus der uns zur Verfügung stehenden geistigen Freiheit erkennbaren Verhaltensnormen sehen, auf die wir unser Leben aufbauen und die uns Antwort geben auf die Fragen nach Ursache und Sinn unseres Seins.
Selbst für den deutschen Kaiser Friedrich II. (1194-1250), in dem die damaligen Päpste wegen seiner betont rationalen Haltung den vor dem Weltende erscheinenden Antichristen sahen, war Religion der tragende Pfeiler, der den Weiterbestand der Gesellschaftsordnung sichert. Es ist zu vermuten, daß wir Menschen die einzigen Lebewesen auf Erden und vielleicht auch im Weltraum sind, die nach dem Grund ihrer Existenz, nach dem Lebenssinn fragen können und auch fragen. Für die Suche nach einer Antwort bieten sich scheinbar zwei Wege an. Der eine Weg führt über die verstandesmäßige Erkenntnis der Problematik und stellt mit dieser Ratio den fragenden Menschen dem Kosmos gegenüber, während der zweite Weg aus einer Welterfahrung außerhalb der Ratio in unmittelbarer Erkenntnis durch reine Intuition besteht.
lm ersten Falle existiert ein großes Angebot an Systemen in Form von philosophischen Denkgebäuden auf der Basis naturkundlicher Erkenntnisse, im anderen wollen uns verschiedenartige Religionen, deren Herkunft sich mitunter im Dunkel der Menschheitsgeschichte verliert, den Weg weisen. Aber in keinem der Fälle begegnen wir einer einheitlichen Aussage, sondern müssen uns mit Widersprüchen auseinander- setzen, die aus zumindest unklaren oder unzureichenden, wenn nicht gar unrichtigen Darstellungen erwachsen sind. Aus diesem, wie ein lrrgarten erscheinenden Gewirr an Barstellungen und Gegendarstellungen gilt es, den richtigen Weg in die klare Luft der Wahrheit zu finden.
Vor dem Versuch, die wesentlichsten Aussagen einzelner Religionen darzulegen und gegen die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung abzugrenzen, möchte ich zunächst einige allgemeine Überlegungen über den eigentlichen Begriffsinhalt und seine Zuordnung zum Menschen anführen. Ein Blick auf die Weltkarte mit den Ausbreitungsgebieten der verschiedenen Religionen läßt das Christentum als die am weitesten verbreitete Religion erkennen. Aber auch die großen Gebiete, deren Bewohner sich zur Lehre Mohammeds bekennen, rechtfertigen für den Islam den Titel einer Weltreligion. Die gleiche Bedeutung ist dem Hinduismus sowie den Lehren von Buddha und Konfuzius zuzumessen, wenngleich sich die letztgenannten Gruppen hauptsächlich auf den ostasiatischen Raum konzentrieren. Nicht vergessen werden in dieser Aufzählung sollte das Judentum, das mit einer zahlenmäßig geringen Anhängerschaft über das ganze Erdenrund Verbreitung gefunden hat.
Neben den genannten großen Verbreitungsgebieten gibt es Landstriche, in denen verschiedene, meist regional begrenzte Religionsgruppen vorherrschen, die gewöhnlich als heidnische oder Naturreligionen bezeichnet werden, weil bei ihnen eine Offenbarung durch Gott selbst oder einen Mittler, vielfach als Prophet bezeichnet, nicht direkt nachweisbar ist. Aber schon eine solche Unterscheidung darf zu keiner Wertung führen, solange nicht geklärt ist, auf welchem Wege dem Menschen eine göttliche Offenbarung zuteil werden oder eine Gotteserkenntnis erfolgen kann.
Man darf bei der Betrachtung der verschiedenen Religionen nicht außer acht lassen, daß die sogenannten Naturreligionen, die ich treffender als regionale Religionsgruppen bezeichnen möchte, immerhin 36,6% der Weltbevölkerung ausmachen, während das Christentum als die zahlenmäßig stärkste Religionsgruppe mit allen seinen verschiedenen Konfessionsgemeinschaften nur 29% der Weltbevölkerung erfaßt hat. Auch eine solche statistische Beschreibung kann kein Wertmaßstab sein, weil sich hieraus nicht ablesen läßt, wie stark das Leben des einzelnen Menschen durch eine Religion geprägt ist, da die Bandbreite der Einstellung zur jeweiligen Religion von tiefster Frömmigkeit bis zum scheinbar totalen Nihilismus reicht.
Denn in allen Rassen, Gesellschaftsschichten und Altersgruppen sind Menschen zu finden, die sich einer Religion total verpflichtet fühlen, und andere, die für religiöse Fragen keine Antenne zu haben scheinen oder zumindest nach außen hin Gleichgültigkeit zeigen.
Im Gegensatz zur heutigen Situation waren bis in das zwanzigste Jahrhundert hinein die kulturellen und moralischen Handlungen des Menschen in erster Linie durch seinen Gottesglauben bestimmt, dessen Form und Inhalt die gesetzmäßigen Ge- und Verbote begründet haben. Auch heute noch ist der überwiegende Teil der Menschheit davon überzeugt, daß der Verstoß gegen solche Gesetze nicht nur im Jenseits Strafen nach sich zieht, sondern auch Unglück und Missgeschick im diesseitigen Leben zur Folge haben kann. Dazu kommt nicht selten noch eine direkte Bestrafung durch die menschliche Gemeinschaft, die sich bewogen fühlt, den Verstoß gegen eine religiöse Satzung im sich selbst erteilten Auftrag eines in ihren Vorstellungen lebenden Gottes rächen zu müssen.
Darüber hinaus bleibt für viele Mitmenschen unverständlich, daß bei einem gottgefälligen Lebenswandel - was man auch immer darunter verstehen mag - nicht immer irdisches Glück, sondern meist nur eine Belohnung im Jenseits in Aussicht gestellt ist. Spätestens hier beginnen dann viele Menschen an der lauteren Aussage einer Religion zu zweifeln. Solche Zweifel jedoch können nur überwunden werden, wenn die Antwort aus dem Innern des Menschen auf dem Nährboden wahrer Erkenntnis erwächst. Wo solcher Nährboden fehlt, wird aus dem Zweifel Verzweiflung;
Das Näherrücken der Kulturkreise in unserem Jahrhundert durch die technischen Entwicklungen vor allem auf dem Gebiete der Wirtschaft und der Kommunikationsmittel, sowie die damit verbundene Mobilität der Weltbevölkerung hat manchen Menschen zu einer Inventur seiner religiösen Vorstellungen veranlaßt oder gar aus dem Fundament eines echten religiösen Lebenswandels herausgerissen.
Die Verschiedenheit der Religionen läßt den Schluß zu, daß Religionen an Kulturkreise gebunden sind. Dabei ist es unerheblich, ob eine bestimmte Kultur eine bestimmte Religion hervorbringt, oder ob Religionen kulturprägend sind. Es bleibt auch abzuwarten, ob bei zunehmender Technisierung die Religionen, dem Schicksal der Kulturen folgend, zu einer wie auch immer gearteten Einheitsform zusammenschmelzen oder aber durch die Erkenntnisse der Wissenschaft alle nicht Materie bedingten Bindungen des Menschen gelöst werden. Ein Zusammenschmelzen der Religionen, die ja alle für sich alleine den Anspruch auf volle objektive Wahrheit erheben, ist aber nur möglich, wenn jede Lehre sich auf den Kern ih - rer Wahrheit besinnt und sich von allem unwahren und irreführenden Ballast trennt.
Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik hat ohne Zweifel den menschlichen Horizont erweitert. Wir sehen heute nicht nur tiefer in den Weltenraum (Makrokosmos) und in die kleinsten Bestandteile der Materie (Mikrokosmos) hinein, sondern haben auch die Aussagen anderer - vorhandener und untergegangener - Kulturkreise und Religionen zusammengetragen. Dieses gewaltige Informationsmaterial ist von uns nicht nur wissenschaftlich, sondern auch seelisch zu verkraften. Da jede Religionsgemeinschaft von sich behauptet, die einzig richtige Lehre zu vertreten, und etliche Gemeinschaften, die die Nicht-Existenz Gottes propagieren, eben falls von der Richtigkeit ihrer Thesen überzeugt sind, bleibt dem fragenden Menschen nur übrig, seine Einstellung zur Religion und damit zu Gott individuell zu überprüfen und als seine ureigene Angelegenheit zu betrachten.
Denn gerade in der Individualität wird der Mensch zur Antwort auf die Frage nach seiner Existenz und nach seinen Beziehungen zur Außenwelt, zu seinem Nicht-Ich, herausgefordert. Er muß um seiner selbst willen antworten, er muß sich verantworten. Für dieses Antworten muß der Mensch frei sein von jedem äußeren und inneren Zwang. Dazu gehört es auch, bisherige Stand- punkte gegebenenfalls zu revidieren, Gedanken zu aktivieren und Begriffe zu klären. Vor allem müssen wir zu der Frage Stellung nehmen, ob der Mensch sich wirklich frei entscheiden kann, oder ob sein Handeln nur Reaktion auf eine vorgegebene Situation ist. Denn in vielen Fällen ist unsere Entscheidungsfreiheit durch andere Menschen bedroht, oder sie wird gar eingeschränkt, wenn wir uns dem nicht widersetzen. Viel zu oft gehen wir Entscheidungen aus dem Wege und zeigen uns kompromissbereit, vor allem, wenn es um unser religiöses Verhalten geht. Dramatisch wird es, wenn wir uns zwischen göttlichen und menschlichen Gesetzen entscheiden müssen.
Die Schwierigkeit liegt hier vor allem darin, daß in den Religionen göttliche Gesetze nicht eindeutig als solche zu erkennen sind. Denn wir müssen uns klar darüber sein, daß nicht alle Lehraussagen einer Religion göttlichen Ursprungs sind. Wir sollten uns aber auch davor hüten, von einigen wenigen Fehlaussagen ausgehend, eine Religion in ihrer Ganzheit als unwahr von uns zu weisen.
Es ist einleuchtend und wird wohl von niemandem bestritten, daß es ohne Mensch keine Religion geben kann. Fraglich ist es nur in der Umkehrung. Gibt es ein wahres Menschsein ohne Religion? Was aber ist Menschsein? Was ist eigentlich Religion? Heinrich Heine (1797-1856) zum Beispieltritt für eine strenge Trennung von Religion und Wissenschaft sein. In seiner Abhandlung „von Luther bis Kant“ schreibt er: „Von dem Augenblick an, wo Religion bei einer Philosophie Hilfe begehrt, ist ihr Untergang unabweislich.“ Für Kant ist Religion die Erkenntnis aller unserer Pflichten als göttliche Gebote. So jedenfalls äußert er sich in seiner Abhandlung: „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.“ Der um 1800 lebende Dichter Jean Paul (1763--1825) schrieb in seiner barock verschnörkelten und bildreichen Sprache zur gleichen Fragestellung:
„ Was ist Religion? - Sprecht die Antwort betend aus: Der Glaube an Gott; denn sie ist nicht nur der Sinn für das Überirdische und das Heilige und der Glaube ans Unsichtbare, sondern die Ahnung dessen, ohne welchen kein Reich des Unfaßlichen und Überirdischen, kurz, kein zweites Universum nur denkbar wäre.“
Otto von Bismarck (1815-1898) äußerte sich zum Thema „Mensch und Religion“ am 8. September 1870:
„ Wie man ohne Glauben an eine geoffenbarte Religion, an Gott, der das Gute will, an einen höchsten Richter und an ein zukünftiges Leben, zusammen leben kann in geordneter Weise, das Seine tun und jedem das Seine lassen, begreife ich nicht. “ -
Sucht man in einem Lexikon nach einer Erläuterung des Religionsbegriffes, so wird Religion definiert als das Wissen von einer uns beherrschenden, übersinnlichen Macht, die Gott genannt wird, und das aus diesem Wissen resultierende praktische Verhalten. An einer anderen Stelle wird Religion erklärt mit dem totalen Engagement des Menschen für eine Wirklichkeit, die als letzter und absoluter Grund erlebt wird, in der das Seiende im Ganzen transzendiert, womit die Entscheidung über den Sinn des Seienden im Ganzen fällt. Es ist jedoch falsch, Religion nur als ein gedankliches, also rationales, Anerkennen einer Gottheit zu betrachten. Denn es gehört als ein wesentlicher Bestandteil das Gefühl zur Verbundenheit mit jener Macht, die auch außerhalb unserer sinnenhaften Welt besteht. So gesehen ist Religion aber auch nicht nur als ein formelles, anerzogenes Kultverhalten zu betrachten; denn in den sakralen Handlungen soll sich der Weg öffnen zu der Erkenntnis des Seins außerhalb unserer sinnhaften Welt und eine Beziehung zum Ewigen geknüpft werden. Religion soll eine Ahnung von dem vermitteln , was wir Gott nennen.
Mit der auf einer Weltanschauung begründeten Lehre von ethischen, also von der menschlichen Gemeinschaft gesetzten, Normen im Verein mit den erkennbar gemachten Gesetzen der absoluten und ewigen Wahrheit bestimmt eine Religion Wege und Ziel des menschlichen Handelns. Der Einfluß von Weltanschauungen und Ethik aber ist die Ursache aller jener Irrtümer, die sich in religiöse Lehren eingeschlichen haben, von denen keine bisher in der Menschheitsgeschichte bekannt gewordene Religion frei geblieben ist.
Auf der Suche nach dem Ursprung des Wortes „Religion“ fand ich in einem alten lateinischen Wörterbuch unter dem Stichwort “religio“ folgen-de Erläuterung: `
„Religio“ ist der Zustand dessen, der wiederholt mit sich zu Rate geht, um zu sehen, ob seine Gedanken und Handlungen mit menschlichen und göttlichen Gesetzen übereinstimmen.
Auf das Menschliche bezogen heißt das Gewissenhaftigkeit, auf das Göttliche bezogen bedeutet es Heilighaltung des Göttlichen, Gottesfurcht.
Diese einfache und klare Definition sollte man bei wiederholtem Lesen auf sich wirken lassen. Ich halte das Wiederholt-mit'-sich-zu-Rate-Gehen für einen wesentlichen Bestandteil religiösen Handelns. Schwierigkeit bereitet dabei jedoch die Tatsache, daß die menschlichen und göttlichen Gesetze,wie Geschichte und Gegenwart zeigen, selten miteinander in Einklang stehen. Daher ist es angebracht, die drei Begriffe Mensch, Gesetz und das Göttliche auf ihren Inhalt hin näher zu untersuchen. Damit werden die Beziehungen des Menschen zur Religion übergeleitet auf die Beziehungen des Menschen zu den einzelnen Gesetzen, die sich in göttliche und menschliche aufteilen. Doch bevor wir uns den Gesetzen als Bezugsobjekt hinwenden, ist es erforderlich, daß wir uns der Wesenheit Mensch zuwenden und versuchen, den Standort des Menschen in der Welt, also im universalen Sein, zu bestimmen.
Schon bei der Definition des Begriffes Mensch zeigen sich auf Grund der verschiedenartigen Weltanschauungen auch verschiedenartige Aussagen. Einmal wird der Mensch nur als der -- bisherige - Endpunkt der Entwicklung der Säugetierreihe gesehen, ein andermal wird er als das Ebenbild Gottes dargestellt. Dabei hat letztere Aussage zur Folge, daß in der Umkehrung Gott als Ebenbild des Menschen betrachtet werden kann. Es ist verständlich, wenn aus solcher Schlussfolgerung Gott auch menschenähnliche Eigenschaften wie Eifersucht, Güte, Strenge und andere zugeschrieben werden.
Von dem Begriff des Ebenbildes läßt sich leicht Abstand nehmen, wenn wir uns mit dem Sinn des im hebräischen Urtext der Bibel verwendeten Ausdruckes näher befassen. In diesem Text steht die Buchstabenfolge BE-ZELMW, wobei der Wortstamm ZEL mit Eindringen, Durchdringen, Wesen, Schatten und letztlich Bild wiedergegeben werden kann. Wer die Bibel nun übersetzt, steht vor der Auswahl dieser verschiedenen Wörter, deren Bedeutung bei einer Übersetzung sorgfältig abzuwägen ist. So ist meines Erachtens für eine sinngemäße Wiedergabe der Begriff Bild oder in seiner Abwandlung Ebenbild für uns Menschen doch ein bißchen hoch gegriffen. Eine Übersetzung mit Schatten würde hier eher zutreffen. Erklären wir uns als Schatten der Schöpfungsmacht, bekennen wir uns auch zu dem gewaltigen Abstand zwischen Gott und seinen Geschöpfen und vereiteln eine Umkehrung der Beziehung Bild-Ebenbild. Denn es wird wohl niemand Gott als Schatten des Menschen betrachten wollen. Aber auch die Begriffe Eindringen und Durchdringen lassen eine sinnvolle Übersetzung zu. Durch die Verschmelzung dieser Ausdrücke können wir vielleicht zu einer neuen biblischen Definition des Menschen kommen, als das Wesen, das als schattengleiches Abbild Gottes von dessen Macht durchdrungen ist, als das Wesen, in das das Göttliche eingedrungen ist. Die extremen, voneinander abweichenden Aussagen über den Menschen als Nur-Säugetier oder schattengleiches Abbild Gottes zeigen, daß wir Menschen selbst uns noch nicht eindeutig begriffen oder erkannt haben. Das Woher, Wohin und Warum unseres Seins, praktisch die Frage nach dem Sinn unserer Existenz, hat seit jeher den denkenden Menschen zur Schaffung immer neuer Denkmodelle angeregt. Sagen und Mythen sind hiervon die ersten Zeugen. Sie sind daher keinesfalls nur als kurzweilige Geschichten anzusehen, sondern sie bergen in sich bei richtiger Darstellung Aussagen über vor- beziehungsweise frühgeschichtliche Ereignisse und frühe Erkenntnisse des menschlichen Geistes, die sich bis in den Bereich der Metaphysik erstrecken. Leider, so müssen wir bekennen, ist bis heute eine vollständige Sinndeutung unserer Sagen und Mythen noch nicht gelungen, wenn auch die Forschungsergebnisse der letzten zweihundert Jahre etwas Licht in das Dunkel gebracht haben.
Das Erwachen der Menschheit läßt sich neben allen wissenschaftlichen Theorien auch aus dem Alten Testament erklären, wenn wir uns von der allgemeinen Auffassung kirchlicher Bibelinterpreten distanzieren, nach denen es sich im zweiten Kapitel der Genesis lediglich um einen zweiten Schöpfungsbericht handeln soll, der uns Gott nur noch einmal in menschlich - übermenschlicher Gestalt präsentiert; denn es fällt auf, daß bis zu Kapitel 2:4 des ersten Mosesbuches (Genesis) stets von Gott, danach aber von Gott, dem Herrn, die Rede ist. Diese Formulierung scheint weder ein Zufall noch eine schriftstellerische Eigenheit zu sein, sondern eine exakte Textübertragung. Denn auch im hebräischen Text finden wir zwei verschiedene Ausdrücke. Es sind dies die Begriffe ELOHIM und JHWH ELO-HIM. Dabei ist ELOHIM im Alten Testament der Ausdruck für die reine Schöpfungsmacht. Er wird an anderer Stelle aber augh für Menschen benutzt, die sich als Wissende auf übernatürliche Mächte berufen. Das können Priester, Propheten, Magier oder Schamanen sein. Denn ELOHIM ist die Mehrzahl von ELOHE oder ELOHA und bedeutet „die Götter“ oder auch Götzen. Aber auch das Wort „Quelle“ ist in dem Wortstamm von Elohim enthalten, sodaß mit dieser Gottesbezeichnung auch die Quelle allen Seins angesprochen ist. Elohim bedeutet somit die Schöpfungsmacht, die aus dem unvorstellbaren Nichts das Leben geschaffen hat.
Die Buchstaben JHWH, die mit der - in der hebräischen Schrift meist fehlenden -- Vokalisierung zu den Wörtern Jahweh und Jehova werden, lassen sich mit ,lebendes Wort' übersetzen. Die mittleren Buchstaben HW oder HU erinnern an das „unwíderrufliche Wort“ der nordamerikanischen Indianer. Doch der eigentliche Sinn ist im Anfangsvers des Johannesevangeliums wiedergegeben: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. JHWH ELOHIM bedeutet dann das lebende Wort der Schöpfungsmacht, das dem Menschen Erkenntnisse vermittelt, sich dem Menschen offenbart. Die Gegensätzlichkeit des Begriffes ELO-HIM zeigt sich deutlich in Kapitel 18, Vers ll des zweiten Buches Mose: „Jetzt erkenne ich, daß der Herr größer ist als alle anderen Götter.“
Den Begriff HW oder HU finden wir wieder im ersten Buch Mose 1:2 bei der Übersetzung von ,wüst und leer“. Diese Übersetzung steht für TOHU-WA BOHU. Wenn auch die ursprüngliche Bedeutung dieser Wörter nicht mehr bekannt ist, ist aber doch zweimal dort die Silbe HU zu finden, die mit „Wort“ zu übersetzen ist. Somit ruhte im Anfang die Erde, oder besser die Schöpfung, im Worte Gottes. Platon (427-347) würde sagen, daß zunächst die Idee der Welt vorhanden war, bevor sie ihren Anfang nahm. Denn nach Platons Auffassung sind Ideen unveränderliche, vollkommene und im Außermateriellen beheimatete Urbilder oder Begriffe. Nach der Übersetzung von I Mose 2:7 schuf Gott, der Herr, also JHWH ELOHIM, den Menschen Adam aus dem Staub der Ackerscholle, im Hebräischen aus der ADAMAH. Das aber ist die weibliche Form von ADAM.
Damit führt uns die Bibel in das von der Wissenschaft erkannte Frühstadium der Menschheit, und wir erkennen in der ADAMAH jene unsere Vorfahren, die noch ohne Wissen um die Bedeutung von Paarung und Zeugung lebten. Sie benutzten zwar schon Werkzeuge aus Holz und Stein, um ihre Umwelt zu gestalten, ordneten sich aber in tierischem Instinkt der Herrschaft der Muttertiere im Matriarchat unter. Diese Gesellschaftsform stand ganz im Zeichen der kultischen Verehrung der Erde und der Frau. Wir kennen die germanische Göttin Nerthus, deren Namen mit Mutter Erde übersetzt wird,und betrachten die kleinen, drei bis zehn Zentimeter großen Statuetten aus Knochen, Elfenbein, Holz oder Stein, die durch die starke Betonung von Brüsten, Bauch und Gesäß deutlich als Abbild der Frau zu erkennen sind.
Die eigentliche Heraustrennung des Menschen aus dem Tierreich ist in Kapitel 12:7 des ersten Buches Mose beschrieben. Das Einhauchen der Seele läßt den Menschen zum eigentlichen Menschen werden und verhilft ihm zur Erkenntnis der ersten Naturgesetze. Denn jetzt erst hat der Mensch nach dem Bibelbericht den Atem, den Geist der Schöpfung, in sich aufgenommen.
Nun konnten die ersten Kulturlandschaften oder Paradiese entstehen, in denen Menschen seßhaft wurden. Bei der im 19. Vers beschriebenen Zuführung der Tiere handelt es sich um die erste Einordnung der Tiere nach ihrer Verwendungsmöglichkeit für den Menschen als Wild oder als Haustiere. Mit ihrer neuen Bedeutung für die Verwendungsfähigkeit wurde den Tieren der entsprechende Name zugeordnet.
Das Herauswachsen des Menschen aus der Primatenreihe ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, wenn auch der Zeitpunkt dieses Geschehens sich noch nicht scharf begrenzen läßt. So datiert man das Erscheinen des Australopithecus, des unmittelbaren Primatenvorfahren des Menschen in Afrika, auf einen etwa vier Millionen Jahre vor uns liegenden Zeitpunkt. Als erster Mensch gilt der homo errectus, der vor etwa 1,3 Millionen Jahren in Afrika und Ostasien lebte. Unter den Schädelfunden dieser ersten Menschen zeigten etliche eine eingeschlagene Basis, und viele menschliche Knochen wiesen Brandspuren auf. Das läßt den Schluß zu, daß die ersten Menschen Kannibalen waren. Nun wird auch heute der Kannibalismus unter den hierfür bekannten Stämmen nicht nur betrieben, um den Hunger zu stillen, sondern er dient in erster Linie als mystische Handlung. Das aber ist ein Hinweis auf frühe religiöse Vorstellungen. „Der Kopfjäger“, so schreibt der Anthropologe Gustav Ralph von Koenigswald, „gibt sich nicht damit zufrieden, den Schädel nicht nur zu besitzen, sondern öffnet ihn und nimmt das Gehirn heraus, das er ißt, um sich dadurch Weisheit und Geschicklichkeit seines Feindes anzueignen.“
Um einmal die Zeitspannen in der Entwicklung des Menschen mit der Geschichte der Erde zu vergleichen, seien die 4,5 Milliarden Jahre, die die Erde nach wissenschaftlichen Ermittlungen bestehen soll, mit dem Ablauf eines Jahres verglichen. In diesem Beispiel habe die Erde mit dem ersten Januar zu existieren begonnen. Bevor nun die ersten Spuren des Lebens vor 3,5 Milliarden Jahren erkennbar wurden, vergehen in unserem Beispiel 80 Tage. Im Kalender ist es der 20. März. Aber erst am 18. Oktober sind auf der Erde die ersten sauerstoffatmenden Lebewesen zu finden.
Das geschah vor 900 000 000 Jahren. Bis zum Auftauchen der ersten Wirbeltiere vor 470 Millionen Jahren vergehen noch einmal rund 35 Tage, und unser Kalender zeigt das Datum des 22. Novembers. Das große Zeitalter der Saurier begann vor etwa 360M.i.llionen Jahren und endete vor 180 Millionen Jahren. Damit ist in unserem Vergleichsjahr der 18. Dezember erreicht. Die ersten Menschen aber erscheinen erst zweieinhalb Stunden vor Jahresende, und die Zeitspanne von der letzten Eiszeit bis heute macht gerade 83 Sekunden aus. `
Wollte man die Erdgeschichte graphisch darstellen, müßte man, um auch den letzten Zeitabschnitt verdeutlichen zu können, einen Kreis in der Größe des Erdäquators zeichnen. Sein Umfang beträgt bekanntlich rund 40 000 Kilometer. In einer solchen Graphik erschiene das Zeitalter des Menschen mit 1,3 Millionen Jahren als eine Strecke von 11 km. Die Zeit von Christi Geburt bis heute betrüge nur 18 Meter.
In seiner Geschichte hat der Mensch immer wieder versucht, sein Wesen und seine Stellung in einem gedanklich erklärbaren Zusammenhang mit dem Kosmos zu bestimmen. Höhepunkt dieser Darstellung ist die philosophische Anthropologie. Das bedeutet zu deutsch nichts anderes als die Lehre vom Menschen. Einer ihrer markanten Vertreter, ihr Neubegründer Max Scheler (1874-1928), weist auf die Zweideutigkeit des Wortes und Begriffes „Mensch“ hin. Er sieht es als selbstverständlich an, daß das als Mensch bezeichnete Lebewesen nicht nur dem Begriff des Tieres untergeordnet bleibt, sondern darüber hinaus nur eine kleine Ecke im Tierreich ausmacht, selbst wenn Carl von Linné (1707--1778) den Menschen an die Spitze der Wirbel-Säugetierreihe setzt. Doch Scheler zeigt auch auf, daß in der Sprache des Alltags dasselbe Wort „Mensch“, und zwar bei allen Kulturvölkern, etwas ganz anderes bedeutet und dem Begriff des „Tieres überhaupt“ aufs Schärfste entgegensteht. Damit ist im Sprachgebrauch der Völker eine klare Unterscheidung zwischen dem Menschen und dem Tier zu verzeichnen.
Der griechische Dichter Sophokles (496--406) schrieb einmal: „Vieles Gewaltige lebt, doch nichts ist gewaltiger als der Mensch.“ Und im achten Psalm lautet der Hymnus auf die Herrlichkeit Gottes:,,Nicht wenig geringer schufst du ihn (den Menschen, Anm. d. Verf.) als einen Gott, mit Lichtglanz und Herrlichkeit kröntest du ihn.“
Die Grenze des Tierreiches wurde vom Menschen überschritten, als er die Fähigkeit entwickelt hatte, zur Natur nein sagen zu können. Mit der Möglichkeit des Nein-sagen-Könnens hatte er zugleich die Fähigkeit erlangt, nach seinem Woher und Wohin zu forschen. Diese Eigenschaften machen es aber unmöglich, den Menschen als Tier zu betrachten. Vielmehr ist ihm dadurch die Aufgabe aufgezwungen, seine Lebensbasis in der Welt zu begründen und abzusichern. Aus den natürlichen Gleisen seiner tierischen Existenz herausgeschleudert, gelangte er in den Zustand einer Freiheit, die zwingend zu einer Willkür führen würde, wenn der Mensch nicht zugleich einem doppelten Zwang unterworfen wäre, nämlich sich zu entscheiden (Entscheidungszwang) und für jede Entscheidung selbst die Verantwortung zu tragen (Verantwortungszwang). Leider sind wir Menschen uns dieser geistigen Freiheit selten bewußt. Zu oft stellen wir das Ergebnis unserer eigenen Entscheidung in den Hintergrund und folgen fremden Gedanken, teils aus Gefälligkeit gegenüber unangemessenen Bitten, teils fühlen wir uns aus einer falsch verstandenen Ethik heraus zu bestimmten Handlungen ver- pflichtet oder wir folgen einer vermeintlichen Autorität. Doch nicht nur Impulsen von außen müssen wir uns erwehren. Aus uns selbst melden Triebe ihren Herrschaftsanspruch an, und darüber hinaus lassen wir uns nur zu leicht von Vorstellungen beirren, die sich mit subjektiven Gedankenbildern verbinden. Man spricht in solchen Fällen von Assoziationen. Gerade zum Erkennen der Trennungslinie zwischen dienender Nächstenliebe und der Willensfreiheit gegenüber anderen Menschen, sowie zwischen der Erfordernis maßvoller Bedienung unseres Körpers und dem Erwehren der eigenen Triebe sollten die Religionen uns eine Entscheidungshilfe geben. Um sich aber richtig entscheiden zu können, gegebenenfalls auch gegen die Lehraussage einer Religion, ist die Erkenntnis der menschlichen Wesensart unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ist es zweckmäßig, wenn wir den Weg zu uns Menschen aus der als tot bezeichneten Materie bis eben zur Spitze der Säugetierreihe verfolgen, wo wir nach Linné zu stehen uns wähnen, indem wir stufenweise die verschiedenen medialen Verbindungen der Lebewesen zur Außenwelt betrachten.
Die unterste Stufe des mit unseren fünf Sinnen erkennbaren Bereiches unserer Umwelt bildet in dieser Betrachtungsreihe die anorganische oder nach dem allgemeinen Sprachgebrauch tote Materie. Die hier stattfindende Stoffumwandlung auf Grund chemischer oder physikalischer Einflüsse wird im allgemeinen noch nicht als Leben bezeichnet, da sie als eine passive Reaktion der Materie angesehen wird. Durch diese Stoffumwandlung als Reaktion auf die besonderen geologischen und klimatischen Verhältnisse auf unserem Planeten Erde im Laufe der ersten Milliarde Jahre haben sich Kohlenstoffverbindungen aufgebaut und Kettenmoleküle gebildet. Ein Ergebnis jener Umstrukturierungen ist die Nukleinsäure, die nach den heutigen Erkenntnissen der Wissenschaft den Informationsspeicher über die Struktur von Lebewesen darstellt. Doch über das Wie und Warum dieser Entwicklung kann unsere Wissenschaft keine Auskunft geben, so daß hier gerne von einem Zufall gesprochen wird. Dieser Begriff stammt aus der Darwinschen Theorie. Es fragt sich aber, ob dieses Wörtchen „Zufall“ zum anerkannten Gott der Wissenschaft ausgerufen oder besser durch das Wort „Absicht“ ersetzt wird, wenn man in Betracht zieht, daß das zu erreichende Ziel den hierfür notwendigen Ablauf vorausbestimmen kann. Eine Frage, die heute in der Quantentheorie eine große Rolle spielt und in der Parapsychologie mit dem Phänomen der Präkognition, dem Vorherwissen, angesprochen wird. Es muß einen logisch denkenden Menschen eigenartig berühren, wenn das in der Nukleinsäure vorgezeichnete Bild des Menschen, was schon lange dort vor seiner eigentlichen Existenz vorprogrammiert war, das zufällige Produkt einer verspielten Natur sein soll. Wenn heute Wissenschaftler solche unerklärbaren Vorgänge wie die Weltwerdung oder die Entstehung des Lebens als Zufall deuten, dann kann das nur als ein Eingeständnis betrachtet werden, in dem zum Ausdruck kommt, daß das Gesetz, das diesem Vorgang innewohnt, noch nicht erkannt ist und letztlich auch Zweifel bestehen, ob dieses Gesetz jemals von uns Menschen wissenschaftlich ergründet werden kann.
Im weitesten Sinne des Begriffes Leben sind auch die Vorgänge in der sogenannten toten Materie eingeschlossen, wenn wir in den einzelnen Reaktionen das Wirken einer Ordnungskraft erkennen. Im engeren biologischen Sinne bezieht sich der Begriff des Lebens auf die Tätigkeit chemischer und kolloidaler Strukturen, die sich in einem Verband zu Organen zusammengeschlossen und in höheren Lebensstufen Spezialaufgaben in dem Zellenverband des biologischen Körpers übernommen haben.
Im organischen Bereich der Materie finden wir zunächst in der untersten Stufe Lebewesen, die nicht mehr nur Veränderungen in ihrer Existenz durch äußere Einwirkungen unterliegen, sondern auch aus sich heraus agieren und reagieren. Bei diesen einfachen Handlungen kann man von einem undifferenzierten Gefühlsdrang sprechen, bei dem vermutlich Gefühl und Trieb noch nicht getrennt sind. Wir erkennen diese Art der Lebensäußerung zum Beispiel in dem Bestreben der Pflanze, zum Licht und damit zur Sonne hin zu wachsen. Bei dieser Erscheinung sprechen wir vom Phototropismus (früher: Heliotropismus). Wenn auch allgemein der Pflanze keine höhere Psyche zugestanden wird, gibt es immer wieder Forscher, die der Pflanze eine Psyche aber nicht aberkennen. So behaupten zum Beispiel die beiden amerikanischen Wissenschaftler Peter Tomkins und Christopher Bird in ihrem Buche „Das geheime Leben der Pflanzen“, das im Scherz-Verlag erschienen ist, daß Blumen außer Gefühlen sogar ein Erinnerungsvermögen besitzen sollen. Auch schon der Naturforscher und Philosoph Gustav Theodor Fechner (1801-1887) schrieb den Pflanzen Empfindungen und sogar Bewußtsein zu, also die Fähigkeit, Erfahrungen, Veränderungen der Umwelt oder Beziehungen zur Außenwelt aufzunehmen und als Wissen zu speichern. Freilich darf man bei seinen Theorien nicht außer acht lassen, daß Fechner bestrebt war, durch eine idealistische Weltanschauung den MateriaIismus zu überwinden. Aber auch der Saudi-arabische Biologíeprofessor Faisal al-Saad von der Landwirtschaftsfakultät der König-Faisal-Univensität in Dschidda will experimentell nachgewiesen haben, daß Pflanzen ein Gedächtnis besitzen und Gefühle haben, die sie jedoch nicht wie die Tiere ausdrücken können.
Bei dem genannten Tropismus der Pflanzen und festsitzenden Tiere, wie beispielsweise bei den Hohltieren, handelt es sich um Bewegungen in Richtung auf einen Reizsender. lm Gegensatz zum Tropismus spricht man von Taxis bei den durch Außenreíze bewirkten und zielgerichteten Ortsbewegungen, wie wir sie bei frei beweglichen pflanzlichen und tierischen Lebewesen wie Algen, Spermatozoiden und anderen Fortpflanzungskörperchen beobachten können. Vergeblich wurde bisher bei diesen Bewegungen nach einem Rückmeldesystem zu einem zentralen Nervensystem oder einer anderen Schaltstelle gesucht. Vielleicht stehen wir hier schon ganz deutlich der nicht materiell erkennbaren Psyche als Lebensäußerung gegenüber.
Die nächsthöhere Stufe der Lebewesen, der wir vor allem bei Tieren begegnen, wird von Trieben und Instinkten beherrscht. Zu den Trieben zählen wir zunächst Hunger-, Flucht- und Sexualtrieb. Wenn Sigmund Freud (1856-1939) den Sexualtrieb besonders hervorhob, so war damit nicht nur der reine Geschlechtsverkehr angesprochen, sondern jede Art von Lustgewinn. Es soll aber auch nicht unerwähnt bleiben, daß die orthodoxe Fassung der Psychoanalyse den Menschen nicht als aus sich selbst handelnd ansieht, sondern nur von einem Reagieren auf Bedürfnisse spricht, die letztlich von Drüsen gesteuert werden. In diesen Auffassungen spiegelt sich die Denkweise des bürgerlichen Materialismus des neunzehnten Jahrhunderts wider.
lm Gegensatz zum Trieb, der ein Agieren aus dem Lebewesen selbst ist, existiert der Instinkt als Reaktion auf Impulse vom Außerhalb des Lebewesens, das auf diese Impulse mit koordinierten und arterhaltenden Bewegungen antwortet. Für solche Lebensäußerungen sind Nervenbahnen als Rückmeldesystem erforderlich. Instinkthandlungen vollziehen sich, ohne daß dem Individuum etwas von der Zweckmäßigkeit seines Handelns bewußt wird. Die Handlungen werden also außerhalb der Ratio, des Verstandes, ausgeführt. Zu den Instinkthandlungen rechnen die Verhaltensweisen bei der Nahrungssuche, der Paarung, der Flucht im Gefahrenmoment oder beispielsweise auch die beim Bau von Höhlen und Nestern. Treten jedoch neue, unerwartete Lebensumstände ein, so versagt dieses instinktive Verhalten.
Der Entwicklungsprozeß der Lebewesen auf den Menschen hin, dessen Notwendigkeit sich nicht aus einer materialistischen Weltdeutung erklären läßt, vollzieht sich in der immer wiederkehrenden Erfahrung aus Erfolg und Mißerfolg bei der sich zwar langsam aber stetig ereignenden sinnvollen Anpassung an neue Situationen. Dieser Lernprozeß bewirkt dann letztlich die Loslösung vom Instinkt und führt zu assoziativen Handlungsweisen.
Der russische Psychologe Iwan Petrowitsch Pawlow (1849-1936) spricht in diesem Zusammenhang von einem bedingten Reflex. Bei einem seiner Versuche verabreichte er der Hinterpfote eines Hundes einen elektrischen Schock und ließ dabei gleichzeitig eine Stimmgabel ertönen. Der Hund reagierte durch Anheben des geschockten Beines. Nach etlichen Wiederholungen des gleichen Vorganges hob der Hund schließlich das Bein, auch wenn der Elektroschock ausblieb und nur die Stimmgabel tönte. Damit hatte Pawlow dem Hund einen neuen Reflex in das Verhaltensmuster ein- gefügt. Pawlow zeigte mit weiteren Versuchen, daß man die verschiedensten Reflexe in das sogenannte assoziative Gedächtnis einpflanzen oder aus ihm herausnehmen kann.
Das assoziative Gedächtnis kommt vor allem bei jeglicher Dressur zum Tragen, ganz gleich, ob mit Zuckerbrot oder Peitsche dressiert wird. Diese Dressurmethode ist auch auf den Menschen anwendbar. Man denke nur an den Drill auf dem Kasernenhof. Schon die Römer formten durch geschlossenes Exerzieren das Verhalten eines einzelnen Bauernjungen in das gleich- geschaltete Reagieren eines Standardlegionärs um. Aber nicht nur beim Militär, sondern in jeder Gesellschaftsgruppe sind assoziative Verhaltensweisen maßgeblich an deren Struktur beteiligt. Selbst das kultische Leben einer Religionsgemeinschaft ist ohne assoziative Dressurelemente nicht denkbar. Hierzu gehören zum Beispiel die Rezitation heiliger Texte, eine Morgenandacht oder ein rituelles Bad. In unserer Gesellschaft bemüht sich die Werbung ganz fleißig, assoziative Reflexe in unser Gedächtnis einzupflanzen. Eine Intensivierung dieser Methode führt schließlich zur Gehirnwäsche. Hierunter versteht man die Zerstörung persönlicher und weltanschaulicher Wertbegriffe und die gesteuerte Neuorientierung durch psychischen Druck oder Suggestion im Bereich des assoziativen Gedächtnisses. Aber auch die Anwendung von Medikamenten und Drogen ist dabei nicht ausgeschlossen. Einer wissenschaftlichen Anwendung der Gehirnwäsche bediente sich Stalin in den dreißiger Jahren. Er hatte etliche Offiziere inhaftiert. als er sich von ihnen in seiner Stellung bedroht gefühlt. In einem angesetzten Gerichtsverfahren war ausländischen Prozessbeobachtern aufgefallen, daß sich die angeklagten Offiziere verschiedener Verbrechen gegen ihr Land für schuldig erklärten, die von diesen Männern gar nicht hatten begangen werden können. Des Rätsels Lösung wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt. Durch eine systematische, auf geistiger Basis vollzogenen Umpolung des assoziativen Gedächtnisses waren die normalen Denkprozesse der lnhaftierten ins Wanken gebracht worden. In das durch endlose Verhöre hervorgerufene Gedankenchaos hatte man neues Wissen eingepflanzt. Wie so etwas geschieht, beschreibt George Orwell in seinem Buche„1984“.
lm Koreakrieg bedienten sich die Chinesen ähnlicher Methoden bei der Behandlung amerikanischer Piloten, um diese Männer zu Propagandazwecken zu mißbrauchen. Man versuchte ihnen die kommunistische Ideologie einzusuggerieren. Wenn das assoziative Gedächtnis auch allen Arten von Sııggestionen unterliegen kann, hat doch gerade das Verhalten einiger amerikanischer Gefangener bestätigt, daß der Mensch nicht unbedingt diesen Einwirkungen unterliegen muß. Denn die Zahl derjenigen ist nicht gering, die dem Druck der Gehirnwäsche widerstanden haben. Ihr Durchhaltevermögen erklären diese Menschen mit ihrem Glauben an die Grundsätze ihrer eigenen Individualität, die ihre Basis im Glauben an ein transzendentes Sein haben kann. Ihr Vertrauen in Religion, Heimat, Freunde und Eltern, sowie ihre Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat sind als Ursachen ihres Durchhalteerfolges anzusehen. Dazu kam der Glaube an die Möglichkeit, alle Strapazen überleben zu können, wenn genügend geistige Kräfte vorhanden sind, um ihre bedingten Reflexe, also das assoziative Gedächtnis,nicht dekonditionieren zu lassen.
Mit dieser Haltung tritt das dem Menschen eigene Prinzip der Willensfreiheit zutage, das sich jedem Versuch einer funktionellen Darstellung wiedersetzt. Daher läßt sich die Reaktion einer Lokomotive leichter voraussagen als die des Lokführers. Die einzige gesetzmäßige Voraussage funktioneller Reaktionen im menschlichen Leben bieten statistische Angaben über das Verhalten einer Menschenmasse. Dieses Verhältnis drückt Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) durch die Worte seiner Romanfigur Sherlock Holmes aus, indem er ihn zu seinem Gehilfen Dr. Watson sagen läßt: „Wenn auch der einzelne Mensch ein unlösbares Rätsel ist, so wird er doch in der Masse zu einer mathematischen Gewißheit. Man kann niemals voraussagen, was ein bestimmter Mensch tun wird, aber man kann mit Gewißheit sagen, wie eine durchschnittliche Anzahl von Menschen sich verhalten wird. Das individuelle Verhalten ist variabel, aber Prozentsätze bleiben konstant.“ Besser läßt sich, glaube ich, die Individualität des Menschen nicht beschreiben.
Während bei Mensch und Tier das assoziative Gedächtnis den Instinkt zurückdrängt, bleibt der Trieb in seiner Kraft bestehen. Dieser Trieb ist nichts anderes als der von Platon in seinem , ,Gastmahl“ beschriebene Eros. Die Trennung des Triebes vom Instinkt bedingt die dem Menschen eigene Maßlosigkeit. Solange beispielsweise der Sexualimpuls mit der Brunstzeit in der Rhythmik der Natur eingebettet ist, ist er ein Diener des Lebens. Im Gegensatz zum Hedonismus, der die Lust als das höchste Gut und Ziel des sittlichen Handelns darstellt und den Menschen auffordert, in allen Handlungen und Verhaltensweisen nach Lust zu streben, zeigt Scheler, daß, wenn das Triebleben vom Menschen prinzipiell als Lustquelle genutzt wird, dies eine späte Dekadenzerscheinung in seinem Leben ist. Scheler schreibt: „Die rein auf Lust gerichtete Lebenshaltung stellt eine ausgesprochene Alterserscheinung des individuellen wie des Völkerlebens dar.“ Die Isolation des Triebes aus dem Instinktverhalten kann so ungeheuerliche Formen annehmen, daß man mit Recht gesagt hat, daß der Mensch stets mehr oder weniger als ein Tier sein könne, aber niemals ein Tier selbst.
Ein Meilenstein in der Entwicklung der Lebewesen zum Menschen hin ist auch das lnnensystem höher entwickelter Lebewesen, das unablässig unterschiedliche Krankheitserreger wie beispielsweise körperfremde Eiweißstoffe, wozu Bakterien und Viren zu rechnen sind, bekämpft und vernichtet. Damit wird das individuell Einmalige jedes Einzelwesens und seine Existenz gesichert. Nachteil dieses Systems sind freilich die sich zeigenden Probleme bei der Organtransplantation. Letztlich ist aber auch daran zu erkennen, daß jedes höhere Lebewesen ein einmaliges Individuum darstellt, was schließlich die Grundlage für das Ich - Bewußtsein des Menschen ist. Worauf wir Menschen uns am meisten einbilden, ist unsere Intelligenz. Jeder möchte nicht nur intelligent sein, sondern auch noch intelligenter als seine Mitmenschen. Jemandem fehlende oder geringe Intelligenz nachzusagen, gilt als Beleidigung. Aus dem lateinischen Wortschatz kommend, bedeutet Intelligenz soviel wie Einsehen oder Verstehen. Wir verstehen unter einem intelligenten Menschen jemanden mit schneller Auffassungsgabe und ausgebildeten geistigen Fähigkeiten. Die Individualität des Einzelwesens bedingt jedoch eine ungleiche Intelligenz. Versuche, Intelligenz zu messen, sind bisher gescheitert. Der französische Psychologe Alfred Binet (1857-1911) entwickelte mit dem Arzt Thomas Simon zusammen ein Verfahren, um bei Kindern zwischen drei und fünfzehn Jahren die intellektuelle Leistung feststellen zu können. Anlaß zu diesen Überlegungen war die Erfahrung, daß Kinder verschieden schnell und in unterschiedlichem Alter ihre Aufnahmelitthigkeit entwickeln. Dabei legte Binet großen Wert darauf, daß die Testergebnisse niemals eine numerische Auswertung erführen, und klassifizierte die untersuchten Kinder immer nur als durchschnittlich, überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Erst der deutsche Psychologe William Stern (1871-1983) entwickelte das Binetsche System weiter und führte den Begriff des Intelligenzquotienten (IQ) ein. Dieser Intelligenzquotient ist das Hunndertfache des Verhältnisses von Intelligenzalter zu Lebensalter:
In der praktischen Anwendung würde ein sechs jähriges Kind den Intelligenzquotienten 100 erhalten, wenn es die für sein Alter bestimmten Fragen (Intelligenzalter) vollständig beantwortet. Dann ist sein
Bei Mensch und Tier läßt sich Intelligenz erkennen, wenn eine zu erfassende Situation nicht nur für die Tierart neu, sondern auch in ihrer Art nicht typisch ist (artneu und atypisch). Außerdem muß diese Situation auch für das einzelne Individuum ein neues Problem aufwerfen, das von ihm zu lösen ist. Ein solcher Fall liegt beispielsweise vor, wenn man einem Affen eine Banane außer Reichweite vor das Käfiggitter legt. Um in den Besitz der begehrten Frucht zu gelangen, wird der Affe sich einen Stock nehmen, sich also eines Werkzeuges bedienen. Eine solche Handlung ist Ausdruck praktischer Intelligenz. Es gibt aber Theoretiker, die dem Tier eine Intelligenz völlig absprechen und diese alleine dem Menschen zugestehen wollen. Völlig gegensätzlich hierzu steht die Auffassung der Evolutionisten aus der Schule Charles Robert Darwins (1809- 1882) und J ean-Baptiste de Monet, Chevalier de Lamarcks (1744--1829), die einen Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier ablehnen, da Intelligenz in beiden Fällen erkennbar ist. Sie weisen den Menschen als homo faber, als Handwerker, aus. Wäre Intelligenz als oberstes Wesensmerkmal gegeben, könnte man dieser Theorie zustimmen, weil selbst eine bis ins Unendliche (wenn es das gäbe) gesteigerte Intelligenz keine Unterscheidung zwischen Mensch und Tier zuläßt.
Beim Menschen aber, und nur bei ihm, begegnen wir noch einem weiteren Wesensmerkmal, das sich in dem Verlangen ausdrückt, das Gegensätzliche zu suchen. Man nennt es schöpferischen Drang oder Kreativität. Auch das Streben zum Außermateriellen, wie es sich in den Religionen widerspiegelt, läßt sich als ein Suchen nach dem Anderssein unserer Sinnenwelt erklären. Dieses kreative Potential ist nun nicht bei allen Menschen gleich stark mobilisiert. Es liegt vielfach eingemottet oder gar verkümmert in den Polstern eines Übermaßes an Konsumgütern. Ich möchte drei Sprichwörter anführen, die diese Situation zwar mit anderen Ausdrücken, aber inhaltlich gleich gut darstellen: Müßiggang ist aller Laster Anfang - Not lehrt beten - Not macht erfinderisch Müßiggang haben wir in den Wohlstandsgesellschaften. Er erzeugt Trägheit und schließlich Stumpfsinn. Laster ist das Meiden kreativen Tuns. Not ist eine Entscheidungssituation, die den Menschen die Verbindung zum absoluten Sein suchen läßt und die kreativen Kräfte mobilisiert.
In der Kreativität verläßt der Mensch das Rationale und wendet sich dem Irrationalen zu. Dabei kommt eine Verbindung mit dem Unterbewußtsein zustande, die vor allem bei phantasiebegabten Menschen festzustellen ist. Die Stärke der Verbindung zum Unterbewußtsein bedingt, daß das Schöpferische einmal sich als spontane Eingebung, als sogenannter Geistesblitz, zeigt, ein andermal aber sich erst als Ergebnis zähen Ringens erweist. So definierte Thomas Alva Edison (1847-1931), dem die Erfindung der Glühbirne nur durch Hunderte von mühseligen Experimenten gelang, eine kreative Tat mit einem Prozent Inspiration und neunundneunzig Prozent Transpiration. Testergebnisse sagen aus, daß Kreativität nicht in einem funktionalen Zusammenhang zur Intelligenz steht. Das heißt, daß ein intelligenter Mensch nicht unbedingt kreativ sein muß, und umgekehrt, daß ein kreativer Mensch sich nicht durch ein besonderes intelligentes Verhalten ausweisen muß.
Doch der kreativen Kraft steht ein großes psychologisches Hindernis entgegen. Es ist die individuelle Angst des Menschen, mit seiner Erkenntnis oder seinem Wollen auf andere zuzugehen, und die Angst der damit verbundenen Möglichkeit einer Ablehnung. Diese Angst läßt sich überwinden, wenn wir unsere Fantasie schulen und uns mehr mit unseren Träumen beschäftigen, die uns Meldungen aus dem Unterbewußtsein übermitteln. Das ist eigentlich eine Grundaufgabe für uns Menschen. Denn es ist der eigentliche Weg, unser kreatives Potential zu mobilisieren, was letztlich heißt, Mensch sein.
Auf den Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier wiesen die Griechen des Altertums hin, als sie den Begriff der Vernunft (griechisch: nous) einführten. Damit ist im Unterschied zur sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeit ein geistiges Erfassen gemeint, das zunächst bei Parmenides (ca. 540480) mit seinem , ,noein' ' Denken und Erdachtes enthielt. Was geistig erfaßt wird, muß auch existieren. Nichtseiendes ist auch nicht denkbar. Bei Aristoteles (384 -322) wurde das Vernünftige zum letzten Prinzip der Organisation des Seins. Kant schrieb hierzu: „Nun ist aber die wesentlichste Naturanlage des Menschen die Vernunft oder sein Vermögen, sich frei von der Nötigung des Instinktes aus eigener Einsicht zum Handeln oder Unterlassen zu bestimmen. „Das ist wiederum nichts anderes als die dem Menschen eigene Willensfreiheit. Fassen wir nun den Vernunftbegriff mit den Begriffen wie Güte, Liebe, Reue, Ehrfurcht, Seligkeit und Verzweiflung zusammen, so haben wir das, was Scheler treffend mit Geist bezeichnete. Denn so ist in dem Begriff Geist alles zusammengefaßt, was in der materiellen Welt nur beim Menschen zu erkennen ist und als wesentliches Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Tier gilt.
Nach diesem Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte der Lebensäußerungen auf unserem Planeten kann man zusammenfassend drei verschiedene Seinsarten erkennen: den leblosen Bereich der Materie, dann den Lebensbereich zwischen Gefühlsdrang und praktischer Intelligenz, der Trieb, Instinkt und assoziatives Handeln einschließt (Eigenschaften also, die Mensch und Tier gemeinsam haben), und drittens den Bereich des Geistigen, ein vom Organischen unabhängiges Daseinszentrum.
Die zuletzt genannte Art des Seins trifft unseres Wissens nach nur auf den Menschen zu, der im Gegensatz zum Tier alleine in der Lage ist, abstrahieren zu können. Während nämlich der Mensch werten und Mengen zahlenmäßig bestimmen kann, hat ein Tier nur vage Mengenvorstellungen, die jeweils an der Gestalt oder Gruppierung hängen bleiben. Beispielsweise sieht der Hund den Wald als Ganzes, gegebenenfalls mit der Assoziation „Reh- jagen“. Der Mensch hingegen ist in der Lage, die Zahl der Bäume zu bestimmen, den wirtschaftlichen Wert einzuschätzen und die Bedeutung des Waldes für die Umwelt zu erkennen. Auch die „Erleuchtung“ Buddhas (um 560 bis 480) ist ein Beispiel für die menschliche Fähigkeit der Abstraktion. Durch seinen reichen Vater stets von allen negativen Eindrücken dieser Welt ferngehalten, begegnete Buddha eines Tages einem Armen, einem Kranken und sah einen Toten. Aus der Abstraktion dieser drei Einzelheiten entstand für ihn ein neues Weltbild, das zur Grundlage seiner Lehre wurde.
Kein Tier, auch nicht der intelligente Schimpanse, hat sich je die Frage vorgelegt, wer er eigentlich ist. Ihm ist die Möglichkeit solchen Tuns einfach verschlossen. Der Mensch ist in der Anthropologie zugleich Subjekt und Objekt. Er stellt die Frage und fragt nach sich selbst. Dadurch gelangt er zu einer Lebensäußerung, die sein eigenes Handeln bestätigt. Das ,cogito, ergo sum“ von René Descartes (1596-1650), dieser Schluß des eigenen Seins aus der Denkfähigkeit, wäre hier umzuwandeln in ein ,quero, ergo ens spiritusum“, was soviel heißt wie: Ich frage, folglich bin ich ein Wesen mit Geist.
Der Wesensunterschied zwischen Mensch und Tier ist auch an der Verschiedenartigkeit im aggressiven Verhalten zu erkennen. In der Auseinandersetzung mit seinen Artgenossen handelt nach unserem Sprachgebrauch human, wer seine Handlungen auf das Erreichen eines bestimmten Zieles richtet und den Einsatz der ihm zur Verfügung stehenden Mittel auf das notwendigste Maß beschränkt. Im anderen Falle spricht man von einer bestialischen Handlungsweise. In der Tierwelt wird diese Forderung der Humanität eingehalten, indem der stärkere Artgenosse den schwächeren auf einen anderen Platz in der Rangstufe zurückdrängt, ihn aber nicht vernichtet oder auf Dauer schädigt. Für dieses Verhalten ist dem tierischen Angriffstrieb ein Hemmechanismus eingebaut, der dann in Funktion tritt, wenn die Gefahr besteht, daß der Gegner den Kampf nicht überleben würde. Bei Wölfen beispielsweise funktioniert die Beißhemmung, wenn der Unterlegene seine Kehle ungeschützt dem Stärkeren darbietet. Der Sieger gibt sich dann mit dem Augenblickserfolg zufrieden. Das ist deswegen möglich, weil ihm das abstrakte Denkvermögen fehlt, das ihm vor Augen führen würde, daß morgen der heute Unterworfene den Sieger erneut zum Kampfe herausfordern und vielleicht besiegen kann. Der Mensch aber kalkuliert auf Grund seines Geschichtsbewußtseins auch das Morgen ein. Aus Angst vor einer neuen Auseinandersetzung, die für ihn ja einen negativen Ausgang haben kann, ist der Mensch bestrebt, seine durch den augenblicklichen Erfolg gefestigte oder errungene Position über das derzeit Notwendige hinaus auf Dauer zu erhalten. Zur Erreichung seines Zieles ist er sogar fähig, die auch bei ihm vorhandene natürliche Tötungshemmung sowohl im einzelnen Mordfall als auch im kriegerischen Massenmord zu überwinden, wobei die Inversion der Begriffe „human“ und „bestialisch“ klar zutage tritt. Die kriegerischen Auseinandersetzungen der Menschen können somit auch nicht mehr, wie es gerne dargestellt wird, als ein natürliches Regulativ betrachtet werden, weil sie stets der freien menschlichen Entscheidung unterliegen und von abstrahierten Handlungsweisen bestimmt werden.
Während also das Tier mit seiner und in seiner Welt besteht, existiert der Mensch durch sein Geschichtsbewußtsein auch gegenüber der Welt. So gesehen ist die aus dem Darwinismus kommende Vorstellung, der Mensch sei ein Tier mit Verstand, unzutreffend und von der wissenschaftlichen Biologie widerlegt. Wenn der Mensch auch körperlich aus dem Tierreich herausgewachsen ist, so ist er doch kein Affe mit Überbau, bei dem sich nur durch die Ausbildung des Großhirns der aufrechte Gang, die Sprache, die Fantasie und die Fähigkeit zur Abstraktion entwickelt haben. Mit diesen Anlagen hat er aber die Schwelle zum Geistigen überschritten. Ein Vergleich mit der Tierwelt zeigt, daß die Entwicklung des menschlichen Embryos sich schon früh aus der tierischen Entwicklungsreihe gelöst und einen eigenen Entwicklungsweg beschritten hat. So bezeichnet der Baseler Zoologe Adolf Portmann (geb. 1897) den menschlichen Säugling als eine physiologische Frühgeburt, da er, biologisch gesehen, ein Jahr zu früh auf die Welt komme. Für diese Erkenntnis spricht der notwendige Reifeprozeß des Neugeborenen durch den sozialen Kontakt im ersten extrauterinen Jahr. Das Fehlen eines solchen Kontaktes erklärt die Heimschäden von Säuglingen, die erst zur Adoption kommen, nachdem sie über Monate hinaus in Heimen auf ihre Adoptionsfähigkeit hin getestet wurden. Durch diese bürokratische Einrichtung wird bei diesen Kindern der menschliche Reifeprozeß gestört, was sich sehr nachteilig auf die seelische Entwicklung des Kindes auswirkt.
Es gilt festzuhalten, daß die biologisch-anthropologische Forschung eine Sonderstellung des Menschen in der Natur festgestellt hat. Danach unterliegt der Mensch zwar dem Einfluß lebensäußernder Körperfunktionen, doch ist seine Individualität letztlich von seiner geistigen Substanz geprägt. Durch seine Willensfreiheit ist er, solange er nicht durch eine Dressur im assoziativen Bereich gefesselt ist, auch nicht nach Charaktergruppen katalogisierbar. Wir haben uns von Conan Doyle sagen lassen, daß das Individuum Mensch in einer bestimmten Situation völlig anders handeln kann als in der gleichen Situation zu einem anderen Zeitpunkt. Das hat jedoch keinen Einfluß auf die Möglichkeit, seine freie Individualität selbst in eine Charakterschablone einzuengen, die wir Persönlichkeit nennen. Dieser Begriff hängt mit dem griechischen ,,persona' zusammen und bedeutet dort Maske. Solche Masken wurden im griechischen Theater getragen. Heute setzt man den Begriff Persönlichkeit gleich dem Erscheinungsbild. Hinter ein solches Erscheinungsbild flüchtet nämlich mancher, damit es ihm als Charakterkorsett dienen kann. Nach den Erkenntnissen der Psychologie entfremdet sich ein Mensch, der sich immer wieder mit seinem Erscheinungsbild, seiner Persona, identifiziert, von seinem wahren Selbst und wird zum Schauspieler seiner eigenen Rolle.
Wir Menschen sind nicht nur bestrebt, unser Weltbild so auszurichten, wie wir es gerne hätten, sondern wir wollen auch uns selbst und unsere Mitmenschen so sehen, wie wir es wünschen. Dabei kümmert es uns auch nicht, daß wir bei dieser Auffassung den Boden der Tatsachen verlassen unduns von der Wahrheit distanzieren. So bequem auch diese Einstellung sein mag, ihre Konsequenzen sind katastrophal. In Bertolt Brechts (1898-1956) „Leben des Galilei“ heißt es: „Wer die Wahrheit nicht weiß, ist ein Dummkopf; aber wer sie weiß und eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.“ Die Lehre Zarathustras (um 630 bis um 553) bezeichnet eindeutig den, der die Lüge der Wahrheit vorzieht, als gottlos. Wenn wir uns so gegenüber der Welt ins Abseits stellen, indem wir in ein festes Persönlichkeitsbild flüchten, Mitmenschen nur so sehen, wie wir sie sehen möchten, und gar das eigene Weltbild unserem Wunschdenken anpassen, lösen wir unseren Verstand von der Wirklichkeit und leben ein Leben in Lüge.
Mit der Möglichkeit der Abstraktion, des Erkennens eines Dinges an sich, gelangt der Mensch zu der Fähigkeit des wissenschaftlichen Arbeitens und des Erkennens von Gesetzmäßigkeiten. Dieses Vermögen ist aber genau das, was der Lateiner mit dem Ausdruck , ,religio“ belegt hat. In dem geisti- gen Daseinszentrum, das wir Menschen doch nur durch die „religio“ entdeckt haben, können wir die Welt in der Abstraktion erfahren und einen letzten, absoluten Grund erkennen, den wir Gott, Schicksal, Vorsehung oder fälschlich auch Natur nennen. Neben der Kreativität, die uns Menschen gegen das Tier abhebt, besitzen wir durch den Geist die Fähigkeit, uns selbst von einem Zentrum jenseits aller raumzeitlichen Welt zu beobachten. Durch unsere Vorstellungswelt sind wir alleine der Ironie und ebenso des Humors fähig. Religion ist somit in der umfassendsten Bedeutung dieses Begriffes nicht nur zielgerichtetes Verhalten auf Gott hin, sondern gleichfalls das den Menschen vom Tier unterscheidende Wesensmerkmal, das den Menschen dem gesamten Kosmos, der sinnenhaften Materie und dem geistigen Sein gegenüberstellt und dann mit letzterem vereinigt.
Aus den bisherigen Ausführungen müßte zu erkennen sein, daß das angesprochene geistige Zentrum des Menschen nicht Teil der mit unseren Sinnen erfaßbaren materiellen Welt sein kann, sondern außerhalb davon zu lokalisieren ist. Mit dieser Erkenntnis aber überschreiten wir eine Schwelle, an der die Unfähigkeit des menschlichen Ausdruckes beginnt. Ab hier reichen unsere fünf Sinne für einen medialen Kontakt nicht mehr aus, ja, sie versagen sogar, wodurch alle gedanklichen Äußerungen aus jener Sphäre nur in Umschreibungen, also in einer versuchten Übersetzung transzendenter Erkenntnisse in unsere Begriffswelt, in unser Tagesbewußtsein gelangen können.
Die Übertragungsschwierigkeiten transzendenter Erkenntnisse in unseren Sprachbereich ist auch die Ursache so vieler Mißverständnisse, vor allem im religiösen Bereich. Wie oft fehlen uns einfach die Worte, wenn wir große Freude, tiefe Trauer oder die Erfahrung der Liebe zum Ausdruck bringen wollen. Man erlebt auf einmal einen Zustand, der, wie wir dann zu sagen pflegen, , ,ganz anders' ' und , ,nicht zu beschreiben“ “ ist. In einem seiner Werke, den „Ideen zur Geschichte der Menschheit“ schrieb Johann Gottfried von Herder (1744-1803): „Alles ist in der Natur verbunden. Ein Zustand strebt zum anderen und bereitet ihn vor. Wenn also der Mensch die Kette der Erdorganisationen als ihr höchstes und letztes Glied schloß, so fängt er auch eben dadurch die Kette einer höheren Gattung von Geschöpfen als ihr niedrigstes Glied an; und so ist er wirklich ein Míttelding zwischen zwei ineinandergreifenden Systemen der Schöpfung.“
Wenn wir uns ein richtiges Bild vom Menschen machen wollen, dürfen wir nicht bei seiner biologischen Entwicklung verharren. Ohne Zweifel teilen sich aber hier die Anschauungen. Eine Gruppe begnügt sich mit der Auffassung, daß der Mensch nur ein Produkt der Materie sei, und verneint die Auffassung der zweiten Gruppe, die eine rein geistige Komponente des Menschen im metaphysischen Bereich verwurzelt sieht. Wie weit unser Wissen in den rein metaphysischen oder außermateriellen Bereich des Seins hineinragt, soll in den nachfolgenden Kapiteln näher untersucht werden; denn nur dann, wenn wir jene außermaterielle Komponente des Menschen anerkennen können, ist es sinnvoll, notwendig, aber auch erst möglich, die Bedeutung der Religionen zu begreifen.
Politische, wirtschaftliche und regional abhängige Lebensbedingungen ließen den menschlichen Geist die unterschiedlichsten Kulturen formen und Religionen mit voneinander abweichenden Aussagen prägen. Ursprünglich symbolische Handlungen erstarrten zu Kulten und sind nur noch Ausweis für die Bindung an eine Religionsgemeinschaft, die als Vereinigung ihren rechtlichen und institutionellen Charakter stärker als ihre transzendente Aussage betont. Das Kennenlernen anderer Religionen hat dazu geführt, Religionen als ein allgemein menschliches, wenn auch geschichtlich verschiedenartiges Erscheinungsbild anzusehen.
Im modernen Schulunterricht begegnen wir heute mitunter statt des konfessionellen Religionsunterrichtes dem Fach Ethik. Diese Entwicklung kennzeichnet das Unvermögen der einzelnen Konfessionen, sich den wahren, aus echtem religiösen Verhalten gewonnenen Erkenntnissen zu öffnen. Statt dessen werden zumeist nur traditionsgebundene, aber damit nicht unbedingt wahre Lehraussagen propagiert, oder man gibt vor, eine Ethik zu lehren, die jedoch nur oberflächlich einen Lehrwert besitzt, weil ihr jegliche fundamentale religiöse Erkenntnis fehlt. Ethik ist kein Religionsersatz und durchaus nicht das Instrument, mit dem die Fragen nach Sinn und Ziel unseres Lebens beantwortet werden können. Ethische Handlungen sind der jeweils vorherrschenden allgemeinen Meinung angepaßte Tätigkeiten, die entsprechend ihrer Zweckmäßigkeit manipuliert werden können. Todes- strafe, Abtreibung und Kriegsdienstverweigerung sind Beispiele, an denen man erkennen kann, wie schwankend ethische Normen sein können, wenn eine Gesellschaft nach vorherrschenden Meinungen deren Wert bestimmt. Die eigentliche Beurteilungsgrundlage, die absolute und immer gültige Wahrheit, bleibt bei diesen nach sogenannten ethischen Gesichtspunkten gefällten Entscheidungen im Hintergrund. Letztlich ist aber eine gültige Antwort auf unsere Lebensfragen nur aus der tiefen religiösen Erkenntnis heraus möglich. Papst Paul Johannes II. drückte dies auf seiner Deutschlandreise am 15. November 1980 so aus: „Nicht, was die öffentliche Meinung sagt, ist wichtig; wichtig ist, was der Wille Christi ist.“
Zweifellos erfahren wir bei unseren Entscheidungen eine Ohnmacht gegenüber einer Kraft, der wir uns in der Erkenntnis der eigenen Schwäche unterordnen. Diese Kraft versuchen wir Menschen uns -- je nach dem Ausmaß unserer sinnenhaften Befangenheit - vorzustellen. Dieser Vorstellung kann ein Fetischzauber entsprechen, ein imaginärer Supermensch oder ein anderes, körperlich vorstellbares Wesen, das vielleicht als Weltraumfahrer von einem fremden Stern zu uns kommt. Es können aber auch die Allmacht einer Partei, der Einfluß der Sterne, die verschiedensten Götter, wie wir sie aus der Antike kennen oder ein Orakel das Objekt unserer Vorstellung sein; wir haben jedoch auch die Fähigkeit, uns jenes Wesens bewußt zu werden, das als Ursprung von allem in totaler Unabhängigkeit als „ens absolutum“, als das total unabhängige Sein, nach christlichem Sprachgebrauch als Gott, der Herr, oder nach Christi Worten als „Unser Vater“ bezeichnet wird.
Wie wir diese Kraft letztlich personifizieren, liegt in unserer eigenen Entscheidungsfreiheit, jenem Hauptmerkmal unserer menschlichen Existenz. Hier kann kein anderer Mensch uns helfen. Hier sind wir auf uns selbst angewiesen und total gefordert. Die uns in dieser Situation bewusst werdende eigene Ohnmacht und das hieraus resultierende Streben nach Überwindung dieses Zustandes ist letztlich die Antwort des Menschen auf den göttlichen Anruf. Es ist der aus der religiösen Haltung erwachsende Glaube.
WAHRHEIT UND DIALEKTIK
Alle Religionen behaupten von sich, daß allein ihre Lehre die volle Wahrheit verkündet. Mit gleichem Anspruch stehen daneben die verschiedensten philosophischen Denkgebäude. Mit allen diesen Systemen muß sich der kritische Mensch auseinandersetzen. Denn auch das Streben der Philosophie und damit das Streben allen wissenschaftlichen Denkens ist zunächst auf die Suche nach Wahrheit ausgerichtet. Da hierbei zwischen dem denkenden Verstand und der zu untersuchenden Wirklichkeit zu unterscheiden ist, kann das Problem der Wahrheitsfindung nur gelöst werden, indem eine Übereinstimmung zwischen Verstand und Wirklichkeit herbeigeführt wird.
Wahrheit ist aber weder unbedingt das, was wir Menschen nach demokratischen Spielregeln durch Mehrheitsbeschluß für richtig erklären, noch das, was diktatorisch von einem einzelnen oder einer kleinen Gruppe als unanzweifelbar verkündet wird. Der alles umfassende Begriff der Wirklichkeit, der das reale Sein und auch das Nicht-Sein mit einschließt, bezieht sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf die Zukunft und die Vergangenheit und enthält das zeitlos Abstrakte der Mathematik genauso wie das überzeitlich Ewige in der religiösen Erfahrung.





























