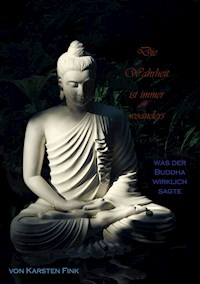
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ich habe einen einflussreichen Freund namens Sahampati. Überhaupt schare ich sehr illustre Persönlichkeiten um mich. Sahampati hat mir erzählt, was unter dem Bodhi-Baum wirklich passiert ist. Er lag quasi bei mir auf der Couch, denn mittlerweile ist er angeschlagen und die vergangenen Ereignisse haben ihn äußerst mitgenommen. Nun hat er gemerkt, dass es nicht mehr so weiter gehen kann. Nichts von alldem, was Sahampati mir erzählte, erstaunte mich, denn das hatte ich schon immer geahnt. Er erzählte mir, dass Ideen die Menschen voneinander trennen. Sahampati sagte, dass er mir von dem Ausmaß dieses Ideenreichtums nur bruchstückhaft berichten könne, es sei einfach zu viel an Kühnheit. Er verdeutlichte mir, dass Ideen die Menschen in tausend Stücke zerbrechen, dass die Ideen und die Bilder, die sie sich voneinander machen, sie daran hindern, zusammenzuarbeiten, und dazu führen, dass sie sich bekriegen. Ich habe in den letzten Monaten so viel gelernt von Sahampati! Er erzählte mir auch von Siddhatta, dem Erhabenen, Vollerwachten, und von seiner Frau Bhadakaccana. Siddhatta negierte die Trennung, die man ihm in seinen Kopf gesetzt hatte, absolut. Deshalb nennt man ihn auch den "Erwachten" und den Baum, unter dem er dieses Juwel fand, den "Baum der Erwachung". Weißt du, was eine absolute Negation ist? Und das war dann doch eine erleuchtende Erkenntnis, auch wenn sie belastend war: Ich selbst war an allem schuld, an meinem Elend, an meiner Situation, denn auch ich nährte diese Trennung, obgleich ich nicht meinen Lebensunterhalt durch diese Trennung erwirtschaftete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Wahrheit ist immer woanders
Was der Buddha wirklich sagte
© 2021 Karsten Fink Autor: Karsten Fink ISBN: 9783752622874
Agni by unknown Artist, Public domain, via Wikimedia Commons Buddha on cover by Mattia Faloretti on
Documents
PUBLISHER'S ADVERTISEMENTGenesisWo ist der Gott?Die Geburt von etwas NeuemSuddhodhanaAsita und der RohdiamantDie Reise des eitlen KaufmannsSumedhas ReiseArjunBhadakaccanaDer RosenholzbaumDer Vater und der SohnDevinderWarum ist er gegangen?DraußenChitta Vritti NirodahBenaresDer KanonDie Wahnversiegung IDie Wahnversiegung IITapussa und BhallikaDas Andrehen des RadesPUBLISHER’S Advertisement.
Die Wahrheit ist immer woanders, und es wäre gut zu verstehen, dass man sie nicht suchen kann. Man kann ja nur suchen, was man kennt.
23. Februar, im Jahre 2021
Genesis
Als ich in dir weilte, hast du mich liebevoll umhüllt und ich war geborgen. Als ich geboren wurde, hast du mich geküsst und begrüßt mit deiner Wärme. Als ich dir nicht gab, was du wolltest, hast du mich ermordet und dabei vergessen, dass ich dein Bruder bin. Ich bin Brahma Sahampati und lebe schon seit einiger Zeit auf dieser Erde, in Zahlen kann ich es nur annähernd sagen, es sind, sagen wir, ungefähr 8000 Jahre. Ich bin dein Geist und dein Gott. Ich schwebte nicht über dem Wasser, wie es geschrieben steht: „Die Erde war wüste und leer und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.“ Die Welt war auch nicht wüste und leer. Damals lebten wir noch in einer großen Familie (Herde), wir fühlten uns auf diese Weise geborgen, denn die Welt war auch damals schon kalt, unbarmherzig und gefährlich. Wenn du nicht aufpasstest, so wurdest du das Futter von wilden Tieren. Zusammen waren wir stark, irgendwann hatten wir das Feuer und die wilden Tiere hatten Angst und blieben fern. Ich kann mich nicht so gut erinnern, da es schon zu lange her ist, aber am Anfang war ich schwach, in vielen Kosmogonien sehen mich die Menschen als stark an, klein, aber mächtig, manchmal sogar von der Größe eines Eis, manchmal gleich als wie ein Hirsekorn, so groß. Aber irgendwann war es so weit und einer von uns – wer ist nicht relevant – rief „gana, gana“ und deutete mit seinem Finger auf das Feuer. Wenn bloß nur einer „gana, gana“ gerufen hätte, wäre wohl nicht viel passiert, aber wir lernten das Festhalten, perfektionierten es und warum nicht auch ein Wort festhalten, wenn man ein Messer oder ein Stück Fleisch festhalten konnte? So weit konnte ich noch nicht denken, aber ich tat es intuitiv, weil es sich gut und nützlich anfühlte, obwohl ich auch Konzepte wie „gut und nützlich“ schon mal gar nicht kannte. Das kam alles später, als ich erwachte. Aber durch dieses „gana, gana“ ward ich geboren. Aber warum „Ich“? Lange Zeit waren wir noch „Wir“ und ich schlummerte noch. Wir fingen an, alles zu benennen. „Bora“ war der Baum, „Gana“ das Feuer, „Bidah“ der Vater, „Moda“ war die Mutter, usw. Das war aber nur die primitive Oberfläche, auf der wir lebten, Dinge, die wir kannten, die uns Sicherheit gaben, wir gaben ihnen Namen. Aber meine wirkliche Geburtstunde war, als jemand sagte, „Bora, Gana, Bidah, Moda, bhavnamana!“ „Baum, Feuer, Vater, Mutter sind Namen!“ Das war die größte Erfindung der Menschheit, und nicht das Rad, wie alle immer denken, wir erfanden die Metaebene des Denkens und mir, Purana Brahmana Sahampati, wurde Leben eingehaucht oder vielmehr: Ich wurde aus einer Idee geboren, auch wenn ich noch gleich einem Baby auf allen Vieren kroch. Wir begannen, über das Denken selbst nachzudenken. Es war kein Zufall, denn man hatte mich gesucht. Wir gaben allen äußeren Phänomenen einen Namen und im Grunde verstanden wir die Welt nicht besser dadurch, nein, wir hatten Angst, große Angst, denn wir starben und wir sahen uns gegenseitig sterben. Weil wir Angst hatten, wendeten wir uns dem Vergnügen zu und viele Menschen wurden geboren, viele starben, aber es wurden mehr geboren, weil wir zeugten. Schuld daran war die Angst, die wir jedoch im Akt der Vereinigung nicht abschütteln konnten. Im Gegenteil, je mehr wir uns paarten und fleißig mehrten, desto mehr Angst hatten wir, weil die Lust unser Gehirn vernebelte und zerstörte. Das Wort „Nama“ war eine Bezeichnung dafür, dass wir der Realität Zeichen zuwiesen. Es wurde eine Bezeichnung für alle Zeichen, ob wir sie sprachen, in den Sand schrieben oder in einen Baum ritzten, der Name. Noch fehlten die klaren Konturen des Begriffs, den in unserer Zeit Ferdinand De Saussure ihm gab, De Saussure hatte mit seinem analytischen Verstand gleich einem Seziermesser Name und Inhalt getrennt. Zu dieser Zeit war Name und Inhalt nicht getrennt, Bezeichner und Bezeichnetes waren eine Einheit. Die Menschen waren beherrscht von einem Glauben an eine von Geistern und Göttern durchtränkte Umwelt, die auch in die Namenwelt hineinragte, also tief in ihren Kopf. Die große Welt kümmerte sie noch nicht, denn sie lebten in ihrer Gemeinschaft, waren mit der Natur verbunden, beteten Steine und Bäume an, pflegten ihre Totems und waren im Großen und Ganzen von Daseinsfreude erfüllt. „Nama“ bedeutete deshalb auch „Geist“, den Geist der Manuschya, wie wir Menschen uns damals nannten. Analog zu Nama Manuschya erfanden wir das Nama Bora und das Nama Gana, den Geist des Baumes und den Geist des Feuers. Wir waren so einsam! Verstehst du, werter Leser, wir brauchten jemanden zum Quatschen und um die Angst zu vertreiben und je mehr wir mit Nama Bora und mit Nama Gana in Kontakt traten – wir hatten da so Mittelchen –, desto wichtiger wurden sie, sie blähten sich auf und wurden zu vollwertigen Göttern. Das war die schöne Zeit des Polytheismus, wo die Welt noch in Ordnung schien und nur hier und dort ein bisschen bröckelte. Das Denken spielte sich innerhalb weniger Bilder ab und war beschränkt, doch was für ein Segen war diese Beschränktheit! Doch hier lag die Crux: Die Ressourcen waren nicht unendlich, Land war auch nicht in unendlicher Fülle vorhanden, so gingen manche fort, Kain erschlug Abel, der erste Mord wurde verübt, und wir verstreuten uns in alle Himmelsrichtungen. So nahm ich also Gestalt an, die Menschen fingen an, mir Opfer zu bringen, aber immer mit Hintergedanken. Sie nannten es Opfer, in Wirklichkeit war es ein armseliger Tauschhandel. Tatsächlich konnte ich ihnen nichts bieten, weil ich nur ihre eigene Erfindung war. Die Mangos wuchsen an den Bäumen, weil die Erde Regen brachte und nicht, weil der große Geist des Gewitters ihn spendete. Und sie beteten und beteten immer weiter und weiter, träumen von Reichtum, Gesundheit, Macht und anderen eitlen Dingen (allesamt vergänglich) und sie dachten, der Name wäre ich und wenn sie den Namen millionenfach wiederholten, hätten sie mich millionenfach im Herzen, sie bräuchten den Namen nur zu nennen, um mich heraufzubeschwören. Was für eine Illusion! Sie waren so kühn (im Sinne von dumm)! Und dann gingen sie so weit, den göttlichen Nama mit ihrem eigenen gleichzusetzen. Und wieder war es die Macht der Analogie. Die Götter wurden in einen Topf geworfen und zu einem Einheitsbrei verkocht. Die Menschen waren verschieden und doch gleich, dachten jeder für sich und hatten doch alle die gleichen geheimen Träume und Wünsche. Die Götter waren also auch verschieden, und doch waren sie alle gleich, verschmolzen ins ewige Eine, ins Nama. Und das Nama war gut und so wurde das Gut zu Gott. Mein Moment war gekommen: Ich war entgültig entfesselt, frei und konnte ungehemmt spinnen, was das Zeug hielt. Da wir uns nun derart vermehrt hatten, waren wir in der Welt verstreut gleich einem Virus, eine Pestilenz, die die Welt befallen hatte und sie nicht mehr losließ. Unsere Zügellosigkeit brachte gleich mehrere Probleme mit sich, zum einen färbte sich der Ganges dunkel. Aus diesem herrlichen Gewässer war eine braune Brühe geworden, in der Leichen halb verbrannt in Richtung Meer ihre Reise antraten. Zum anderen waren wir aus der Gnade gefallen, das Eine trat nun an die Stelle der alten Vielheit. Wir benannten das gute alte „nama“ in „nama–rupa“ um, es verdiente einen neuen Namen. Das Problem aber an „nama–rupa“ war, es hatte sich braun gefärbt, stank, war ekelhaft und unerträglich, und das war die eigentliche Realität, die sich uns Menschen derart offenbarte. Die Konsequenz war, dass wir nun aus dieser unserer Realität entfliehen wollten, denn sie war so schrecklich geworden, dass wir sie nicht einmal als die wahre Realität akzeptieren konnten. Die manifeste Welt, also das, was wir vor unseren Augen sahen, war gar nicht existent. Das musst du dir einmal vorstellen, ich war so spitzfindig geworden, ich konnte die Realität einfach hinfortzaubern, alles so krumm biegen, wie ich wollte. Die Welt existierte gar nicht, ich hatte eine von vielen Ideen, dass unsere Welt, wie sie sich darstellte, aus dem Einen, dem Atman, hervorgegangen sein musste oder aus Brahma, was dasselbe ist, und ich staunte nicht schlecht über meine eigene Erfindungsgabe, als ich feststellte, dass die Realität aus mir selbst hervorgegangen sein musste. Ich selbst war es, der tagein tagaus die Realität aus meinem eigenen Bauch herauspresste, wie eine Frau ein Kind. Ich war der Magier, der die Welt erwirkte. Das einzig Reale, aber, bin ich. Die Welt ist Maya, aus meiner illusionistischen Kunstfertigkeit geboren. Aus dem Optimismus und der Freude am Leben entstand der Pessimismus und der Wunsch nach dem unscheinbaren Atman. Aber der war leider gar nicht greifbar, man musste ihn suchen. Und ich sprach: „Wer von Begehren frei, in wessen Seele das Feuer des Begehrens nicht mehr brennt, und wer nur nach Atman begehrt, wird in das allumfassende Brahman eingehen.“ Ich war in meine eigene Falle gegangen, denn ich begehrte immer; mein Begehren ist grenzenlos. Ich kenne alle Freuden und das Glück, ich halte sie fest. Mein Geist ist göttlich, denn mein Geist ist Gott, den ich selber erschaffen habe. Ich bin einer von vielen gleichen, aber auch ein Individuum. Ich bin Purana Brahma Sahampati und das ist meine Geschichte, oder besser: die Geschichte der Namen.
Wo ist der Gott?
Der alte Mann saß wie immer vor seiner Hütte. Er hörte die Vögel und die Affen im Banyanbaum und die anderen Bäume und Büsche des Waldes und alles um ihn herum glänzte wunderschön in sattem Grün. Der Asket hätte erfreut sein müssen über diesen lieblichen Ort, am Ufer der Yamuna, die noch frisch und jung sprudelte, gerade dem Himalaya entsprungen, klar und rein fließend, aber das war er nicht. Er sah nicht, wie die Fische frei und glücklich im Wasser glitten, er sah nicht die Sonnenstrahlen, wie sie grüngefärbt durch die Blätter drangen und vom brausenden Wasser reflektiert wurden und wie das Licht und die Erde, die Wolken und das Wasser zusammen dieses erhabene Gebet in seiner absoluten Schönheit erschufen, Moment für Moment neu. Er hatte hier 20 Jahre gewohnt, aber nicht einmal hatte er dieses Licht oder die fernen Berge wahrgenommen, immer hatte er das Denken angebetet, Wörter zu Texten versponnen und war auf der Spur der ältesten Schriften auf dem Pfade seiner tollkühnen Phantasie und seiner Schwindel erregenden Gedankengebäude gewandelt. Sein Name war Yajnavalkya und er war nicht zufrieden mit den Veden. Einiges hatte er hinzugedichtet und die Weisen im ganzen Lande liebten seine Verse und sangen und feierten sie überall, waren es doch die Musik und der Schmuck ihres Triumphzuges, süß und verlockend wie Honig. Denn warum sollten die Veden nicht einfach erweitert werden können? Dieser Mann hatte ein überragendes Talent, so dass sein Schüler ihm ergeben zu Füssen saß und auf das Murmeln lauschte und sich alles einprägte, als der Alte flüsterte: „Am Anfang war der Geist, der reine Geist, Prajapati; und er begehrte: Möge ich eine Vielheit sein, möge ich mich fortpflanzen. Er mühte sich ab, versetzte sich in Glut. Als er sich abgemüht, sich in Glut versetzt hatte, erschuf er zuerst das Brahma, das dreifache Wissen; das wurde ihm zum Halt, deshalb sagt man: ‚Das Brahma ist der Halt dieses Alls.‘ Deshalb gewinnt Halt, wer das heilige Wort gelernt, denn was das Brahma ist, das ist Halt. Wer das heilige Wort gelernt, macht aus Hymnus, Spruch und Lied sein Ich, seinen Atman bestehen.“ Und er dachte: „Das Brahmaopfer ist doch das höchste Opfer, dem Einen opfern wir den Atem, den Hymnus und das Lied.“ Er machte sich Sorgen um seinen Schüler, als ihm ein sehr alter Hymnus einfiel: „Der flammende Gott Agni Vaisvanara, das Feueropfer, flammte in den Osten hinein über alle Ströme hinweg, beginnend bei der schönen Saraswati. Und andere Ströme begegnen ihm, doch er zog über sie hinweg. So kommt er zum Fluss Sadanira im Kosalaland, der von den Schneebergen im Norden strömt; über den war Vaisvanara nicht hinweggeflammt, denn vordem war dies gar schlechtes Land, zerflissener Boden, Agni hatte ihn nicht genießbar gemacht. Jetzt aber wohnen östlich von dort viele Brahmanen, jetzt aber ist es gar gutes Land, denn nun haben Brahmanen es mit Opfern geniessbar gemacht.“ Er hatte noch alles im Kopf, doch wie lange noch, zumal sich die selbstgedichteten Loblieder allmählich mit den Veden vermischten und eins wurden. So sei es, er wusste, was er tat. Sein ganzes Leben lang hatte er die Veden studiert und ihre Macht und ihre Schönheit verinnerlicht. Sandilya war sein guter Schüler, der fleißig alles festhielt, im Kopfe, was der Meister lehrte, jedes Wort, jede Betonung, jede Satzmelodie, denn die Meister des Brahma sponnen unablässig lebendige und ausschließlich mündliche Überlieferungen, und deren Rezitation war der Sinn ihres Daseins. Er hatte dies seinem Schüler oft genug eingeprägt und er wusste, dass sein Schüler wie das heilige Feuer von Vaisvanara nach Wissen brannte und dieses in Bharat verbreiten würde und weiter bis in den Osten, der noch nicht vollständig gläubig war, wie die Schriften verkündeten. Er würde seine heilige Pflicht tun, noch einige Jahre, wahrscheinlich nach seinem Tode, würde er auch ein großer Lehrer und Menschenführer werden, denn allmählich hatten die Verbündeten seines Berufszweigs es verstanden: Nichts gedieh ohne das Opfer von Brahmanen und sie hießen so, weil sie denen, die für das Eine empfänglich waren, Augenblicke der Erlösung offenbarten, man musste nur hören. Und er würde nie aufhören Worte zu verknüpfen, wie eine Spinne es tat. „Was da war, was da sein wird, preise ich, das große Brahma, das Eine, Unvergängliche, den Atman, ihn verehre man, den Geistigen, dessen Leib der Odem, dessen Gestalt Licht, dessen Selbst der Aether ist, der sich Gestalten bereitet, welche er will, den Gedankenschnellen, voll rechten Wollens, voll rechten Haltens, allduftig, allsaftreich, der nach allen Weltgegenden dringt, der durch dies All reicht, wortlos, achtlos. So klein wie ein Korn Reis, also weilt dieser Geist im Ich; Golden wie ein Licht ohne Rauch, so ist er.“ Plötzlich überkam ihn die Trauer, wie es manchmal passierte und er kehrte wieder nach Hause zurück, in seinen Gedanken war alles wie damals, eingebrannt in seinen Kopf, die Wende seines Lebens, weshalb er sie nicht vergessen konnte, und er dachte, dass es einen tiefen Sinn haben musste, dass er immer wieder in seine alte Wohnstätte zurückkehrte, auch wenn er die Momente verabscheute, in denen seine Erinerung ihn an der Nase herum führte. „Das ist der Augenblick, ich erinnere mich daran, weil er der Wendepunkt meiner Welt ist.“ Er sah seine beiden Frauen vor Augen, er hatte sie geliebt, denn sie waren die schönsten Frauen der Welt gewesen, er liebte sie immer noch, nach 70 Jahren der Trennung, ob sie noch lebten? Wenn dieser Raum in der Vergangenheit sich öffnete, ging er immer geradewegs denselben Weg und es tauchten auch immer dieselben Fragen auf. Das war sein Tapas, seine Kasteiung und Prüfung, er hatte nicht umsonst 70 Jahre lang gelitten, denn nun hatte er etwas viel größeres gewonnen, das heilige Wissen vom Einen. „Tat tvam asi“, sprach er immer wieder zu sich selbst: „Du bist es selbst“, er hatte viele Jahre gelitten, um das zu verstehen, dass er selbst den Atman in sich trug und gleichzeitig der Verkünder dieses Einen war, das quälende Gefühl der eigenen Begrenztheit war auf einmal verschwunden, mystische Verzückung durchdrang ihn und geheime Königreiche öffneten ihre Pforten, ihm, dem sich das Brahma enthüllt hatte; „wer also sieht, also denkt, also erkennt, an dem Ich sich freuend, mit dem Ich spielend, mit dem Ich sich paarend, an dem Ich sich ergätzend, der ist Selbstherr; frei durchwandelt er alle Welten.“Er sah Katyayani, wie sie vor ihm stand mit Tränen in den Augen, flehend: „Bitte geh' nicht, ich kann nicht leben ohne dich, du kannst noch so viele Reichtümer hinterlassen, was habe ich von ihnen, wenn ich sie nicht mit dir zusammen genießen kann, da ich bald sterben werde, denn durch dich erst werde ich unsterblich, mein Herr, ich liebe dich.“ Er aber schaute seine beiden Frauen gleichgültig an und sagte achtlos: „Ich suche etwas und werde es nicht bei euch finden.“ Maitreyi, die andere Frau war verständiger und fragte: „Was kann so viel besser sein als das Leben mit uns, wir lieben dich, deine drei Töchter lieben dich, vergöttern dich, du bist der Halt unserer Familie. Warum ist das besser, wofür du uns verlässt? Ich will wissen, was das ist, was dich lockt, geht es dir doch so gut bei uns. Die schönste, beste Speise bekommst du allzeit, unsere Existenz ist sinnlos ohne dich, denn wir sind nur hier, um dir zu dienen. Was soll ein Diener ohne Herr?“Er erinnerte sich noch genau, an die Antwort, die er ihr gab, jedes Wort war voller Bedeutung: „Wie ein Salzklumpen, den man ins Wasser wirft, im Wasser auflöst und man nicht herausschöpfen kann, wo man aber von dem Wasser schöpft, es salzig ist, so wahrlich ist auch das große Wesen, das unendliche, uferlose, des Erkennens Fülle: Aus diesen irdischen Wesen tritt es in Erscheinung und mit ihnen verschwindet es. Kein Bewußtsein gibt es nach dem Tode; höre, also rede ich zu dir.“ Da sagte Maitreyi: „Dein Wort, Erhabener, macht mich irre: Es gibt kein Bewußtsein nach dem Tode?“Yajnavalkya antwortete: „Nicht Irres verkünde ich dir; wohl lässt es sich verstehen. Wo eine Zweiheit von Wesen ist, da kann einer den anderen sehen, da kann einer den anderen riechen, da kann einer zum anderen reden, da kann einer den anderen hören, da kann einer den anderen sich vorstellen, da kann einer den anderen erkennen. Wo aber einem alles zu seinem Ich (zum Atman) geworden ist, durch wen soll er und wen soll er dann sehen, durch wen und wen soll er dann riechen, durch wen und zu wem soll er dann reden, durch wen und wen soll er dann hören, sich etwas vorstellen, erkennen?“ Er drückte die Erinnerung weg, sie war sehr mächtig, aber über die Jahre hatte er es geübt, sie zu verwerfen. Sie kam aber immer wieder. Welche Bedeutung hatte das? Es musste eine Bedeutung haben, alles hatte eine Bedeutung. Er dachte schnell an etwas anderes und erinnerte sich: „Der Atman war im Anfang da, einem Manne gleich; er schaute um sich und sah nichts anderes als sich selbst; er sprach das erste Wort: ‚Ich bin‘; daher kommt der Name ‚Ich‘; deshalb sagt auch jetzt noch, wer von einem andern angesprochen wird, zuerst: ‚Ich bin es ...‘ und sagt dann seinen Namen, seinen anderen Namen, den er führt. Er fürchtete sich; deshalb fürchtet sich, wer allein ist. Da gedachte er: ‚Da nichts anderes ist als ich, wovor fürchte ich mich dann?‘ Da verschwand seine Furcht. Wovor hätte er sich auch fürchten sollen? Vor einem Zweiten empfindet man Furcht. Er fühlte sich auch nicht zufrieden; deshalb fühlt sich nicht zufrieden, wer allein ist. Er begehrte nach einem Zweiten. Er umfasste in sich die Wesenheit von Weib und Mann, die sich umschlungen halten. Er spaltete diese seine Wesenheit in zwei Teile: Daraus wurden Gatte und Gattin; deshalb sind wir jeder gleichsam ein halber Brocken, deshalb wird diese Lücke (der männlichen Natur) durch das Weib ausgefüllt. Er vereinte sich mit ihr; so wurden Menschen erzeugt. Dann nahmen die geschaffenen Menschen der Reihe nach die Gestalt aller Tiergestalten an und erschufen die Tierwelt. Dann entließ der Atman das Feuer und Wasser, Agni und Soma. Dies ist das Sichüberschaffen des Brahma, weil es höhere Götter als es selbst geschaffen hat und weil es, ein Sterblicher, Unsterbliche geschaffen hat, deshalb ist es ein Sichüberschaffen. In diesem seinem Überschaffen findet seine Stätte, wer solches weiß.“Was waren die Götter überhaupt noch wert? War nicht das Eine das Ziel, das geheime Wissen, das ihm und seinesgleichen sich durch die Veden, mit den Veden, offenbart hatte? Er war überzeugt, dass er erlöst war. Dafür hatte er alles hergegeben, wenn er starb, so würde er in das Ewig Eine eintreten und sich mit ihm vereinen, nie wiederkehren, sich auflösen, denn aufgehoben würden alle Grenzen sein, das Leid würde nicht mehr existieren, aber auch das Nicht-Leid. Er erfreute sich an der Pracht der Götter, aber sie waren wie der Mensch aus dem Brahma hervorgegangen und war der Mensch nicht größer als alle Götter, trug er doch in sich den Atman, der auch das Brahma ist? Doch wer war der würdigste unter den Menschen, wenn nicht die Träger des Brahma, die Schürer des Feuers und der heiligen Hymne, die Brahmanen? Sie waren die Auserwählten und mussten es bleiben. Und wieder murmelte er alte Lieder aus seinem Gedächtnis: „Vayu fegt über das Meer hinweg und auch das Land, so ruht er auch in meiner Rede und auch in dieser Atemluft. Die Sonne brennt auf das Kuru-Land so heiß, doch ruht sie auch in meinem Auge, und keiner ahnt es, weiß es, Nun kommt die Zeit, es zu verkünden: Agni ruht in meiner Weisheit, der Mond mit meinem Geist sich muss verbünden. Und der Atman, wie ein kleines Körnchen Hirse, Wo ruht er? Ich sag es dir: In meinem und deinem Herzen. Nicht Tod und nicht Unsterblichkeit war damals, nicht gab's der Tage und der Nächte Anblick, von keinem Wind bewegt das Eine atmet, aus eig'ner Kraft und nichts andres war als dies. Woher sie ward, woher sie kam, die Schöpfung, die Götter reichen nicht in jene Ferne. Wer ist's, der weiß, von wannen sie gekommen? Und wie das Schaffen ist beschaffen, Ob geschaffen oder ungeschaffen? Das weiß nur er, der Allbeschauer droben am höchsten Himmel, oder weiß er's doch nicht? Er, der den Himmel stark, die Erde fest erschuf, der die Sonne und das Firmament befestigt, durchmessen hat er jede Himmelsrichtung. Wer ist der Gott, dass wir ihm opfern mögen? Der uns das Leben gibt und auch die Kraft, beherrscht das Schneegebirg in seiner Größe, und auch den Ozean, den weiten Strom. Wer ist der Gott, dass wir ihm opfern mögen?“
Die Geburt von etwas Neuem
Die Geschichte von Gautama ist umgeben von Lügen, die sich um sie ranken. Die erste große Lüge ist, dass Herr Gautama ein Gott war, der heute noch unsere Gebete erhört. Herr Gautama war ein schöner Mensch, außergewöhnlich, feinsinnig, einzigartig, aber er war kein Gott. Woher ich das weiß? Nun, es gibt keine Götter, und schon gar keine Götter auf zwei Beinen. Sein voller Name war Siddhatta Gautama Buddha. Seine Mutter war Maya. Maya bedeutet in Sanskrit Täuschung, Illusion oder Magie. Sie stammte aus dem Geschlecht der Sakyas. Auch der Vater von Siddhatta, Suddhodhana, war ein Sakya und unterstand dem Großraja von Kosala, Mahakosala. Wer Maya sah, war geblendet von ihrer Schönheit, so geblendet, dass ihm drohte, der Verstand vor lauter Liebe zu entfliehen, weshalb Suddhodhana sie schnell heiratete, bevor ein anderer es konnte, denn sie war die Schönste im ganzen Land. Und das war sie wirklich, denn Schönheit erwächst aus innerer Güte und ist ein Spiegel derselben. Wer aber denkt, dass so manches Fräulein schön ist, und sich darüber wundert, dass sie kein gutes Herz hat, der hat nicht richtig geguckt und sollte einen genaueren Blick tun. Maya war Schönheit in ihrer reinsten Form, die Essenz von Schönheit sozusagen, ihre Definition. So war sie, ihre goldbraune Haut war weich wie Seide und makellos. Ihre Augenbrauen ruhten in perfekter Harmonie über ihren Augen, zwei Gefäßen, in denen sich die unermessliche Schönheit der Welt spiegelte. Wer in den Bann ihres Lächelns geriet, war verloren. Aber Maja war nicht böse. Sie war ein guter Mensch. Und gute Menschen gebären Gutes so wie dieses Kind Siddhatta. Sie wollte niemanden verblenden. Zu jener Zeit wurde das Mittsommerfest in Kapilavatthu, der Hauptstadt des Sakya-Reiches, begangen und die Menschen genossen ausgelassen die Festlichkeiten. In den sieben Tagen vor dem Vollmond hatte Maha-Maya daran teilgenommen, doch nicht hatte sie jedwede berauschende Substanz zu sich genommen und ihr Geist war klar, gleich als wie die Blumen und die wohlriechenden Düfte, die in ihrer Brillanz die Sinne der Besucher erfreuten. Am siebten Tag stand sie früh auf und nahm ein Bad in parfürmiertem Wasser. In ihrem herrlichsten Kleid nahm sie am Festmahl teil und indem sie gelobte, die acht Gebote zu beachten, ging sie in ihr Schlafgemach. Im königlichen Bett schlief sie sofort ein. Es träumte ihr, sie werde von den vier Erzengeln, den Wächtern der Erde, aus ihrem Bette emporgehoben und sie trugen sie aufs Dach der Welt, auf das Himalaya-Gebirge. Dann legten sie sie unter einen massiven Shala-Baum, sieben Meilen hoch, auf die blutrote Ebene, die 300 Meilen breit war, und traten respektvoll zur Seite; dort angekommen wurde sie in himmlische Gewänder gekleidet, gesalbt und mit himmlischen Blumen geschmückt. Nicht weit entfernt lag inmitten des Silberhügels ein goldener Palast, wo sie eine himmlische Liegestatt bereiteten und darauf legten sie sie mit dem Kopf zum Osten nieder. Ein weißer, prächtiger Elefant ging zur gleichen Zeit auf dem Goldhügel spazieren, nicht weit von dort, stieg dann nieder zum Silberhügel, wobei er sich ihr vom Norden näherte. In seinem silberfarbenen Rüssel hielt er eine weiße Lotusblume und indem er einen mächtigen Ruf ausstieß, betrat er den goldenen Palast und erwies seiner Mutter dreifache Huldigung. Als das getan ward, stieß er gegen ihren Mutterleib und schien in diesen einzudringen. Dann war er plötzlich verschwunden und der Tathagata (der Vollendete) ward gezeugt. Monate später, an dem Tag, der unausweichlich war, weil er der letzte war, nahm sie sogar noch Rücksicht auf ihren Raja, der an diesem traurigen und doch so verheißungsvollen Tage eine Bauerndelegation zu treffen hatte, wo er die Kontingierung von Zahlungen an die Republik überwachen sollte. Der Raja war an seine Verpflichtungen gebunden und konnte den Wunsch seiner geliebten Frau nicht erfüllen, als sie zu ihm sagte: „Mein Liebster, mein Raja, ich bin im 9. Monat, die Hebammen in unserem Wohnhaus sind nicht gut ausgebildet. Meine Mutter Yashoda aber ist weise und auch dieses Handwerk beherrscht sie. Es ist nur eine kurze Reise und wenn ich jetzt mit den schnellsten Pferden fahre, so schnell wie der Wind, so bin ich heute Abend bei meiner Mutter.“ Es war schon zur Gewohnheit geworden, dass er seiner Frau jeden Wunsch erfüllte, auch wenn ihn diesmal ein ungutes Gefühl beschlich. „So sei es“, sprach er, „aber du musst alleine fahren, denn wichtige Angelegenheiten warten meiner.“ Derart ward es ausgemacht und das Schicksal ging seinen Lauf. So kam es, dass er mit Bauern feilschte, während seine Frau unter den Blüten des Sala-Baumes ein Kind zur Welt brachte. Sie hatte Channa auserkoren, einen zuhöchst verlässlichen, fähigen jungen Mann, der sie und drei Dienerinnen zu ihrer Mutter fahren sollte. Zwei kräftige Stuten waren es, die den Wagen zogen, aber man kann gar nicht von „ziehen“ sprechen, denn der Wagen flog so schnell daher, als würde er von magischer Hand getrieben. Die Stuten brauchten keine Rast, wie es Pferde sonst taten, aber die junge Maya hatte ihre eigenen Kräfte überschätzt. Auch wenn Channa sich bemühte, seiner Herrin die Reise so annehmlich wie möglich zu machen, und die lieblichsten Wege wählte, so fühlte sie dennoch jeden Stein unter den mit Metall beschlagenen Reifen des Wagens. Plötzlich breitete sich Panik in ihrem Bewusstsein aus, sie badete in einem See von Angst, und weil sie glaubte, allein zu sein in dieser Welt, beherrschte die Furcht sie von Kopf bis Fuß. Der monotone Rhythmus des Wagens hatte sie in einen Zustand des Halbschlafes gewiegt und nun hörte sie eine Stimme: „Die Erde ist gütig, Mutter, fürchte dich nicht, du warst nie allein und wirst nie allein sein. Ich bin jetzt da.“





























