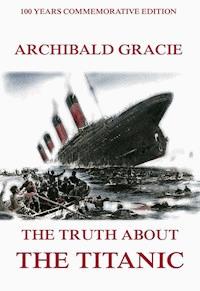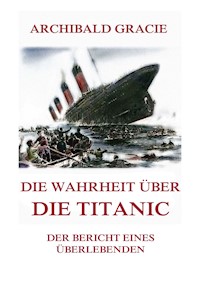
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"Die Wahrheit über die Titanic", von Colonel Archibald Gracie, ist eine eindrucksvolle Darstellung des monumentalen Schiffsuntergangs, die der Autor als einer der wenigen Passagiere überhaupt überlebt hat . Das Buch ist als Hommage und Zeugnis für den "Heldentum aller Beteiligten" geschrieben worden. Colonel Gracie widerlegt viele der Presseberichte über die Katastrophe, wie zum Beispiel, dass der Kapitän und der Erste Offizier Selbstmord begingen. Vieles, was in den bekannten Kinofilmen gezeigt und erzählt wird, ist schlichtweg falsch. Die Geschichte der wunderbaren Rettung des Autors steht für sich selbst. Die von ihm beschriebenen Szenen sind schrecklich und zeigen das Martyrium der Passagiere - sowohl der vielen tausend, die mit dem Schiff sanken, als auch der Überlebenden, die bis zur Ankunft der Carpathia um ihr Leben bangen mussten. Einige der Zeugenaussagen, die vor dem Senatsausschuss und dem britischen Untersuchungskommitee gemacht wurden, werden analysiert und die Geschichte jedes Rettungsbootes wird entsprechend der Zeugenaussagen und der verschiedenen eidesstattlichen Erklärungen wiedergegeben. Der Teil, der der Aussage von J. Bruce Ismay gewidmet ist, dürfte für die Leser von besonderem Interesse sein. Der Tod von Colonel Gracie acht Monate nach der größten Schiffskatastrophe der Welt war auf die damalige Belastung zurückzuführen. Werden Sie Zeuge eines lebendigen Berichts über eine beispiellose Katastrophe, die das Mitleid, aber auch das Unverständnis der Welt hervorrief.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Wahrheit über die Titanic
Der Bericht eines Überlebenden
COLONEL ARCHIBALD GRACIE
Die Wahrheit über die Titanic, A. Gracie
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849652630
www.jazzybee-verlag.de
Inhalt:
Kapitel I – Der letzte Tag an Bord des Schiffes. 1
Kapitel II. – Vom Eisberg Getroffen. 8
Kapitel III – Der Untergang der "Titanic". 27
Kapitel IV – Überlebenskampf im Wasser34
Kapitel V – Die Nacht auf dem gekenterten Boot46
Kapitel VI - Backbord: Frauen und Kinder zuerst59
Kapitel VII - Steuerbord: Frauen zuerst, aber Männer, wo keine Frauen sind. 115
Schlussnote. 160
Kapitel I – Der letzte Tag an Bord des Schiffes
"Daselbst gehen Schiffe, der Leviathan, den du geschaffen hast, darin zu spielen."— Psalm 104:26.
Als einziger Überlebender aller männlichen Passagiere, die sich während des Beladens von etwa sechs Rettungsbooten auf der Backbordseite des Schiffes befanden, vorne auf dem mit Glas überdachten A-Deck und später auf dem darüberliegenden Bootsdeck, ist es meine Pflicht Zeugnis abzulegen vom Heldentum aller Beteiligten. Zuallererst gegenüber meinen männlichen Gefährten, die ruhig dastanden, bis die Rettungsboote mit Frauen und Kindern und dem entsprechenden Anteil an Besatzungsmitgliedern abgelegt hatten – und die dann fünfzehn oder zwanzig Minuten später mit dem Schiff sanken, sich dessen bewusst, dass sie ihr Leben für die Schwachen und Hilflosen geopfert hatten.
Zweitens gegenüber dem Zweiten Offizier Lightoller und der Crew des Schiffes, die ihre Pflicht erfüllten, als ob ähnliche Ereignisse zu ihrer täglichen Routine gehörten; und drittens den Frauen gegenüber, die keinerlei Anzeichen von Furcht oder Panik zeigten in einer Situation, die schrecklicher war als bei jedem anderen Schiffsunglück zuvor.
Ich glaube, dass diejenigen Leser, die an atemberaubende Abenteuergeschichten gewohnt sind, froh sein werden, endlich einen Bericht aus erster Hand lesen zu können; einen Bericht über den Heldenmut der Menschen auf der Titanic, für die es meine traurige Pflicht ist, dieses Zeugnis abzulegen. Ich werde mich bei meiner Erzählung weitestgehend auf das beschränken, was ich selbst gesehen, gehört und getan habe während dieser unvergesslichen Jungfernfahrt der Titanic, die mit der Havarie und ihrem Untergang gegen 2:22 Uhr morgens am Montag, den 15. April 1912 endete. Dem Untergang, nachdem sie einen Eisberg gerammt hatte "am oder um die Position 41 Grad 46 Minuten nördlicher Breite, 50 Grad 14 Minuten westlicher Länge im Nordatlantik" und der mehr als 1500 Menschen das Leben kostete.
Am Sonntag, den 14. April, war dieses wunderbare Schiff, die Perfektion aller Wasserfahrzeuge, die sich das menschliche Gehirn bis dahin erdacht hatte, schon dreieinhalb Tage lang auf ihrem Weg von Southampton nach New York unterwegs auf einem Meer, das so glatt erschien, als sei es aus Glas und das sich noch nicht mal vom leichtesten Anzeichen eines Sturms gekräuselt hatte.
Der Kapitän hatte Tag für Tag die Geschwindigkeit erhöht und prophezeit, dass wir bei anhaltend gutem Wetter einen neuen Rekord für diese Strecke aufstellen und die Jungfernfahrt deutlich früher beenden würden. Aber all seine Berechnungen hatten nie dieses proteische Monster der Nordmeere mit ins Kalkül gezogen – das Monster, das sich schon vorher fatal für jede navigatorische Kalkulation und als furchtbare Vernichtungswaffe erwiesen hatte.
Unsere Entdecker haben die Region der Eisberge soweit nördlich und südlich wie möglich durchdrungen, aber das Wissen über ihr Habitat, das letztendlich sicherstellte, dass unsere Ozeanriesen in der Lage waren ihnen auszuweichen, war nicht ausreichend, um auch verlässlich sagen zu können, wann sie sich loslösen und den Weg versperren.
Am 14. April hatte das Schiff, zumindest sagten das die Berechnungen, 546 Meilen hinter sich gebracht, und man sagte uns, dass wir in den nächsten 24 Stunden noch mehr Strecke machen würden.
Gegen Abend hörte ich, wie sich die Nachricht verbreitete, dass andere Dampfschiffe telegrafische Meldungen gesandt und die Offiziere unseres Schiffes von der Anwesenheit von Eisbergen in Kenntnis gesetzt hatten. Die zunehmende Kälte und die Notwendigkeit, sich wärmer anzuziehen, wenn man an Deck wollte, waren äußerliche und wahrnehmbare Anzeichen, die in Einklang mit dieser Meldung standen. Aber trotz allem wurde die Geschwindigkeit nicht verringert und die Motoren wummerten beständig weiter.
Die alten Seeleute erzählten uns, dass man schon seit über fünfzig Jahren soweit südlich keine größeren Massen Eis oder Eisberge mehr gesehen hatte.
Die Freuden und der Komfort, den wir alle auf diesem schwimmenden Palast genossen, erschien vielen von uns, inklusive meiner Person, fast schon zu schön, um wahr zu sein, und schien nur darauf zu warten, von der schrecklichen Vergeltung einer wütenden Allgewalt zerstört zu werden. Mister Charles M. Hays, Präsident der Canadian Grand Trunk Railroad war nicht nur einer der angesehensten Mitreisenden, sondern brachte auch unsere Gefühle in dieser Sache am besten zum Ausdruck. Er war damals damit beschäftigt, die Ausstattung kommender Erweiterungen seines eigenen, großartigen Eisenbahnnetzes zu sondieren und einzukaufen und schon von daher mit dem Prunk der Unterbringungen auf der Titanic befasst. Hier nun seine prophetische Äußerung, mit der er schließlich nur wenige Stunden später sein eigenes Schicksal besiegelte: "Die White Star, die Cunard und die Hamburg-Amerika-Linie", sagte er, "legen heute all ihre Aufmerksamkeit darauf, sich gegenseitig dabei zu überbieten, die luxuriösesten Apartments auf ihren Schiffen zu erschaffen, aber die Zeit wird bald kommen, in der das schrecklichste und verheerendste aller Unglücke auf See eintreffen wird."
Während der verschiedenen Atlantiküberfahrten, die ich bereits unternommen habe, war es immer meine Gepflogenheit, mich jeden Tag und wann immer das Wetter es zuließ, mit viel Sport in die bestmögliche körperliche Verfassung zu versetzen. An Bord der Titanic aber, in den ersten Tagen unserer Reise, also von Mittwoch bis Samstag, habe ich mich von dieser Praxis abgewandt. Statt mich meiner selbst auferlegten Kur zu widmen, verbrachte ich meine Zeit mit Unterhaltung, nämlich dem Lesen einiger Bücher aus der hervorragend bestückten Bibliothek des Schiffes. Ich genoss die Zeit wie in einem der Sommerpaläste an der Küste, umringt von jedem nur erdenklichen Komfort – nichts ließ mich annehmen oder vermuten, dass ich mich inmitten des stürmischen Atlantiks befand. Die Bewegung des Schiffes und die Geräusche der Maschinen waren auf Deck oder in den Salons kaum wahrnehmbar, weder am Tag noch in der Nacht. Dann wurde es Sonntagmorgen und ich beschloss, dass es höchste Zeit war, meine gewohnten Übungen durchzuführen und mich für den Rest der Reise mehr auf dem Squashfeld, in der Turnhalle oder im Swimmingpool aufzuhalten. Ich war schon zeitig vor dem Frühstück auf und spielte gegen einen professionellen Squashspieler, sozusagen ein halbstündiges Warmmachen vor dem Schwimmen im fast zwei Meter tiefen Salzwasser-Bassin, das angenehm beheizt war. Kein anderes Schwimmbecken hatte mir bisher so viel Vergnügen bereitet. Wie eingeschränkt wäre dieser Genuss jedoch gewesen, hätte mir eine Vorahnung mitgeteilt, wie nahe ich meinem letzten Eintauchen war und dass ich noch vor dem Morgengrauen des nächsten Tages inmitten des Ozeans, auf und unter Wasser und bei minus 2 Grad Wassertemperatur um mein Leben schwimmen musste!
Mein beeindruckendes Gedächtnis holt justament die Bilder der Angestellten des Schiffes und die Unterhaltungen, die ich mit ihnen führte, herbei, als sei alles erst gestern gewesen. Der Squash-Profi, F. Wright, war ein glatt rasierter, typischer junger Engländer, ähnlich den hundert anderen, die ich in vergangenen Jahren gesehen oder mit denen ich gespielt habe – meistens mein Lieblingsspiel Cricket, das mehr zu meiner körperlichen Fitness beigetragen hat als jeder andere Sport. Ich habe seinen Namen in keinem einzigen Bericht über das Unglück gefunden und nehme daher nun die Gelegenheit wahr, von ihm zu sprechen. Vielleicht bin ich ja der einzige Überlebende, der etwas über seine letzten Tage auf Erden berichten kann.
Wir Überlebende haben hunderte Briefe erhalten, viele davon mit Fotos von verlorenen Lieben, die wir vielleicht zufällig gesehen oder mit denen wir eventuell gesprochen hatten, bevor das Schicksal zuschlug. Nur selten war es mir vergönnt, diese zahlreichen Anfragen zufriedenstellend zu beantworten. Das nächste und letzte Mal, dass ich Wright sah, war auf dem Treppengang von Deck C, etwa eine Dreiviertelstunde nach der Kollision. Ich wollte in meine Kabine, als er mir von unten entgegenkam. "Sollten wir den Termin morgen früh nicht besser absagen?", sagte ich etwas drollig zu ihm. "Ja", antwortete er, hielt aber nicht an, um mir vom Zustand des Spielfeldes auf dem G-Deck zu berichten, das zu diesem Zeitpunkt, zumindest sagten das andere Zeugen, bereits überflutet war. Seine Stimme war ruhig, ohne Begeisterung, und sein Gesicht ein bisschen blasser als sonst.
Dem Aufseher beim Swimmingpool gab ich noch das Versprechen, am nächsten Morgen früher da zu sein, aber ich habe ihn nie wiedergesehen.
Eine der Persönlichkeiten auf dem Schiff und allen bestens bekannt war T. W. McCawley, der Sportlehrer. Auch er erwartete mich am nächsten Morgen zur ersten echten Übungseinheit aber ach!, auch er wurde vom Meer verschlungen. Wie gut wir Überlebenden uns noch an diesen stämmigen, kleinen Mann erinnern können, an seinen weißen Flanellanzug und seinen breiten, englischen Akzent! Mit unermüdlicher Begeisterung zeigte er uns die vielen mechanischen Geräte, über die er Herr war, und drängte uns dazu, die Gelegenheit wahrzunehmen und sie auch zu benutzen. Er schwelgte in Sportarten wie Fahrradrennen, Rudern, Boxen, Kamel- und Pferdereiten, etc.
Im Grunde waren meine morgendlichen Übungen die Vorbereitung für die unvorhersehbaren körperlichen Strapazen, die ich nur wenige Stunden später, gegen Mitternacht, im Kampf um mein teures Leben ertragen musste. Konnte man ein Training für diese schreckliche Tortur besser planen?
Die Übungen und das Schwimmen hatten mir Appetit auf ein herzhaftes Frühstück gemacht. Dann folgte der Gottesdienst im Speisesalon und ich erinnere mich noch wie beeindruckt ich war von "Prayer for those at sea", Nummer 418 des Gebetsbuches. Schon allein die Wortwahl war großartig. Vierzehn Tage später hörte ich das Lied erneut, dieses Mal in einer kleinen Kirche in Smithtown, Long Island, beim Besuch eines Gedächtnisgottesdienstes für meinen alten Freund James Clinch Smith, der ebenfalls Mitglied des Union Clubs gewesen war. Seiner Schwester, die neben mir auf der Kirchenbank saß, erzählte ich, dass dies das letzte Lied gewesen war, dass wir an diesem Sonntagmorgen an Bord der Titanic sangen. Sie war sehr bewegt und nannte mir den Grund, warum es für diesen Gedächtnisgottesdienst ausgewählt worden war: es war Jims Lieblings-Kirchenlied, weil es das erste Stück war, das er als Kind spielen konnte und dafür mit einem von seinem Vater versprochenen und gestifteten Preis belohnt wurde.
Es war ein bemerkenswerter Zufall, dass beim ersten, wie auch beim letzten Gottesdienst an Bord das Kirchenlied mit diesen beeindruckenden Zeilen begann:
O God our help in ages past,
Our hope for years to come,
Our shelter from the stormy blast,
And our eternal home.
Die Tage an Bord waren so identisch, dass es wirklich schwer ist, in unserer Beschreibung alle Details der Ereignisse des letzten Tags zu erwähnen.
Das Buch, das ich beendet hatte, und zur Schiffsbibliothek zurückbrachte, war Mary Johnstons "Old Dominion." Während ich friedlich die Abenteuergeschichten und Berichte von außergewöhnlichen Rettungen las, hatte ich keine Ahnung davon, dass ich in den nächsten Stunden Zeuge, Teilnehmer und Darsteller einer Szene sein würde, für die dieses Buch keine Entsprechung bot – dass meine eigene Rettung aus einem nassen Grab eine bemerkenswerte Darstellung der alten Weisheit "Wahrheit ist seltsamer als Fiktion" werden würde.
An diesem Tag habe ich Mr. und Mrs. Isidor Straus oft gesehen. Tatsächlich waren wir vom Beginn bis zum Ende unserer Reise auf der Titanic mehrmals am Tag zusammen. Ich stand mit ihnen an Deck am Tag, als wir Southampton verließen und Zeuge dieses ominösen Beinnahe-Unfalls mit dem amerikanischen Linienschiff "New York" wurden. Dieses lag an seinem Pier, als die Wasserverdrängung unseres gigantischen Schiffes einen solchen Sogeffekt verursachte, dass es aus der Vertäuung gerissen wurde und es fast zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Bei dieser Gelegenheit erzählte mir Mr. Straus, dass es ihm schien, als seien nur wenige Jahre vergangen, seit er genau auf diesem Schiff, der "New York", Passagier während der Jungfernfahrt war und sie ihm als "das Beste, das der Schiffsbau jemals hervorbringen würde" gepriesen wurde. Indem er die beiden Schiffe, die Seite an Seite lagen, miteinander verglich, nahm er meine und die Aufmerksamkeit seiner Frau gefangen. Während unserer vielen, täglichen Unterhaltungen danach erzählte er hauptsächlich von bemerkenswerten Vorkommnissen in seiner Karriere. Oft begannen diese Erzählungen in seinen jungen Jahren, als er in Georgia lebte und für die Konföderierten den Nachschub steuerte und damit für die Blockade Europas verantwortlich war. Seine Freundschaft mit Präsident Cleveland und wie dieser ihn würdigte, interessierte mich am meisten.
An diesem Sonntag beendete er ein Buch, das ich ihm geliehen hatte, und für das er große Begeisterung zeigte. Das Buch war "Die Wahrheit über Chickamauga", also mein eigenes Werk. Nach sieben Jahren, die ich daran gearbeitet hatte, gönnte ich mir die dringend benötigte Pause und um meine Gedanken endlich davon loszueisen, hatte ich diese Fahrt über das Meer gebucht.
Ich erinnere mich, dass Mr. und Mrs. Straus um die Mittagszeit besonders fröhlich erschienen. Sie freuten sich auf eine Unterhaltung mit ihrem Sohn und dessen Frau, die sich auf dem Weg nach Europa befanden und deren Schiff Amerika ganz in der Nähe vorbeifuhr. Für diesen Zweck durften sie den Telegrafen benutzen. Irgendwann vor sechs Uhr erzählten sie mir zufrieden von der Grußbotschaft, die sie im Gegenzug erhalten hatten. Dieses letzte "Auf Wiedersehen" an die Lieben muss ein tröstlicher Gedanke gewesen sein, als nur wenige Stunden später das Ende kam.
Nach dem Abendessen zogen wir uns wie üblich, zusammen mit unseren Tischgenossen James Clinch Smith und Edward A. Kent sowie vielen anderen Passagieren, in den Palmenhof zurück, um dort an unterschiedlichen Tischen Kaffee zu genießen und dabei der immer entzückenden Musik der Band der Titanic zu lauschen. Zu diesen Anlässen war Galakleidung en règle – was bedeutete, dass man in aller Deutlichkeit und voller Bewunderung beobachten konnte, wie viele wunderschöne Frauen doch an Bord dieses Schiffes waren.
Während dieser wunderbaren Abende wanderte ich beständig hin und her, plauderte mit denen, die ich kannte und denen, deren Bekanntschaft ich während der Reise gemacht hatte. Natürlich könnte ich hier Namen und Themen dieser Konversationen nennen, aber diese Details sind wohl nur für die interessant, die daran beteiligt waren und nicht notwendigerweise für den Leser. Die Erinnerung an die Menschen, mit denen ich Seite an Seite diese Katastrophe durchlebte - sowohl diejenige, die den Tod erlitten, dem ich entkommen konnte, als auch die Überlebenden – werden mir ein geschätztes Andenken und Einheitsband sein bis zum Tag meines Todes. Die Männer meines Standes gingen vom Palmenhof immer hinüber zum Rauchersalon, um sich dort jeden Abend mit einigen der namhaften Mitreisenden, die man dort treffen konnte, in Konversation zu begeben. In meinen Erinnerungen finde ich den Namen von Major Archie Butt, Militärberater von Präsident Taft, mit dem man über Politik diskutieren konnte; oder Clarence Moore, aus Washington, D.C., der einige Jahre zuvor eine abenteuerliche Reise durch die Wälder und Berge West Virginias unternommen hatte, um einem Zeitungsreporter ein Interview mit dem Outlaw Captain Anse Hatfield zu beschaffen; oder Frank D. Millet, der bekannte Künstler, der eine Reise nach Westen plante; oder Arthur Ryerson oder, oder, oder.
Während dieser Abende unterhielt ich mich auch mit John B. Thayer, dem zweiten Vizepräsidenten der Pennsylvania Railroad and George D. Widener, einem Sohn des Straßenbahn-Magnaten P. A. B. Widener aus Philadelphia.
An diesem speziellen Abend war mein Aufenthalt im Rauchersalon zum ersten Mal kürzer als sonst und ich zog mich früh zurück; aber nicht ohne das Versprechen meines Kabinenstewards Cullen, mich am nächsten Morgen früh zu wecken, damit ich meine Verabredung zum Racquet-Spiel einhalten und mich später in der Turnhalle und im Schwimmbad verausgaben konnte.
Ich kann kaum glauben, dass es Zufall war, dass ich in dieser Sonntagnacht früh schlafen ging und damit drei Stunden belebenden Schlaf genießen konnte. Wäre der Zusammenstoß um Mitternacht eines der vergangenen vier Tage passiert, wäre ich mental und physisch ausgelaugt gewesen. Dass ich somit gut gerüstet war für die schreckliche Qual - vielleicht sogar besser, als wenn ich vorgewarnt gewesen wäre - erachte ich heute als erste Voraussetzung für meine Sicherheit, eingefädelt von dem Schutzengel, in dessen Obhut ich auch während der wundersamen Rettung war, die ich nunmehr hier niederschreiben werde.
Kapitel II. – Vom Eisberg Getroffen
"Wächter, wie lang ist noch die Nacht?" — Jesaiah 21:11.
Meine Kabine lag steuerbord auf Deck C, etwas achtern mittschiffs, und war nach außen gerichtet. Die Nummer war C51. Ich schlief tief und fest, als mich eine plötzliche Erschütterung und ein Krach vor mir auf der Steuerbordseite wachrüttelte. Ich schloss sofort, dass es einen Zusammenstoß gegeben haben muss, vielleicht mit einem anderen Schiff. Ich sprang aus dem Bett, machte das elektrische Licht an und blickte auf meine Uhr, die auf der Kommode lag. Am Tag zuvor hatte ich sie auf Schiffszeit umgestellt und nun zeigte sie null Uhr. Die korrekte Schiffszeit wäre 11:45 Uhr gewesen. Ich öffnete die Tür meiner Kabine, schaute in den Flur, konnte aber niemanden sehen oder hören – es war keinerlei Aufregung zu bemerken; aber direkt nach der Kollision war lautstark das Geräusch entweichenden Dampfs zu hören gewesen. Ich lauschte angestrengt, konnte aber keine Maschinen hören. Es gab kein Vertun, irgendetwas Schlechtes war passiert, denn das Schiff hatte gehalten und Dampf abgelassen.
Ich zog mein Schlafgewand aus und kleidete mich geschwind in Unterwäsche, Socken, Hosen, Schuhe und einem Norfolkmantel. Ich beschreibe das so detailliert, damit man sich die Zeitspanne, die ich dafür gebraucht haben muss, besser vorstellen kann. Von meiner Kabine war es nur ein kurzer Weg den Gang entlang zur Treppe und ich stieg hinauf zum dritten Deck, also dem Bootsdeck. Dort fand ich aber nur einen jungen Mann vor, offensichtlich mit derselben Mission unterwegs wie ich selbst.
Vor uns auf der Backbordseite lag das Quartier der Ersten Klasse und von dort aus versuchten wir angestrengt zu erspähen, was uns getroffen hatte. Aus verschiedenen Blickwinkeln, immer darauf bedacht, dass die Sicht nicht durch die Rettungsboote an Deck behindert wurde, suchte ich das Objekt; aber mein Unterfangen war umsonst, obwohl ich den Horizont von links nach rechts absuchte. Nichts war zu sehen.
Es war eine wunderschöne Nacht, wolkenlos und mit hell leuchtenden Sternen. Die Luft war ziemlich kalt, aber es war weder Eis noch ein Eisberg in Sicht. Wenn uns ein anderes Schiff getroffen hatte, war von diesem keine Spur zu sehen; und noch kam es mir nicht in den Sinn, dass es tatsächlich ein Eisberg gewesen sein konnte, mit dem wir zusammengestoßen waren. Da mich meine unvollständigen Ermittlungen nicht wirklich zufriedenstellten, ging ich das Deck einmal komplett ab und suchte jede Richtung des Kompasses mit meinen Augen ab. Auf dem Weg zum Heck sprang ich über das Eisentor und den Zaun, der die Kabinen der Ersten und Zweiten Klasse voneinander trennte. Das Schild "Zutritt verboten" ignorierte ich geflissentlich. Ich schaute mich in Richtung der Offiziersquartiere um, wohl in Erwartung eines Rüffels wegen Nichtbeachtung der Vorschriften. In Anbetracht des Zusammenstoßes hatte ich erwartet, einige Schiffsoffiziere auf dem Bootsdeck zu sehen, aber dort war kein Mensch – und damit auch niemand, von dem man Informationen darüber bekommen hätte können, was denn nun tatsächlich passiert war. Während meines Rundgangs waren die einzigen Menschen, die ich wahrnahm, ein Paar mittleren Alters, das Arm in Arm und ganz unbesorgt spazieren ging. Sie waren auf der Steuerbordseite des Quartiers unterwegs und hatten gegen den Wind zu kämpfen. Der Mann trug einen grauen Überzieher und eine schützende Kappe.
Nachdem ich hier nichts Befriedigendes feststellen konnte, ging ich hinab auf das mit Glas überdachte A-Deck und spähte auf der Backbordseite über die Reling, um festzustellen, ob die Kiellinie des Schiffes gleichmäßig verlief. Aber es gab nichts Beunruhigendes zu sehen. Im Niedergang traf ich Mr. Ismay, der mit einem Mitglied der Crew die Treppe hinaufeilte. Er trug einen Tagesanzug und, wie üblich, keinen Hut. Er war viel zu beschäftigt, um irgendjemanden wahrzunehmen. Daher sprach ich ihn nicht an, betrachtete aber sein Gesicht sehr genau; vielleicht konnte ich ja daraus erschließen, wie ernst der Zwischenfall gewesen war. Es schien mir, als wollte er seinen Gesichtsausdruck so tapfer wie möglich halten, um ja keine Beunruhigung unter den Passagieren auszulösen.
Am Fuß der Treppe standen einige männliche Passagiere beisammen und ich stellte zum ersten Mal fest, dass auch andere genauso aufgerüttelt worden waren wie ich selbst. Unter ihnen war auch mein Freund Clinch Smith, von dem ich zuerst erfuhr, dass uns ein Eisberg getroffen hatte. Er öffnete seine Hand und zeigte mir ein Stück Eis, flach wie meine Uhr, und schlug ganz ungerührt vor, dass ich es als Souvenir mit nach Hause nehmen könne.
Wir Überlebende können uns sicher alle an seine Art erinnern, einen Witz zu machen, ohne dabei auch nur eine Miene zu verziehen. Während wir dastanden, erreichte uns schließlich die Geschichte des Zusammenstoßes – wie jemand beim Auflaufen des Schiffes aus dem Rauchersalon stürmte, um zu sehen, was passiert war und bei seiner Rückkehr erzählte, dass er einen Eisberg gesehen hatte, der das A-Deck um gute fünfzehn Meter überragte – was wiederum bedeutete, dass er insgesamt über dreißig Meter hoch war, sollte diese Schätzung zutreffen. Hier erfuhr ich auch, dass der Einkaufsbereich überflutet war und die mutigen Postangestellten in einem halben Meter tiefen Wasser standen und trotzdem ihren Job machten. Sie waren damit beschäftigt, die zweihundert Taschen mit über viertausend Briefen auf höher gelegene Decks zu verfrachten. Die Männer, die allesamt mit dem Schiff untergingen, haben es verdient, dass ich hier ihre Namen nenne. Diese waren: John S. Marsh, William L. Gwynn, Oscar S, Woody, Iago Smith und E. D. Williamson. Die drei Erstgenannten waren Amerikaner, deren Familien nach dem Untergang durch die Regierung versorgt wurden, die anderen Engländer.
Und dann entdeckten Clinch Smith und ich eine Liste, die auf dem Boden des Niedergangs lag. Wir hielten diese Erkenntnis zwischen uns beiden, da wir nicht beabsichtigten, irgendjemanden zu erschrecken oder Panik zu verursachen; dies betraf insbesondere die Damen, die nun auch nach und nach auftauchten. Wir erachteten es auch nicht als unsere Pflicht, unsere Meinungen zur Ernsthaftigkeit der Situation, welche sich uns nunmehr mit Nachdruck darstellte, abzugeben. Er und ich beschlossen, geeint durch das stille Band der Freundschaft, bis zum äußersten Notfall zusammenzubleiben und uns, wann immer es notwendig war, gegenseitig zu helfen.
Ich erinnere mich daran, dass mir in diesem Moment alles in den Sinn kam, was ich in vergangenen Tagen über Schiffswracks gelesen hatte; und dass ich mir Smith und mich selbst vorstellte, wie wir uns an ein überladenes Floß klammerten und kaum mehr Wasser und Nahrung hatten. Wir kamen überein, unsere jeweiligen Kabinen aufzusuchen und uns später wiederzutreffen. Dort angekommen packte ich meine Habseligkeiten in drei große Reisetaschen für den Fall, dass das Gepäck bereitstehen musste, sollte es zu einem eiligen Transfer zu einem anderen Schiff kommen. Glücklicherweise zog ich meinen langen Newmarket-Überzieher an, welcher hinunter bis über meine Knie reichte. Als ich schließlich vom Flur zurück in den Niedergang kam, fand ich meine größten Ängste bestätigt. Männer und Frauen zogen sich Schwimmwesten über und die Stewards halfen ihnen dabei, diese korrekt auszurichten. Steward Cullen bestand darauf, dass ich meine Weste aus der Kabine holen müsse. Ich folgte seiner Anweisung und er befestigte eine Weste an mir selbst, während ich die andere holte, um damit jemandem anderen nützlich sein zu können.
Draußen auf dem A-Deck, backbord und in Richtung des Hecks, hatten sich bereits Männer und Frauen versammelt. Ich suchte und fand die schutzlosen Frauen, denen ich für die Zeit der Überfahrt meine Dienste angeboten hatte, als sie das Schiff in Southampton bestiegen hatten; Mrs. E. D. Appleton, die Frau eines Freundes und Schulkameraden aus der St. Paul's School; Mrs. R. C. Cornell, die Frau des bekannten New Yorker Richters; und Mrs. J. Murray Brown, die Frau des Bostoner Verlegers, allesamt alte Freunde meiner Frau. Die drei Schwestern befanden sich auf der Heimreise von einer traurigen Mission im Ausland. Sie hatten die sterblichen Überreste einer vierten Schwester, Lady Victor Drummond, zur letzten Ruhe gebettet. Ich hatte in einer Londoner Zeitung von deren Dahinscheiden gelesen und erfuhr all die traurigen Einzelheiten, die damit einhergingen, von den Schwestern höchstselbst. Dass sie selbst ein noch viel größeres Martyrium erleiden würden müssen, schien unmöglich – und was es schlussendlich bedeuten würde, die Verantwortung für ihre Sicherheit übernommen zu haben, war mir nicht im mindesten klar. Sie waren in Begleitung ihrer Freundin, Miss Edith Evans, die ebenfalls schutzlos war und der sie mich vorstellten. Mr. und Mrs. Straus, Colonel und Mrs. Astor und einige andere wohlbekannte Gesichter waren ebenfalls unter den hier auf der Backbordseite des A-Decks Versammelten. Dazu gehörten auch, neben Clinch Smith, zwei weitere Mitglieder unserer Tischgesellschaft: Hugh Woolner, der Sohn des englischen Bildhauers und H. Björnström Steffanson, der junge Leutnant der schwedischen Armee, der mir während der Reise von seiner Bekanntschaft mit Mrs. Grades Verwandtschaft in Schweden erzählt hatte.
Dies war der Zeitpunkt, als die Band zu spielen begann und auch nicht aufhörte, als die Boote abgelassen wurden. Wir hielten dies für eine weise Maßnahme, um eventuell aufkommende Aufregung zu lindern. Ich erkannte keine der Melodien, aber ich kann sagen, dass sie fröhlich waren und beileibe keine Loblieder. Wenn, wie vielfach berichtet, "Nearer My God To Thee" tatsächlich eines der Stücke gewesen wäre, hätte ich dies ganz sicher bemerkt und es als eine taktlose Warnung vor unser aller bevorstehenden Tod verurteilt. Darüber hinaus hätte es genau die Panik verursacht, die wir mit aller Macht vermeiden wollten – was uns auch vollständig gelang. Ich weiß nur von zwei Überlebenden, deren Namen von den Zeitungen als Beweis dafür zitiert wurden, dass diese Hymne gespielt worden war. Alle, die ich befragt habe oder mit denen ich korrespondieren konnte, darunter die sachkundigsten Menschen überhaupt, bestätigten nachdrucksvoll das Gegenteil.
Die Schiffsoffiziere streuten die Information, dass es einen Wechsel von Funksprüchen mit vorbeifahrenden Schiffen gegeben hatte, und dass eines davon sicherlich zur Rettung eilen würde. Diese Nachricht gab unseren Hoffnungen Auftrieb. Um die Damen, für die ich mich verantwortliche fühlte, weiter zu beruhigen, zeigte ich ihnen ein hellstrahlendes Licht in etwa fünf Meilen Entfernung und erzählte ihnen, dass dies meiner Meinung nach ein Schiff war, das zu unserer Rettung eilte. Colonel Astor hörte, wie ich dies erzählte, und bat mich ihm das Licht zu zeigen, was ich auch bereitwillig tat. Dazu mussten wir uns beide über die Schiffsreling lehnen und nach vorne zum Bug schauen, wo unsere Sicht durch ein in diesem Moment präpariertes Rettungsboot, dessen Dollbord auf die Ebene des Bootsdecks heruntergelassen worden war, beeinträchtigt wurde. Aber anstatt an Leuchtkraft zuzunehmen, wurde das Licht schwacher, immer schwerer zu erkennen und verschwand schließlich ganz in der Nacht. Mittlerweile habe ich mit tränenreichem Bedauern für diejenigen, die vielleicht gerettet hätten werden können, erfahren, dass das Licht zum Dampfer Californian der Leyland-Linie gehörte. Das Schiff war unter der Führung von Kapitän Stanley Lord unterwegs von London nach Boston. Es gehörte ebenfalls der International Mercantile Marine Company, den Eignern der Titanic.
Die Californian war das Schiff, das zwei der sechs "Eisnachrichten" abgesandt hatte. Die erste wurde um 19:30 Uhr von der Titanic empfangen und bestätigt; es war eine abgefangene Nachricht an ein anderes Schiff. Die nächste kam gegen 23 Uhr, als der Kapitän der Californian ein anderes Schiff von Osten herankommen sah. Man sagte ihm, dies sei die Titanic und auf seinen Befehl hin wurde folgende Nachricht abgesetzt: "Wir werden von Eis aufgehalten, das rings um uns herum schwimmt." Woraufhin der Bediener des Telegrafen auf der Titanic brüsk antwortete. "Halt den Mund, ich bin beschäftigt. Ich kommuniziere mit Kap Race." Die genannte Beschäftigung bestand aus dem Senden von Nachrichten für die Passagiere der Titanic; und der stärkere, ostwärts gerichtete Strom der Californian störte dies. Obwohl die Navigation des Schiffes und das Wohl der Passagiere auf Leben und Tod gefährdet war, hatte der Nachrichtenverkehr mit Kap Race bis auf wenige Minuten vor der Kollision der Titanic mit dem Eisberg Vorrang. Fast die gesamte Zeit über lauschte der Telegrafist der Californian seinen Kopfhörern, aber um halb zwölf Uhr nachts, während sich die Titanic immer noch mit Kap Race unterhielt, "setzte er diese ab, zog sich aus und legte sich hin."
Das Schicksal vieler tausend Menschen stand in dieser unheilvollen Nacht mehr als einmal auf Messers Schneide, aber die Vorkommnisse in Zusammenhang mit der SS Californian untermauern die Erkenntnisse der amerikanischen Untersuchung, nämlich: es war nicht der Zufall, sondern die allergrößte Nachlässigkeit höchstselbst, die das Verhängnis all der prächtigen Männer und Frauen, die ihr Leben verloren, besiegelte.
Die eben genannten Erkenntnisse, von denen wir das erste Mal nach unserer Ankunft in New York erfuhren, geben auch Anlass zu der Annahme, dass der Kapitän der Californian und seine Crew unsere Lichter, die sich bis um 5:15 Uhr am folgenden Morgen nicht bewegten, vom Deck ihres Schiffes beobachteten. Es ist belegt, dass sie während dieser gesamten Zeitspanne nie mehr als sechs oder sieben Meilen entfernt waren. Tatsächlich war sie um Mitternacht, genau in der Richtung, wo ich und mindestens ein Dutzend weiterer Passagiere, sie vom Deck der Titanic aus sahen, höchstens vier oder fünf Meilen weg. Und das waren nur die Passagiere, die dies noch vor dem amerikanischen Untersuchungskomitee bezeugen konnten.
Die weißen Raketen, die wir abschossen, und über die wir gleich berichten werden, waren ebenfalls klar zu sehen. Kapitän Lord war sich vollkommen dessen bewusst, dass er in der Nähe eines Schiffes in Seenot war. Hätte er Interesse daran gehabt, den Namen des Schiffes bestätigt zu bekommen und den Grund für den Notfall zu erfahren, hätte er sich sofort über den Telegrafen mit uns in Verbindung setzen können. Seine Ignoranz wird noch offensichtlicher durch seinen Befehl "auf Morse umzuschalten", statt die moderne Methode des erfinderischen Genies und Gentlemans Marconi zu nutzen, die uns vielleicht alle gerettet hätte. "Die Nacht war klar und das Meer ruhig. Das Eis, von dem die Californian umringt war", schreibt der britische Bericht, "war abgebrochenes Eis, das sich nicht mehr als ein oder zwei Meilen in Richtung der Titanic ausbreitete." Als man dort die ersten Raketen sah, hätte die Californian ohne großes Risiko durch das Eis auf freies Wasser fahren und der Titanic zu Hilfe eilen können. Die Diskussion über dieses Thema ist schmerzlicher als alles andere für diejenigen, die ihre Lieben an Bord unseres Schiffes verloren haben.
Als wir erkannten, dass das Schiff, dessen Lichter wir sahen, nicht auf uns zuhielt, dämpfte dies unsere Hoffnung auf Rettung entsprechend. Aber der Rat der Männer, Ruhe zu bewahren, behielt immer noch die Oberhand; und um die Damen zu beruhigen, bemühte man immer wieder die hochgelobte Fiktion des "unsinkbaren Schiffes", so wie sie uns von der höchstmöglichen Autorität vorgebetet worden war. Es war in dieser Minute, dass Miss Evans mir die Geschichte erzählte, dass ihr Jahre zuvor ein Wahrsager in London geraten hatte, sie solle sich "vom Wasser fernhalten" und dass sie nun "ganz sicher ertrinken werde." Meine Versuche, sie vom Gegenteil zu überzeugen, waren umsonst. Obwohl sie diese Geschichte erzählte, zeigte sie keinerlei Anzeichen von Angst; und als ich sie etwa eine Stunde später erneut traf und mit ihr redete, in einer äußerst verzweifelten Lage, in der das letzte Rettungsboot angeblich gerade abgefahren war, war sie immer noch äußerst besonnen und fing nicht nochmal von ihrer abergläubischen Erzählung an.
Meine eigenen Schlussfolgerungen, als auch die anderer Passagiere, lassen vermuten, dass zu diesem Zeitpunkt 45 Minuten vergangen waren, seit Kapitän Smith angeordnet hatte, die Rettungsboote mit Frauen und Kindern zuerst zu besetzen und abzulassen. Mr. und Mrs. Isidor Smiths Selbstverleugnung trat nun besonders heroisch zu Tage, als sie sofort und empathisch ausrief: "Nein! Ich werde mich nicht von meinem Mann trennen; wir haben zusammen gelebt und wir werden zusammen sterben." Auch meine dringende Bitte, dass für ihn aufgrund seines Alters und seiner Hilflosigkeit eine Ausnahme gemacht werden müsse und er seine Frau ins Boot begleiten dürfe, lehnte er dankend ab. "Nein!", sagte er, "ich wünsche nicht, dass man mich zuvorkommender behandelt als alle anderen hier." Soweit ich mich erinnern kann, waren genau das die Worte, die die beiden mir gegenüber benutzten. Sie sagten noch, dass sie absolut darauf vorbereitet wären zu sterben, und setzten sich bedächtig auf zwei Liegestühle auf dem mit Glas überdachten A-Deck – bereit, ihr Schicksal zu erwarten. Weiteres Flehen, ihre Entscheidung nochmals zu überdenken, war nutzlos. Später begleiteten sie das Dienstmädchen von Mrs. Straus, das dort ein Rettungsboot bestieg, hinauf aufs Bootsdeck.
Als die Crew den Befehl zum Bemannen der Boote erhielt, waren wir auf der Backbordseite des A-Decks und ich bewegte mich sofort mit den in meiner Obhut befindlichen Damen in Richtung der Rettungsboote, die vom darüber liegenden Bootsdeck zu uns herabgelassen wurden. Ein großer, schlanker Engländer – der Sechste Offizier J. P. Moody, wie ich später erfuhr – und andere Mitglieder der Schiffscrew versperrten uns Männern jeden weiteren Zugang zu den Booten. Alles, was mir übrigblieb, war die Damen von meiner Verantwortung in die des Schiffsoffiziers zu übergeben. Ich war sicher, dass sie sicher in die Boote verladen werden würden und war meiner Verpflichtung entledigt. Ich erinnere mich, wie ein Steward ein kleines Fass aus der Tür eines Niedergangs rollte. "Was haben Sie da?", fragte ich. "Brot für die Rettungsboote", war seine knappe und vergnügte Antwort, als ich ein letztes Mal ins Innere des Schiffes ging, um dort nach meinen beiden Tischgenossen, Mrs. Churchill Candee aus Washington und Mr. Edward A. Kent, zu suchen. Dort traf ich auch Wright, den Racquetspieler, und wechselte mit ihm die paar Worte, die ich bereits berichtet habe.
Ich überlegte, dass es wohl sinnvoll wäre, in den offenen Booten einen Vorrat an Decken gegen die Kälte zu haben, und beschloss, ein weiteres – und letztes – Mal hinunter in meiner Kabine zu gehen, um dort danach zu suchen. Aber die Tür war verschlossen und auf meine Frage nach dem Grund dafür antwortete ein Steward – es war nicht Cullen -, dass man "Plünderungen vorbeugen wolle." Ich gab ihm zu verstehen, was ich benötigte und ging mit ihm zum Quartier der Kabinenstewards, wo zusätzliche Decken gelagert wurden, und wo ich diese auch bekam. Danach ging ich unter dem Glas des A-Decks die ganze Länge des Schiffes von achtern nach voraus ab und sah in jedem Raum und in jeder Ecke nach meinen fehlenden Tischgenossen. Aber es waren keine Passagiere mehr zu sehen, mit Ausnahme von vier Männern im Rauchersalon, die ganz für sich allein um einen Tisch herum versammelt saßen. Drei davon waren mir persönlich bekannt, Major Butt, Clarence Moore und Frank Millet. Der vierte war mir fremd, weswegen ich ihn nicht identifizieren kann. Alle schienen sich vollständig darüber im Klaren zu sein, was auf den Decks draußen vor sich ging. Es war Blödsinn anzunehmen, dass sie nichts von der Kollision mit dem Eisberg mitbekommen hätten, obwohl der Raum, in dem sie sich befanden, von allen anderen schleunigst verlassen worden war. Es dämmerte mir in diesem Moment, dass diese Männer ihre komplette Gleichgültigkeit der drohenden Gefahr gegenüber demonstrieren wollten und sie mich vermutlich ausgelacht hätten, wenn ich genau darauf hingewiesen hätte. Es war das letzte Mal, das ich die vier Männer gesehen habe, und ich kenne auch niemanden, der bezeugen könnte, sie später einmal gesehen zu haben – mit Ausnahme einer Dame, die Major Butt fünf Minuten, nachdem das letzte Boot das Schiff verlassen hatte, auf der Brücke gesehen haben will. Es gibt auch keinen authentischen Bericht darüber, was sie taten, als das Wasser dieses Deck erreichte, und ihr endgültiges Schicksal kann man nur erahnen. Ich persönlich glaube, dass sie vom A-Deck im Innern des Schiffes hinunterstiegen, als die Passagiere des Zwischendecks (wie später beschrieben) den Weg zu den oberen Decks blockierten, und zwar aus folgenden Gründen: Erstens, weil weder ich, noch jemand den ich kenne, jemals einen von ihnen auf dem Bootsdeck gesehen hat und zweitens, dass keine einzige ihrer Leichen jemals geborgen werden konnte; was wiederum damit zu erklären wäre, dass sie alle im Innern des Schiffes untergegangen sind.
Danach ging ich auf der Backbordseite weiter nach voraus, teilweise auf dem Bootsdeck, teilweise auf dem A-Deck, wo ich Clinch Smith wiedertraf, der mir darüber berichtete, dass Mrs. Candee das Schiff auf einem der Boote verlassen hatte. Wir blieben zusammen, bis das Schiff unterging. Ich war auf dem Bootsdeck, als ich die erste Rakete bemerkte. In Abständen wurden weitere Leuchtzeichen abgefeuert. Es folgten die roten und blauen Morselichter, die auf unserem Deck ganz in der Nähe signalisiert wurden; nach einer Antwort hielten wir umsonst Ausschau. Diese Notfallsignale machten uns allen klar, dass das Schiff dem Untergang geweiht war und es sogar sinken könnte, bevor die Rettungsboote abgelassen werden konnten.
Zurück auf dem A-Deck half ich dabei, zwei der Rettungsboote, die vom oberen Deck heruntergelassen wurden, zu beladen. Insgesamt besaß das Schiff zwanzig Boote; vierzehn Rettungsboote aus Holz, jedes ca. neun Meter lang und ca. 3 Meter breit und für 65 Personen ausgelegt; zwei hölzerne Kutter, Notfallboote, knappe acht Meter lang und gute zwei Meter zwanzig breit, jedes für um die 40 Personen geeignet; und schließlich vier Engelhardt "Brandungsboote", mit faltbaren Seiten aus Segeltuch über dem Dollbord, jedes ausgelegt für 47 Menschen und ca. acht Meter lang und knappe zweieinhalb Meter breit. Die Rettungsboote befanden sich entlang der Schiffsreling, oder besser deren gedachte Verlängerung voraus und achtern am Bootsdeck. Die ungeraden nummerierten Boote hingen steuerbord, die geraden backbord. Zwei der Engelhardt-Boote waren auf dem Bootsdeck voraus unter den Notfallbooten, die auf Ladebäumen darüber hingen. Die anderen Engelhardt-Boote befanden sich dem ersten Schornstein voraus auf dem Dach des Offiziershauses. Sie trugen die Buchstaben A, B, C und D; A und C standen steuerbord, B und D backbord. Ihr Bauch war gerundet und ähnelte dem eines Kanus. Der Name "Faltboot", unter dem sie wegen der oben erwähnten faltbaren Seiten auch bekannt sind, hat leider viele falsche Vorstellungen davon erweckt.
In diesem Quartier wurde ich nicht mehr davon abgehalten, mich den Rettungsbooten zu nähern, sondern man nahm meine Hilfe und Anstrengungen beim Beladen der Boote dankend an. Es gab keine Zeit mehr zu verlieren und sie mussten so schnell wie möglich weg. Der Zweite Offizier Lightoller hatte das Kommando auf der Backbordseite voraus, wo ich mich befand. Er stand mit einem Fuß in einem Rettungsboot, mit dem anderen auf der Reling des A-Decks, während wir in schneller Reihenfolge und ohne jede Panik Frauen, Kinder und Babys durch die Holzrahmen der heruntergelassenen Glasfenster auf diesem Deck hinausgeleiteten. Unter diesen Menschen war auch Mrs. Astor, die ich über die Reling des Schiffes trug. Ihr Gatte hielt ihren linken Arm, als wir sie vorsichtig an Lightoller übergaben, der sie in das Boot setzte. Es folgte ein Dialog zwischen Colonel Astor und dem Offizier, dem ich intensiv und mit größtem Interesse lauschte. Astor stand ganz in der Nähe in einem Fensterrahmen links von mir. Indem er sich über die Reling lehnte, erbat er Lightollers Erlaubnis, ins Boot zu dürfen und seine Frau zu beschützen. In Anbetracht ihres schwächlichen Zustandes erschien dies eine annehmbare Bitte zu sein, aber der Offizier, der den Millionär nicht kannte, ganz auf seine Pflicht bedacht war und seine Befehle befolgen wollte, antwortete: "Nein, Sir, in diesen Booten sind keine Männer erlaubt, solange nicht alle Frauen darin verstaut sind." Colonel Astor erhob keinen Einspruch und trug die Weigerung tapfer und mit Fassung. Dann fragte er noch nach der Nummer des Bootes, damit er später, sollte auch er gerettet werden, seine Frau wiederfinden könne. "Nummer vier", war Lightollers Antwort. Damit war das Gespräch beendet. Colonel Astor verließ seine Position und ich sah ihn nie mehr wieder. Ich glaube nicht einen Moment lang, dass er versuchte, in ein Boot zu gelangen oder dies sogar geschafft hat. Sollte ihm überhaupt jemals der Gedanke gekommen sein, konnte dies nur zum gegenwärtigen Zeitpunkt, in diesem Boot und mit seiner Frau, gewesen sein. Der Zweite Offizier Lightoller konnte sich sofort an diesen Vorfall erinnern, als ich ihn danach fragte. Nur durch mich kannte er Colonel Astors Identität. "Ich dachte", sagte er, "dass der Passagier die Nummer des Rettungsbootes aus irgendeinem unbekannten Grund haben wollte, vielleicht um sich über mich zu beschweren. " Ich schließe aus der Tatsache, dass ich Colonel Astor später auf dem Bootsdeck nicht mehr gesehen habe, und dass seine gefundene Leiche zertrümmert war (glaubt man der Aussage von Mr. Harry K. White aus Boston, dem Schwager von Mr. Edward A. Kent, meinem Schul- und Jugendfreund), dass er vom Schicksal ereilt wurde, als die Dampfkessel das Schiff durchtrennten. Aber davon später mehr.