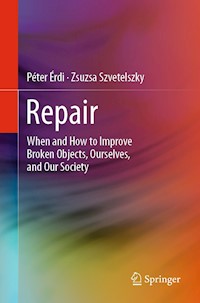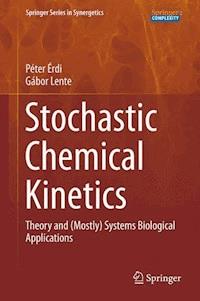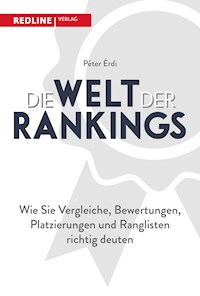
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ranglisten bestimmen unseren Alltag: Rivalität unter Kollegen, Wettstreit beim Sport, ein guter Platz bei Bewertungen. Listendenken scheint fest in der menschlichen Natur verankert zu sein. Wir wollen stets wissen, wer stärker, reicher, klüger, was empfehlenswerter ist. Viele der Top-Listungen basieren jedoch auf subjektiven Kategorisierungen und vermitteln lediglich den Eindruck von Objektivität. Érdi zeigt, wie man Ranglisten und soziale Hierarchien verstehen und besser zwischen objektiven und subjektiven Rankings unterscheiden kann – unerlässlich im Zeitalter der Ranglisten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Péter Érdi
Die Welt der Rankings
Péter Érdi
Die Welt der Rankings
Wie Sie Vergleiche, Bewertungen und Ranglisten richtig deuten
Übersetzung aus dem Englischen von Britta Fietzke
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2020
© 2020
by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe by Oxford University Press 2020
Die englische Originalausgabe erschien 2020 bei Oxford University Press unter dem Titel Ranking.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Britta Fietzke, Frankfurt a. Main
Redaktion: Monika Spinner-Schuch, Bad Aibling
Umschlagabbildung: Shutterstock/Preissymbol, Von Djent
Umschlaggestaltung: Mark Fischer, München
Satz: Helmut Schaffer, Hofheim a. Ts.
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-86881-797-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-225-6
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-226-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für meine Kinder, Gábor and Zsuzsi
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
VORBEMERKUNG
1 – PROLOGRANKING UND ICH, DIE FRÜHEN JAHRE
2 – VERGLEICH, RANKING, RATING UND LISTEN
3 – SOZIALES RANKING IN DER TIER- UND MENSCHENWELT
4 – ENTSCHEIDUNGEN, SPIELE, GESETZE UND DAS INTERNET
5 – DIE IGNORANTEN, DIE MANIPULATIVEN UND DIE SCHWIERIGKEITEN, EINE GESELLSCHAFT VERMESSEN ZU WOLLEN
6 – RANKING-SPIELE
7 – DER KAMPF UM DAS EIGENE IMAGE
8 – EMPFEHLUNGEN BASIEREND AUF IHREM WUNSCHZETTEL
9 – EPILOG
ANMERKUNGEN
VORWORT
In diesem brillanten und ausführlichen Buch beschäftigt sich der preisgekrönte Lehrer und Forscher Péter Érdi mit dem Phänomen des Rankings und Ratings (zum Unterschied komme ich gleich). Érdi beweist hier, dass er nicht nur ein Wissenschaftler der computergestützten Wissenschaften, sondern auch ein versierter Beobachter der Gesellschaft ist und so die Implikationen der allgegenwärtigen Rankings und Ratings durch die sozialen und Mainstream-Medien aufdeckt. Wir messen numerischen Rankings, die im Kern rein subjektive Eindrücke sein könnten, viel zu viel Glaubwürdigkeit bei, dabei ist es jedoch noch weitaus verstörender, dass wir nicht nur unser Verhalten anpassen, um uns auf diesen Listen weiter nach oben zu arbeiten, sondern uns von diesen Rankings auch manipulieren lassen.
Rankings sowie unsere Verhaltensreaktionen auf sie geschehen auf allen soziotechnischen Ebenen. Damit Sie die Breite seiner Forschung begreifen können, nehmen Sie sich einen Moment Zeit und browsen Sie durch das Stichwortverzeichnis. Hier ein kleiner Ausschnitt von hinten nach vorne: die Wong-Baker-Skala zur Schmerzdokumentation, die ungarische Fußballnationalmannschaft, die U.S. News & World Report-Universitäts-Rankings, Scar (japp, aus Der König der Löwen), die Illusion der Objektivität, Erdős-Zahlen, Empfehlungsschreiben, Elo-Schach-Ratings und Campbells Gesetz. Allein unter A finden sich Jane Austen, Aristoteles und das Allgemeine Unmöglichkeitstheorem (nach Arrow).
Diese Themenauswahl ist wirklich nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was Sie bei dieser Lektüre erwartet. Péters kreativer und aktiver Verstand versteckt sich auf keiner Seite ‒ Sie erwartet also etwas Großes. Auch wenn sich das Buch mit teils technischen Themen beschäftigt, so bleibt doch Péters Schreibstil stets locker, lustig und verständlich. Am Ende der Lektüre werden sicher die einen oder anderen Lesenden den Impuls verspüren, sich in den Zug nach Budapest oder ins Flugzeug nach Kalamazoo zu setzen, in der Hoffnung, dort von Péter mehr über den Matthäus-Effekt, die begrenzte Rationalität, die sozialen Neurowissenschaften, die Psychologie von Listen oder die Anwendung von Netzwerkstatistiken erfahren. Für die, die Péter persönlich kennen, vor allem seine ehemaligen Studierenden, wird dieses Buch an seine uneingeschränkte und offene Neugier erinnern. Wie Péter selbst ist dieses Buch informativ, tiefgründig, zum Nachdenken anregend und erfreulich.
Die besten Rankings basieren auf objektiven Kriterien ‒ Rankings der höchsten Gebäude, der größten Hechte und der schnellsten Motorräder werden sofort für bare Münze genommen. Allerdings beinhalten selbst die objektivsten Kriterien genauer betrachtet auch subjektive Aspekte. Die offizielle Höhe eines Gebäudes beinhaltet auch dessen Türme, wenn sie für das Gebäude wesentlich sind. Die Spitze auf dem Freedom Tower in New York zählt mit, während die zwei Antennen auf dem Willis Tower in Chicago dies nicht tun. Der wesentliche Teil eines Gebäudes liegt im Auge des Betrachters. Und genau da fängt das Problem an: die Integration der Subjektivität.
Subjektivität erlaubt uns das Ranking, wie wir es für richtig halten. Im Film Der Stoff, aus dem die Helden sind (basierend auf Thomas Wolfes Die Helden der Nation) fragt ein Journalist den Astronauten Gordon Cooper (gespielt vom jungen Dennis Quaid), wer seiner Meinung nach der beste Pilot aller Zeiten sei. Zuerst schwadroniert Cooper über Bilder an einer Wand an einem nicht mehr existenten Ort und aufeinander rasenden Stahl – als Auftakt, um dann Chuck Yeager zu nennen. Als Cooper jedoch begreift, dass die Medien einfach eine Story wollen, aber wenig Interesse an der Wahrheit haben, breitet sich ein Grinsen auf seinem Gesicht aus und er antwortet: »Wer ist der beste Pilot aller Zeiten? Naja, er steht direkt vor Ihnen.«
Das Air & Space Magazine würde an dieser Stelle widersprechen. Bei ihnen rankt Gordon Cooper nicht mal in den Top 10 ‒ im Gegensatz zu Yeager. Péter würde an dieser Stelle anmerken, dass sowohl Coopers Ranking als auch das des Magazins ebenso wie die vielen Rankings im Netz ‒ die zehn besten Strände, die acht besten belgischen Biere, die sieben besten Hunderassen ‒ rein subjektiv sind. Irgendjemand (oder irgendeine Gruppe von Menschen) hat sich eine Ordnung ausgedacht, die dann wiederum nachträglich anhand bestimmter Kriterien begründet wurde. Und trotzdem verleihen diese Rankings dem Ganzen eine gewisse Autorität – ach ja, die Macht der Zahlen!
Dennoch, wie Péter zeigt, sind objektive Rankings in den meisten der wichtigen Fälle unmöglich. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Ausflug in den Formalismus. Formell gesehen ist ein Ranking eine komplette, asymmetrische und transitive Relation. »Komplett« heißt, dass es zwei beliebige Sachen vergleicht; »asymmetrisch« heißt, dass es diese zwei Sachen nacheinander rankt: Entweder mag man Karotten lieber als Rüben oder Rüben lieber als Karotten; »transitiv« heißt, dass, wenn A vor B bevorzugt wird und B vor C, dann muss A auch vor C bevorzugt werden.
So logisch Transitivität auch wirken mag, kann sie doch von vielen Rankings verletzt werden. In einem Condorcet-Triplett, einer dreiköpfigen Wahl mit Mehrheitsprinzip, bei dem alle drei Menschen transitive Präferenzen haben, ist das Resultat: A gewinnt über B, B über C und C über A. Somit wird das Mehrheitsprinzip zu einer Version des Spiels »Schere, Stein, Papier«. Umformuliert bedeutet dies also, dass das Ergebnis, auch wenn jede Person ein gleichbleibendes Ranking erstellt, in keiner Weise die Existenz eines kollektiven Rankings impliziert.
Ein ähnliches Problem entsteht, wenn die zu ordnenden Gegenstände mehrere Ebenen besitzen. Magazine ranken Restaurants auf Basis der Essensqualität, der Atmosphäre und der Professionalität der Angestellten. Dann ordnen sie jedem Restaurant eine Nummer auf jeder dieser Ebenen zu und subsummieren sie zu einem finalen Rating. Bei einem Maximum von 30 Punkten erhält also ein Restaurant vielleicht 28, ein anderes aber 27. Diese Zahlen sind rein subjektiv, wie Péter aufzeigt. Eine Person mag fünf von fünf Punkten geben, aber eine andere hätte an der gleichen Stelle nur vier gegeben. Was also wissenschaftlich daherkommt, ist letztlich zum großen Teil nur ausgedacht.
Fairnesshalber muss man aber sagen, dass die meisten Scores eine Mischung aus objektiv und subjektiv sind. So ist es zum Beispiel bei den U.S. News & World Report-Universitäts-Rankings, die einerseits die Anzahl der angebotenen Kurse mit weniger als 19 Studierenden sowie das allgemeine Zahlenverhältnis von Studierenden zu Lehrkörpern (beide objektiv) einbezieht, aber andererseits auch den Dekanen untereinander einen Rang zuteilt (subjektiv). Um daraus Ratings zu generieren (die dann wiederum zu Rankings vereinfacht werden können), legt U.S. News für jedes Kriterium eine Relevanz fest. Wie aber definieren sie diese Wichtigkeit? Auch hier denkt man sich wieder ‒ auf Basis des gesunden Menschenverstands ‒ etwas aus ‒ erneut erscheint etwas Subjektives im wissenschaftlichen Gewand.
Eine sofortige Konsequenz dieser Methode ist, dass eine Hochschule ihr Ranking mithilfe der Einschränkung ihrer Immatrikulationen auf 19 Studierende pro Kurs beeinflussen kann. Vergessen Sie nicht, dass es nicht wissenschaftlich erwiesen ist, dass der Lerneffekt sinkt, sobald eine zwanzigste Person zugelassen wird; U.S. News hat willkürlich die Zahl 19 festgelegt. Um den Schaden dieses einzelnen Kriteriums sehen zu können, müssen Sie nur eine der Hochschul-Webseiten anschauen und werden feststellen, dass die Kurse mit 19 oder weniger Studierenden beworben werden. Hochschulen hindern Studierende an der Kursteilnahme (»Es tut uns leid, Sie sind Nummer 20.«), um ihrem Ranking nicht zu schaden.
Paradoxerweise folgt daraus, dass selbst die gut gemeinten Versuche, die Besten zu finden, das Schlechteste zu Tage fördern kann, weil wir uns für eine Verbesserung unseres Rankings verbiegen. Je mehr Wichtigkeit wir also diesen zumeist subjektiven Rankings beimessen, desto mehr Verhaltensveränderungen und -anpassungen führen wir durch. Professor Péter Érdi hat uns mit diesem Buch einen großen Dienst erwiesen. Er hat uns anhand von mitreißenden Beispielen und von leichter Hand beigebracht, tiefer in die Materie tauchen zu wollen.
Scott E. PageLeonid Hurwicz Collegiate Professor für Komplexe Systeme,Politikwissenschaften und Wirtschaftslehre an derUniversity of Michigan-Ann Arbor; Privatdozent am Santa Fe Institute
VORBEMERKUNG
In diesem Buch geht es – wie der Titel schon verrät – um das Thema Ranking. Ob man es mag oder nicht: Rankings sind Teil unseres Lebens. Alle, mit denen ich in den letzten zwei Jahren gesprochen habe, waren sich einig, dass dieses Thema gerade wichtig ist. Unsere Beziehung zu Rankings ist recht paradox: Sie sind gut, weil sie informativ und objektiv sind; sie sind schlecht, weil sie verzerrt und subjektiv ‒ manchmal sogar manipuliert ‒ sind. Dieses Buch ist dafür gedacht, allen Lesenden dabei zu helfen, dieses Paradoxon des Ranking-Prozesses zu verstehen. Zusätzlich bietet es Strategien zum Umgang mit diesem Paradoxon an. Rankings fangen mit Vergleichen an: Wir vergleichen uns gerne mit anderen und legen so fest, wer stärker, reicher, besser oder klüger ist. Unsere Liebe für Vergleiche hat zu einer Leidenschaft für Rankings geführt. Sachen einzuordnen, hilft dabei, organisierter zu werden – und wer möchte das schließlich nicht?
Menschen sind nicht die einzige Spezies, die gerne eine Rangordnung verteilen ‒ es ist ein Ergebnis der Evolution. Das Konzept der »Hackordnung« unter Hühnern konnte bereits vor circa hundert Jahren beobachtet werden und die Forschung hat gezeigt, dass sich gemeinsam in einem Auslauf lebende Hühner in einer Sozialhierarchie organisieren. Soziale Rankings in der menschlichen Gruppe haben sich aus der Tierwelt heraus entwickelt. Dieses Buch beschäftigt sich anhand von lebensnahen Beispielen mit dem Warum und dem Wie unserer Liebe für und Angst vor Rankings sowie der Rangvergabe. Diese Beispiele werden aus drei verschiedenen objektiven Perspektiven betrachtet: Realität, Illusion, Manipulation.
Rankings nutzen sowohl wissenschaftliche Theorien als auch alltägliche Erfahrungen, indem sie zum Beispiel Fragen aufwerfen und beantworten wie »Sind Hochschul-Rankings objektiv?«, »Wie ordnen und bewerten wir Länder auf Basis ihrer Unsicherheit, ihrem Korruptionsniveau oder sogar der Zufriedenheit ihrer Einwohner?«, »Wie finden wir die relevantesten Webseiten?«, »Wie ranken wir unsere Arbeitnehmer?«. Da wir kontinuierlich uns selbst und unser Umfeld einordnen ‒ und wiederum eingeordnet werden ‒, erhalten wir zwei Fragen: Wie erstellt man das möglichst objektivste Ranking und wie akzeptiert man, dass ein Ranking nur bedingt unsere wirklichen Werte und Leistungen widerspiegelt?
Auch wenn in diesem Buch Beispiele aus der Sozialpsychologie, der Politikwissenschaft und der Informatik genutzt werden, ist dieses Buch doch nicht nur für die Wissenschaftler unter uns. Ich möchte dieses Buch den Menschen ans Herz legen, deren Nachbar das schickere Auto hat; den Angestellten, die von ihren Vorgesetzten eingestuft werden; den Managern, die im Ranking-Prozess involviert sind, ihn aber nicht gänzlich befürworten; den Geschäftspersonen, die sich eine bessere Sichtbarkeit ihres Unternehmens wünschen; den Wissenschaftlern, Schriftstellern, Künstlern und anderen Konkurrenten, die sich gerne ganz oben im Ranking sehen würden; den Studierenden, die sich gerade auf die nächste Phase des sozialen Konkurrenzkampfs vorbereiten und glauben, dass man nur um jedem Preis den eigenen Notendurchschnitt maximieren muss; den Computerwissenschaftlern, die Algorithmen entwerfen, um Menschen Produkte basierend auf ihren jeweiligen Gepflogenheiten zu empfehlen; und den Menschen, die ungewollt Empfehlungen bekommen (uns allen).
Es gibt bereits hervorragende Bücher über diverse Aspekte des Rankings auf dem Markt – sei es zu mathematischen Algorithmen oder dem Ranking von akademischen Institutionen, Ländern, Politikern oder Webseiten. Zum Beispiel Who’s #1?: The Science of Rating and Ranking der beiden Mathematiker Amy N. Langville und Carl D. Meyer (Princeton University Press, 2012), die aufbauend auf ihrer Forschung der Analyse des Internets einen Überblick geben über die mathematischen Algorithmen und Methoden, um Sportteams, Politiker, Produkte, Webseiten etc. zu bewerten und zu ordnen ‒ und es findet sich im Regal der Mathebücher. Ich möchte im Geiste dieses Buches erklären, wie man objektive Rankings erstellen könnte, und werde die Schwierigkeiten aufzeigen, die die Objektivität wiederum mit sich bringt.
Die nächsten zwei Bücher auf der Liste befassen sich mit Hochschulen- und Universitäts-Rankings. Engines of Anxiety: Academic Rankings, Reputation, and Accountability (Russell Sage, 2016) von den beiden Soziologen Wendy Nelson Espeland und Michael Sauder, das die Geschichte und momentane Bewertungsund Ranking-Praxis der Qualität von Hochschuleinrichtungen (vor allem juristischen Fakultäten) analysiert. Rankings reflektieren jedoch nicht nur die Vergangenheit, sondern beeinflussen auch die Zukunft, da die entscheidenden Interessenvertreter (Studierende, Eltern, Zulassungsstellen, Administratoren) auf Rankings reagieren. Dieses Buch zeigt den Charakter unserer paradoxen Haltung gegenüber dem Phänomen der Rankings auf: Quantifizierungen von Leistung ist einerseits nötig, aber andererseits ein Quell der Angst. Ellen Hazelkorn, eine führende Expertin zum Thema der globalen Hochschulbildung, beschrieb in Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence (Palgrave Macmillan, 2016, 2. Aufl.) ihre ausführliche Forschung zu Bildungs-Rankings aus globaler Perspektive.
Ranking the World: Grading States as a Tool of Global Governance (Cambridge University Press, 2015), herausgegeben von Alexander Cooley und Jack Snyder, zeigt die kontroversen Emotionen gegenüber den Länder-Rankings auf. Diese internationalen Rankings von Ländern und ihren Leistungen werden von ungefähr einhundert verschiedenen Indizes charakterisiert – vom Freiheitsindex über den Korruptionswahrnehmungsindex zum World Happiness Report. Dabei ist es ein wiederkehrendes Motiv, dass die Ranking-Organisationen nicht völlig unabhängig fungieren, und auch wenn einige Länder (etwa China und Russland) teils verärgert auf die Leistungsanalyse reagieren, so sind sie doch letztlich auch interessiert an den Ergebnissen. Dieses Buch hat mir zu der Erkenntnis verholfen, dass die glücklichsten Länder der Welt gleichzeitig die sind, die am meisten Steuern zahlen.
In Majority Judgment: Measuring, Ranking, and Electing von Michel Balinski und Rida Laraki (MIT Press, 2011) geht es um die Politiker-Rankings. Die Autoren argumentieren hier, dass es ihre Absicht sei, zu »zeigen, warum der Mehrheitsentscheid allen anderen Wahlmethoden sowie jeder anderen bekannten Methode zur Wettbewerbsbeurteilung überlegen ist.«
Gundi Gabrielles SEO — The Sassy Way to Ranking #1 in Google — When You Have NO CLUE!: A Beginner’s Guide to Search Engine Optimization (Amazon Digital Services, 2017) erklärt die Tricks, um die eigene Webseite, den eigenen Blog etc. an die Spitze zu pushen, ohne dabei von Google oder einer der anderen Autoritäten des Internets abgestraft zu werden.
Zwei vor Kurzem publizierte Bücher überschneiden sich ein wenig mit meinen eigenen Zielen und wir haben eventuell auch eine ähnliche Leserschaft. Gloria Origgis Reputation: What It Is and Why It Matters (Princeton University Press, 2017) untersucht den Beitrag mancher Ranking-Systeme an der Imagebildung aus Sicht einer »experimentellen Philosophin«. Jerry Z. Mullers The Tyranny of Metrics (Princeton University Press, 2018) entstand aus seinen Beobachtungen heraus, dass die Messung und Quantifizierung der menschlichen Leistungen eine viel zu große Rolle in der Organisation unserer Gesellschaft spielten. Der Historiker weist auf den schwierigen, schmalen Grat zwischen der subjektiven Bewertung und der objektiven Messung hin und er legt dabei vielleicht eine etwas andere Herangehensweise an den Tag, als ich sie für mich hier abbilden möchte.
Die Herausforderung für mich zu Beginn dieses Schreibprozesses war, dass ich ein populäres, leicht lesbares, integratives Buch zum Thema Ranking und Rating schreiben wollte, um den Lesenden ein Verständnis für die Regeln des täglich praktizierten Ranking-Spiels zu vermitteln. Die größte Motivation für dieses Buch kam von meiner ehemaligen Assistentin und meiner besten Freundin Judit Szente. Nachdem ich ihr wiederholt erzählt hatte, dass ich meinte, ich könne für eine breite Leserschaft schreiben, schenkten mir ihr Mann Bart van der Holst und sie etwas wirklich Passendes zum Geburtstag: Sie schrieben mich für den Gotham Writers’ Workshop in New York City ein. Dort nahm ich an bemerkenswerten Kursen von Roseanne Wells, Francis Flaherty, Cullen Thomas, Kelly Caldwell und J. L. Stermer teil.
Ich bin der Community des Kalamazoo College dankbar, und vor allem meinen engen Kollegen, die mir mit ihrer freundlichen, intellektuellen Stimmung zur Seite standen. Außerdem bin ich meinen Kollegen am Department of Computational Sciences am Wigner Research Centre for Physics der Hungarian Academy in Budapest zu Dank verpflichtet. Ich danke auch der Henry R. Luce Foundation dafür, dass ich als Henry-R.-Luce-Professor unterrichten durfte.
Natalie Thompson, die gerade einen zweifachen Master in Politikwissenschaften und Mathematik macht, war meine Assistentin. Sie lektorierte nicht nur die »unglische« Version dieses Buches, sondern kommentierte die Entwürfe jedes Kapitels mit einem Blick auf das große Ganze. Zusätzlich half sie dabei, die Struktur dieses Buches zu gestalten. Ihre Hilfe ging weit über alle meine Erwartungen hinaus. Vielen Dank, Natalie!
Ich profitierte viel von der Interaktion mit meinem Budapester Alumni-Netzwerk. Ich bin vor allem den Kommentaren von Peter Bruck, George Kampis, András Schubert und János Tóth dankbar. Ich unterrichtete einen Kurs über die Komplexität von Rankings im Wintersemester 2018 und sprach dort viel mit meinen Studierenden über das Thema. Ich bin besonders dankbar für die Kommentare von Allegra Allgeier, Brian Dalluge, Gyeongho Kim, Timothy D. Rutledge, Skyler Norgaard und Gabrielle Shimko.
Auch bedanke ich mich für die Kommentare, Gespräche, den Schriftwechsel und/oder die moralische Unterstützung einiger Kollegen: Brian Castellani, John Casti, Alexander Cooley, Peter Dougherty, György Fabri, Rabbi Mordechai Haller, István Hargittai, De-Shuang Huang, Bryan D. Jones, Mark Kear, Andrew Mozina, Scott Page, Peter Prescott, Frank Ritter, Eric Staab, András Telcs, Jan Tobochnik, Osaulenko Viacheslav und Raoul Wadhwa. Ich habe gerade gezählt und sie kommen tatsächlich aus sechs verschiedenen Ländern. Ich profitierte von den Fragen zu und Kommentaren während mehrerer Vorlesungen in Budapest, Liverpool und Cambridge (UK). Mein Dank für die Einladungen geht an János Tőzsér, Zsuzsa Szvetelszky, Károly Takács, De-Shuang Huang, Abir Hussain und Dhiya Al-Jumeily.
Mir waren vor allem die Kommentare von Peter Andras, Basabdatta Sen-Bhattacharya, György Bazsa, Zoltán Jakab, Christian Lebiere, András Lőrincz, Ferenc Tátrai, Emanuelle Tognoli, Ichiro Tsuda und Tamás Vicsek auf der Aboutranking-Webseite von Nutzen.
Ich schulde meiner Lektorin Joan Bossert bei der Oxford University Press meinen Dank für ihre Beratung und Bestärkung.
Meine Frau Csuti und ich haben bereits viele Erfahrungen bei dem Rating und Ranking der diversen Optionen im Leben gesammelt. Ich verdanke also ihrer Unterstützung, ihrer Liebe und ihrer Klugheit sehr viel ‒ aber es ist schlicht zu schwierig, hier meine Dankbarkeit ihr gegenüber in Worte zu fassen.
Péter ÉrdiKalamazoo, MI und BudapestDezember 2018
1PROLOG
RANKING UND ICH, DIE FRÜHEN JAHRE
Wie wird man der Populärste? Man besitzt einen Fußball!
Man kann nicht ohne Ball Fußball spielen. Aber wir hatten einen, also spielten wir! Ich wuchs nicht lange nach dem Krieg in Budapest auf (naja, also im flachen Pest, nicht im hügeligen Buda wie meine Frau, aber ich habe ihr versprochen, keine weiteren Witze über die kulturellen Unterschiede dieser zwei Teile der Stadt zu machen). Meine Grundschule hatte Schüler (also Jungs; damals gab es noch keine gemischtgeschlechtlichen Schulen) sowohl aus Angyalföld (das »Engelsland«, das der inzwischen verschwindenden Arbeiterklasse gehörte) als auch Újlipótváros (»Neu-Leopoldstadt«, in der die mittelständischen Intellektuellen jüdischer Abstammung wohnten). Auch wenn es einen offensichtlichen Kontrast bei der Herkunft unserer Eltern gab (an dieser Stelle übergehe ich die traurigen Geschichten, die von den Eltern der Neu-Leopoldstadt-Kindern verheimlicht wurden), so einte uns doch die Liebe zum Fußball. Ungarn hatte in den frühen 1950er-Jahren die beste Fußballmannschaft der Welt – angeführt von Ferenc Puskás (1927–2006), dessen linker Fuß ihn zu einem der besten Spieler aller Zeiten machte. In diesem Buch geht es um Rankings und ich teile die Meinung vieler, dass er einer der zwei bekanntesten Ungarn des 20. Jahrhunderts war (Béla Bartók [1881–1945] dürfte der andere sein). Das ungarische Team blieb 33 Spiele lang ungeschlagen, ein Zeitraum von 1950 bis 1954 – und endete mit einer historischen Niederlage gegen die westdeutsche Mannschaft während der Weltmeisterschaft 1954 (der erste Erfolg des neuen Deutschlands nach dem Krieg). Auf diese Geschichte komme ich in Kapitel 2 noch einmal zu sprechen, wenn ich die Tristesse des »zweiten Platzes« betrachte. Aber es ist nun einmal so: Fußball war wahnsinnig beliebt und fast alle von uns spielten acht Jahre lang eigentlich täglich.
Unser Lehrer forderte uns 40 Schüler in meiner Klasse eines Tages dazu auf, anonym unseren besten Freund zu benennen. 37 Stimmen gingen an Péter Erdélyi ‒ ein Junge mit wunderbarem Humor, was aber nicht der Grund war für seinen großen Sieg. Sein Vater war der Leiter eines staatseigenen (was auch sonst?) Unternehmens mit Namen »Kulturelle Gegenstände«, das teure Fußbälle vertrieb. Wir lebten in einem armen Land, also war alles in den Läden teuer und Péter dementsprechend der einzige Junge in der Klasse, der einen richtigen Fußball hatte. Wir waren ihm wirklich dermaßen dankbar dafür, mit einem richtigen Fußball spielen zu können, dass wir Péter für unseren besten Freund hielten. Er führte sicherlich das gesamte Jahr die Popularitätsliste an. (Ich habe diese Geschichte viele Male in meinen Einführungskursen zur Netzwerktheorie erzählt, um zu zeigen, wie sternförmige Ordnungen funktionieren, siehe Abb. 1.1.)
Mit diesem Beispiel möchte ich zeigen, dass die Wahl des Anführers unserer Popularitätsliste objektiv die Weisheit der Vielen widerspiegelt, die wiederum weder Illusion noch Manipulation ist. Jetzt, wo ich so über diese Geschichte nachdenke, fällt mir auf, dass Péter aus einer privilegierten Familie stammte, und um ein wirklich privilegierter Junge im Budapest der 1950er-Jahre zu sein, musste man einen Fußball besitzen. Die Kombination aus dieser privilegierten Situation und seiner freundlichen Persönlichkeit brachte ihn an die Spitze der Popularitätsliste.
Rating und Ranking von Fußballspielern: die Illusion der Objektivität
Ich war wohl ungefähr zehn, vielleicht elf Jahre alt, als ich einen Zeitungsartikel las, an dessen paradoxen Titel ich mich immer noch erinnern kann: »Lassen Sie die objektiven Zahlen sprechen!« Aber warum war das paradox? Am Ende jeder Fußballsaison bewertete die Sportzeitung die spielerischen Leistungen aller elf Positionen, vom Torwart bis zum linken Außenspieler. Der Artikel – nebst verbalen Einschätzungen – beinhaltete elf Rankings, eine für jede Position. Dort wurden die Spieler aus jedem Team nach Leistung in dieser Saison gelistet (siehe Abb. 1.2).
Abb. 1.1Sternförmige Ordnung: Das Kind mit dem richtigen Fußball war der beste Freund von allen. Naja, außer einem Jungen (dessen Namen ich zwar weiß, aber nicht preisgeben werde, auch wenn ich hier verrate, dass er viele Jahre in Toronto gelebt hat). Danke an Tamás Kiss für die Abbildung.
Wie wurden diese Ergebnisse erreicht? Fußball ist nicht wie Baseball, wo die Spieler objektiv an ihrer erreichten Punktzahl gemessen werden können. (Naja, das hat sich in den letzten Jahren ein wenig verändert und einige Metriken zur Leistungsmessung wurden inzwischen eingeführt.) Ein Journalist in Ausbildung wurde zu jedem Spiel geschickt und er (definitiv ein »er« zur damaligen Zeit) gab jedem Spieler nach jedem Spiel eine Punktzahl.
Jobbhátvédek
1. Káposzta (U. Dózsa)
7.13
2. Bakos (Vasas)
7.06
3. Hernádi (Pécs)
6.99
4. Várhelyi III (Szeged)
6.88
5. Kárpáti (Eger)
6.77
6. Keglovich (Gyor)
6.76
7. Vellai (Csepel)
6.71
8. Novák (Ferencváros)
6.68
9. Lévai (Tatabánya)
6.59
10. Kelemen (Komló)
6.59
11. Marosi (Bp. Honvéd)
6.52
12. Kmetty (Salgótarján)
6.42
13. Formaggini (Dunaújv.)
6.41
14. Kovács (Diósgyor)
6.41
15. Keszei (MTK)
6.30
16. Szabó B. (Szombathely)
5.51
Abb. 1.2Ranking der Rechtsverteidiger basierend auf ihren Punktergebnissen während der Saison 1967 in der ungarischen Fußballliga, gegeben von der (subjektiven) Evaluation von Journalisten mit später ausgerechnetem Durchschnitt (objektiv).
Jedem Spieler, der es aufs Feld schaffte, wurde mindestens ein Punkt gegeben. Eine überaus geringe Anzahl Spieler erhielt für ihre überragenden Leistungen in jeder Saison ein Ergebnis von zehn Punkten. Die meisten Ergebnisse rangierten zwischen fünf und acht, also irgendetwas zwischen »knapp unter dem Durchschnitt« und »ausgezeichnet (aber nicht brillant)«. Nach jedem Spiel besprachen mein Vater und ich auf dem Weg zur Straßenbahnhaltestelle aus dem Vorort Újpest, wo das Stadion lag, unsere eigene Punktevergabe an jeden einzelnen Spieler unseres Teams. Nach jedem Spiel wartete ich sehnsüchtig auf die Morgenzeitung, um die Punkte des Journalisten mit meinen eigenen zu vergleichen. Als ich also am Saisonende von »objektiven Zahlen« las, wusste ich, dass sie den objektiven Durchschnitt von subjektiven Noten widerspiegelte. Diese Beobachtung wies darauf hin, dass ein Ranking, das auf subjektiven Ratings basiert, nur die Illusion der Objektivität herstellt. Die Punktevergabe war nicht arbiträr – sie spiegelte die besten Einschätzungen der Journalisten wider ‒, aber sie war definitiv auch nicht subjektiv.
Eine nicht so schöne Geschichte: ein Beispiel eines absichtlich verzerrten Rankings aus einem ungarischen Märchen
László Arany (1844–1898), der Sohn des gefeierten Dichters und »Shakespeare der Balladen« János Arany (1817–1882), sammelte ungarische Märchen. Eines dieser Märchen veranschaulicht Kindern, wie das stärkste Mitglied einer Gruppe das Kollektiv und somit die Entscheidung manipulieren kann. Das Märchen lautet wie folgt:
Mehrere Tiere rissen von zu Hause aus und gerieten in eine Falle. Sie konnten sich nicht befreien und wurden sehr hungrig. Es gab kein Essen, also schlug der Wolf der Gruppe die folgende Lösung vor: »Also, meine lieben Freunde! Was machen wir nun? Wir sollten bald etwas essen, sonst verhungern wir. Ich habe eine Idee! Lasst uns die Namen aller verlesen und der hässlichste wird aufgegessen.« Alle stimmten zu. (Ich habe nie verstanden, warum.) Der Wolf entschied, dass er selbst der Richter sein würde, und so zählte er ab: »Wolf-bolf, 0! So großartig! Fuchs-buchs, auch großartig, Mein-Wild-dein-bild, sehr großartig, Häschen-näschen, auch großartig, Hahn-kran, auch großartig, Meine-Henne-meine-penne, du bist nicht großartig.« Und so aßen sie die Henne … Beim nächsten Mal wurde dann Hahn-kran zum Futter auserkoren und so weiter und so fort. (Vielen Dank an Judit Zerkowitz für die Übersetzung aus dem Ungarischen.)
Dieses Beispiel zeigt, wie Objektivität manipuliert werden kann, wenn ein einzelner Wähler die Wahl kontrolliert. Es deutet eine Art Diktatur an: ein Regierungsmechanismus, bei dem eine Person ungehindert die vollständige Macht innehat.
Erkenntnisse: Die Realität, Illusion und Manipulation der Objektivität
Im Sportbereich ist eine der ältesten und objektivsten Formen des Rankings die der Geschwindigkeit von Läufern, was bereits bei den Olympischen Spielen der Alten Griechen stattfand. Wir wissen zum Beispiel, dass Koroibos von Elis, der von Beruf Koch war, den Stadionlauf während der ersten Olympischen Spiele gewann, er war also der schnellste Läufer dieses Wettbewerbs. Allerdings basieren viele andere Top-10(oder 21, 33 etc.)-Listen auf subjektiven Kategorien und bilden daher nur eine Illusion der Objektivität. In Wahrheit wollen wir Objektivität gar nicht immer, da unsere Leistungen, Webseiten, Unternehmen oder Organisationen gerne ein besseres Image, Ergebnis oder Ranking bekommen dürfen, als sie eigentlich verdient hätten. Wir werden also manchmal zum Opfer unserer eigenen verzerrten Selbstwahrnehmung (ich bin mir sicher, dass viele Lesende das Spiegelbild des Kätzchens als Löwen kennen1) oder täuschen uns manchmal absichtlich selbst und wünschen uns, so wahrgenommen zu werden, als hätten wir einen höheren Status. Dabei stört es uns auch nicht, wenn wir die Objektivität mit dem sogenannten (euphemistisch ausgedrückt) Reputationsmanagement manipulieren.
Diesem Kampf um unser Image widme ich mich in Kapitel 7. Aber zuerst sollten wir einen Blick auf die vielen Konzepte werfen, die in diesem Buch vorkommen werden.
2
VERGLEICH, RANKING, RATING UND LISTEN
Der Vergleich: der »Dieb der Freude« oder die treibende Kraft hinter unseren zukünftigen Erfolgen?
Wir vergleichen uns andauernd mit anderen. Kinder lernen schon früh in vielen Kulturen, dass sie in Wettbewerben beweisen müssen, dass sie besser, stärker und erfolgreicher sind als die anderen. Klassentreffen zum Beispiel sind eine wunderbare Möglichkeit, um sich in allen Lebensaspekten mit den ehemaligen Schulkameraden zu vergleichen ‒ sei es in punkto Attraktivität, Karriere, Intelligenz oder Eheglück. Im Alltag basiert die Bewertung unserer eigenen Standpunkte, Fähigkeiten und Glaubenssätze auf dem Vergleich mit anderen. Diese Beobachtung ist die Basis einer renommierten sozialpsychologischen Theorie: die Theorie des sozialen Vergleichs, die Leon Festinger (1919‒1989) bereits 1954 beschrieb. Auch wenn wir vielleicht im Vergleich ungerne feststellen, dass wir mehr wiegen als die ehemaligen Mannschaftskameraden, können wir doch normalerweise (naja, also nicht immer) aufgrund unserer Sozialkompetenz den Neid in Grenzen halten. Trotz des wahren Gehalts des Sprichworts »Vergleich ist der Dieb der Freude«, das dem ehemaligen US-Präsidenten Theodore Roosevelt zugesprochen wird, können wir doch nicht anders und vergleichen uns mit anderen.
Aufwärts- und Abwärtsvergleiche
Die Begriffe des Aufwärts- und Abwärtsvergleichs beziehen sich auf Situationen, in denen eine Person sich selbst mit anderen vergleicht, die besser (schlechter) sind als sie selbst. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben: Als junger Mann hatte ich zwei enge Freunde, wir nennen sie jetzt John und Joe. In den 1970ern und frühen 1980ern besaß nicht jeder in Budapest ein Auto. Wenn doch, war es sehr wahrscheinlich ein »Ost«-Auto; das bekannteste war der Trabant und wurde in der damaligen DDR produziert. Es besaß einen auch damals schon veralteten Zweitaktmotor. Man scherzte, dass es zwei Menschen für die Produktion eines solchen Motors brauchte: einen zum Schneiden und einen zum Kleben, da er vollständig aus Plaste hergestellt wurde (eine Tatsache, über die viel gelacht wurde). Ich erinnere mich besonders an einen Witz:
Ein Esel und ein Trabant treffen sich im Thüringer Wald.
»Hallo Auto!«, grüßt der Esel.
»Hallo Esel!«, antwortet der Trabant.
Der Esel fühlt sich vor den Kopf gestoßen und reagiert empört: »Es ist nicht nett, dass du mich einen Esel nennst, nachdem ich dich als Auto angesprochen habe, mir stünde also wenigstens ›Pferd‹ zu!«
Mit Mitte 30 kaufte ich mir einen sechs Jahre alten Trabant. Es war mein erstes Auto, und auch wenn es kein Statussymbol darstellte, so hatte es doch immerhin vier Räder. John besaß kein Auto (einerseits, weil er es sich von seinem Mathematikergehalt nicht leisten konnte, und andererseits, weil ihm seine miserable Sehkraft einen Strich durch die Führerschein-Rechnung machte). Es ist nachgewiesen, dass der Abwärtsvergleich zu Dankbarkeit führt ‒ wie bei mir, wenn ich mich mit dem autolosen John verglich. Ich glaube zwar nicht, dass ich den klassischen Negativeffekt des Abwärtsvergleichs (Verachtung) spürte, aber irgendwie kam ich mir wohl überlegen vor. Joe wiederum arbeitete für eine französische Firma und bekam bald ein »West«-Auto, einen Renault. Löste dies in mir den ebenso oft in Lehrbüchern beschriebenen Positiveffekt des Aufwärtsvergleichs aus, also Hoffnung oder Inspiration? Vielleicht steigerte es mein Streben danach, mir irgendwann (also in der fernen Zukunft) selbst ein »West«-Auto wie Joe leisten zu können. Allerdings kann ich definitiv nicht den Negativeffekt (Neid) abstreiten. Aber war der autolose John wiederum unglücklich oder frustriert? Mitnichten! Relevanz ist die Voraussetzung für den sozialen Vergleich ‒ und ihn interessierte es überhaupt nicht, ob er ein Auto besaß oder nicht, es war ihm schlicht egal!
Sozialpsychologen analysieren weiterhin unsere Motivationen für Vergleiche. Adam Galinsky (ein Sozialpsychologe der Columbia University in New York) und Maurice Schweitzer (von der Wharton School of Business der Universität von Pennsylvania)1 beschreiben daher in ihrem Buch Friend and Foe: When to Cooperate, When to Compete, and How to Succeed at Both: »Wenn man mithilfe des sozialen Vergleichs seine eigene Motivation steigern will, gibt es eine Regel, die man dabei nicht vergessen darf: Nutze die vorteilhaften Vergleiche, wenn du glücklicher sein willst, und die unvorteilhaften Vergleiche, wenn du dich selbst motivieren möchtest. Es ist gut möglich, dass du dir den sozialen Vergleich mit anderen nicht abgewöhnen kannst, aber du kannst ihn immerhin zu deinem Vorteil nutzen.«
Sich mit den eigenen Zielen vergleichen
Nachdem ich ein paar meiner vorläufigen Entwürfe zum Thema Vergleich auf meinem Blog gepostet hatte, kommentierte Peter Andras, ein Professor und Querdenker der englischen University of Keele, mit folgendem Text2:
»Meiner Meinung nach hängt dies mit dem Ausmaß dessen zusammen, wie sehr man sich im Entscheidungsprozess von internen oder externen Faktoren beeinflussen lässt, oder dem Ausmaß der eigenen Autonomie bei der Entscheidungsfindung. Viel Arbeit wurde bereits im Kontext der Bildungstheorie und -psychologie in Bezug auf die Wichtigkeit dieser Differenzierung sowie die der Rolle der Autonomie in der Entwicklung von Individuen und ihrer Persönlichkeit getan. Autonomer gepolte Menschen vergleichen sich selbst, ihre Leistungen und Besitztümer mit ihren eigenen Zielen. Allerdings musste auch schon oft festgestellt werden, dass die Menschen, die sich von externen Faktoren beeinflussen lassen, die Gesellschaften dominieren, weil die meisten Entscheidungen dann doch auf Basis des Vergleichs mit den Nachbarn oder anderen Menschen getroffen werden.«
Diese Ansichten wurden im umstrittenen Buch Punished by Rewards3 bereits näher betrachtet und Alfie Kohn argumentiert dort gegen die oft zur Motivation anderer genutzte Strategie: »Mach dies und du bekommst das.« Belohnung und Bestrafung sind die zwei Seiten des manipulativen Verhaltens, und Autoren wie Kohn sehen die Belohnungen als besonders problematisch, vor allem wenn der Schüler, Athlet oder Arbeitnehmer bereits eine intrinsische Motivation für den Erfolg hat. Neuere Forschungsergebnisse und -theorien, wie beispielsweise von Christina Hinton (von der Harvard Graduate School of Education; Gründerin und stellvertretende Leiterin der dortigen Research Schools International) untermauern die These, dass es nicht ausreicht, Schüler und Studierende mit extrinsischen Belohnungssystemen (wie Geld) längerfristig zum Lernen zu motivieren.4 Wenn diese allerdings intrinsische Gründe