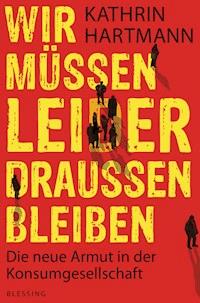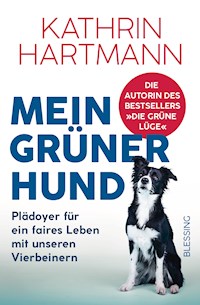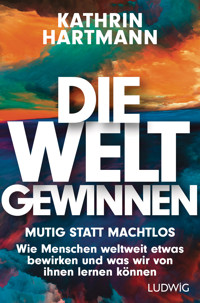
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Sie haben toxische Fabriken verhindert, Flüchtlingen ein Zuhause gegeben und Industriearbeitende mit der Klimabewegung vereint. Mit Solidarität und Einfallsreichtum haben sie den Mythos widerlegt, dass der Einzelne machtlos ist und Veränderungen immer von »oben« kommen müssen. Kathrin Hartmann hat die mutigen Menschen getroffen, die sich in David-gegen-Goliath-Momenten erfolgreich gegen Energiekonzerne, Agrar-Multis und die Textilindustrie gewehrt haben. Sie erzählt vom Mut und der Stärke von Aktivistinnen und Aktivisten, die im globalen Süden, aber auch in Europa und Deutschland, das Leben ihrer Mitmenschen verbessern und berichtet von Graswurzelbewegungen, die mit globaler Perspektive soziale und ökologische Probleme aktiv und erfolgreich angehen. Sie zeigt, wie es möglich ist, die Zukunft trotz widrigster Umstände selbst zu gestalten und sich durch Rückschläge nicht entmutigen zu lassen - und warum wir immer Alternativen haben und was wir tun müssen, damit diese Wirklichkeit werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Was wenn wir die Welt tatsächlich zu einem besseren Ort machen könnten? Nur ein schöner Traum? Oder eine reale Option, die zu beherztem Tun auffordert?
Die Journalistin Kathrin Hartmann ist seit 15 Jahren dorthin unterwegs, wo Menschen inmitten chronisch prekärer Lebensbedingungen aktiv werden: gegen die radikale Ausbeutung auf Palmölplantagen in Asien, gegen die umweltrassistische Petrochemie in den Staaten, gegen die Ausgrenzung der Schwächsten in weltweiten Finanz- und Gesellschaftskrisen. Menschen vor Ort mit Mitteln vor Ort zeigen, wie echte Veränderung funktionieren kann. Auch uns, die wir inzwischen selbst eingeholt werden von sozialen Unruhen, akuten Folgen des Klimawandels und dem Erstarken rechter Ideologien.
KATHRIN HARTMANN
DIE WELT GEWINNEN
MUTIG STATT MACHTLOS
Wie Menschen weltweit etwas bewirken und was wir von ihnen lernen können
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Ludwig Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
www.penguin.de/verlage/ludwig
Alle Rechte vorbehalten.
Redaktion: Caroline Kaum
Coverdesign: wilhelm typo grafisch, Zollikon
Umschlagabbildung von Shutterstock.com / agsandrew
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-33067-5V001
FürAbdul Karim, Kurigram, Bangladesch († 2012)Jopi Peranginangin, Java, Indonesien († 2015)Nordin Abah, Borneo, Indonesien († 2017)Mike Ngubule, Lusaka, Sambia († 2024)Ihr Leben für die Menschen bleibt unvergessen.Rest in Power.
Inhalt
I. Vorwort: Wir sind noch lange nicht verloren
II. Das falsche Gute: Wie ökonomisierte Hilfe, Wohltätigkeit und Greenwashing Veränderung blockieren
1. Von der Wall Street in die Blechhütte: Mikrokredite, das Geschäft mit der Armut
2. Charity is not Change: Die Almosenökonomie der Tafeln
3. Das Elend schönreden: Neue Optimisten, Philantrokapitalisten und Effektive Altruisten
4. Grüne Lügen: Das Geschäft mit dem guten Gewissen
III. Die Welt wartet nicht: Wie Menschen von unten für uns alle kämpfen
1. Die Heldinnen von Hermosa: Textilindustrie und Patriarchat
2. The Descendants Project: Geschichte für die Zukunft ändern
3. Solidaritätsbewegung in Griechenland: Gegen die Barbarei des Kapitals
4. Acker für alle: Essen ist politisch
5. City Plaza, Grandhotel Cosmopolis, Bellevue di Monaco: Das Recht zu bleiben
6. VW heißt Verkehrswende: Gemeinsam das Unmögliche möglich machen
IV. Schlusswort: Bildet Banden!
Danke!
Anmerkungen
I. VORWORT: WIR SIND NOCH LANGE NICHT VERLOREN
»Eine andere Welt ist nicht nur möglich, sie ist im Entstehen. An einem ruhigen Tag kann ich sie atmen hören.«
ARUNDHATIROY
Durch die Fensterritzen meiner Unterkunft dringen schwüle Luft und ein schwerer süßlicher Geruch: eine Mischung aus Abgasen, Müll und exotischen Gewürzen. Ich kauere auf meinem schmalen Bett und starre in den kleinen Fernseher auf der abgenutzten Holzkommode an der Wand gegenüber. Sein durchdringendes Pfeifen konkurriert mit dem Straßenlärm draußen; das krisselige, tanzende Bild zeigt Herzogin Kate und Prinz William, wie sie sich in der Westminster Abbey das Ja-Wort geben. Ich bin nun wirklich kein Fan der Royals, ganz im Gegenteil, und habe mir bis dato keines ihrer Hochzeitsspektakel angesehen. Aber an diesem 29. April 2011 ist alles anders, hier in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch.
Ich wollte unbedingt hierherkommen, um die verheerenden Folgen des Mikrokreditsystems zu recherchieren. Ich habe nie daran geglaubt, dass sich ausgerechnet die Ärmsten aus ihrer Armut befreien könnten, indem sie sich verschulden. Aber die reichen Länder des Nordens waren von dieser Idee damals so begeistert, dass sie einem Banker den Friedensnobelpreis verliehen: Muhammad Yunus und seiner Grameen Bank. Dann folgte eine Suizidwelle in Indien, mindestens 100 Frauen nahmen sich auf grausame Weise das Leben, manche von ihnen tranken Pestizide. Für einen winzigen Moment gerieten Mikrokredite in die Kritik, doch die Aufregung legte sich erstaunlich schnell. Weil ich unabhängig von Banken und großen internationalen Hilfsorganisationen recherchieren wollte, nahm ich vor meiner Reise Kontakt zu einigen Graswurzelbewegungen und kritischen Wissenschaftlern in Bangladesch auf. Alle versprachen, mir bei meinen Recherchen zu helfen. »Komm einfach her«, sagten sie, »wenn du erst einmal da bist, sehen wir weiter.« Also hatte ich all meinen Mut zusammengenommen – und nun war ich also hier: mittendrin in Dhaka.
Nie zuvor war ich im Globalen Süden gewesen, geschweige denn in einem sogenannten Entwicklungsland. Nun saß ich in diesem kleinen Zimmer mit einfach verputzten Wänden, über 7000 Kilometer weit weg von zuhause, mitten in der Fremde. Vor mir: vier Wochen allein in einem der ärmsten Länder der Welt. Draußen wurde es dunkel. Der Mut verließ mich und meine Angst wurde immer größer. Was hatte ich mir denn da bloß in den Kopf gesetzt? So suchte ich also Trost im einzigen englischsprachigen Programm, das der uralte Fernseher hergab, und das war nun, the irony, ausgerechnet die Hochzeit im Vereinigten Königreich, das mit seiner fast 100-jährigen Kolonialherrschaft in Britisch-Indien erst die Strukturen für die manifeste Armut hier geschaffen hat. Währenddessen kreisten meine Gedanken: Was, wenn nichts von dem hinhaut, was ich mir vorgenommen habe? Wenn ich hier krank werde oder mitten in eine Naturkatastrophe gerate? Schließlich war das kleine Land am Flussdelta aus Brahmaputra, Ganges und Meghna damals schon eines der am meisten von der Klimakrise betroffenen, inklusive unvorhersagbarer Sturmfluten, Überschwemmungen und Unwetter. Welche schrecklichen Dinge würde ich sehen, welche furchtbaren Schicksale kennenlernen? Würde ich all das überhaupt verkraften können? Wäre ich nach diesen vier Wochen vielleicht nicht mehr dieselbe wie vorher?
Natürlich war ich danach nicht mehr dieselbe. Aber eine Hoffnungsvollere.
Denn am nächsten Abend traf ich Badrul Alam, der die Kleinbauern-Bewegung Krishok Federation leitet. Er und Shipra Rani von Kishani Soba, dem weiblichen Pendant, einer Bewegung von Kleinbäuerinnen, führten mich auf meinen Recherchen in zwei der ärmsten Regionen des Landes im Norden und im Süden. Ich sprach dort mit Frauen, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert verschuldet und mittellos sind, besuchte ganze Schuldendörfer, deren Bewohnerinnen von den hiesigen Geldeintreibern und Banken erbarmungslos unter Druck gesetzt werden. Ich lernte Menschen kennen, denen nach einer jähen Sturmflut buchstäblich das Wasser bis zum Hals stand und die später ihre toten Freunde und Familien aus Bäumen bergen mussten. Ich besuchte Slums, in die viele Menschen aus den Küstengebieten des Südens geflohen waren, weil ihnen die Klimakrise dort Land und Lebensgrundlagen geraubt hatte. Seither sind sie gezwungen, zu Hungerlöhnen in einsturzgefährdeten Fabriken der Hauptstadt zu schuften. Ich sah in die angsterfüllten Augen arbeitender Kinder. Ich habe in Bangladesch das ganze Grauen der Klimakrise begriffen und verstanden, was existenzielle Armut und Hunger bedeuten – und was Ausbeutung und Unterdrückung mit Menschen machen. Als Journalistin aus dem reichen Norden habe ich mich oft schuldig und hilflos gefühlt, und manchmal verzweifelte ich fast ob des schieren Elends. All das werde ich nie vergessen.
Auf der anderen Seite habe ich in Bangladesch viele Menschen kennengelernt, die mich bis heute beeindrucken, die mich inspirieren und mir Mut machen. Die organisierten Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die verlassenes Land besetzen, um sich dort selbst zu versorgen, die der Macht der Agrarkonzerne trotzen. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die gegen die ausbeuterischen Verhältnisse in Landwirtschaft und Industrie kämpfen, aktivistische Wissenschaftler und Studierende, die ihre Arbeit und ihren Intellekt in den Dienst einer besseren, gerechten Zukunft stellen. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Als ich auf der Rückreise am Flughafen Dubai auf meinen Anschlussflug nach München wartete, sah ich noch einmal auf mein Handy. Viele meiner neuen Freundinnen und Freunde aus Bangladesch hatten mir Nachrichten geschickt, mir eine gute Reise gewünscht und geschrieben, ich möge doch bald wiederkommen. Ein Teil von mir wollte das, am liebsten sofort, denn tatsächlich hat diese Reise mein Leben verändert. Es mag absurd klingen, aber sie hat mich zuversichtlich gemacht. Denn sie hat mir eine gerechte Welt real und greifbar vor Augen geführt: Ich weiß seither, wie wunderschön sie aussieht.
Hilfe, die das System stützt, ist keine
Viele Menschen in den reichen Ländern des Nordens haben vermutlich sehr abstrakte Vorstellungen vom Globalen Süden. Wir hören von beunruhigenden Armutsquoten und lesen von in Zahlen gefasstem Hunger. Aus Spendenkampagnen sind uns grässliche Bilder von ausgemergelten, in Lumpen gekleideten Körpern vertraut, kennen wir von Dürre gezeichnete Landschaften und Fotos von Kindern mit aufgeblähten Hungerbäuchen. Wir wissen um die miserablen Arbeitsbedingungen in den Rohstoffminen, Textilfabriken und auf den Kakaoplantagen, und auch, dass für Soja- und Palmölmonokulturen Urwald vernichtet und Indigenen ihr Land gestohlen wird. Nach Überschwemmungen und Wirbelstürmen sehen wir erschreckende Bilder der Zerstörung in den Nachrichten. Auch nach Katastrophen wie dem Einsturz des maroden Gebäudes Rana Plaza in Bangladesch, bei dem mehr als 1100 Menschen ihr Leben verloren haben. Die meisten von ihnen Näherinnen, die unter ohnehin schon ausbeuterischen Bedingungen Kleider für Markenkonzerne fertigten. Wir fühlen uns dann macht- und mutlos und haben ein latent schlechtes Gewissen, weil wir ahnen, dass all das irgendwie auch etwas mit uns zu tun hat, weil unser Konsum, der Überfluss, in dem wir leben, und unsere Industrie, die auf maximalen Profit ausgerichtet ist, auf Kosten von Bevölkerung und Natur im Globalen Süden gehen. In den Nachrichten erscheinen uns die Menschen dort oft als anonyme und handlungsunfähige Opfer, die dringend Unterstützung aus dem reichen Norden brauchen – in Form von ökonomischer Entwicklungshilfe, Förderprogrammen von Milliardärsstiftungen, Nachhaltigkeitssiegeln, die Umweltverträglichkeit versprechen, sogenanntem ethischem Konsum, technologischen Scheinlösungen und Geschäftsmodellen, die zusichern, auf profitable Weise existenzielle Probleme zu lösen. Aber diese Vorstellung ist falsch. Denn sie tut so, als ob in einem per se ungerechten System einzelne Missstände einfach abgestellt werden könnten. Dann wäre – win-win! – die Weltrettung für die Profiteure der Ungerechtigkeit sogar noch ein zusätzliches lukratives Business.
Ich bezeichne solche Ideen als das »falsche Gute«. Es ignoriert die strukturellen Ursachen von Armut, Ungleichheit und Naturzerstörung nicht nur, es legitimiert und erhält sie. Es will beruhigen, indem es suggeriert, es gebe keine Schuldigen und alles könne so bleiben, wie es ist. Das falsche Gute ist deshalb der größte Bremsklotz für echte Veränderung. Denn in Wahrheit lässt es die Welt, so wie sie ist, als alternativlos erscheinen. Und nimmt uns damit die Zuversicht und den Glauben daran, dass wir wirklich etwas um- und neu gestalten und eine gerechte Welt schaffen können – und damit ein gutes Leben für alle.
Die allzu laute Erzählung des falschen Guten übertönt außerdem die Menschen vor Ort und wertet so ihren Mut, ihre Stärke und ihre Vorstellung von diesem anderen besseren Leben ab. Graswurzelbewegungen, die ökologische und soziale Fragen mit einer globalen Perspektive zusammenbringen, kommen in diesem Geschrei ebenso wenig vor wie die großen und kleinen Siege, für die sie gemeinsam gekämpft und damit das Leben so vieler Menschen verbessert haben. Die vielfältigen Formen solidarischer Alltagspraxis, die diese Bewegungen entwickeln und leben, mit denen sie zeigen, dass alles auch ganz anders sein kann – schöner, friedlicher, gerechter –, treten damit in den Hintergrund, werden unsichtbar.
Mit diesem Buch will ich genau diesen Menschen eine Stimme geben, eine Stimme, die klar, stark und selbstbewusst neben dem Lärm des falschen Guten steht und ihn zum Schweigen bringt.
Solidarische Begegnungen weltweit
Nach meiner ersten Bangladesch-Reise vor nun fast 15 Jahren hat es mich immer wieder zu Recherchen in Länder des Südens und an die Peripherie des europäischen Kontinents gezogen. Jedes Mal war ich dort mit Menschen aus Graswurzelbewegungen unterwegs, die mir nicht nur die Missstände vor Augen geführt haben, gegen die sie arbeiten, sondern auch die Alternative, für die sie kämpfen. Nie war das eine für sie ohne das andere denkbar. Jedes Mal habe ich dort die Grundzüge einer anderen Welt aufscheinen sehen, einer, in der ich selbst gerne leben möchte. Und vermutlich die allermeisten von uns. Eine, in der die Daseinsvorsorge nicht den Profiten einiger weniger, sondern dem Wohl aller dient. Eine, in der wichtige Ressourcen Gemeingüter sind statt Privateigentum. Eine, in der alle Menschen Zugang zu Gesundheit und Bildung sowie das Recht auf demokratische Teilhabe haben. Eine, in der der Natur Rechte zugestanden werden und wir uns als Teil von ihr verstehen, nicht als ihre Beherrscher. Das falsche Gute entlarvt sich im Anblick dieser anderen Welt ganz von selbst.
Ich spreche nicht von netten kleinen Nischenprojekten, die inmitten extremen Elends Leid bloß lindern und es damit erträglicher machen – insbesondere für uns Menschen im Globalen Norden. Sondern von Bewegungen, die die strukturellen Ursachen dahinter offenlegen und verändern wollen. Ich werde nie die Tage in Brasilien vergessen, wo der österreichische Regisseur und Filmemacher Werner Boote und ich einen Teil unseres Greenwashing-Films Die grüne Lüge drehten.[1] Wir begleiteten die indigene Aktivistin und Stammesführerin Sônia Guajajara zu einer Versammlung, einer Assamblea der Stämme Terena und Guarani Kaiowá in Mato Grosso do Sul. Es ist der brasilianische Bundesstaat mit den meisten Rinderfarmen, Zuckerrohr- und Futtersojafeldern. Durch die endlosen Monokultur- und Weidegebiete zu fahren, war unglaublich bedrückend. Alle Konzerne, die hier dahinterstecken, waren mit Nachhaltigkeitssiegeln für ihre Produkte dekoriert, ungeachtet der Tatsache, dass für deren Anbau und Herstellung große Waldflächen vernichtet wurden und werden. Außerdem war das Land den Indigenen geraubt worden: Begonnen hatten damit die kolonialen Unterdrücker vor 500 Jahren. Heute vertreiben Agrarkonzerne, Großgrundbesitzer und illegale Holzfäller die Menschen. Mato Grosso do Sul gehört zu den Bundesstaaten, in denen die Gewalt gegen Indigene, die sich gegen diese verbrecherische Praxis wehren oder versuchen, sich ihr Land zurückzuholen, am größten ist.[2] Sônia zeigte uns Bretterverschläge und armselige Zelte aus Plastikplanen, die sich am Straßenrand aneinanderreihten: Hütten derjenigen Menschen, die von hier stammen und keinen anderen Platz zum Leben finden als zwischen Straße und Plantage, um im Pestizidregen ihr elendes Dasein zu fristen. Aber es sind auch eben solche Menschen, die gemeinsam dafür kämpfen, ihr Land zurückzubekommen.
Einer von ihnen, Estevinho Floriano Teragao Terena, nahm uns mit zur Farm Cristalina, die er und seine Gemeinschaft sich von einem Großgrundbesitzer zurückerobert haben. Ich bekomme noch heute Gänsehaut, wenn ich daran denke, was für einen schönen und friedlichen Ort Estevinho und seine Leute dort für sich, die Natur und die Tiere geschaffen haben. Das war alles andere als einfach, denn Angehörige der Terena und auch der anderen Stämme wurden und werden von Großgrundbesitzern in Brasilien bedroht, misshandelt und umgebracht, obwohl ihnen das umkämpfte Land verfassungsgemäß zusteht. »Alles ist schwierig, deshalb kämpfen wir jeden Tag«, sagte Sônia damals. »Wir müssen dranbleiben, jeden Tag darüber reden, es der Welt sagen. Und fest daran glauben, dass die Geschichte eines Tages ihren Lauf ändert.«[3]
Sie hat ihren Lauf bereits geändert, und das damals noch Undenkbare ist wahr geworden: Sônia ist heute die erste indigene Ministerin von Brasilien. Zum ersten Mal gibt es ein Ministerium für die 1,7 Millionen Menschen umfassende Urbevölkerung im Land, und das ist ein riesiger Erfolg der Bewegung. Sônia kämpft dort weiter gegen die Abholzung der brasilianischen Wälder, für die Rechte der Natur und für Gerechtigkeit für die indigenen Völker – und das mit ihnen zusammen. Indem sie sich für den Erhalt der Wälder, des Wassers und der Lebensgrundlagen dort einsetzen, kämpfen sie letztendlich für uns alle. Deswegen dürfen wir sie nicht im Stich lassen.
Vor einer Weile schwärmte ich einer Freundin von den Aktivistinnen vor, die ich kurz vorher im US-Bundesstaat Louisiana kennengelernt hatte. Dort stehen so viele Ölraffinerien und Chemiefabriken, dass sie die Menschen krank machen. Insbesondere People of Color und Arme. Diese Schwarzen Frauen aber haben ihre Nachbarinnen und Nachbarn zum gemeinsamen Protest gegen weitere giftspuckende Fabriken mobilisiert, die neben ihre Häuser gebaut werden sollten. Und es ist ihnen tatsächlich gelungen, zwei der größten geplanten Industrieanlagen zu verhindern. Mit einer Handvoll Leute vor Ort und vielen Verbündeten in den USA und darüber hinaus. Meine Freundin, die sich genauso dringend eine andere Welt wünscht wie ich, fragte mich: »Du erzählst so oft von solchen Bewegungen. Was, denkst du, macht diese Leute aus? Sind es einfach besonders außergewöhnliche Menschen oder gibt es etwas, das sie verbindet und das wir uns von ihnen abschauen könnten?« Über diese Frage denke ich immer wieder nach. Ja, natürlich sind das alles besondere Menschen. Aber nicht, weil sie eine spektakuläre Idee hatten, auf die zuvor noch keiner gekommen wäre, oder weil sie irgendeine Zaubermaschine erfunden hätten. Und auch nicht, weil sie einer vermögenden Elite mit Privatuni-Abschluss angehören, wie sie in den oberen Konzernetagen sitzt. Sondern weil sie durchdrungen sind vom unerschütterlichen Wunsch nach bedingungsloser Gerechtigkeit und dem unbedingten Willen, diese zu erreichen. Dieser Wille ist ansteckend, verbindet und schafft Raum für Utopien, die gemeinsam entwickelt werden. So werden soziale und ökologische Fragen auch nicht gegeneinander ausgespielt, sondern gemeinsam beantwortet.
Die Nachfahrinnen der Versklavten am Mississippi, die für den Klimaschutz und gegen die Ausbreitung der fossilen Industrie ins Feld ziehen, stemmen sich gleichzeitig gegen Umweltrassismus und setzen sich für eine gerechte und emanzipatorische Erinnerungskultur im Kontext der abscheulichen Geschichte der Sklaverei ein. Die Frauen, die in El Salvador für bessere Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken kämpfen, stehen damit gleichzeitig gegen das Patriarchat und eine gewalttätige Politik auf. Die Solidarische Bewegung in Griechenland hat der Barbarei der Banken etwas entgegengesetzt. Sie hat in der Finanzkrise nicht nur Zigtausende Menschen versorgt und Leben gerettet, sondern auch in der Praxis bewiesen, dass eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus besser für alle funktioniert. Progressive Initiativen für Geflüchtete holen die Menschen in unsere Städte, mitten in unsere Gemeinschaft, und bearbeiten auch hierzulande politisch die Forderung nach bezahlbaren Mieten. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auf der ganzen Welt zeigen jeden Tag, dass wir keine Agrarkonzerne brauchen, nicht ihr Gift und nicht ihren Dünger, um die ganze Welt mit gutem Essen zu versorgen. Und die Klimaaktivistinnen und -aktivisten, die gemeinsam mit Beschäftigten und der Gewerkschaft versuchen, einen Autokonzern so umzukrempeln, dass er statt SUVs Straßenbahnen und Busse baut, kämpfen gleichzeitig für zukunftsfeste und gesellschaftsrelevante Arbeitsplätze sowie eine klimafreundliche Mobilität für alle. Es mögen unterschiedliche Protagonisten, Institutionen, Wirtschaftszweige, politische und ideologische Kräfte sein, gegen die all diese Bewegungen antreten. Aber ob es sich nun Palmölfirmen, Goldminen, Rinderbarone oder Großkonzerne handelt, spielt letztlich keine Rolle. Der aktive und entschlossene Einsatz für Gerechtigkeit ist universal und strukturelle Änderungen sind übertragbar. Es gibt Menschen überall auf der Welt, die sie erkämpfen oder bereits umgesetzt haben. Es hat mich immer überwältigt, mit wie viel Klugheit, Liebe und Solidarität sie das tun, mit wie viel Mut, Leidenschaft und Empathie. Wir können so viel von ihnen lernen. Sich der Verhältnisse bewusst zu werden, sie nicht als unveränderbar anzunehmen, aufzustehen und Nein zu sagen, das ist der allererste Schritt.
»Nah«, verneinte 1955 die Schwarze Sekretärin und Näherin Rosa Parks, als sie ihren Sitzplatz im Bus für einen Weißen räumen sollte. Sie weigerte sich aufzustehen. In Montgomery im Bundesstaat Alabama galten damals die rassistischen Jim-Crow-Gesetze,[4] Rosa wurde verhaftet. Genau damit aber stieß sie die Schwarze Bürgerrechtsbewegung mit an, die dazu führte, dass eben jene diskriminierenden Gesetze abgeschafft wurden. »Unsere Freiheiten wurden uns nicht von irgendeiner Regierung gewährt. Wir haben sie ihnen abgerungen. Und sind sie einmal preisgegeben, wird der Kampf um ihre Rückgewinnung zur Revolution. Dieser Kampf muss in allen Kontinenten und Ländern geführt werden. Kein Ziel ist zu klein, kein Sieg zu unbedeutend«, sagt die indische Schriftstellerin Arundhati Roy, von der das wunderschöne Eingangszitat stammt.[5]
Inmitten sich zuspitzender Ereignisse
Während ich dieses Buch schreibe, bricht gerade die Welt zusammen. Erst brennen in Kalifornien Wälder und Häuser lichterloh. Dann wird Donald Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Er bastelt sich dort mit Techno-Milliardären eine Oligarchie: Am ersten Amtstag gründet Trump das Department of Government Efficiency und überlässt die Führung dem rechtsradikalen Elon Musk. Der setzt nach dem Vorbild des argentinischen Autokraten Javier Milei die Kettensäge an die öffentliche Verwaltung, feuert mehrere Tausend Bundesbedienstete und friert Geld für das Entwicklungsprogramm USAID ein. Er ignoriert Bürgerrechte und lässt mehr als eine halbe Million Migrantinnen und Migranten ausweisen. Er verlässt per Dekret die Weltgesundheitsorganisation WHO und steigt zum zweiten Mal aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus. Er kündigt an, noch mehr Öl und Fracking-Gas zu fördern, vor allem in Naturschutzgebieten, er will sich Grönland samt seiner Rohstoffe einverleiben, notfalls mit militärischer Gewalt, und tönt, die Palästinenser aus Gaza vertreiben zu wollen, um dort ein Immobilienparadies einzurichten. Er hofiert Rechtsextreme und sucht die Konfrontation mit Europa und der Ukraine. Hass, Gewalt und Zerstörung als oberstes Ziel.
Bei der Bundestagswahl in Deutschland wiederum entscheidet sich jeder fünfte Wahlberechtigte, sein Kreuz bei der rechtsextremen AfD zu machen. Zuvor hatten sich die bürgerlichen Parteien CDU, FDP, SPD und Grüne im Wahlkampf fast nur noch auf das Thema Migration und die Abschiebung von Geflüchteten kapriziert. Insbesondere CDU und FDP schienen sich gegenseitig zu überbieten in ihrem Versprechen, Armen noch mehr wegzunehmen, sowie in ihrer Diffamierung und Stigmatisierung Geflüchteter. Nach einer zehrenden Pandemie und inmitten einer allumfassenden sozialen und ökologischen Krise haben sie keine positiven Angebote an die Menschen, die das Leben aller besser machen. Nur das Versprechen, das Leben von anderen noch schlechter zu machen. Klimaschutz? Ist zugunsten von Wirtschaftswachstum und Aufrüstung auch bei den Grünen längst von der Agenda gerutscht.[6] Der rechtskonservative Friedrich Merz, die Union und die FDP haben im Bundestag das Tabu gebrochen und mit den Stimmen der rechtsextremen AfD eine Mehrheit für einen besonders widerwärtigen Entschließungsantrag erreicht, der teilweise wortgleich die menschenverachtenden Forderungen der AfD enthält und zum Ziel hat, dass Asylsuchende so gut wie gar nicht mehr ins Land kommen. Weil die Menschen aber immer das Original wählen, ist die AfD nun zweitstärkste Kraft im Bundestag. Und Friedrich Merz, Millionär und Lobbyist der Finanz- und Chemieindustrie[7] ohne jede Regierungserfahrung, ist jetzt Bundeskanzler. Ein Mann, für den das bevorzugte Verkehrsmittel sein Privatjet ist[8] und bei dem man gar nicht weiß, wen er eigentlich am meisten verachtet: Frauen, Migranten, Geflüchtete, Arme, Linke, Grüne, Klimaschützer oder Antifaschisten.
Seine erste Amtshandlung? Die Zivilgesellschaft einschüchtern: Am Tag nach der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar 2025 stellen Friedrich Merz und die Unionsfraktion eine Kleine Anfrage mit dem Titel »Politische Neutralität staatlich geförderter Organisationen« an die noch amtierende Ampel-Regierung.[9] Als Hintergrund nennen sie die »Brandmauer«-Massenproteste gegen die CDU, zu denen einige der in der Anfrage genannten Organisationen aufgerufen hatten, nachdem Merz und CDU mit der AfD paktiert haben. Mehr als 550 Fragen hat die Union zu den Omas gegen Rechts, Campact, Attac, der Amadeu Antonio Stiftung gegen Rassismus, der Verbraucherorganisation Foodwatch, der Tierschutzorganisation PETA, Greenpeace, der Deutschen Umwelthilfe, dem BUND Naturschutz sowie dem Medienunternehmen Correctiv und dem Netzwerk Recherche. Es gehört zum klassischen Handwerkszeug rechtsextremer Parteien, zivilgesellschaftliche Organisationen zu bedrohen und unter Druck zu setzen.
Gewalt nimmt zu
Zu den mehr als 86 Ländern, in denen die Menschenrechtsorganisation Amnesty International unrechtmäßige staatliche Gewalt gegen Demonstrierende festgestellt hat, gehört 2023 zum ersten Mal auch Deutschland. Das Recht auf Versammlungsfreiheit wird auch hier zunehmend eingeschränkt und der Protest kriminalisiert. Dazu gehören Demonstrationsverbote, Polizeigewalt, eine repressive Gesetzgebung, Einschüchterungen und die sogenannte Präventivhaft: In Bayern wurden Klimaaktivistinnen und -aktivisten bis zu 30 Tage ins Gefängnis gesteckt, ohne dass sie etwas verbrochen hätten.[10] Man wollte sie daran hindern, die Internationale Automobilausstellung (IAA) zu stören. Laut einer Recherche des Online-Magazins Krautreporter werden zehnmal so viel Klimaaktivisten eingesperrt wie religiöse Gefährder, für die solche Polizeigesetze angeblich verabschiedet wurden.[11] Gegen die sogenannten Klima-Kleber der Letzten Generation ging man besonders hart vor: Razzien wegen »Verdachts auf kriminelle Vereinigung«, Anklagen, Anzeigen, drakonische Strafen, Haft ohne Bewährung.
Der vorläufige Höhepunkt: Die bayerische Landesregierung macht tatsächlich den Schritt, Berufsverbote zu verhängen. Sie untersagt der Münchner Klimaaktivistin und Studentin Lisa Poettinger die Zulassung zum Referendariat. Sie darf nicht Gymnasiallehrerin werden. Poettinger hatte Demos gegen rechts in München mitorganisiert, dort gegen die Automesse IAA und gegen den Braunkohleabbau in Lützerath demonstriert. Eine solche Einschränkung von Demokratie und Meinungsfreiheit wird mit dem Rechtsrutsch und der Weigerung, Klimaschutz politisch durchzusetzen, auch hierzulande mehr werden. Nicht weniger. Widerstand dagegen ist wichtiger denn je, wenn wir nicht weiter im dauerhaften Krisenmodus leben wollen.
Ja, ich gebe zu, dass ich oft sehr genau hinhören muss, um die gute andere Welt atmen zu hören. Ich kann aber umso besser innehalten, je mehr ich an all die Kämpferinnen und Kämpfer denke, denen ich begegnet bin. Aber ich will ihre Geschichten hier nicht erzählen, um zu trösten oder zu beruhigen. Zu grausam sind die Umstände, aus denen ihr bedingungsloser Einsatz erwachsen ist, zu ernst die Lage der Welt. Denn gleichzeitig mit dem weltweiten Rutsch ins Autoritäre und dem klimapolitischen Backlash nimmt die Gewalt gegen Umwelt- und Klimaaktivisten zu. Laut der NGO Global Witness sind zwischen 2012 und 2023 mehr als 2100 Aktivistinnen und Aktivisten ermordet worden, die für ihr Land und ihre Lebensgrundlagen gekämpft haben. Allein 2023 waren es 196 Menschen.[12]
Besonders dramatisch ist die Lage in Honduras. In diesem mittelamerikanischen Land bin ich Männern und Frauen begegnet, die in ständiger Bedrohung leben. Mit der Menschrechts-NGO Romero-Initiative habe ich deren Partnerorganisation Radio Progreso dort besucht. Der kleine lokale Sender berichtet regierungskritisch und informiert über Bergbau-, industrielle und andere Großprojekte im Land. Er unterstützt widerständige Gemeinden, die gegen den Ausverkauf ihrer natürlichen Ressourcen kämpfen. Gegen Staudämme und gigantische Solarparks, die nur Strom für den Export, die Goldminen und die Textilfabriken liefern, nicht aber für die Menschen. Radio Progreso vernetzt Organisationen und Aktivistinnen und Aktivistinnen selbst über Landesgrenzen hinaus, arbeitet mit Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, einem Kollektiv von Menschenrechtsanwältinnen, zusammen und hält für Gefährdete ein Schutzhaus bereit. Dort höre ich allerdings in nur einer Woche so viele absolut entsetzliche Geschichten wie selten zuvor.
Zum Beispiel die von Fredi, der in Wahrheit anders heißt. Der Ortsvorsteher einer kleinen Gemeinde in El Progreso nördlich der Hauptstadt erzählt, dass er sich mit dem korrupten Bürgermeister angelegt hat, der die Wasserquelle, von der alle im Ort abhängig sind, an ein Unternehmen verkaufen will. Er möchte das verhindern. Ob er es überlebt hat, weiß ich nicht. Aber im selben Ort wurde ein Familienvater, der sich gegen eine solche Machenschaft wehrte, mitten in der Nacht aus dem Bett gezerrt und vor dem Haus seiner Familie mit 40 Schüssen getötet. Zwei Jahre vor meinem Besuch wird die weltbekannte indigene Menschenrechts- und Umweltaktivistin Berta Cáceres, die den Kampf gegen den Agua-Zarca-Staudamm anführte, in ihrem Haus erschossen. Drei Aktivisten, die ich bei meinen Recherchen kennengelernt habe, sind tot. Jopi, der in Indonesien ein Buch über Korruption im Palmöl-Geschäft geschrieben hat, wurde erstochen. Dem bangladeschischen Kleinbauernführer Abdul Karim schnitt man die Kehle durch, weil er Landraub verhindern wollte. Und den Regenwaldkämpfer Nordin, den haben die ungerechten Verhältnisse umgebracht: Er ist infolge der vielen verheerenden Waldbrände in seiner Heimat Borneo schwer krank geworden und gestorben. Mich erschüttern diese Geschichten von Menschen tief, die ihr Leben aufs Spiel setzen oder gar lassen für eine bessere Welt. Und mich berührt, dass sie ihr Leben lang kämpfen, egal, wie aussichtsreich dieser Kampf ist und obwohl sie wissen, dass sie diese bessere Welt vielleicht gar nicht mehr selbst erleben werden. Dass sie nicht aufgeben, obwohl es immer wieder auch harte Rückschläge gibt. Für mich ist das ein Ausdruck größter Menschenliebe. Sie brauchen uns und unsere Solidarität, und wir brauchen einander und müssen uns gegenseitig schützen. Denn auch im Globalen Norden, in den USA, Australien, Großbritannien und Europa gibt es wachsende Repressionen gegen Aktivistinnen und Aktivsten.[13]
Grenzenlose Verbindungen und gute Anfänge
»Es ist so hart und schwer, gestern Abend habe ich aus Verzweiflung fast geweint«, verrät mir James Hiatt. Ich treffe ihn in Lake Charles im Bundesstaat Louisiana. Dort recherchiere ich für mein Buch Öl ins Feuer, wie sich die fossile und petrochemische Industrie an der Golfküste ausbreitet.[14] Die Region ist bereits stark von der Klimakrise betroffen und wird immer häufiger von immer stärkeren Hurrikans heimgesucht. Vor zehn Minuten hat mich der Graswurzelaktivist aus meinem Hotel abgeholt, wir haben uns also gerade erst kennengelernt. Und trotzdem gibt es diese Verbindung zwischen uns, dieses tiefe Verständnis darum, wie sich die Sorge um die Welt anfühlt. »Ich muss dich das jetzt gleich mal fragen«, wendet er sich an mich, »warum machst du diese Arbeit? Wie hältst du das aus? Was machst du, damit du nicht kaputtgehst?« »Ich versuche, so oft es geht, in der Natur zu sein, am liebsten in den Bergen, da schöpfe ich Kraft, da geht es mir gut«, antworte ich. Und sehe, wie James traurig lächelt. In diesem Moment spüre ich einen tiefen stechenden Schmerz. Ich muss daran denken, dass ich ja gerade an meinen geliebten Bergen sehe, wie rasant sich dort alles verändert. Wie die Gletscher schmelzen und ganze Felsen einfach wegbrechen, weil der Permafrost sie nicht mehr zusammenhält. Wie nach starkem Regen ganze Hänge abrutschen, wie einst schöne Wege unter Geröllmassen verschwinden und gar nicht mehr begehbar sind. Diese Gefühle von Angst, Verlust und Hilflosigkeit angesichts der Zerstörung des Planeten hat sogar einen Namen: ökologische Trauer. Ich bin überrascht, dass ich dieses so überwältigende Gefühl mit einem mir bis eben noch völlig fremden Menschen auf einem anderen Kontinent viel besser teilen kann als mit manchen guten Freunden. Auch wenn die Einschläge näher rücken, ist es, zumindest in den reichen Ländern, immer noch einfach, die Augen davor zu verschließen, was gerade passiert. Man kann es mit dem Trotz von Dreijährigen einfach wegbrüllen, man kann glauben, man könnte im dicken SUV der Krise davonbrausen, und überzeugt sein, dass man im Supermarkt die Welt rettet (und allen, die das nicht tun, die Schuld in die Schuhe schieben), oder sich an der Wunsch- und Wahnvorstellung festhalten, dass uns eines Tages grüne Daniel Düsentriebe mit einer Zaubertechnologie retten werden. Aber innezuhalten, sich dem Ausmaß der Krisen und dem Verlust dessen, was wir lieben, zu stellen, das tut weh. Es macht wütend, traurig und verzweifelt. Aber aus dieser ökologischen Trauer heraus kann genau dieser dringende Wunsch nach Gerechtigkeit erwachsen, die Sehnsucht nach einer anderen Welt und die unbedingte Entschlossenheit, die wir brauchen, um gemeinsam für Veränderung zu kämpfen. Sie schafft tiefe Verbindungen zwischen Menschen über Kontinente hinweg: Wir stecken ja alle gemeinsam drin. Das ist das Wesen der globalen Solidarität.
»Hoch! Die! Internationaaale! Solidarität!« Das habe ich schon bei unzähligen Demos gerufen. Und natürlich, das ist Folklore. Aber für mich klang es immer verheißungsvoll. Was globale Solidarität tatsächlich bedeutet, das habe ich aber erst verstanden, als ich mit den Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort unterwegs war. Vielleicht sogar noch mehr, als ich während der Covid-Pandemie so lange Zeit zuhause war. Mich dort weiterhin mit der ökologischen und sozialen Krise zu beschäftigen, erschien mir, zurückgeworfen auf mich selbst, allein an meinem Schreibtisch, mit der Welt nur über den Bildschirm verbunden, immer unerträglicher. Die Krisen erdrückten mich. Was hatte das alles noch für einen Sinn? Ich konnte doch sowieso nichts ändern! Ich hatte gute Lust, mir einen neuen Beruf zu suchen. Aber dann habe ich mir vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ich den Kämpferinnen und Kämpfern genau das sagen würde: »Leute, lasst doch gut sein. Man kann doch eh nichts machen.« Das wäre ungeheuerlich. So ungeheuerlich, wie nur in Erwägung zu ziehen, es ginge nicht anders, besser, schöner und gerechter. Ich bin dankbar, dass ich mich mit diesen Menschen wieder austauschen kann, dass ich wieder neue Bewegungen kennenlernen und mir etwas von ihnen abschauen darf. Und dass sie meine Erkenntnis immer wieder bestätigen: Es gibt mehr Liebe als Hass. Und das, finde ich, ist schon mal ein guter Anfang.
II. DAS FALSCHE GUTE: WIE ÖKONOMISIERTE HILFE, WOHLTÄTIGKEIT UND GREENWASHING VERÄNDERUNG BLOCKIEREN
»Es ist immer möglich, jemanden aus dem Schlaf zu wecken. Aber kein Lärm der Welt kann jemanden wecken, der nur so tut, als würde er schlafen.«
JONATHANSAFRANFOER
1. Von der Wall Street in die Blechhütte: Mikrokredite, das Geschäft mit der Armut
Die späte Nachmittagssonne macht, dass das Wasser zwischen den Mangroven golden glitzert und die Bäume grün leuchten. Es könnte idyllisch sein. Doch davor erhebt sich ein Podest aus festgebackenem grauem Lehm. Darauf sind Hütten verteilt. Oder vielmehr das, was von ihnen übrig geblieben ist: notdürftige Holzverschläge, abgedichtet mit Pappe und Blech, statt Türen verhängen leere Reissäcke den Eingang. Hier sitzt Lali Begum auf dem Boden. Die Frau ist so ausgemergelt, dass ich ihr Alter kaum schätzen kann. Wenn sie spricht, sehe ich, dass ihre Zähne und ihr Zahnfleisch knallrot sind, so, als wäre ihr Mund eine offene blutende Wunde. Das kommt von den stark färbenden Betelnüssen, die sie kaut. Sie unterdrücken den nagenden Schmerz des Hungers.
Vier Jahre vor meiner Reise nach Bangladesch erlebt das kleine Land im Flussdelta von Brahmaputra, Ganges und Meghna eine der schlimmsten Naturkatastrophen. Aus dem Nichts fegt 2007 Zyklon Sidr mit bis zu 250 Stundenkilometern über das Land und schiebt eine fünf Meter hohe Flutwelle vor sich her, die den gesamten Küstenstreifen verwüstet. Sidr tötet dreieinhalbtausend Menschen und macht drei Millionen obdachlos. Er zerstört Häuser, Straßen und vernichtet Ernten. Besonders stark betroffen ist der Distrikt Patuakhali, der im Süden von Bangladesch an den Golf von Bengalen grenzt. Dort leben viele Menschen auf sogenannten Chars, Sandbänken im Flussdelta, die besonders von Überschwemmungen bedroht sind. Die Region ist seit jeher Risikogebiet, doch die Klimakrise verschärft die Situation. Die Menschen dort müssen schon seit Jahren mit den bedrohlichen Folgen leben, doch kein Damm schützt sie, obwohl sie seit Langem einen fordern.
Selbst vier Jahre nach dem Desaster lebt Lali Begum hier noch in einer provisorischen Hütte. Ihr rechter Arm hängt schlaff von ihrer Schulter, die Hand ist steif und verkrümmt. Als die Sturmflut die Frau mitreißt, schneidet ihr ein in den Wellen treibendes Blechdach die Hand auf und zerfetzt Sehnen und Nerven. Nun kann Lali Begum nicht mehr arbeiten. Wo auch? Die Katastrophe hat sowohl ihre Lebensgrundlage als auch die ihres Mannes, Abdul Malik, zerstört. Sidr hat Lalis Kiosk weggerissen, Abduls Fischerboote zertrümmert und die Fische vor der Küste vertrieben. Jetzt stehen sie vor dem Nichts. Nein, schlimmer noch: Sie haben Schulden. Bei der berühmten Grameen Bank, der weltweit größten nichtstaatlichen Entwicklungsorganisation BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) und bei den örtlichen NGOs Shanapur und Udipon. Mit deren Mikrokrediten bauten sie den Laden auf, von dem sie leben konnten, bis die Flut kam. Ihr Nachbar Habibur Rahman gesellt sich zu uns. »Als nach Sidr die NGOs zu uns kamen, waren wir erleichtert. Wir dachten, endlich ist Hilfe in Sicht! Aber sie wollten nur unser Geld!«, sagt der alte Mann mit dem hennarot gefärbten Bart. Er zeigt auf die Planen, die Baracken und die Unterschlupfe aus Treibgut. »Die meisten konnten ihre Häuser nicht aufbauen, weil sie mit der Nothilfe der Regierung ihre Schulden abbezahlen mussten.«[15]
Als ich 2011 Bangladesch besuche, um dort zu den verheerenden Auswirkungen der Mikrokredite zu recherchieren, leben in den von Sidr betroffenen Regionen im Süden und Südwesten 1,5 Millionen Kreditnehmerinnen mit einem Schuldenberg von insgesamt umgerechnet 116,8 Millionen Euro. Doch nicht einmal nach dieser Katastrophe werden den Armen die Schulden oder wenigstens Zinsen erlassen. Ein Jahr nach dem Zyklon besucht die britische Organisation Action Aid die betroffenen Gebiete und berichtet von unhaltbaren Zuständen. Sidr-Opfer, die fast alles verloren hatten, wurden von NGOs schikaniert, damit sie ihre Mikrokreditraten zurückzahlen. Der immense Druck brachte Verschuldete außerdem dazu, das gelieferte Hilfsmaterial, wie Baustoffe oder Ähnliches, wieder zu verkaufen. Dieser Druck kam von großen, etablierten Hilfsorganisationen sowie von Muhammad Yunus, seines Zeichens Friedensnobelpreisträger, und der von ihm gegründeten Grameen Bank, der Pionierinstitution der Mikrokredite. Selbst von den am schlimmsten Betroffenen wurde erwartet, dass sie wöchentlich zurückzahlen – mit den vereinbarten Zinsen. Man hätte, so Action Aid, die Menschen sogar ausdrücklich dazu gezwungen, die finanzielle Nothilfe, die ihnen die Regierung für den Wiederaufbau ihrer Häuser gab, zur Tilgung der Kredite und Zinsen zu verwenden.[16]
Für dieses knallharte und rücksichtslose Vorgehen bat der Wirtschaftswissenschaftler, Geschäftsmann und heutige Chef der Übergangsregierung in Bangladesch Muhammad Yunus die westliche Welt um Verständnis: »Wenn wir jetzt die Schulden streichen, dann wollen die Leute jedes Mal die Schulden erlassen bekommen, wenn ein Haus gebrannt hat oder sonst etwas passiert ist.«[17] Dass es damals keinen Aufschrei gegen diese Grausamkeit gab, liegt daran, dass zu dieser Zeit Mikrokredite als Allheilmittel gegen Armut gelten. Das zugehörige Märchen klingt einfach zu gut: Anfang der Siebzigerjahre lehrt der bangladeschische Ökonom Muhammad Yunus, Sohn eines Juweliers, an der Universität von Chittagong, in der zweitgrößten Stadt des Landes. Zu jener Zeit herrscht im noch jungen Staat eine Hungersnot, und Yunus, der gerade aus den USA zurückgekehrt ist, verschreibt sich, so die Legende, der Armutsbekämpfung. Im Dorf Jobra sei ihm eine junge Frau begegnet: Sufiya Begum hat drei Kinder, sie lebt in einer schäbigen Lehmhütte und fertigt Bambusstühle an. Trotz harter Arbeit bleibt sie arm: Sie borgt sich bei einem Wucherer das Geld für den Bambus. Doch die Kreditzinsen sind so hoch, dass sie vom Verkauf der Stühle nicht leben kann. 42 Opfer der Geldverleiher, die zusammen umgerechnet 20 Euro Schulden haben, macht Yunus in diesem Dorf insgesamt ausfindig. Er leiht den Frauen den Betrag. Nach einem Jahr seien sie schuldenfrei gewesen, Sufiya Begum habe sich ein schönes Haus gebaut. 1983 gründet Yunus die Grameen Bank. 2006 erhält er als erster Banker in der Geschichte den Friedensnobelpreis. Happy End. Für das Kapital. Sufyia Begum aber stirbt 1997 in bitterster Armut.[18]
Schulden für die Ärmsten
Mikrokredite sind umgerechnet zwei- bis dreistellige Eurobeträge, die an Arme verliehen werden, die keinen Zugang zu Finanzkapital haben. Mit dem geliehenen Geld sollen sie eine Kuh kaufen, Gemüse anbauen und auf dem Markt verkaufen, einen Handwerksbetrieb oder eine Nähstube eröffnen. »Arme Menschen sind wie Bonsais. Der beste Samen eines großen Baumes wird nur wenige Zentimeter groß, wenn man ihn in einen Blumentopf pflanzt; er verkümmert, genau wie die Armen. Ihr Problem ist nicht der Samen, sondern die Gesellschaft, die ihnen keinen Raum gibt zu wachsen.«[19] Das klingt mehr nach einem biblischen Gleichnis als nach knallhartem Business. Jedenfalls dann, wenn es Muhammad Yunus sagt, der Messias der Märkte. Selten waren Wirtschaftsliberale, Kirchen, Entwicklungsministerien, NGOs, Weltbank und sogenannte ethische Banken gleichermaßen begeistert von einer Idee. So, als sei endlich eine Lösung für die globale Armut gefunden worden. Und zwar, ohne dass irgendwer Geld dafür ausgeben müsste.
Als Beleg für den Erfolg der Mikrokredite verweisen Institute auf die Rückzahlungsquote: Die liege bei über 90 Prozent, postulierte Banker Yunus. Das Narrativ, dass ausgerechnet die Armen eine so ausgezeichnete Zahlungsmoral besäßen, erscheint wie die ökonomische Variante der kolonialen und rassistischen Schwurbelei vom »edlen Wilden«. In Wahrheit werden die Ärmsten in die Schuldenfalle gedrängt und das Geld treibt man mit äußerster Brutalität von ihnen ein.
Meine Reise beginnt im Norden von Bangladesch, nahe der Grenze zu Nepal im Dorf Joymonirhat. Die Szenerie auf dem Dorfplatz erinnert an die Fotos pittoresker Armut, mit denen Banken und NGOs ihre Werbekampagnen zu Mikrokrediten und die dazugehörigen Erfolgstorys verzieren. Rund 30 Frauen haben sich hier versammelt, sie tragen bunte Saris. Erst auf den zweiten Blick sehe ich, wie abgetragen und zerschlissen manche davon sind. Dulali Begum beginnt als Erste zu erzählen: »Früher war unser Leben hart und arm. Aber es war besser. Jetzt ist jeder nur noch damit beschäftigt, die Schulden zurückzuzahlen. Sie bestimmen unser ganzes Leben«, erzählt sie. 1988 sei die Grameen Bank in das kleine Dorf im Nordosten Bangladeschs gekommen und habe den Frauen die Kredite schmackhaft gemacht. Seit mehr als 30 Jahren sind sie also bereits verschuldet. Dulali leitet eine Einheit von Kreditnehmerinnen vor Ort. Die Schuldnerinnen müssen sich, laut Vorgaben der Bank, in Kleingruppen organisieren. »Obwohl jede Kreditnehmerin selbst für ihr Darlehen verantwortlich ist, funktioniert die Gruppe wie ein kleines soziales Netzwerk, dessen Mitglieder einander aufmuntern, psychologisch unterstützen und gelegentlich in praktischen Fragen unter die Arme greifen«, schreibt Yunus in seinem Buch Die Armut besiegen.[20] Was klingt wie eine solidarische Selbsthilfegruppe, ist in Wahrheit eine Sippenhaft, die den Banken als Sicherheit dient. Die Frauen sind nicht allein dem Zahlungsdruck von Grameen ausgeliefert, sondern auch dem der Gruppe. Der sieht dann etwa so aus: »Einmal«, sagt Dulali und schaut beschämt zu Boden, »haben mich die Mitarbeiter der Bank gezwungen, einer Frau, die nicht pünktlich zahlen konnte, die einzige Kuh wegzunehmen.«
Schlägertrupps und Geldeintreiber
Während meiner knapp vierwöchigen Reise besuche ich 13 Dörfer und spreche mit Dutzenden verschuldeter Frauen. In jedem Dorf höre ich dieselben unfassbaren Geschichten: Die Geldeintreiber nehmen ihnen Hausrat, Kühe und Ziegen weg. Sie beschimpfen und beschämen die Schuldnerinnen vor der ganzen Gemeinschaft, sitzen stundenlang in deren Haus, manchmal sogar bis zum frühen Morgen, oder zerlegen ganze Hütten. Familien sind mit nichts anderem beschäftigt als damit, die Rückzahlung der Schulden und Zinsen zu erarbeiten, auch die Kinder, die deshalb nicht mehr zur Schule gehen. Weil dann oft nichts mehr für sie selbst übrig bleibt, hungern sie. Wenn die Schergen der Banken erfahren, dass jemand gestorben ist, stehen sie bereits vor der Tür. Denn dann ist oft Geld für die Bestattung im Haus, das sie den Angehörigen abknöpfen. So bleibt den verschuldeten Trauernden nichts anderes übrig, als ihre Toten in den Fluss zu werfen. Dulali Begum aus Joymonirhat verkauft schließlich ihr Land. Aber auch das reicht nicht, um schuldenfrei zu werden. Die Reisbäuerin muss als Tagelöhnerin auf anderen Feldern rackern. »Ich vermisse meine Erde«, sagt Dulali. Sie weint. »Manchmal sitzen wir zusammen und überlegen, wie wir hier jemals wieder herauskommen sollen. Aber wir finden keinen Weg. Erlösen kann uns nur der Tod.«
Schulden sind Machtinstrumente. Um »Dinge zu rechtfertigen, die ansonsten empörend und obszön erscheinen würden«, müsse man sie moralisch aufladen, schreibt der US-amerikanische Kulturanthropologe David Graeber in seinem gleichnamigen Buch Schulden.[21] Der Mythos der Mikrokredite als »gute« Schulden speist sich aus kapitalistischer Ideologie, befeuert durch die gleichnishaften Erzählungen von Yunus, der in der Öffentlichkeit stets eine traditionelle »Kurta« trägt, ein kragenloses langes Männerhemd, darüber eine einfache Weste. So erweckt er den Eindruck, er stamme aus dem einfachen Volk. Dabei gehört er zur bangladeschischen Elite. Er begann seine Professorenkarriere in den USA und ist den Reichen und Mächtigen im Globalen Norden sehr viel näher als den Armen in Bangladesch. Kein Wunder, dass sich Investmentbanker, Konzernbosse und neoliberale Politiker ebenso für seine Worte begeistern wie Kirchen und Weltrettungspromis wie Bono von U2 oder Angelina Jolie. Etwa dann, wenn Yunus die Tatsache, dass Arme keine Kredite bekommen, als »finanzielle Apartheid« bezeichnet. Er erklärt Schulden kurzerhand zum Menschenrecht – das Recht auf Zugang zu Trinkwasser, Medizin, Bildung und eigenem Land zur Selbstversorgung lässt er dabei außen vor.
Ich habe die Märchen von den Armen, die sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Mittellosigkeit ziehen, von Anfang an nicht geglaubt. Im reichen Deutschland ist ja schon das neoliberale Konzept der Ich-AG gescheitert. Dieses drängte als Teil der Hartz-Gesetze 2003 viele Menschen in die Selbstständigkeit. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kamen sieben Jahre später nur 20 Prozent der öffentlich geförderten Zwangsgründungen in Deutschland halbwegs über die Runden. Ein Fünftel der Selbstständigen war 2010 armutsgefährdet, neun Prozent waren arm.[22] Und in Deutschland gab es immerhin staatliche Zuschüsse. In Bangladesch gibt es stattdessen Schulden – mit grotesk hohen Zinsen von 20 Prozent.
Wie könnte Unternehmertum auf Kredit in einem der damals ärmsten Länder der Welt funktionieren, wo jegliche Infrastruktur fehlt? Wo die Klimakrise jederzeit für ein Extremwetterereignis sorgen kann? Wo Millionen Menschen mangelernährt sind und keinen Zugang zu Bildung haben? Und: Wie viele verschiedene Geschäftsmodelle kann es in so einem Land geben, dass sich die Menschen nicht gegenseitig Konkurrenz machen? Wie viele Kioske, Näh- und Teestuben benötigt ein Dorf? Wie viele Reisstände können auf dem Markt bestehen, ohne sich gegenseitig die Preise zu verderben? Woher sollen die Kunden kommen, wenn die Menschen so arm sind, dass sie hungern?
Als sich im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh mehr als 50 Frauen das Leben nehmen, weil sie hoffnungslos verschuldet sind, gibt es erstmals leise Kritik. Infrage gestellt wird das Konzept jedoch nicht. Eine »gute Idee« sei missbraucht worden, deshalb seien die Dinge aus dem Ruder gelaufen, lautet der Tenor – bis heute. Dabei ist die Wirksamkeit von Mikrokrediten in den vergangenen 30 Jahren gründlich untersucht worden. Bis heute gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass sie die Armut lindern. Keinen einzigen.[23]
Social Business statt Sozialstaat
Ein Jahr bevor ich nach Bangladesch reise, treffe ich Ramin Khabirpour, den damaligen Europa-Chef des Konzerns Danone. Zu der Zeit gibt es im damaligen Wirtschaftsmagazin Enorm