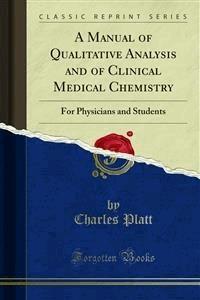8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Memoranda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Weltenschöpfer
- Sprache: Deutsch
Der erste Band der drei Bände umfassenden Reihe präsentiert achtzehn der fast sechzig Essays, die auf Charles Platts Gesprächen mit bedeutenden SF-Persönlichkeiten basieren. Die Texte entstanden zwischen 1978 und 1982 und werden nun erstmals vollständig auf Deutsch vorgelegt. In zahlreichen zusätzlichen Texten und Ergänzungen, die Charles Platt jetzt, vier Jahrzehnte später, exklusiv für diese deutsche Ausgabe verfasst hat, erzählt er weitere Anekdoten und persönliche Erinnerungen an seine Gesprächspartner. In Band 1: Gespräche mit Isaac Asimov, Thomas M. Disch, Ben Bova, Robert Sheckley, Kurt Vonnegut Jr., Hank Stine, Norman Spinrad, Frederik Pohl, Samuel R. Delany, Barry N. Malzberg, Edward Bryant, Alfred Bester, C. M. Kornbluth, Algis Budrys, Philip José Farmer, A. E. van Vogt, Philip K. Dick und Harlan Ellison.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Charles Platt
DIE
WELTEN
SCHÖPFER
Kommentierte Gespräche
mit Science-Fiction-Autorinnen
und -Autoren
Band 1
übersetzt von
Frank Böhmert, Andreas Fliedner, Horst Illmer,
Bernhard Kempen, Matita Leng, Jasper Nicolaisen,
Michael Plogmann, Erik Simon und Simon Weinert
Impressum
Die Weltenschöpfer erschienen im Original erstmals 1980 und 1983 in zwei Bänden unter dem Titel Dream Makers, Band 1 deutsch 1982 als Gestalter der Zukunft. In der vorliegenden Neuausgabe ist der ursprüngliche Text vom Autor überarbeitet worden – geändert, umformuliert, erweitert, stellenweise auch gekürzt. Wo es sachlich möglich war, wurden Passagen aus Ronald M. Hahns Übersetzung der älteren deutschen Fassung übernommen.
Weitere Informationen zu den Originalausgaben finden Sie am Ende dieses Bandes.
Charles Platt
Die Weltenschöpfer – Band 1
© 2021 by Charles Platt
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
© der deutschen Ausgabe 2021 by Memoranda Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Redaktion: Hardy Kettlitz
Lektorat und Korrektur: Christian Winkelmann & Melanie Wylutzki
Gestaltung: s.BENeš [http://benswerk.com]
Memoranda Verlag
Hardy Kettlitz
Ilsenhof 12
12053 Berlin
Kontakt: [email protected]
www.memoranda.eu
www.facebook.com/MemorandaVerlag
ISBN: 978-3-948616-60-1 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-948616-61-8 (E-Book)
Inhalt
Impressum
Inhalt
Einführung
Mein eigener Prozess
Der Kontext
Kommerzielle Folgen
Schöpferische Umstände
Private Umstände
Diese Ausgabe
Band 3
Schlüsse
Meine eigene Kurve
Isaac Asimov
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Thomas M. Disch
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Ben Bova
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Robert Sheckley
Historischer Kontext
Erwähntes Werk und seine deutsche Übersetzung
Kurt Vonnegut Jr.
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Hank Stine
Norman Spinrad
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Frederik Pohl
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Samuel R. Delany
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Barry N. Malzberg
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Edward Bryant
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Alfred Bester
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
C. M. Kornbluth
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Algis Budrys
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Philip José Farmer
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
A. E. van Vogt
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Philip K. Dick
Historischer Kontext
Erwähnte Werke und ihre deutschen Übersetzungen
Harlan Ellison
Historischer Kontext
Quellen
Erwähntes Werk und seine deutsche Übersetzung
Quellen und Originalausgaben der Porträts
Publikationsgeschichte und Copyrights
Bücher bei MEMORANDA
Allen Menschen,
die mir in den dreißig Jahren
meiner Tätigkeit in der Science Fiction,
1965 bis 1995,
so viel Freundschaft und
Großmut entgegengebracht haben.
Ich habe mehr empfangen,
als mir zustand.
Einführung
Ich wollte etwas über Science-Fiction-Autoren wissen. Ich fragte mich, wer sie waren, wo sie waren und wie sie ihre Werke veröffentlicht bekamen. Wie entschieden sie, was sie schreiben wollten, wie viel zahlten ihnen die Verlage – und wer setzte ihnen diese schrecklichen Titelbilder auf die Bücher?
Viele Leser interessieren sich nur für den Text eines Buches, ich aber wollte etwas über den Entstehungsprozess eines Buches wissen. Meine Neugier ließ mich für zwei Bücher, Dream Makers Band 1 und 2, nahezu sechzig Science-Fiction-Autoren interviewen.
Mein eigener Prozess
Meine Reise begann 1978, als eine ziemlich unbekannte Zeitschrift namens ARIEL mich bat, ein Porträt Isaac Asimovs zu schreiben. Bis dahin hatte ich größtenteils Belletristik verfasst und niemals wirklich journalistisch gearbeitet. Trotzdem sollte ich doch wohl dazu imstande sein. Was konnte daran schon schwer sein?
Zum Glück wurde meine Arroganz belohnt. Dem Redakteur gefiel, was ich geschrieben hatte.
Unterdessen hatte ein Science-Fiction-Fan namens Darrell Schweitzer begonnen, kurze Interviews mit Autoren, die er auf Veranstaltungen traf, auf Band aufzunehmen. Er verschriftlichte diese Gespräche in einfacher Form von Frage und Antwort und brachte sie in Fanzines unter. Ich las Darrells Interviews gern, fand sie aber frustrierend, weil sie nicht detailliert genug waren und er nie die Fragen stellte, die ich gern gestellt hätte.
Ob ich wohl ehrgeiziger an die Sache herangehen könnte? Ich malte mir aus, mit all den bekanntesten Autoren der Fünfziger- und Sechzigerjahre zu sprechen, die sich jetzt auf dem Gipfel ihrer Laufbahn befanden. Ich würde ihnen die Fragen stellen, die Darrell nicht gestellt hatte, und würde meine eigenen Kommentare hinzufügen, um die Atmosphäre der tatsächlichen Begegnung wieder aufleben zu lassen. Ich brauchte weiter nichts als einen Verleger, der mich dafür bezahlen würde.
Im März 1979 schrieb ich ein Angebot und schickte es an Berkley Publishing. Sie nahmen es an, was mich erfreute, und boten einen Honorarvorschuss von 6500 Dollar, was ich weniger erfreulich fand, weil es gerade ausreichte, um meine Aufwendungen an Zeit und Reisekosten zu decken. Aber immerhin war es machbar, also ging ich an die Arbeit.
Letzten Endes gaben mir nur zwei Schriftsteller, die ich ansprach, eine Absage: Robert A. Heinlein und Ursula K. Le Guin. Heinlein gab nie Interviews, und seine Frau schickte mir einen schnippischen Brief und schalt mich, dass ich überhaupt auf so ein dreistes Ansinnen kommen konnte. Le Guin gab keine Erklärung.
Ich nahm die Interviews auf Kassettenbänder auf und benutzte dabei ein Diktiergerät von Ampex und ein Hi-Fi-Tauchspulen-Mikrofon von Sony. Die Qualität war ziemlich hoch, obwohl ich in einigen Fällen eine Menge Hintergrundgeräusche aushalten musste. Erstaunlicherweise sind diese Bänder nach vierzig Jahren immer noch abspielbar.
Über dreißig Stunden Tonaufnahmen zu transkribieren war harte Arbeit, und da Textverarbeitungsprogramme noch nicht allgemein verfügbar waren, tippte ich alle Transkripte auf einer Schreibmaschine.
Als Nächstes wollte ich meine eigenen Bemerkungen mit Zitaten meiner Interviewpartner zusammenführen, und zwar so, dass in einem Strom von Assoziationen ein Thema ins andere überging. Das war nur möglich, indem ich einzelne Absätze aus meinen Niederschriften ausschnitt, sie hin und her schob, in der gewünschten Reihenfolge zusammenklebte und alles wieder abtippte.
Das fertige Manuskript lieferte ich Ende 1979 bei Berkley ab. Ich hatte es »Wer schreibt Science Fiction?« genannt, doch sie änderten den Titel in Dream Makers, was ich für eine erhebliche Verbesserung hielt. (In Großbritannien blieben Savoy Books für ihre Ausgabe bei dem ursprünglichen Titel.)
Dream Makers wurde im Oktober 1980 als Paperback veröffentlicht und erhielt gute Kritiken – eigentlich die Art Kritiken, von der Autoren träumen. »Scharfsinnige, kenntnisreiche, schön geschriebene Essays«, befand PUBLISHERS WEEKLY. »So lebhaft, dass man wünschte, sie würden nie zu Ende gehen«, schrieb die CHICAGO TRIBUNE. »Es hat nie ein besseres Buch über Science Fiction gegeben«, erklärte THE CLEVELAND PRESS, und »Reines Genie« die Zeitschrift HEAVY METAL. »Platt hat mich stundenlang gefesselt gehalten«, sagte ANALOG. (Dieser letzte Satz war etwas befremdlich, implizierte er doch eine Art absonderlicher physischer Intimität.)
Die Kritiken waren derart schmeichelhaft, dass ich mich fragte, ob sie nicht vielleicht ein Syndrom hervorrufen würden, das ich manchmal bei Verlagslektoren bemerkt hatte und »kritikerzeugte Verzückung« nenne. Lektoren neigen dazu, von Natur aus zynisch zu sein, denn ein Buch mit Erfolg zu publizieren ist ziemlich schwierig, und die Verkaufszahlen sind oft enttäuschend. Ab und zu können ein paar wirklich positive Besprechungen einen kurzen Anfall von Optimismus auslösen, also die besagte »Verzückung«. Diese kann den üblichen Zynismus zumindest für kurze Zeit überdecken, und ein Schriftsteller sollte darauf vorbereitet sein, die Gelegenheit zu ergreifen, indem er ein neues Projekt vorschlägt, ehe die Verkaufszahlen des gegenwärtigen sich dann doch als enttäuschend erweisen.
Ich rief Victoria Schochet, meine Lektorin bei Berkley, an und schlug vor, eine Fortsetzung zu schreiben. Der erste Band der Dream Makers hatte aus Platzmangel oder anderen praktischen Erwägungen ein paar wohlbekannte Namen ausgelassen. Ich hatte das Bedürfnis, auch mit Theodore Sturgeon, Harry Harrison, Jerry Pournelle, Arthur C. Clarke, Joe Haldeman, Poul Anderson, Piers Anthony und anderen zu reden. Wenn ich sie in den zweiten Band der Porträts aufnahm, würden ihre Fans das Buch sicherlich kaufen.
Um Victoria zu motivieren, schlug ich vor, sie könne ein paar Autoren nach eigener Wahl hinzufügen. Ich wollte eigentlich nicht, dass sie auf das Angebot einging, denn (wie jedem Schriftsteller) lag mir an möglichst wenig Einmischung seitens des Lektorats, doch ich wusste, dass Lektoren mitunter gern etwas Einfluss auf Bücher haben, wenn es sie nicht zu viel Zeit kostet. Natürlich hatte Victoria ein paar Namen, die sie gern hinzufügen wollte, denn sie meinte, es sollten mehr Frauen in dem Buch sein. Wie wäre es mit Joanna Russ? Kit Reed? Andre Norton? Joan Vinge?
Ach, die! Talent hatten sie, keine Frage, aber sie schrieben nicht die Sorte Science Fiction, die ich gern las. Nun ja, ich konnte mein Angebot nicht zurücknehmen, also gab ich Victorias Forderung nach einem ausgewogeneren Geschlechterverhältnis nach.
Nachdem wir nun eine Liste von einzuladenden Autoren festgelegt hatten, war es an der Zeit für die wichtigste Frage: die Bezahlung.
»Sag einfach deinem Agenten, dass er mich anrufen soll«, sagte Victoria.
Ich teilte ihr mit, dass ich zu dem Zeitpunkt keinen Literaturagenten hatte.
Das hörte sie nicht gern. Mit Agenten ist leichter zu verhandeln als mit Schriftstellern, weil Schriftsteller dazu neigen, den Wert ihrer Arbeit zu überschätzen, und weil sie möglicherweise übel reagieren, wenn ein Verleger ihre Illusionen nicht teilt. »Ich vermute, du willst so um die 15.000 Dollar«, sagte Victoria.
Ich versuchte, meine Überraschung zu verbergen. Ich hatte vorgehabt, 10.000 Dollar zu verlangen, denn das war das Höchste, was ich glaubte bekommen zu können, eingedenk der geringen Summe, die ich für den ersten Band erhalten hatte. »Also …«, begann ich.
»Ich kann 12.500 Dollar aufbringen«, sagte Victoria. »Mehr kann ich nicht bieten.«
Sie hatte mir das Verhandeln abgenommen! Sie war nämlich eine von diesen seltenen und wunderbaren Lektorinnen, die manchmal Geld für Bücher ausgaben, als würden sie sich Schuhe kaufen. »In Ordnung«, sagte ich. »Zwölf-fünf könnte ich akzeptieren.«
Kritikerzeugte Verzückung. Wenn sie nur öfter vorkäme! Ich hatte jetzt ein Budget, das mir für die neue Serie von Interviews weitere Reisen ermöglichen würde, immer vor Augen, dass Leute in häuslicher Umgebung entspannter sind und eher gesprächsbereit.
Als ich an Band 2 zu arbeiten begann, gelang es mir, ein paar zusätzliche Autoren hineinzuschmuggeln – zum Ausgleich für die von Victoria verlangten, die ich nicht allzu interessant fand. Keith Roberts zum Beispiel: ein britischer Autor, der relativ unbekannt und nie interviewt worden war. Ich meinte, sein Werk verdiente mehr Beachtung. Dann fügte ich D. M. Thomas hinzu, dessen SF-Lyrik in den Sechzigerjahren in der Zeitschrift NEW WORLDS erschienen war. Sein Buch The White Hotel (dt. Das weiße Hotel) war gerade überraschend ein Bestseller geworden, was dessen Aufnahme rechtfertigen sollte. Und dann war da William S. Burroughs, der in seinen Romanen SF-Elemente verwendete. Ich hatte herausgefunden, dass Burroughs in New York lebte, und brannte darauf, mich mit ihm zu treffen. Berkleys wunderbarer Titel Dream Makers konnte alle möglichen Abweichungen von dem rechtfertigen, was die Leute wahrscheinlich von mir erwarteten.
Ich fügte auch Porträts von ein paar Herausgebern hinzu. Warum nicht? Sie spielten eine maßgebliche Rolle in dem Prozess, der mich so sehr interessierte. Donald A. Wollheim war in seiner Zeit bei Ace Books sehr einflussreich gewesen, und Ed Ferman schien THE MAGAZINE OF FANTASY AND SCIENCE FICTION seit einer Ewigkeit herauszugeben.
Als ich mich abermals an Ursula K. Le Guin wandte, sagte sie immer noch Nein und behauptete jetzt, sie neige dazu, durch Interviews »gestört und desorientiert« zu werden. Na schön. John Varley erklärte, dass er niemals wem auch immer Interviews gebe. (Warum nicht? Das blieb ein Rätsel.) John Norman, dessen Barbaren-Sklavenmädchen-Romane für Lektorinnen ein einziges Ärgernis waren, glaubte wahrscheinlich, ich würde mich über seine Texte lustig machen, und sagte darum Nein. In Wahrheit hätte ich mich nicht lustig gemacht, denn ich habe immer versucht, mich jedem Schriftsteller offen zu nähern. Doch wenn John meinen Beweggründen nicht traute, konnte ich daran wohl nichts ändern.
Ich dachte, ich könnte den Physiker Fred Hoyle aufnehmen, weil er Science Fiction geschrieben hatte, doch seine Sekretärin sagte, er sei zu beschäftigt. Anthony Burgess, Stanley Kubrick, der Schweizer Maler H. R. Giger sowie die Musiker Brian Eno und David Bowie reagierten überhaupt nicht auf meine Briefe.
Ich habe ein Interview aufgezeichnet, welches ich nicht ins Buch aufgenommen habe. Ich sprach mit Don Van Vliet, dem auch als Captain Beefheart bekannten Musiker, war aber vom Ergebnis enttäuscht, denn das Wesen seiner Musik kam dabei nicht rüber.
Mit dem Transkript der Bänder für Dream Makers Band 2 wurde ich 1982 fertig, und inzwischen hatte ich mir einen Desktoprechner zugelegt, was die Zusammenstellung des Textes und das Umsortieren der Zitate wesentlich erleichterte. Berkley veröffentlichte das Buch im Jahr darauf, und ich weiß nicht mehr, ob es gute Kritiken bekam. Ich hatte mich mit Schriftstellerinterviews inzwischen erschöpft und mich anderen Projekten zugewandt.
Ich erwähne diese Einzelheiten, weil die Bände der Dream Makers nicht nur den Prozess sondieren, wie Bücher entstehen, sondern auch selbst Ergebnisse dieses Prozesses waren.
Der Kontext
Die Porträts, die ich geschrieben habe, werden verständlicher sein, wenn ich den Kontext ihrer Entstehung zusammenfasse. Zwischen 1979 und 1982 erlebte das Verlagswesen eine seismische Aufwölbung, und die Autoren, mit denen ich sprach, konstatierten das mit Unbehagen.
Als die meisten von ihnen zu schreiben begonnen hatten, fünfzehn, zwanzig Jahre zuvor, war SF als Schund für jugendliche Leser betrachtet worden, und von einem typischen Paperback wurden in den Vereinigten Staaten vielleicht 20.000 bis 50.000 Exemplare verkauft. Der miese und erbärmliche Zustand des Gebiets war für jene, die ihre Arbeit ernst nahmen, eine Quelle endloser Frustration, hatte aber doch zwei positive Folgen:
Seltsame und interessante Bücher konnten gedruckt werden, indem sie sich als SF ausgaben. Romane von Philip K. Dick haben das wiederholt geschafft.
Man musste gern Science Fiction schreiben, denn niemand verdiente viel Geld damit. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren waren die Autoren der SF zugetan, und das merkte man.
Gegen Ende der Sechzigerjahre begann sich der Status der SF als Reaktion auf Faktoren in der Außenwelt zu ändern. 1968 kam der Film 2001: Odyssee im Weltraum heraus, und ein Jahr später landeten Menschen auf dem Mond. Vielleicht war die SF doch nicht so bekloppt. Vielleicht verdiente sie mehr Beachtung.
Inzwischen rauchte eine neue Studentenpopulation langhaariger Hippies Marihuana und nahm LSD, und während sie ihr Bewusstsein veränderten, begannen sie, Bücher wie Der Wüstenplanet und Der Herr der Ringe zu lesen. Selbst Heinleins Ein Mann in einer fremden Welt wurde ein Bestseller, worüber sich jedermann wunderte, vermutlich auch Heinlein selbst.
Science Fiction war keine Schmuddelecke mehr. Es war auch nicht mehr in erster Linie ein Gebiet für Erzählungen, da neue Lektoren eingestellt wurden, um Dutzende und sogar Hunderte von neuen Romanen ausfindig zu machen.
Zeitschriftenherausgeber wie H. L. Gold bei GALAXY und John W. Campbell bei ASTOUNDING SCIENCE FICTION hatten für die Erzählungen, die sie veröffentlichten, einige ungeschriebene Regeln durchgesetzt. Erlaubt war eine spekulative Idee, oft definiert als Frage »Was wäre, wenn …?«, etwa »Was wäre, wenn Zeitreisen möglich wären?«. Dann musste man sich in einem rational plausiblen Szenario die Konsequenzen der Idee vorstellen. Mit anderen Worten, die Idee musste sinnvoll sein. Wenn beispielsweise das Szenario in einer Zeitreisegeschichte es dem Helden erlaubte, in der Zeit zurückzureisen und seinen Vater umzubringen, musste man erklären, warum es nicht passierte – oder wenn es doch geschah, welches die Folgen wären.
Sogar H. G. Wells hatte diese ungeschriebenen Regeln respektiert. Unter seinen Ideen nach dem Muster »Was wäre, wenn …?« finden sich solche Klassiker wie »Was wäre, wenn die Marsianer in England einfallen würden?« oder »Was wäre, wenn es einen Stoff gäbe, der die Schwerkraft abschirmt, sodass man zum Mond fliegen kann?«. Er entwarf dann Szenarien mit rationaler Plausibilität wie im Krieg der Welten, wo die britische Landschaft mit peinlich genauer Detailtreue geschildert wird, während die Marsianer Städte niederbrennen und die Menschen panisch schreiend wegrennen.
Es ist wesentlich, dass sowohl Wells als auch die ihm nachfolgenden Autoren sich nur ein »Was, wenn« pro Erzählung oder Roman erlaubten. Beispielsweise ließ Wells nicht zu, dass jemand den Marsianern entkam, indem er plötzlich ein Raumschiff erfand. Das wäre Schummelei gewesen.
Die Verlagslektoren, die in den Siebzigerjahren eine maßgebliche Rolle erlangt hatten, schienen diese ungeschriebenen Regeln nicht zu verstehen, oder sie waren ihnen egal. Eine Menge »weiche« SF wurde veröffentlicht, wo die rationale Plausibilität etwas … ins Wanken geriet. Aus dem für mich zuständigen Lektorat war zu hören: »Scheiß auf die Wissenschaft, wichtig ist, ob der Junge das Mädchen küsst.«
Dann kam Star Wars in die Kinos, und die rationale Plausibilität wurde vollends aufgegeben. George Lucas erlaubte sich auch so viele Was-wenns, wie es ihm passte, etwa: Was, wenn es vor langer Zeit in einer Galaxis diesen alten Burschen gibt, der sich wie ein Mönch kleidet und ein leuchtendes Schwert hat, und da ein böser Kerl ist, der klingt, als hätte er Asthma, und der einen Nazihelm aus Kunststoff trägt? He, warum denn nicht?
Hat jemals jemand George gefragt, warum diese Leute so aussehen? Wohl kaum. Schließlich war es Hollywood.
Die Was-wenns hörten damit nicht auf. Was, wenn ein Halbwüchsiger die Galaxis retten kann, indem er mit einer Rakete mit Tragflächen durchs Vakuum des Weltraums in eine Spalte rund um einen künstlichen Planeten fliegt, der »Todesstern« heißt, obwohl er kein Stern ist und nie erklärt wird, wozu er eigentlich dient?
Und wenn wir schon einmal dabei sind: Was, wenn es auf einer fremden Welt eine Band gibt, die Dixieland spielt? Und ein fliegendes Auto? Und einen schimmernden humanoiden Roboter mit britischem Akzent?
Und dann tun wir noch einen anderen Roboter hinzu, der (wer weiß, warum) weder reden noch gehen kann und der Quietschgeräusche macht, während er auf kleinen Rädern umherrollt, die unmöglich mit unebenem Gelände oder Treppen zurechtkommen können. Und auf dem Höhepunkt schiebt dann ein Junge mit einer Mopp-Frisur die computerisierte Bombenzieleinrichtung beiseite, damit er »dem Fluss der Macht folgen« kann, was immer das heißen soll.
So war die Science Fiction nie gewesen, aber man muss eingestehen, dass Lucas sagte, sein Film sei nicht als SF gemeint gewesen. In einem Interview für den ROLLING STONE erklärte er damals: »Ich wollte die Wissenschaft einfach vergessen … Ich wollte eine Weltraum-Fantasy machen.«
Aber leider hatte Lucas das visuelle Erbe der Science Fiction geplündert wie ein Zehnjähriger einen Süßwarenladen, und der Film sah aus wie SF und wurde deshalb als SF gesehen, und als er Erfolg hatte, definierte er die SF neu. Wer versucht hatte, das Gebiet ernst zu nehmen, fand sich jetzt in der Minderheit.
Was nun? Die albtraumhafte Partnerschaft von Lester del Rey und seiner Frau Judy-Lynn widmete sich mit vereinten Kräften dem Ruin des Gebiets. Sie sahen das riesige, unkritische Publikum, das von Star Wars erschlossen worden war, und zögerten nicht, es unter ihrem Verlagsimprint Del Rey Books auszubeuten. Lester war ein Autor alter Schule aus den Vierzigerjahren, er verstand die ungeschriebenen Regeln durchaus, gab sie aber ohne einen Schimmer von Bedauern auf. Die del Reys begannen, Bücher im STAR WARS-Universum zu publizieren – mit anderen Worten: Bücher, die nicht nur ein Abklatsch waren, sondern ein Abklatsch von einem anderen Abklatsch.
Das war ein schlaues Manöver. Als ich zum letzten Mal nachgeschaut habe, Anfang 2014, konnte ich zwischen 400 und 600 von Star Wars abgeleitete Titel finden, rund die Hälfte davon bei Del Rey Books veröffentlicht. Die genaue Anzahl ließ sich nicht feststellen, da viele Titel rasch verschwanden, aber von anderen Verlagen aufgekauft, modifiziert und neu herausgebracht wurden.
Was konnten die del Reys noch tun, um die Leser zu befriedigen, die – nun ja, nicht sehr anspruchsvoll waren? Sie waren auf einen unbekannten Autor namens Terry Brooks gestoßen, der von J. R. R. Tolkien, sagen wir: stark beeinflusst war. Sein Das Schwert von Shannara ließ ernsthafte Tolkien-Fans die Augen verdrehen, aber es verkaufte sich gut, also starteten die del Reys zu Ehren des Erfolgs gleich ein neues Imprint, das ausschließlich der Fantasy gewidmet war.
Andere Verlage fühlten sich verpflichtet, diesem Beispiel zu folgen.
1979, als ich begann, Interviews mit SF-Autoren zu machen, war das der Kontext. Alle wussten um die seismische Aufwölbung und fragten sich, wie sie sich auf ihre Zukunft auswirken würde.
Die Optimisten hofften, wenn Heinlein nun mindestens 500.000 Dollar für sein neues Buch verlangte, könnten sie vielleicht immerhin 50.000 bekommen. War das zu viel verlangt? Die Flutwelle sollte doch wohl alle Boote flottmachen?
Eben nicht. Um noch eine Wasser-Analogie zu verwenden: Es sickerte nichts nach unten durch, denn die Verlage steckten riesige Summen in eine Handvoll Bücher und überließen die anderen Titel ihrem Schicksal.
In den Porträts, die ich geschrieben habe, werden Sie sehen, dass sich die Leute zu diesen Themen äußern.
Kommerzielle Folgen
Nachdem die Leserschaft in den Siebzigerjahren drastisch expandiert war, verloren einige Leser das Interesse an SF, ohne durch neue ersetzt zu werden. Das Publikum schrumpfte ein wenig.
Zu diesem Zeitpunkt hätten die Verlage reagieren können, indem sie die Zahl der monatlich publizierten Titel verringerten, doch sie zögerten, das zu tun, denn der erste Verlag, der reduzierte, riskierte, Regalmeter in den Buchgeschäften an die Konkurrenz zu verlieren, die das nicht tat. Es gab eine Pattsituation: Niemand wollte als Erster zucken.
In der Folge schrieb ich für das MAGAZINE OF FANTASY AND SCIENCE FICTION eine Kolumne mit dem Titel »Too Many Books«. Ich interviewte mehrere Lektoren, die ich in New York kannte, und alle stimmten sie überein, dass es in einer idealen Welt weniger Titel gäbe – wenn nur ihre Konkurrenten als Erste die Zahl reduzieren würden.
Eine weitere Folge von zu vielen Titeln war, dass das einzelne Buch weniger wahrgenommen wurde. Als Antwort darauf wurden Trilogien, Fortsetzungen und Zyklen veröffentlicht. Tolkien war in dieser Hinsicht sehr ermutigend. Er hatte neun Bücher über Mittelerde geschrieben, und niemand würde ihm seine Regalmeter streitig machen. Außerdem konnte eine Serie dazu beitragen, die Verkaufszahlen zu stützen, denn wenn Leser den ersten Band kauften, kauften sie vermutlich auch den zweiten, und der zweite konnte helfen, den ersten im Druck zu halten.
Manche Autoren versuchten, sich an diesen Trend anzupassen, obwohl sie es vielleicht eigentlich nicht wollten. Beispielsweise entwarf Brian W. Aldiss seine HELLICONIA-Trilogie und erklärte mir 1979 während seines Interviews für Dream Makers: »Man muss mit dem Verlagssystem arbeiten, nicht dagegen.« Mit anderen Worten: Ein allgemein angesehener und international erfolgreicher britischer Autor machte sich Sorgen um seine schwindende Präsenz in den Vereinigten Staaten, also begann er, Romane eigens zu dem Zweck zu schreiben, der von Lektoren in New York entwickelten Marketingstrategie zu genügen.
Gleichermaßen konzipierte Thomas M. Disch Der Merkurstab als ersten Band eines Zyklus, weil er glaubte, dass die Verlage das von ihm verlangten. Philip José Farmer fand neue kreative Wege, seinen FLUSSWELT-Zyklus zu erweitern. Michael Moorcock holte Elric von Melniboné wieder hervor, Piers Anthony schrieb buchstäblich Dutzende von XANTH-Fantasys, Isaac Asimov nahm die FOUNDATION wieder auf, Harry Harrison schrieb DIESSEITS VON EDEN in drei Bänden und Robert Silverberg kehrte mehrfach nach MAJIPOOR zurück, obwohl er gelobt hatte, es nicht zu tun.
Sogar Alter und Tod konnten diese Strategie nicht stören. Als Frank Herbert starb, setzte sein Sohn den WÜSTENPLANETEN fort. Als Arthur C. Clarke zu alt oder zu desinteressiert war, viel an seinem ZEIT-ODYSSEE-Zyklus zu machen, nahm ihm Stephen Baxter bereitwillig die schwere Arbeit ab.
Manche Schriftsteller waren nicht bereit oder außerstande, so zu arbeiten, und das konnte unangenehme Folgen für sie haben. Als Fallstudie weise ich auf Algis Budrys hin.
Sein einzigartiger Roman Michaelmas wurde ein Jahr, nachdem Star Wars in die Kinos kam, im Paperback veröffentlicht. Das Buch war eine wahrlich prophetische Tour de Force und extrapolierte das weltverändernde Potenzial von dezentralisierter Rechenleistung, künstlicher Intelligenz und Vernetzung. Budrys hatte hohe Ansprüche und ein einfühlsames Verständnis für zwischenmenschliche Beziehungen. Diese Eigenschaften brachten seinem Buch eine rühmende Kritik in NEWSWEEK ein, aber das sorgte nicht für hohe Verkaufszahlen. Die rationale Plausibilität seiner Vision kümmerte die Leser kaum, die die Formel von Lucas vorzogen – die Prinzessin, die leuchtenden Schwerter, der Schurke mit dem Nazihelm aus Kunststoff und das ganze Zeug. Michaelmas wurde kein großer Erfolg, und in den Achtzigerjahren gab Budrys das Schreiben von Science Fiction auf.
Schöpferische Umstände
So viel zu den kommerziellen Faktoren, die auf die Science Fiction einwirkten, als die Bände der Dream Makers geschrieben wurden. Nun muss ich einen anderen Aspekt des Prozesses hinzufügen, der ein Buch beeinflussen kann, nachdem ein Schriftsteller mit der Arbeit daran begonnen hat. Ich rede von den schöpferischen Umständen. Als Beispiel wollen wir Eine Handvoll Venus und ehrbare Kaufleute von Frederik Pohl und C. M. Kornbluth nehmen, ein sehr beliebtes klassisches Werk, von dem Pohl einmal schätzte, dass davon im Laufe der Jahrzehnte zehn Millionen Exemplare verkauft worden sind.
Als ich ihn interviewte, erzählte er mir, dass er das erste Drittel des Romans schrieb und dann stockte, weil er vorher noch nie allein einen Roman geschrieben hatte und nicht wusste, wie er weitermachen sollte. Um sich Rat zu holen, zeigte er das Manuskript H. L. Gold, dem es gefiel und der ihm sagte, dass er den Roman in drei Fortsetzungen drucken wolle. Und dass sich Pohl ans Schreiben von Teil zwei machen solle.
Pohl wusste immer noch nicht recht, wie er das anfangen sollte, doch zum Glück hatte sein Freund Cyril Kornbluth schon bewiesen, dass er Romane sehr schnell herunterhämmern konnte. Als sich Pohl an ihn wandte, erklärte er, er werde sehr gern an Eine Handvoll Venus mitarbeiten.
Wenn man den Roman liest, sieht man genau, wo Kornbluth übernommen hat. Pohl hatte ein sorgfältiges, solides Fundament gelegt, aber Kornbluth stieg ein wie ein Schwarzarbeiter auf dem Bau mit einem Bündel krummer Nägel und verzogener Bretter. Bald schon baute er in alle möglichen Richtungen wüst und selbstvergessen drauflos. Ich mag Kornbluths Arbeiten, insbesondere die von ihm allein verfassten Erzählungen, aber seinen Teil von Eine Handvoll Venus hat er eilig zusammengeschustert, um H. L. Golds Abgabetermin für Teil zwei zu halten, der ihm, glaube ich, nur ein paar Wochen Zeit zum Schreiben ließ.
Und was war nun mit Teil drei? Kornbluth hatte alle möglichen Ereignisse und Rätsel hinzugefügt, die erklärt werden mussten. Normalerweise konnte ein Autor zurückgehen und den Anfang eines Romans überarbeiten, um die Ereignisse vorzubereiten und Widersprüche in der Handlung zu glätten, doch Pohl und Kornbluth konnten das nicht tun, weil der Anfang bei GALAXY schon im Druck war.
Gemeinsam taten sie ihr Möglichstes, um die Probleme zu lösen. Es blieb nur ein Ereignis, das nicht erklärt werden konnte, also sagten sie, es könne nicht erklärt werden, und ließen es dabei.
Die Epopöe war noch nicht vorüber, denn Gold verlangte nun zwei weitere Kapitel – warum, wird man vielleicht nie erfahren. In diesen Kapiteln unternahm der Reklamefachmann, der das ganze Buch über der Hauptheld war, mit seiner neuen Ehefrau einen plötzlichen, spontanen Ausflug zur Venus, wo er eine fremde Lebensform entdeckte.
Was? Warum? Na – warum denn nicht?
In der Ausgabe bei Ballantine Books, die später erschien, wurden diese Kapitel weggelassen.
Ich halte dafür, dass jeder, der Eine Handvoll Venus und ehrbare Kaufleute kennt, sein Leseerlebnis vertiefen kann, wenn er von diesen schöpferischen Umständen erfährt.
Private Umstände
Noch ein Aspekt des Prozesses muss erwähnt werden: das Privatleben. Die privaten Umstände des Autors oder der Autorin.
Als ich E. C. Tubb interviewte, bestritt er, dass sein Leben irgend von Bedeutung oder wichtig sei. Er sagte: »Ich habe immer Formulare von jenen Leuten zurückgeschickt, die wissen wollen, wann man geboren ist, welchen Familienstand die Großeltern hatten, alles Mögliche. Ich denke, das ist lauter Unsinn. Wen zum Teufel interessiert so was?«
Also mich schon! Ich stellte fest, dass Tubb in relativ armen Verhältnissen im Großbritannien der Nachkriegszeit aufgewachsen war und ein faszinierendes Leben hatte. Es gefiel mir auch, zu erfahren, dass er Romane in erstaunlichem Tempo liefern konnte und es bis zu seinem Tode auf ungefähr hundert brachte. Damals wandte man ein, zwei Wochen an das Verfassen eines Abenteuerromans, bekam an die 25 Pfund Sterling, und dann wandte man ein, zwei Wochen an den nächsten Abenteuerroman.
Andere Schriftsteller hatten ihre eigenen privaten Umstände, die ich für wesentlich hielt. Als ich Stephen King interviewte, fragte ich ihn, ob er das Gefühl habe, für eine bestimmte Person zu schreiben, und er antwortete: »Ich finde immer den Gedanken interessant, dass viele Schriftsteller für ihren Vater schreiben, weil der Vater nicht mehr da ist.« Kings Vater verließ die Familie, als King ein Kind war.
Ebenso erzählte mir Kurt Vonnegut von einem Psychoanalytiker, der sich darauf spezialisiert hatte, Schriftsteller als Patienten zu behandeln, und der überzeugt war, jeder schreibe hauptsächlich für eine Person – eine Folgerung, die Vonnegut akzeptierte.
In der Welt der Malerei ist das Leben Vincent van Goghs wohlbekannt. Seine Armut, das Zimmer, in dem er schlief, sein Sommer in Arles, seine Beziehungen zu anderen Malern und natürlich seine tragische Liebesgeschichte werden allesamt als bedeutsam für seine Kunst betrachtet. Menschen, die seine Kunst mögen, scheinen eine stärkere Intimität zu empfinden, wenn sie von seinen privaten Umständen erfahren. Warum sollte es in der Literatur anders sein?
Diese Ausgabe
In einigen früheren Ausgaben der Dream Makers wurde ungefähr die Hälfte der Autoren ausgelassen, damit der Text in einen Band passte. (Das war übrigens ein weiterer Fall, bei dem der Prozess das Produkt beeinflusste.)
Die vorliegende Ausgabe bringt so viele von den ursprünglichen Interviewpartnern wie möglich, auch Ben Bova, der nur in der ersten britischen Ausgabe auftauchte. Ich habe zudem ein Porträt von mir selbst aufgenommen, welches Douglas Winter freundlicherweise 1982 geschrieben hat.
Wesentliche Änderungen habe ich nicht vorgenommen. Wie ja auch niemand alte Bilder in einem Fotoalbum aktualisieren würde, habe ich nichts verändert, was mir Autoren gesagt haben, als ich sie vor vierzig oder mehr Jahren interviewte. Meinen eigenen Kommentar habe ich an einigen Stellen überarbeitet, wo ich glaube, dass sich meine Ansichten als ungenau erwiesen haben, doch das ist alles.
Andererseits könnte man, wenn man in einem Fotoalbum blättert, versucht sein, ein paar retrospektive Notizen hinzuzufügen, »Das ist Onkel Harry, als er noch mit dieser schrecklichen Frau verheiratet war, die ihn ausplünderte, als sie geschieden wurden« oder »Mein Freund Tom, kurz bevor ihn der tollwütige Hund biss und er in die Notaufnahme musste«. Ich liefere hier ähnliche Anmerkungen, indem ich zu den meisten Porträts den historischen Kontext hinzufüge. Mitunter ist dieser Kontext etwas ernüchternd, da unrealistische Hoffnungen im Laufe der späteren Jahre in niederschmetternder Enttäuschung enden konnten, und viele Leute sind inzwischen verstorben – aber derlei Tatsachen sind unvermeidlich.
Naturgemäß habe ich bei Autoren, die ich persönlich kenne, mehr historischen Kontext angefügt. Thomas M. Disch beispielsweise war rund dreißig Jahre lang, als wir beide in New York City lebten, hin und wieder mit mir befreundet. Er pflegte in meiner Wohnung aufzukreuzen, wenn er auf der Sixth Avenue einkaufen ging. Ein anderes Beispiel ist Harlan Ellison, den ich von 1969 bis 1981 als Freund betrachtet habe. Ich habe es aufgegeben, über ihn zu schreiben, nachdem wir eine gegenseitige Vereinbarung unterzeichnet hatten, einander nicht zu erörtern – aber Ellison ist gestorben und mit ihm die Vereinbarung, was mir erlaubt, etwas detaillierter über meine Beziehungen zu dieser sehr komplizierten und notorisch ausfallenden Person zu schreiben.
Ich entschuldige mich nicht für persönliche Voreingenommenheit, denn die war immer ein Teil der Dream Makers-Bücher. Ich kann nicht objektiv sein und sollte daher nicht vorgeben, ich könnte es.
In den Fällen, wo ich einen Autor nicht persönlich kannte, habe ich keinen Sinn darin gesehen, historischen Kontext zu liefern, indem ich Passagen aus der Encyclopedia of Science Fiction oder der Wikipedia kopierte. Der Leser kann sie mühelos online finden.
Bei Autoren, die nach den ersten Ausgaben der Dream Makers gestorben sind, habe ich nicht versucht, von ihren Familien Erinnerungen oder Informationen zu sammeln. Ich hätte das gern getan, konnte aber die notwendige Zeit nicht investieren, da mir dafür keine Mittel zur Verfügung standen.
Was die Reihenfolge der Porträts angeht, so ist es dieselbe wie in den Originalausgaben, wenngleich die Autoren für die deutsche Ausgabe auf drei statt zwei Bände verteilt wurden. Das war mit Blick auf den Umfang der Bände notwendig, zumal ich neuen Text hinzugefügt habe. Wo ich über die Information verfüge, gebe ich für jedes Interview das exakte Datum an, andernfalls nur den Monat.
Band 3
Gelegentlich bin ich gefragt worden, ob es vielleicht einen weiteren Band der Dream Makers geben könnte, um Autoren zu erfassen, die nach 1982 Bedeutung erlangt haben. Ich denke dabei an Namen wie William Gibson, Greg Bear, Kim Stanley Robinson, Richard Kadrey, Rudy Rucker, Bruce Sterling und viele andere.
Leider ist im heutigen Buchgeschäft ein Projekt wie Dream Makers Band 3 wirtschaftlich nicht tragfähig. Die Inflation eingerechnet würde der Vorschuss, den ich für Band 2 erhalten hatte, 2021 rund 35.000 Dollar betragen, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verlag so viel Geld einsetzt, geht gegen null. Ich glaube nicht, dass mit Ausnahme eines Kleinverlags jemand das Projekt überhaupt wollen würde, und ein Vorschuss aus solch einer Quelle läge näher bei 0 Dollar als bei 35.000.
Crowdfunding könnte eine Möglichkeit sein, aber ich habe gesehen, wie zwei Freunde diesen Weg gegangen sind. Es ist nicht einfach, und wahrscheinlich würde trotzdem nicht genug Geld zusammenkommen.
Wie immer bestimmt der Prozess, was ich schreiben kann und was Sie vielleicht werden lesen können. Ich bin von den Veränderungen auf dem Buchmarkt ebenso betroffen wie die Autoren, die ich vor vierzig Jahren interviewt habe.
Schlüsse
Im Jahr 2000 ließ ein zufälliges Ereignis mein Interesse am Gebiet der SF wieder aufflammen: Ich erhielt eine Einladung zum Readercon, einer Convention, die Leute ansprechen soll, welche Bücher ernst nehmen. Ich beschloss, hinzugehen und festzustellen, was aus den Autoren geworden war, die ich früher gekannt hatte.
Es war keine angenehme Erfahrung. Ich hatte meine Zeitgenossen als bunt zusammengewürfelte junge Radikale in Erinnerung, die Pläne schmiedeten, um zu Ruhm und Reichtum zu kommen – oder wenigstens zu Ruhm. Jetzt sahen sie aus wie Opfer eines jahrzehntelangen militärischen schikanösen Initiationsrituals. Manche von ihnen humpelten an Stöcken.
Als ich in den Verkaufsraum schlenderte, war ich überwältigt vom Aroma billigen Papiers, das mir in der Kindheit so vertraut gewesen war. Hier gab es die Schätze meiner Vergangenheit – all jene wunderbar haarsträubenden Bilder auf Zeitschriftenumschlägen, die jetzt so altmodisch wirkten wie Acht-Spur-Tonbänder bei einem Garagenverkauf in der weißen Unterschicht.
Die Leser, die in diesem Endbereich literarischer Vergeblichkeit auf der Suche waren, schienen alle älter als 55 Jahre zu sein, und manche hatten einen grauen, fahlen Teint und eine krumme, zusammengesunkene Haltung. Für ganze 2,50 Dollar las ich ein Exemplar von Thomas M. Dischs Angoulême auf – wahrscheinlich sein anspruchsvollster Roman, innovativ in der Struktur und umfassend im Themenspektrum. Leider hatte diese düstere Studie der Menschheit im 21. Jahrhundert nie viele Leser gefunden, und nun war sie größtenteils vergessen.
Ich erwähne diese betrübliche Szene, weil sie für die Porträts in diesem Buch relevant ist. Die seither vergangenen Jahre haben reichlich Gelegenheit gegeben, dass Laufbahnkurven flacher wurden – oder abwärtsgingen.
Seinerzeit, 1982, konnte sich wohl niemand von uns vorstellen, dass seine Laufbahn abstürzen würde, nachdem er weithin Anerkennung gefunden hatte. Doch es passiert: Du kannst für jedes neue Buch einen lukrativeren Vertrag abschließen, kannst Preise gewinnen und dein Werk verfilmt bekommen, du kannst eine solide Fangemeinde begeistern – und doch kann auf diesen berauschenden Gipfel ein langsames Abgleiten in die Vergessenheit folgen. Was du schreibst, beginnt altmodisch zu wirken. Kritiker verlieren ihre Begeisterung, Leser beginnen dich zu vergessen, Lektoren wollen möglichst keine Anrufe von dir bekommen, dein Literaturagent findet keine Zeit, dein neuestes Werk zu lesen, und schon binnen fünf weiteren Jahren bekommst du keine Nachauflagen mehr und stellst fest, dass du niemandem mehr irgendetwas verkaufen kannst.
Natürlich ist das das Worst-Case-Szenario, aber ich habe gesehen, wie Leute, die ich gut kannte, von dem Umschwung erfasst wurden. Erst danach wurde mir bewusst, welches Risiko ein Schriftsteller eingeht, wenn er bei seiner beruflichen Laufbahn auf sein Talent setzt. Schauspieler gehen ein ähnliches Risiko ein, aber sie können immer einem schlechten Drehbuch oder schlechter Regie die Schuld geben, wenn ein Film misslingt. Für einen Schriftsteller ist Zurückweisung durch die Leser ebenso persönlich wie durch jemanden, den man liebt, und sie kann den Ruin bedeuten, nicht nur psychologisch, sondern auch finanziell.
Ich würde lieber weniger negativ klingen, aber es wäre unehrlich, wenn ich nicht darüber schreiben würde. Wahrscheinlich war mehr als die Hälfte der Autoren, die in den Bänden von Dream Makers vorgestellt werden, nicht imstande, ihren Erfolg auf Dauer zu bewahren.
Manchen blieb dieses Schicksal natürlich erspart. Die Glücklichen richteten sich in etwas ein, das ich den Steady-State-Status nenne, den Status des stabilen Zustands. Ihre alten Werke wurden nachaufgelegt und brachten Tantiemen ein, während sie ab und zu für Vorträge engagiert und zu Conventions eingeladen wurden und eine angemessen komfortable Lebensführung beibehielten.
Mein bevorzugtes Beispiel ist Ray Bradbury. Seine Laufbahnkurve verlief so:
Zuerst hatte er großen Erfolg, indem er auf etwas kam, das ich eine große, einfache Idee nenne. Das ist oft eine notwendige Zutat für Erfolg in der SF, kann allerdings nicht genügen, wenn die Idee nicht mit etwas Talent einhergeht.
Im Fall Bradburys war seine große, einfache Idee nicht Die Mars-Chroniken. Ich glaube, sie kann zusammengefasst werden als »Feuerwehrleute verbrennen Bücher«.
Rational betrachtet ergab das keinen Sinn. Sogar in einer totalitären Zukunft werden Feuerwehrleute eine teure Ausbildung haben und hoch qualifiziert sein. Ihre Ausrüstung zu unterhalten wird Geld kosten, und daher wird man erwarten, dass sie Feuer löschen. Hingegen kann jeder ungelernte Arbeiter Bücher verbrennen, und man braucht ihm nicht mehr als den Mindestlohn zu bezahlen. Wenn Bücher verbrannt werden sollen, werden ungelernte Arbeiter das erledigen, keine Feuerwehrleute.
Trotzdem kann eine große, einfache Idee, die keinen Sinn hat, ebenso populär sein wie eine große, einfache Idee mit Sinn. Nach Fahrenheit 451 schrieb Ray Gedichte, die zu den schlechtesten der Welt gehören und von denen er mir sagte, sie gehörten zu den besten der Welt – doch wie dem auch sei, es spielte keine Rolle. Sein Name war in der SF zu einer Marke geworden, die jeder kannte. Er war ein bezaubernder Mensch mit einer ansteckenden Begeisterung für das Leben. Alle mochten ihn, und er hielt großartige Reden. Er genoss einen Steady-State-Status, der niemals verblasste.
Zu einigen anderen Beispielen für den Steady State gehörten:
Frederik Pohl, der einfach nie zu schreiben aufhörte.
Gregory Benford, desgleichen.
Larry Niven. Seine Ringwelt zeigte, dass eine große, einfache Idee besonders stark wirkt, wenn sie aus einem sehr großen Objekt besteht.
Arthur C. Clarke, der nie aufhörte, andere Autoren zu beschäftigen. (Übrigens war Rendezvous mit Rama eine große, einfache Idee mit einem sehr großen Objekt und erwies sich als profitabel.)
Isaac Asimov, wie Clarke. Asimov hatte zu Beginn seiner Laufbahn zwei große, einfache Ideen: die drei Gesetze der Robotik und die Psychohistorik. Millionen von Wörtern später blieben sie als sein Erbe.
Robert Silverberg. Als er sah, wie seine alten Titel allmählich aus den Buchläden verschwanden, während manche seiner Freunde ziemlich gut mit dem Verfassen dicker Fantasyromane fuhren, sagte Silverberg recht unverhohlen, er wolle herausfinden, wie viel er auf dem Buchmarkt der späten Siebzigerjahre wert sei. Er kam auf eine große, einfache Idee in zwei Teilen. Erstens: »Großer Planet mit normaler Schwerkraft«. Das war ein guter Anfang, denn damit war das sehr große Objekt gegeben. Aber der zweite Teil der Idee machte es perfekt: »Der Held ist ein Jongleur.« Dieses Konzept hätten die meisten Schriftsteller als albern verworfen, wenn es ihnen überhaupt eingefallen wäre, aber es war eine geniale Entscheidung und ermöglichte eine Unzahl von Kostümen auf SF-Conventions.
Zu Zeiten von H. G. Wells waren große, einfache Ideen leicht zu finden. Man denke nur an die von ihm verwendeten: »Der Mars greift die Erde an«, »Eine Maschine reist durch die Zeit«, »Ein Mann macht sich unsichtbar« und »Abschirmung der Schwerkraft«. Wir können neidvoll darüber den Kopf schütteln, was er für ein unglaubliches Glück hatte, dass diese Ideen einfach so herumlagen und warteten, von ihm aufgelesen zu werden. Heutzutage sind große, einfache Ideen schwerer zu finden.
Für Schriftsteller, die es nicht schaffen, den Steady-State-Status zu erlangen, ist nicht alles verloren, denn es gibt einige Ausstiegsstrategien. Am offensichtlichsten ist der Schritt seitwärts, von der SF in ein tangential anliegendes Gebiet.
Algis Budrys’ Schritt seitwärts führte in Reklame, Öffentlichkeitsarbeit und das Verfassen von Verkaufsprospekten für einen Lkw-Hersteller. Dann wurde er der wichtigste Kurator für Writers of the Future, eine von L. Ron Hubbard finanzierte Organisation, die Seminare für junge Leute unterstützte, die Schriftsteller werden wollten.
Bruce Sterling wich in die Sachliteratur aus (ein Buch über Computerhacker) und dann in öffentliche Vorträge – er erwies sich als außerordentlich begabter Redner. Er hatte SF-Romane mit großen Ideen geschrieben, doch es waren große, komplizierte Ideen, die nicht so populär sind wie große, einfache Ideen.
A. E. van Vogt schritt seitwärts in Unternehmensprojekte von der Dianetik bis zu einem Sprachlernsystem. Als ich ihn interviewte, sagte er, ihm sei bewusst, dass er als SF-Autor überholt war, und er habe sich darauf eingestellt.
Samuel R. Delany wurde Professor, was eine übliche Zuflucht für Schriftsteller war. Joe Haldeman hielt sich fast sein ganzes Berufsleben lang die Lehre als Rückfallposition offen.
Janet Morris machte Regierungsberatung zu ihrem Geschäft und entwickelte Konzepte für nicht tödliche Waffen. E. C. Tubb arbeitete eine Zeit lang im Verkehrsordnungsamt.
Meine eigene Kurve
Anständigerweise sollte ich mich selbst hier einfügen. Während der seismischen Aufwölbung, die das Verlagswesen in den Achtzigerjahren erlebte, hatte ich Glück. Lektoren waren freundlich zu mir, und ich überlebte als Romanautor, obwohl ich mich weigerte, mich zu wiederholen. Ich verdiente nicht viel Geld, aber ich wurde publiziert.
Nach den Dream Makers-Bänden schrieb ich sechs Science-Fiction-Romane. Am zufriedensten war ich mit Less Than Human, Free Zone, The Silicon Man und Protektor.
The Silicon Man erhielt nette Kritiken und wurde für den Campbell Award nominiert, aber wenige Wochen nach der Veröffentlichung bei Bantam Spectra Special Editions nicht mehr gedruckt. Der Roman erlitt das typische Schicksal vieler einzelner Romane: Er wurde von anderen Büchern verdrängt, die die Regalmeter brauchten.
Als Protektor erschien, hatte ich erkannt, dass die Science Fiction nicht der passende Ort für mich war, also unternahm ich meinen Schritt seitwärts. Ich begann, für die Zeitschrift WIRED zu schreiben. Sie räumte mir zum ersten Mal in meinem Leben eine fast totale Freiheit ein, zu schreiben, was ich wirklich wollte, und zahlte gut. Ich wurde Stammautor bei WIRED und habe in den späten Achtzigerjahren wahrscheinlich mehr Artikel beigesteuert als jeder andere.
Als die Dotcom-Blase platzte, bekam die Zeitschrift einen Herausgeber, der mir nicht zusagte. Für WIRED zu arbeiten machte keinen Spaß mehr, also schritt ich wieder seitwärts – ins Gebiet der Kryonik, das der SF nächstliegende in der realen Welt, das ich erreichen konnte. Ich leitete ein Notfallteam und entwarf und baute Laborausrüstung.
Danach begann ich mit einem weiteren Schritt seitwärts Sachbücher zu schreiben, um jungen Leuten und Hobbybastlern mitzuteilen, wie man elektronische Schaltkreise baut. Außerdem verfasste ich The Encyclopedia of Electronic Components, und diese Bücher bringen mir zehn Jahre später immer noch ein paar Tantiemen ein, anders als alles, was ich sonst jemals geschrieben habe.
Mit dem Lesen von Science Fiction hörte ich um 1995 auf, weil sie für mich keine Bedeutung mehr zu haben schien. Die Literatur hatte sich verändert, mein Geschmack hatte sich verändert und die Welt hatte sich verändert. Ich empfinde aber immer noch eine tiefe Zuneigung und Respekt für die Erzählungen, die ich als Teenager in den Zeitschriften gelesen habe, denn sie haben mir lebenslanges Vertrauen in die Kraft der Technik, unser Leben zu bereichern, vermittelt.
Ich habe uneingeschränkte Bewunderung für jene, die so kühn waren, ihre Egos als Weltenschöpfer aufs Spiel zu setzen. Eine ehrenwertere Beschäftigung kann ich mir nicht vorstellen.
Charles Platt, Northern Arizona, 2021
(Deutsch von Erik Simon)
Isaac Asimov
Isaac Asimov ist der mit Abstand produktivste Science-Fiction-Autor. Nach mehreren Science-Fiction-Romanen (Foundation, The Caves of Steel) verlegte er sich erst auf populärwissenschaftliche Artikel (mehr als 300 allein für das MAGAZINE OF FANTASY AND SCIENCE FICTION) und dann auf einen endlosen Strom von Sachbüchern, in denen er der breiten Masse die Geheimnisse von Mikro- und Makrokosmos nahebrachte. Er hat umfangreiche Nachschlagewerke veröffentlicht, kurze Texte für Fernsehzeitschriften, Donquichotterien wie drei Bände mit »lüsternen Limericks« und The Sensuous Dirty Old Man, außerdem eine kommentierte Neuausgabe des Don Juan und eine 640.000 Wörter umfassende Autobiografie (dieses Werk allein ist so lang wie ein Dutzend Science-Fiction-Romane zusammen, länger als die Memoiren von Richard Nixon).
Seine Produktivität ist so immens, dass einige Rezensenten überzeugt waren, bei seinem Namen könne es sich nur um ein Pseudonym handeln, hinter dem ein Konsortium von Autoren seine Kollektivkräfte bündelte. In Wahrheit gibt es da niemand anderen, er arbeitet ohne jede Hilfe, tippt von der ersten bis zur letzten Manuskriptfassung alles selbst, beantwortet eigenhändig seine Post und geht persönlich ans Telefon. Dabei stützt er sich lediglich auf seine äußerst bescheidene Handbibliothek, einen billigen Taschenrechner und sein phänomenales Gedächtnis.
Er lebt in einem teuren, doch gesichtslosen Hochhaus in New York City – es ist einer dieser Türme in Modulbauweise mit einem kleinen Springbrunnen vorm Eingang und einem Kronleuchter aus Plastik im Foyer. Von dem weitläufigen Penthouse-Apartment im 32. Stockwerk, das er sich mit seiner Frau Janet teilt, schaut man auf den Central Park hinunter.
Für mehr als einen Blick in das behaglich und modern eingerichtete Wohnzimmer bleibt keine Zeit. Mit einer vagen, linkischen Handbewegung komplimentiert mich Asimov (der kein eleganter Mann ist) rasch einen Flur entlang zu einer Tür, neben der wie in einer Arztpraxis ein Schild mit seinem Namen hängt. »In diesen beiden Räumen arbeite ich«, erklärt er. »Selbst meine Frau muss vor dem Hereinkommen anklopfen. Ich sage jedes Mal ›Komm rein‹, aber anklopfen muss sie trotzdem.«
Asimovs persönlicher Bereich wurde mit weniger Schwung eingerichtet. Sein Schreibzimmer ist fast schon primitiv. In der Raummitte steht, zur kahlen weißen Wand ausgerichtet, ein billiger grauer Schreibtisch aus Metall. Die Schubladen einiger Metallschränke sind sorgfältig beschriftet. Alles ist sehr ordentlich, sehr kahl. Die Rollos vor den Fenstern lassen die vermutlich spektakuläre Aussicht auf die Skyline von Manhattan verschwimmen. »Ich arbeite lieber bei künstlichem Licht«, erklärt er.
In Wahrheit erträgt dieser Führer zu fernen Galaxien keine Höhen, steigt dieser Seher der Sterne und des Raumflugs in kein Flugzeug und bleibt dem Planeten Erde grundsätzlich so nahe wie möglich. Das stellt keinen Verzicht dar, denn Reisen interessieren ihn ohnehin nicht. »In meiner Phantasie war ich schon überall im Universum, da sind solche popeligen kleinen Ausflüge für mich nicht so wichtig. Ich habe mal England besucht, per Schiff, 1974. Stonehenge war schon nett.« Er zuckt mit den Schultern. »Es sah genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe.«
Wir setzen uns in seine »Bibliothek« (die weniger Bücher enthält als bei den meisten Autoren, die ich kenne, das Wohnzimmer). Er fläzt sich in seinem schlabbrigen Unterhemd hin, als wollte er es darauf anlegen, weder imposant noch charismatisch zu erscheinen. Dennoch besitzt er ein bewusstes Auftreten, eine sichtliche Freude daran, Isaac Asimov zu sein. Er ist direkt (»Ich kann Interviews nicht ausstehen«, sagt er, als ich mein Tonbandgerät auspacke), aber auf die entschuldbare Art eines knurrigen Exzentrikers von Ende fünfzig. Er vermittelt mir das Gefühl, ihn in seinem präzise durchgetakteten Arbeitstag zu stören; gleichzeitig möchte er eindeutig nicht unnahbar erscheinen. Bevor er aus seiner Person eine Firma gemacht hat, wurde sein Name jahrelang im öffentlichen Telefonbuch gelistet. Soweit es die Arbeit zulässt, kann er sogar gesellig sein:
»Ich arbeite jeden Tag vom Aufstehen bis zum Schlafengehen – mit allen möglichen Unterbrechungen. Als da wären die biologischen Funktionen: Essen, Ausscheidungen, Sex.« Er zählt die Punkte an den Fingern ab. »Die sozialen Unterbrechungen: Man muss ja auch mal rausgehen und seine Freunde treffen.« Ich merke an, dass das bei ihm so klingt, als wäre es amüsanter, zu Hause zu bleiben und zu tippen. »Wenn das so klingt, dann will ich ja vielleicht genau das damit ausdrücken. Dann gibt es noch geschäftliche Unterbrechungen, Arbeitsessen etwa.« Er sieht mich an. »Du bist so eine Unterbrechung.«
Seine soziale Ambivalenz und sein selbst auferlegtes Arbeitsethos reichen weit in die Vergangenheit zurück. »Ich hatte in vielerlei Hinsicht eine unterprivilegierte Kindheit … Ich musste im Süßwarenladen meines Vaters arbeiten, ich habe kaum mit den anderen Kindern gespielt und wurde von ihnen nicht akzeptiert. Aber eigentlich wollte ich ohnehin vor allem lesen. Deshalb hat es mich nur wenig gestört.«
Um mit dieser Entfremdung zurechtzukommen, die er nie vollständig erfasst oder anerkannt hat, begann Asimov als Jugendlicher, akribisch Tagebuch zu führen. Zunächst diente es nur dazu, beim Baseball auf dem Laufenden zu bleiben – »eine ganze Reihe von Listen mit Querverweisen« –, doch nachdem er mit achtzehn Jahren seine erste Science-Fiction-Story verkauft hatte, wurde das Tagebuch – »angefüllt mit mikroskopisch kleiner Schrift« – stattdessen zum Protokoll seiner Karriere und bildete mit derselben zwanghaften Aufmerksamkeit für Details eine private Realität ab, in der alles sauber organisiert und spezifiziert war.
Sein erster Verkauf ging an John W. Campbell Jr., den Herausgeber von ASTOUNDING SCIENCE FICTION. »Ich verfiel seinem Zauber. Er erfüllte mich mit Enthusiasmus. Er machte Science Fiction zur aufregendsten Sache der Welt. Am 21. Juni feiere ich das vierzigste Jubiläum meines ersten Verkaufs.« Und jetzt, mitten in unserem Gespräch, geht ihm plötzlich ein Licht auf: »Ach du liebe Zeit!« Seine Stimme wird lauter. Er versetzt sich eine Ohrfeige. »Ist heute der 21. Juni? Herrje! Heute jährt sich zum vierzigsten Mal der Tag, an dem ich zum ersten Mal die Redaktion eines Science-Fiction-Magazins – ASTOUNDING – aufgesucht und John Campbell kennengelernt habe! Herrjemine.« Er setzt sich wieder, völlig entgeistert. »Oh, das ist entsetzlich – ich habe vielleicht nur noch –, mir bleiben nur noch vier Stunden, um in dieser Erinnerung zu schwelgen!« (Während unseres gesamten Gesprächs hat er nur in diesem Moment Gefühl gezeigt beziehungsweise seine Contenance verloren.) Er schüttelt den Kopf und reißt sich mit einiger Mühe zusammen. »Tja, also jedenfalls bin ich am 21. Juni 1938 zum ersten Mal in John Campbells Büro spaziert, und heute haben wir den 21. Juni 1978. Donnerwetter.«
Während er hauptsächlich für Campbell schrieb, machte er sich in der Science-Fiction-Leserschaft rasch einen Namen. Viele frühe Geschichten drehten sich um Roboter; paradoxerweise hat er, wie er bereitwillig zugibt, von Technik keine Ahnung, kann nicht einmal seine Schreibmaschine reparieren, wenn sie nicht funktioniert, und seine Laborarbeit ließ auch zu wünschen übrig. »Ich bin der Elfenbeinturmbewohner schlechthin. Ich kann Dinge erklären, aber ich kann sie nicht machen.«
Seine Fähigkeit, Dinge zu erklären, hat ihn schließlich außerhalb der Science Fiction bekannt gemacht; das war jedoch ein langer Weg. »Erst mit Anfang vierzig stellte sich heraus, dass ich, in Gänsefüßchen, Erfolg haben würde.« Laut eigener Aussage ist es ihm nie um den Erfolg gegangen. »Wenn ich überhaupt ehrgeizig war, dann weniger als meine Freunde. Eigentlich habe ich mir keine hohen Ziele gesteckt. Ich war absolut damit zufrieden, Science Fiction zu schreiben, obwohl ich wusste, dass das schlecht bezahlt war und mich nur wenige Leute lesen würden.«
In seiner Storysammlung The Bicentennial Man erklärte er: »Mein größtes Interesse gilt dem Schreiben. Das Verkaufen interessiert mich auch noch ein bisschen, aber was dann daraus wird, ist mir im Grunde völlig egal.« Während wir jetzt in seiner Bibliothek sitzen, zitiere ich ihn mit einiger Skepsis, doch er bleibt beharrlich. »Mich interessiert zum Beispiel nicht, ob eines meiner Bücher verfilmt werden soll«, sagt er. »Mich interessiert nicht, ob sie Werbung für meine Bücher machen. Es ist mir ehrlich egal. Wenn meine Verlage mir aus eigener Initiative ein größeres Publikum verschaffen wollen, werde ich sie nicht davon abhalten. Aber es interessiert mich nicht genug, als dass ich sie dazu würde bewegen wollen. Ich bin viel mehr daran interessiert, das nächste Buch zu schreiben. Vor immerhin zwanzig Jahren sagte meine erste Frau zu mir: ›Du verdienst auch genug, wenn du nur das halbe Jahr tippst, dann könnten wir in der anderen Hälfte Urlaub machen‹. Und ich antwortete, ›Meinetwegen, aber hast du etwas dagegen, wenn ich während des Urlaubs weitertippe, nur um irgendetwas zu tun zu haben?‹. Als ich wegen meines Herzinfarkts für sechzehn Tage im Krankenhaus lag, brachte mir meine Frau das Manuskript meiner Autobiografie, damit ich es per Hand korrigieren konnte, während ich dort festsaß. Sobald ich damit durch war, mussten sie mich entlassen, weil allen klar war, dass es meiner Genesung nicht förderlich sein würde, dort untätig herumzusitzen.«
Ich frage ihn, was für ein Gefühl es ist, von der Arbeit abgehalten zu werden. »Teilweise fühle ich mich dann wohl schlecht, weil ich doch schreiben sollte. Die Tasten klappern in meinem Kopf weiter und Ideen stauen sich auf, und solange ich es nicht irgendwie zu Papier bringe, erzeugt das einen unangenehmen Druck im Kopf.« Keine sonderlich präzise Beschreibung von einem Fachmann der Biowissenschaften, und dessen ist er sich offenbar auch bewusst. »Schwer zu sagen«, entschuldigt er sich. »Ich analysiere meine Gefühle normalerweise nicht.«
Bei weniger persönlichen Angelegenheiten drückt er sich deutlich klarer aus. »Nach meinem Eindruck beträgt die Chance, dass wir bis ins 21. Jahrhundert hinein als funktionierende Zivilisation überleben, weniger als fünfzig, aber mehr als null Prozent. Es gibt verschiedene Probleme, von denen jedes einzelne genügt, uns umzubringen. Nummer eins ist die Überbevölkerung. Wenn wir uns in großer Zahl vermehren, kann alles andere gut ausgehen und wir sind trotzdem geliefert. Unglücklicherweise lässt sich das den Menschen nur schwer vermitteln, aber ich stelle mir vor, dass es in absehbarer Zeit gesetzlich erschwert wird, ein drittes Kind zu bekommen, durch abschreckend hohe Steuern oder eine Zwangssterilisierung nach dem zweiten Kind. Dazu wird es nur durch zwei Dinge nicht kommen. Erstens: Wenn gewaltfreie Mittel zur Senkung der Geburtenrate greifen; mit anderen Worten, wenn die Menschen freiwillig darauf verzichten, zu viele Kinder zu bekommen. Zweitens: Wenn die Überbevölkerung uns einholt und die Welt in Chaos und Anarchie versinkt, bevor wir überhaupt noch zu drastischen Mitteln greifen können.«
Ist er grundsätzlich pessimistisch eingestellt? »Was Problemlösungen betrifft, die nicht in erster Linie von Menschen abhängen, bin ich eher optimistisch. Zum Beispiel halte ich es, solange man das Ganze von der technischen Seite betrachtet, nicht für besonders schwer, Solarkraftwerke im All zu errichten, die uns mit sämtlicher Energie versorgen, die wir brauchen. Aber wenn Sie fragen ›Meinen Sie, wir können den Kongress überzeugen, die Geldmittel zur Verfügung zu stellen?‹ und ›Glauben Sie, wir können die Weltbevölkerung dazu bringen, ihr Konkurrenzdenken beiseitezuschieben und an einer Aufgabe zu arbeiten, die für ein einzelnes Land zu groß ist?‹, dann erkennen Sie, dass dieses Problem vielleicht unmöglich zu lösen ist.«