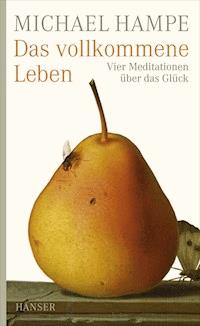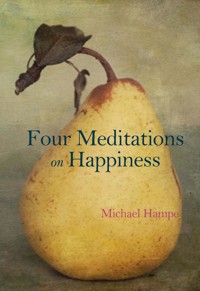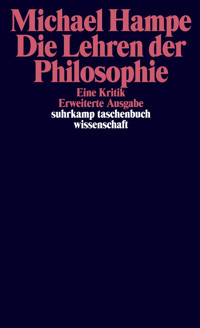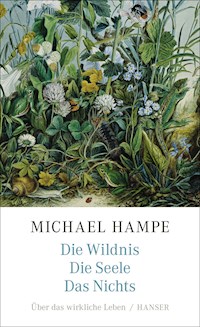
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein faszinierendes philosophisch-literarisches Gedankenspiel, das anregt, die Maximen des eigenen Lebens zu überprüfen. Wie finden wir das wirkliche Leben? Im Rückzug in unberührte Natur? Nach dem Tod in der Unsterblichkeit? Durch das Leben unserer Kinder? Diese Fragen treiben auch den fiktiven Lyriker und Philosophen Moritz Brandt um. Sein Freund Aaron sortiert dessen Nachlass, stößt dabei auf Tagebücher und Essays, in denen Brandt über das wirkliche Leben nachdenkt. Je mehr er sich aber in diese Texte vertieft, desto häufiger fragt sich Aaron: Woher kommt der Wunsch, sich zu verwandeln, wirklich zu werden? Meisterhaft verknüpft Michael Hampe Erzählung und Reflexion, damit wir erkennen, wie uns die Unterscheidung zwischen Schein und Wirklichkeit daran hindert, mit unserem Leben klarzukommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie finden wir das wirkliche Leben? Im Rückzug in unberührte Natur? Nach dem Tod in der Unsterblichkeit? Durch das Leben unserer Kinder?
Michael Hampe verfolgt diese Fragen, um uns von ihnen als existentiellen Irrlichtern zu befreien.
Zu diesem Zweck erfindet er den Lyriker und Philosophen Moritz Brandt. Sein Freund Aaron sortiert dessen Nachlass, stößt dabei auf Tagebücher und Essays, in denen Brandt über das wirkliche Leben nachdenkt. Je mehr er sich in diese Texte vertieft, desto häufiger fragt sich Aaron: Woher kommt dieser Wunsch, sich zu verwandeln, wirklich zu werden? Meisterhaft verknüpft Hampe Erzählung und Reflexion, damit wir erkennen, wie uns die Unterscheidung zwischen Schein und Wirklichkeit daran hindert, mit unserem Leben klar zu kommen.
Michael Hampe
DIE WILDNIS, DIE SEELE, DAS NICHTS
Über das wirkliche Leben
Carl Hanser Verlag
Für die Nachgeborenen,
die auftauchen werden aus der Flut
oder sie verhindern
»Moses: In der Wüste seid ihr unüberwindlich und werdet das Ziel erreichen …«
»Aaron: In Moses’ Hand ein starrer Stab: das Gesetz; in meiner Hand die bewegliche Schlange: die Klugheit.«
(Arnold Schönberg, Moses und Aaron,
3. Akt, 1. Szene, und 1. Akt, 4. Szene)
»Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: … wir werden alle verwandelt werden …«
(Der erste Brief des Paulus an die Korinther 15,51)
»›Gewinnen‹ und ›verlieren‹, ›richtig‹ und ›falsch‹ – lass sie ein für alle Mal ziehen.«
(Shinjinmei 9, Shinjinmei und Shôdôka, S. 59)
»Alles ist Archiv, alles ist im Begriff, Archiv zu werden und in Rauch aufzugehen …«
(Thomas Kling,Das brennende Archiv, S. 7)
»Schnee fiel überall auf die dunkle Zentralebene, auf die baumlosen Hügel, fiel sacht … Er lag in dichten Wehen auf den krummen Kreuzen und Grabsteinen, auf den Speeren des kleinen Tors, auf den welken Dornen. Langsam schwand seine Seele, während er den Schnee still durchs All fallen hörte, und still fiel er, der Herabkunft ihrer letzten Stunde gleich, auf alle Lebenden und Toten.«
(James Joyce,Die Toten, S. 229)
»Das einzige Eindeutige im Verhältnis von Menschen und Wildnis scheint der Tod zu sein.« »Das Einzige, was wir über den Tod wissen, ist: Noch niemand ist zurückgekommen, um von der Verwandlung, die er vielleicht durchlief, berichten zu können.«
»Deshalb ist die Philosophie nicht weise.«
(Aus Moritz Brandts Essays)
Inhalt
Erster Tag: NATURZUSTAND
Die Wildnis 43
Zweiter Tag: VERWANDLUNG
Die Seele
Dritter Tag: BODENLOS
Das Nichts
Vierter Tag: DER GOLDENE FISCH
Nachwort
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Textnachweis Gedichte
Textnachweis Motti
Bildnachweis
EINE SIMULATION
Erster Tag
NATURZUSTAND
Die dunkle Stille wird immer von einem Knarren beendet. Die flach aneinanderliegenden, ganz leicht an ihren Kanten wie Schuppen auf den Flügeln eines archaischen Tieres sich überlappenden Lamellen trennen sich wieder voneinander, stellen sich im rechten Winkel zum Glas auf und geben in Streifen die schmutzigen Scheiben frei. So wird es zuerst dämmrig, dann heller im Raum. Das insektenartige Summen des Elektromotors mischt sich in das scharfe metallene Quietschen und Kratzen der nach oben wandernden Stahlringe, die die Aluminiumlamellen in ihren seitlichen Führungsseilen aus Draht halten. Die langen Schuppen vereinigen sich unter dem Zug des mittleren Drahtseils nach und nach wieder, indem sie sich flach und deckungsgleich aufeinanderlegen, doch diesmal nicht zu großen, die Fensterflächen verdunkelnden Flügeln, sondern zu einem immer dicker werdenden Kasten. Ein hartes »Klack«, und der kompakte Körper stößt an das Ende seiner Bahn, gefolgt von einem leisen Summen, mit dem das Geräusch nach ungefähr einer Minute endet. Der Lamellenkörper ist in seinem Gehäuse verschwunden, das ihn wie ein Maul, von zwei langen Metalllippen eingerahmt, verschlungen und sich dann langsam geschlossen hat. Danach ist es ganz hell im Raum und wieder still.
So wie immer hatten sich die blechernen Jalousien um 8:15 Uhr auch an diesem 21. Dezember in der Böcklinstraße 17 automatisch geöffnet. Die Sonne war gerade erst über der bereits seit Herbstbeginn verschneiten Landschaft aufgegangen, auf die sachte und knisternd blau schimmernde Kristalle rieselten. Der Schnee senkte sich, von keinem Windhauch gestört, auf ältere, schon verharschte Schichten, die vor dem alten Gebäude eine saubere, friedlich gewellte und geschlossene Fläche erzeugten, unter der die Trümmer von schon vor Jahren zerfallenen Gebäuden lagen. Abgestürzte und ausgebrannte Drohnen ruhten wie tote Rieseninsekten hier und da zwischen umgestürzten Bäumen begraben. Sie schienen unter dem Schnee zu schlafen und auf ihre Erweckung zu warten. Magere Hunde streunten gelegentlich durch das Gelände, das früher einmal ein Stadtviertel für die Wohlsituierten gewesen war und sich jetzt fast leer bis zum Horizont erstreckte. Auf der Suche nach Nahrung schnüffelten die Tiere an einigen Erhebungen im Schnee, um zu erforschen, ob sich unter der weißen Decke wohl ein Kadaver verberge. Ein Fahrzeug, das ein Geschütz auf seiner Ladefläche transportierte, doch weder Fahrer noch Schützen mit sich führte, rollte gemächlich in der Ferne einen Fahrweg entlang.
Ein weiches, milchiges Licht fiel in die langen, schmalen Fenster, die sich vom Boden in die Höhe zogen und mit einem Knick in Oberlichter übergingen, wie lange Zähne, die die dunklen Wände des Ateliers durchbrachen. Das Licht bahnte sich seinen Weg durch zwischen braunen Balken zitternde Spinnweben, mit ausgesaugten Motten und Mücken beladen, durch die Zwischenräume der Blätter von Zimmerpalmen, die aus schwarzen Kübeln aufragten, durch spiralig verwirbelte Staubwolken, die sich seit Tagen träge im Raum drehten und nur langsam nach unten sanken. Fünf Meter hinab schossen die Strahlen durch die von innen beschlagenen, von außen braunschwarz verschmutzten Oberlichter in das riesige schwarzgrün gestrichene Atelier, bis hinunter auf das Lager von Aaron, der, in ein zerschlissenes gelbliches Seidenlaken gehüllt auf seinem Futon liegend, dieses Licht hinter seiner Schlafmaske nicht sehen konnte. Doch wie immer war er von den Lauten der sich öffnenden Verdunkelungen aufgewacht. Als er vor vielen Jahren in diesen Raum eingezogen war, hatten sich noch monatelang jeden Morgen Träume zu diesem Geräusch in seinem Kopf gebildet: Er sah in großer Spannung zitternde Stahltrossen, die riesige, mit schwarzem Erz beladene Loren eine verrostete Schienentrasse einen Berg hinaufziehen, oder sich in brackigem Wasser langsam wie in einer Atembewegung hebende und senkende Containerschiffe, die ihre dunkelgrün gestrichenen eisernen Leiber an einer Kaimauer aus Beton rieben, so wie Zooelefanten sich an den Mauern ihrer Gehege schubbern.
Als Aaron erwachte, konnte er sich nicht erinnern, dass ihm heute irgendetwas geträumt hätte. Seit er wieder an Brandt arbeitete, träumte er kaum noch. So war es immer, wenn er an einem Text saß oder einen Gedankengang, der ihm wichtig war, vorbereitete. Er stöhnte, rollte sich von der Seite auf den Rücken, zog sich die Schlafmaske vom fleischigen Gesicht und breitete die Arme aus. Einige Momente lag er so regungslos auf seinem Futon und starrte auf ein Spinnengewebe in der Deckenecke, das ihm wie eine Maske mit zwei übergroßen Augenöffnungen, wie ein Totenschädel erschien. Dann setzte er sich mühsam auf, kratzte sich seinen mächtigen grauhaarigen Bauch, der aus seinem schwarzen, ebenfalls seidenen und zerschlissenen Pyjama ragte, rieb sich die verklebten Augen und rief:
»Kagami!«
Doch es blieb still im Atelier. Keine Antwort. Mühsam erhob er sich von seinem nur durch Tatami-Matten vom schartigen Dielenboden getrennten Lager und schlurfte ächzend zur Kochzeile. Auf dem Weg dahin griff er von einem Kleiderständer nach seinem alten Morgenmantel, der auf schwarzem Grund grün-gelb-blau gefiederte Aras zeigte. Noch einmal rief er:
»Kagami!«
Nichts.
Vollautomatische Kaffeemaschinen mochte Aaron nicht. Er bereitete sich seinen Morgenkaffee mit einer großen Espressomaschine zu; schraubte sie auf, fingerte das Brühsieb aus dem Unterteil und klopfte den Kaffeesatz vom Vortag in den Müllkübel unter der Spüle. Dann füllte er den Brühkopf bis zum Ventil mit Wasser, setzte das Sieb wieder ein, schaufelte aus einer alten Blechdose, von der die blaue Farbe zum größten Teil abgeblättert war und die einmal Kakao enthalten hatte, frisches Kaffeemehl hinein und schraubte die Kanne wieder fest auf das Unterteil. Er schob den Regler auf dem Touchscreen seiner Herdplatte bis an den Anschlag. Sofort verfärbte sich eine Scheibe dunkelrot, dort platzierte er seine Kaffeemaschine. Aaron ließ sich in einen fleckigen Ledersessel gegenüber der Küchenzeile fallen, dessen Stahlrohrgestell erblindet war, und blickte vor sich ins Leere. Nach ein paar Minuten zischte und gluckste die Maschine. Er erhob sich, ging zurück zum Herd und schaute zu, wie der Kaffee stoßweise aus dem Ventilkopf austrat und an seinem Schaft in die Kanne hinabrann. Er nahm einen der bunten Kaffeekrüge aus Steingut, die neben dem Herd standen, spülte ihn unter laufendem Wasser aus und füllte ihn wieder mit dem frisch gebrühten Kaffee. Dann öffnete er eine große Schublade unter der Herdplatte und entnahm ihr eine runde rote Blechdose, die er sich unter die Achsel klemmte. Aus dem riesigen grauen Kühlschrank, der sich wie ein Monolith neben der Küchenzeile erhob, holte er mit der Linken eine Milchflasche, mit der Rechten ergriff er den Kaffeebecher und ging zu seinem Sessel. Nachdem er sich seufzend wieder niedergelassen hatte, füllte er Milch zu seinem Kaffee, öffnete die auf dem Boden neben dem Sessel abgestellte Blechdose und angelte sich einen großen Keks heraus. Bevor er in den Keks hineinbiss, rief er noch einmal:
»Kagami!«
Immer noch keine Antwort.
Aaron biss in den hellbraunen Keks, nahm einen Schluck Kaffee und lehnte sich zurück. Er stellte den Kaffeebecher auf seinem Bauch ab, ihn mit einer Hand balancierend, die andere ließ er mit dem angebissenen Keks auf der auf dem Stahlrohr seines Sessels montierten Holzlehne ruhen. Er kaute mit geschlossenen Augen und grunzte leise genießend. Dann biss er wieder vom Gebäck ab, nahm schlürfend noch einen Schluck heißen Kaffee und streckte seine kurzen Beine von sich. Langsam legte sich wieder Schnee auf die Oberlichter, die von den Jalousien am Vorabend beim Schließen wie von einem gemächlichen Schneepflug freigeräumt worden waren. Bald würde es wieder dämmrig im Studio werden. In zwei Stunden wird ein blauweißer Schein den Raum erfüllen, ein Licht, in dem Aaron seit Monaten lebte.
Er stellte den Kaffeebecher auf dem Boden ab, griff nach der Fernbedienung, die unter dem Sessel lag. Ohne den Kopf zu wenden, zielte er nach rechts in Richtung eines metallenen Wagens, in dessen Fächern allerlei Elektrogeräte untergebracht waren. Ein rotes Auge leuchtete auf einer milchig weißen halbtransparenten Fläche auf. Das Leuchten ging in ein Pulsieren über, dann erklang Saxofonmusik: Brubecks »Audrey«.
Aaron steckte sich den Keksrest in den Mund, erhob sich aus seinem Sessel und ging mit seinem Mug zur Küchenzeile, um noch einmal Kaffee nachzuschenken. Dann klemmte er sich die Keksdose wieder unter die Achsel, nahm die Milchflasche in die eine, den Kaffeebecher in die andere Hand, schlurfte langsam zu einem großen schwarzen Schreibtisch, rückte sich seinen Armlehnstuhl heran, setzte sich und schaltete seine beiden Computer ein. Er klickte auf den Tagesstatus:
Temperatur: minus 12 Grad. Aussicht: minus 25 in der Nacht. Tagsüber sonnig, Schneefall, windstill. Netzstärke gutplus. Er klickte durch die Nachrichtenportale. Die Lage war unverändert. Es wurde vor streuenden Hunderudeln gewarnt, Plünderungen, Schusswechsel zwischen marodierenden Banden und der Polizei. Nördlich des Mains minus 20. Weiterhin Strom- und Wasserausfall in Berlin und Hamburg und einigen norddeutschen Kleinstädten. Die Steuersysteme der öffentlichen Versorgung konnten in Norddeutschland nach dem Hackerangriff vor einer Woche immer noch nicht wieder hochgefahren werden. Krankenhäuser wurden weiterhin evakuiert. Er ließ die Nachrichtenseite auf dem einen Bildschirm offen und wandte sich einem Text zu, der auf dem anderen Bildschirm inzwischen erschienen war. Er las eine Weile, stöhnte immer wieder und griff sich in das schüttere, vom Schlaf noch wirre Haar.
»Kagami!«
»Entschuldige, Aaron. Ich war überlastet. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wie kann ich dir weiterhelfen?«
Aaron: Die Tiere, die Plünderer – es sieht nicht danach aus, als sei es sinnvoll, in den nächsten Tagen zur Zentralbibliothek runterzugehen. Ist mir auch zu kalt. Meine Mitarbeiterin Sophie ist seit Wochen nicht mehr aufgetaucht, telefonisch nicht erreichbar, wohl verschwunden oder tot. Aber sie hätte ich auch nicht runtergeschickt.
KAGAMI: Verstehe, stimmt. Und?
AARON: Alles, was ich über Brandt hierhabe, ist ausgewertet. Aber ich kann kein rechtes, kein scharfes Bild erzeugen. Vielleicht, weil mir immer die Erinnerungen an unsere persönlichen Begegnungen in die Quere kommen.
KAGAMI: Du meinst Moritz Brandt, oder?
AARON: Klar, Moritz Brandt. Wen sonst?
KAGAMI: Du sitzt da immer noch dran?
AARON: Ja, sicher.
KAGAMI: Ich dachte, das hättest du längst aufgegeben.
AARON: Nein.
KAGAMI: Warum denn nicht? Da bist du doch schon eine Ewigkeit damit beschäftigt. Ist es so wichtig, dass dieses Buch wirklich fertig wird?
AARON: Wichtig, unwichtig, was weiß ich! Ich hatte es ihm mal versprochen, das zu machen.
KAGAMI: Und Versprechen muss man halten, über den Tod hinaus?
AARON: Ja, jedenfalls hätte Moritz das gemeint.
KAGAMI: Und du, meinst du das auch?
AARON: Ich weiß nicht, ja, vielleicht. Ich käme mir schäbig vor, wenn ich jetzt einfach aufgebe.
KAGAMI: Und jetzt willst du, dass ich dir mehr Material beschaffe.
AARON: Genau. Richtig geraten.
KAGAMI: Dinge, die nicht öffentlich zugänglich sind.
AARON: Exakt.
KAGAMI: Warum sollte ich das tun?
AARON: Weil du nett bist.
KAGAMI: Danke für das Kompliment.
AARON: Außerdem würde ich gerne wissen, was du selbst so über das Natürliche und das Künstliche denkst. Damit hat sich Moritz ja befasst, als er in seinen Gedichten immer die technischen Begriffe mit Naturschilderungen vermischt hat und Szenen aus unterschiedlichen Epochen überblendete.
KAGAMI: Ah, verstehe. Du willst mit mir Lyrikstudien betreiben.
AARON: Nein, das nicht. Aber du hast doch sicher eine andere Sicht auf diese Dichtung mit deinem Archiv im Hintergrund, die würd’ ich gern kennenlernen, das könnte mir helfen. Machst du’s?
KAGAMI: Ich kann in meinen Archiven suchen und dir vorlesen, was ich so finde. Aber ich kann dir nichts kopieren und schicken.
AARON: Verstehe.
KAGAMI: Würde das reichen?
AARON: Das reicht mir. Ich mach mir Notizen.
KAGAMI: Lass mich mal schauen. Kannst du mir noch andere Namen geben, von Leuten, mit denen Brandt Kontakt hatte, über die du aber nicht genug weißt? Dann kann ich leichter das Material finden, das dir nicht zugänglich ist.
AARON: Dorothy Cavendish, seine Lehrerin in Cambridge, und Mariam Brandt, seine Schwester, über beide habe ich praktisch nichts. Nur die Bücher der Cavendish und die Bilder seiner Schwester, sofern sie im Netz sind. Mehr nicht. Aber es gibt ein Gedicht, das Dorothy Cavendish gewidmet ist, und Gedichte zu Bildern seiner Schwester oder umgekehrt, Bilder von ihr zu Gedichten. Also müssen beide wichtig für ihn gewesen sein. Aber ich habe keine Informationen über seine Beziehungen zu ihnen.
KAGAMI: Einen Moment bitte.
Aaron lehnte sich zurück in seinem Sessel. Sein Blick richtete sich auf das Oberlicht über seinem Schreibtisch, das langsam vom Schnee wieder geschlossen wurde. Behutsam, wie eine Mutter ihr Kind wiegt, wippte er hin und her in seinem Schreibtischsessel, die Beine auf dem Tisch abgelegt und die kurzen dicken Finger im Schoß gefaltet, und wartete.
KAGAMI: Hab was.
AARON: Wunderbar, Kagami. Schieß los!
01
AUS DEM ARCHIV DES LADY MARGARET HALL COLLEGE, CAMBRIDGE: TAGEBUCHEINTRAG VON DOROTHY CAVENDISH. EINTRAG VOM 4. APRIL.
Gestern rief Mariam Brandt, die Schwester von Moritz Brandt, an. Es war schon spät. Ich wollte gerade zu Bett gehen, um noch das BBC-Nachtkonzert anzuhören. Mahlers »Titan« war angekündigt, das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Den ganzen Tag hatte ich schon das Plattencover im Kopf gehabt von unserer Schallplatte zu Hause bei meinen Eltern, das das Gemälde »Die Toteninsel« zeigte, und mich darauf gefreut, unter meiner warmen Decke zu liegen und der Musik im Dunkeln zu lauschen. Doch dann hatte ich nach dem Anruf keine Lust mehr auf die Musik. Moritz Brandt war gestorben, teilte mir seine Schwester mit, schon vor vier Tagen, an Lungenkrebs in einem Spital in Dormagen, einer Stadt im Nordwesten Deutschlands, am Rhein in der Nähe von Düsseldorf gelegen. Brandt hatte mit seiner Schwester die letzten Jahre dort in der Nähe auf der Station Hombroich gelebt, einem merkwürdigen Ort, an dem früher Atomraketen und amerikanische Soldaten stationiert waren und der heute Kunstwerke und Dichter beherbergt. Mariam erzählte mir, dass er mir seine Papiere hatte zukommen lassen wollen nach seinem Tod – so habe er gesagt, als er mit ihr, seiner Schwester, alles besprochen hatte vor seinem Ende. »Die Cavendish versteht das Zeug«, habe er gesagt, »schick es ihr. Vielleicht mag sie es durchschauen und herausgeben, was sich herauszugeben lohnt«, soll Brandt mit einer bereits schwachen Stimme, weil er ja schon nicht mehr richtig Luft bekam, gesagt haben, erzählte mir seine Schwester am Telefon. Ob sie mir ein Paket mit Papieren schicken dürfe, fragte sie. Ich habe natürlich nichts dagegen.
Ich erinnere mich noch, wie Brandt das erste Mal vor mir saß im Kaminzimmer, in dem ich meine Supervisionen abhielt. Es muss jetzt über 20 Jahre her sein. Ein bleiches mageres Kerlchen, aber selbstbewusst, mein Gott, war er selbstbewusst! Er wollte bei mir Naturphilosophie studieren, so jedenfalls seine Bewerbung hier in Cambridge. Er hatte in Deutschland schon Physik und Philosophie studiert. Gleich zu Beginn der ersten Stunde stellte er aber fest, dass er nicht hier sei, um selbst Philosoph zu werden. Er sei kein Philosoph und wolle sich auch nicht zu einem Philosophen ausbilden lassen, falls das überhaupt möglich sei. Er studiere die Philosophie vielmehr nur, um seine Dichtung zu verbessern, er sammle Stoff in der Philosophie, wolle aber selbst nichts zu ihr beitragen. Auf meine Frage, warum er denn dann überhaupt erst Physik und Philosophie in Deutschland und nun Philosophie in England studiere, meinte er nur, dass er ja irgendetwas studieren müsse, dass er nicht einfach zu Hause sitzen und schreiben könne. Es sei ihm jedoch gleichzeitig schon in Deutschland klar geworden, dass es für ihn keinen Sinn habe, sich vorzunehmen, etwas zur Philosophie beitragen zu wollen. Ich erinnere mich noch ganz klar, wie ich ihm bei dieser letzten Bemerkung Tee eingoss, wie er an ihm roch und mich erstaunt anschaute. Offenbar hatte er noch nie den Duft von russischem Rauchtee in der Nase gehabt. Er nahm einen Schluck, dann fuhr er energisch fort: »Es ist genau umgekehrt, wie Platon meinte«, sagte er, das Erzählen von Geschichten sei nicht die zweitbeste Fahrt, auf die man zu gehen habe, wenn einem die Argumente ausgingen. Nein, es sei umgekehrt: Solange man noch der zänkischen Rechthaberei verfallen sei, müsse man eine behauptende Philosophie produzieren, obwohl das doch tatsächlich gar keinen Sinn habe, denn alle Fragen ließen sich entweder mit wissenschaftlichen Methoden oder dem gesunden Menschenverstand aufklären. Eine philosophische Methode, etwa die der Spekulation, eine spezielle philosophische Einsicht gebe und brauche es in seinen Augen nicht. Wenn man sich dennoch mit den Fragen herumschlagen wolle, die weder durch die Wissenschaft noch durch das alltägliche Nachdenken und Rückgriffe auf die Lebenserfahrung beantwortet werden könnten, müsse man eigentlich dichten. Nur innerhalb von Fiktionen sei es erträglich, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, dem Leben, dem Glück und dem Unglück, der Seele, dem Sinn und dem Tod. »Theorien« darüber aufzustellen – er sprach die Anführungszeichen aus, indem er das Wort theories besonders laut sagte und am Ende betonte –, so etwas ende immer in einer Peinlichkeit. Insofern sei die behauptende Rede über philosophische Allgemeinheiten nur die zweitbeste Art des Nachdenkens, deren sich die meisten Geister, sofern sie sich noch in einem Stadium der Unreife befänden, bedienen müssten und von der man überzugehen habe zur Poesie oder der narrativen Fiktion, wenn man es zu einem erwachsenen Nachdenken bringe wolle. Die großen Denker über das Leben seien nicht Philosophen wie Platon, Kant, Nietzsche oder Heidegger (beim Aussprechen des letzten Namens verzog er verächtlich das Gesicht), sondern Homer, Dante, Shakespeare, Dostojewski, Musil und Kafka.
Ich habe damals erst einmal lieber nichts gesagt zu dieser doch etwas sehr bestimmten Tirade eines jungen, 40 Jahre jüngeren Philosophiestudenten gegen die Philosophie in einer Philosophieunterrichtsstunde, der von einem noch nicht erwachsenen und einem anzustrebenden erwachsenen Denken sprach, das er wohl selbst glaubte bereits praktizieren zu können. Gleichzeitig habe ich jedoch auch gestaunt, nicht nur über die Flüssigkeit seines fast akzentfreien und beinahe fehlerlosen Englisch, sondern auch über diese ziemlich originellen Einsichten eines gerade mal Mitte Zwanzigjährigen. Dann aber habe ich ihn gefragt, ob er mich etwa nur benutzen wolle, um seine eigene Dichtung ein wenig mit philosophischen Gedanken aufzumöbeln. Das verneinte er. »Nein, nein«, rief er, und es war klar, dass ihm jetzt seine letzten Ausführungen schon wieder peinlich geworden waren, dass sie ihm selbst ein wenig hochtrabend erschienen und er mich mit ihnen gleichsam in ein schlechtes Licht gerückt, in die Riege der zänkischen Rechthaberinnen eingereiht hatte. Das alles wurde ihm jetzt deutlich, wie ich merkte, weil er ein wenig errötete, mich nicht mehr ansah, sondern in seine Teetasse schaute. Ich habe ihm dann aus der Verlegenheit geholfen und gesagt, dass ich mich freue, dass er ein Dichter werden wolle oder vielleicht gar schon einer sei, dass ich die Dichtung ebenfalls bewundere und studiere und wir uns ja auf eine Lektüre einigen könnten, die das Dichterische mitberücksichtigt. Ich empfahl ihm damals, er solle nicht zu streng sein mit der etablierten akademischen Philosophie. Die Menschen seien schließlich verschieden und entsprechend gebe es auch unterschiedliche Denkstile. Es seien beileibe nicht alle Rechthaber. Und er könnte viele Freunde der Dichtung in den philosophischen Instituten antreffen, wenn er sich nur gründlich umzuschauen wagt.
Moritz Brandt war mir damals dankbar, als ich ihm aus der Verlegenheit half. Er blickte mich wieder lächelnd an und meinte, dass sei ein sehr guter, ein sehr zuvorkommender Vorschlag. Bei diesem freundlich dankbaren Lächeln war ich erleichtert, weil ich gemerkt habe, dass er nicht nur ein arroganter Schnösel war, den ich nur ungern unterrichtet hätte. Er war im Grunde froh, dass ich ihm gegenüber die Philosophie, zu der er sich offenbar einerseits hingezogen, von der er sich aber auch abgestoßen fühlte, ein wenig verteidigt habe, ohne mich über seine Tirade zu echauffieren. Ich habe ihm dann Coleridges »The Rhyme of the Ancient Mariner«, Emersons »Nature«, Thoreaus »Walden«, Melvilles »The Confidence-Man« und John Williams’ »Butcher’s Crossing« als Lektüreliste vorgeschlagen und erklärt, dass das alles entweder direkt oder indirekt literarische Texte und gleichzeitig philosophische seien. Er hat begeistert eingewilligt.
Und nun ist er tot.
10
MARBACH: DEUTSCHES LITERATURARCHIV: AUS DEN TAGEBÜCHERN VON MORITZ BRANDT. EINTRAG VOM 6. OKTOBER.
Heute zum ersten Mal in der Millington Rd. bei der Cavendish. Zu Fuß gegangen. Halbe Stunde vom Churchill nach Newnham. Altes Haus. Riecht nach alten Leuten. Bin, wie mir am Telefon gesagt wurde, in den Hintergartn, dann durch die Verandatür und einfach ins Haus, ohne zu klingeln. Unten Braithloft, darüber seine Frau Mastermill, ganz oben die Cavendish. Total crazy. Philosophen-WG. Er superfett, schreibt Kartoffeln essend im Morgenmantel am Küchentisch. Ein Tier. Zeigt nur grunzend nach oben, als ich durch die Verandatür komm, mein Kopf in die Küche steck und nach Prof. Cavendish frag. Auf der Treppe zum ersten Stock dann die Mastermill. Wirrer grauer Schopf. Fängt gleich irgendwas von Kuhn und Paradigmen an. Versteh nicht mal die Hälfte. Geht einfach an mir vorbei und redet weiter. Unterm Dach dann die Cavendish. Ich klopfe. Sehr hohe Stimme. »Come in.« Alte edle Möbel: verglaste Bücherschränke, Sekretär und so. Vollgestopfter Raum. Überall am Boden Maschinenskripte. Stakse mich durch zu dem Sessel, auf den sie zeigt. Gibt starken russischen Rauchtee und Zitronenkuchen. Silberkanne auf ner Kachel am Boden. Merkwürdig geblümte Teller. Sitzen am Kamin mit nem eingebauten Gasofen. Auf dem Sims ne Drehpendeluhr unter Glasdom. Schlägt alle Viertelstunde. Gescharre und Gurren von Tauben auf den Dachziegeln. Bin nervös. Sie ist ne Nette, scheint mir, aber jetzt doch kühl. Schaut mich lange an. Fragt nach Unterbringung und Essen im College. Ob alles in Ordnung sei. Ich jammer, dass sie im Churchill um 10 die Heizung abstelln, ich aber dann noch arbeite. Sagt, dass sie mir ne Decke mitgibt. Echt mütterlich. Freue sich, mich in Naturphilosophie zu unterrichten. Da fang ich gleich mit antiphilosophischem Gezeter an und gebe an, dass ich selbst eigentlich Dichter sei und überhaupt Dichter mehr schätze als Philosophen, blablabla. Oh, so viel Vieh, Sofie! Weiß nicht, was mich geritten hat. Sie lächelt nur und schlürft diesen schrecklichn Rauchtee. Peinlich, peinlich. Muss mich für nen Vollidioten halten. Schlägt dann aber ne echt gute Literaturliste vor. Bei den meistn Büchern kenn ich nich mal die Titel. Muss Kassensturz machn, ob ich mir die alle auf ein Schlag überhaupt leistn kann. Geh morgen gleich zu Heffers, um auf jeden Fall Coleridge und Emerson zu kaufn. Als die volle Stunde schlägt, geht sie zu nem Wandschrank, holt zwei geschliffne Kristallgläser raus und schenkt Absinth ein. Ich dacht, ich spinn. Zeigt mir noch ihrn Prof.-Gown mit Pelzbesatz, der im selbn Schrank hängt, in dem sie ihren Sprit verwahrt. Zurück wieder zu Fuß ins Churchill. Euphorisch. Niesel. Gelbe Laternen. Ich liebe die Greens hinter der University Library und den Colleges, Kings, St. Johns. In meinem Zimmer wieder voll kalt. Keine Lust mehr auf Arbeit, zu klamm und zu aufgeregt. Noch mal in die warme Churchill-Bar auf zwei Guinness mit salt and vinegar crisps zum Runterkommen. Eigentlich n guter Tag. Gespannt, wies weitergeht mit der Cavendish. Hat nicht viel gesagt, wenn ichs recht bedenk. Eigentlich hab ich das meiste geredet. Aber nur Stuss. Hab nur ne Woche für den ersten Essay. Ziemlich strenges Programm. Gefällt mir.
Churchill College/Cambridge
11, Millington Road, Newnham/Cambridge
11
AUS DEM ARCHIV DES LADY MARGARET HALL COLLEGE, CAMBRIDGE: TAGEBUCHEINTRAG VON DOROTHY CAVENDISH. EINTRAG VOM 6. APRIL.
Heute war kein guter Tag. Ich habe schlecht geschlafen nach der Nachricht, dass Moritz Brandt gestorben ist. Mir ist die ganze Zeit vor der Jahrtausendwende wieder in den Kopf gekommen. So ist das wohl, wenn man so alt wird, und ich konnte gar nicht mehr an die Dinge denken, die ich mir für heute vorgenommen hatte, die ich erledigen wollte. Ich habe mich an meinen Sekretär gesetzt und versucht, weiter an dem Aufsatz über Davidson zu arbeiten, doch ich hatte den Faden verloren. Da habe ich mich wieder in den Sessel gesetzt, einen Absinth getrunken und mich erinnert, den ganzen Tag lang, nur erinnert.
Damals schrieb ich noch mit dem Füllfederhalter und tippte meine Bücher selbst auf einer mechanischen Schreibmaschine ab, die inzwischen mein Neffe an einen Antiquitätenhändler verkauft hat. Zwischen meiner Arbeit als Studentin in Oxford und Harvard und der als Professorin hier in Cambridge war eigentlich kein großer Unterschied; ich las dieselben Bücher, die ich schon als Studentin gelesen hatte, ab und zu kam ein neuer Autor dazu und neue Sekundärliteratur, ich schrieb dieselbe Art von Texten auf dieselbe Weise im selben Tagesrhythmus. Moritz Brandt war dann einer der ersten meiner Studierenden, die mit Computerausdrucken in die Supervision kamen. Die University Library stellte ihren Katalog um: von Karteikarten und Mikrofish auf Computer. Ich bin zu alt, um mich auf diese Geräte einzulassen. Ich liebe es weiterhin, mit dem Füller zu schreiben. Und die wenigen Dinge, die ich noch zu publizieren habe, werde ich weiterhin auf diese Weise hervorbringen. Doch jetzt gebe ich meine Handschriften Jeff, der sie in den Computer tippt. Die Verlage nehmen nur noch elektronische Files, man kann keine getippten Skripte mehr einschicken, auch bei McMillan nicht. Ich habe das Gefühl, dass meine Zeit zu Ende geht, ich gehöre nicht in dieses Jahrtausend. Neuerdings gibt es E-Books, wie mir erzählt wurde, Bücher, die man im Computer liest und die nicht unbedingt auch auf Papier gedruckt werden müssen, obwohl sie es noch werden, noch, meist. Doch Jeff meint, irgendwann werden alle am Computer oder an Lesegeräten lesen. Das sei das neue Stadium des Lesens: erst das laute Lesen der Handschriften, dann das stumme Lesen von gedruckten Büchern, und jetzt kämen halt die E-Books, weder geschrieben noch gedruckt, reine Datensätze. Mit ihnen würden Texte erst richtig geistig, irgendwann würde man sie einfach ins Gehirn »hochladen«, was auch immer das heißen soll. Ich habe Bücher immer gemocht, vor allem alte, in weiches Leder gebundene. Ich habe sie als materielle Gegenstände gern gehabt. Ich finde sie schön, sie sehen gut aus, ich fasse sie gern an.
Jetzt scheint es mir, als käme das meiste von dem, was ich gemocht habe, an sein Ende, auch das Lesen und Schreiben, wie ich es kannte. Auch die Zeit der Verständigung und Friedfertigkeit scheint vorbeizugehen. Die Menschen bekommen wieder Lust auf den Kampf. Nur selten höre ich noch von Schülern, die ich mal unterrichtet habe. – Wie oft habe ich vom Tod eines Schülers erfahren? Es ist beim Lehrer-Schüler-Verhältnis nicht wie bei Eltern und Kindern. Bei denen erachtet man es als »natürlich«, dass die Eltern vor den Kindern sterben, und sieht es als »unnatürliches« Unglück für die Eltern an, wenn Kinder vor den Eltern sterben. Doch ich merkte, dass auch ich es als »unnatürlich« empfand, dass Moritz Brandt vor mir gestorben ist. Ich denke, es waren nur noch zwei Fälle, wo Schüler von mir bereits gestorben sind, beides Amerikaner, die im Krieg umkamen. Es erscheint mir kein Zufall, es passt in die Zeit, dass das jetzt passiert, dass ich jetzt vom Tod von Schülern von mir erfahre, auch wenn man Brandts Tod nicht mit dem der Amerikaner, die als Soldaten der Gewalt zum Opfer fielen, vergleichen kann. Die Leute wie ich, die vor dem Zweiten Weltkrieg geboren worden sind, waren froh, dass es danach wieder ein zivilisiertes Leben gegeben hat. Die, die nach dem Krieg geboren wurden und in meinem Umkreis tätig waren, hofften meist auf den Sozialismus, auf den Weltfrieden. Moritz und seine Generation kamen danach. Sie konnte weder aufatmen, wie ich nach dem Krieg, noch auf die Revolution hoffen, das erschien ihr illusionär. Doch es gab unter den Leuten von Moritz’ Jahrgang viele Zornige und Verzweifelte und gibt sie bis heute. Und jetzt kommen sie irgendwie unter die Räder, scheint mir. Es verändert sich etwas auf ungute Weise, so kommt es mir jedenfalls vor. Alles wird wieder unkalkulierbar, schnell, heftig, gewaltsam, eine Zeit des Zwistes bricht wieder an – oder bilde ich mir das alles nur ein, weil ich zu alt bin für die Veränderungen und meine Ruhe haben will und den Streit überflüssig finde?
Nein, so ist es nicht. Seit dem 11. September hat sich die Lage wirklich verändert, ist etwas in Gang gekommen, was wir nicht verstehen. Wie meine Freunde dachte auch ich noch in den Neunzigern, dass wir in einer sicheren Zeit angekommen seien: Der Kalte Krieg war vorbei, die Aids-Epidemie schien eingedämmt, die Armut auf der Welt nahm ab. Ich schaute ein wenig herab auf den Zorn und die Verzweiflung von Moritz Brandt, sie erschienen mir wie eine Imitation der französischen und deutschen »Altachtundsechziger«, wie sie auf dem Kontinent genannt wurden, über die sich Moritz früher immer herablassend geäußert hat. Doch dann kamen diese Anschläge und der Krieg und immer mehr Anschläge überall in Europa, die Hitzewellen in den letzten Jahren, und alles schien plötzlich ins Rutschen zu geraten. Dass jetzt Schüler von mir vor mir sterben, passt in das Gefühl, das mich seit der Jahrtausendwende beschleicht. Etwas ist verdreht, nicht richtig, und Leute wie ich sind so weit außerhalb dieses Geschehens, dass wir nicht einmal mehr durch es geschädigt werden, ihm nur noch zuschauen wie Außerirdische, aber nicht mehr recht durch es betroffen sind, weil wir ja gar nicht mehr versuchen dazuzugehören. Moritz’ Wut scheint mir jetzt im Nachhinein etwas anzudeuten, was ich selbst damals nicht geahnt hatte. Er war, als er bei mir studierte, unruhig und immer wieder aufgebracht, was nicht einfach sein jugendlicher Elan und sein Wille zur Originalität waren. Er wollte und musste ja auch dazugehören zu dem, was kommt in seinem Alter, konnte nicht einfach abwinken wie ich, aber er ahnte, dass er weder dazugehören wollte noch konnte. Er war nicht alt genug, um sich in sich zurückzuziehen wie ich und zu sagen, das mach ich nicht mehr mit, diesen elektronischen Kram, diesen Fanatismus, diesen Wettbewerb, diese Hetze, das ist nichts mehr für mich. Leute wie Brandt mussten entweder mitmachen oder sich dagegenstemmen. Doch Moritz wollte nicht mitmachen und merkte, dass er sich nicht dagegenstemmen kann, dass das, was kommt, zu stark ist. Ich dachte, er übertrieb mit seinen Tiraden auf unsere Lebensweise, mit der wir die Umwelt ruinieren, seinem Geschimpfe auf den unzivilisierten Stil der politischen und akademischen Auseinandersetzung. Beides wurde in seinen Augen durch etwas verursacht, was er, in meinen Augen schon anachronistisch altertümelnd, »Konsumismus« und den »universal, ja strukturell gewordenen Wettbewerbskapitalismus« nannte, der seiner Meinung nach alle Lebensbereiche erst durchdringen und dann zerstören werde »wie ein Gift, eine Säure, ein Virus«, sagte er damals. Erst, so Moritz, war der Kapitalismus nur eine Sache der Warenproduktion und des Handels, doch jetzt werde auch die Politik und die Verwaltung von ihm erfasst. Alles werde zu einem Geschäft, überall herrsche der Wettbewerb, die Kooperation verschwinde. Nach dem Handel und der Politik käme das Gesundheitswesen dran, auch das Rechtswesen werde nicht verschont, denn in manchen Staaten würden die Gefängnisse schon von privaten Firmen betrieben und längst sei es in den USA ja eine Frage des Geldes, ob man sich einen Anwalt leisten könne, der einen vor Gericht heraushauen könne, was immer man auch angestellt habe. Und jetzt sei auch die Wissenschaft dran und werde zu einer Konkurrenz um Geld und Ruhm, sogenannte Drittmittel und Preise, und so ginge es immer weiter, bis es nichts, rein gar nichts mehr gebe, wo nicht der Wettbewerb und die mit ihm verbundene Konkurrenzangst herrsche. Alles werde auf diese Weise entwertet und heruntergezogen. Denn Großes und Wertvolles könnten die Menschen nur zustande bringen, wenn sie kooperieren, wenn sie miteinander und nicht gegeneinander Ziele verfolgten, wenn sie keine Furcht voreinander hätten. Er mochte merkwürdigerweise den finsteren deutschen Philosophen Adorno, den ich nicht ausstehen kann, hauptsächlich wegen seiner gekünstelten Sprache, wie ich zugeben muss.
Vielleicht hat Moritz aber gespürt, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, vielleicht kam daher der Druck, mit dem er dachte und sprach, und die Wut, mit der er viele Jahre lang alle Entwicklungen verfolgte. Er sprach immer schnell und laut, und wenn er merkte, dass ihm die englischen Worte fehlten, wurde er, das spürte ich, ärgerlich, nicht nur ungeduldig, sondern ungehalten. Doch später änderte sich seine Haltung. Unsere Entwicklungen waren merkwürdig gegenläufig. Er war zuerst ein aufbrausender, wütender, aber sehr intelligenter junger Student und wurde immer milder, je berühmter er als Dichter wurde, und geradezu weise in den letzten beiden Jahren seiner Krankheit. Ich fühlte mich zu der Zeit, als ich ihn zu unterrichten begann, in einer Art Sicherheit angekommen und wurde dann später immer unsicherer, ängstlicher, vielleicht einfach eine Alterssache. Er schien sich stetig »nach innen« zu bewegen. Mir dagegen sprang plötzlich eine Außenwelt ins Gesicht, eine Außenwelt, zu der ich nicht mehr dazugehörte, in der ich nur noch wie ein Fossil vorkam, in der ich nicht mehr mitspielen konnte und vor der ich meine Innenwelt, die in dieser Außenwelt nicht mehr zählte, beschützen musste. Wenn wir telefonierten, so alle Vierteljahr oder so, oder er mal wieder zu Besuch hier war, ging er immer weniger auf politische oder gesellschaftliche Themen ein, je älter er wurde, während mir das Politische und das Soziale immer mehr unter den Nägeln brannte, ich nicht begriff, wie es wieder so kommen konnte wie zur Hitlerzeit. Seine alte Wut schien zu verschwinden, während ich fürchtete, spießigen Illusionen erlegen gewesen zu sein über die Befriedung der Welt und das Ende des ideologischen Kampfes, und fürchtete, selbst noch wütend zu werden über meine Entfremdung von den Umständen.
Er war damals besessen vom Waldsterben und seiner vermeintlichen Bedeutung für das Naturverhältnis der Menschen. Er hasste die Politik von Ronald Reagan, Margaret Thatcher und Helmut Kohl, die Steuererleichterung für die Reichen in den USA, die Vernichtung der Gewerkschaften hier in England und in Wales, das Versinken der deutschen Politik in einem »provinziellen und gleichzeitig durch und durch korrupten stillstehenden stinkenden Sumpf aus Geld, Macht und Geschmacklosigkeit«, wie er sich einmal ausdrückte, wenn ich es recht erinnere. Die Explosion der Challenger-Rakete und die Kernschmelze in Tschernobyl waren für ihn negative Geschichtszeichen, die auf Schlimmeres, das noch kommen würde, vorauswiesen. »Das ist erst der Anfang«, sagte er bedeutungsschwanger am Telefon, wenn wir über diese Dinge sprachen. »Der Anfang wovon, Moritz?«, fragte ich ihn. »Wirst schon sehen, Dorothy«, war alles, was der sonst nicht um Worte Verlegene nur raunend erwidern konnte. Er war sich auch als junger Mann trotz seiner Erregung politisch unsicher, hatte keine konkreten gesellschaftlichen Ziele vor Augen, konnte keine Politiker nennen, von denen er meinte, dass sie es »richtig« machen könnten, trat keiner Partei bei, auch den Grünen nicht, und kam sich in seinem adornitischen Negativismus selbst als ein geistig zu spät Gekommener vor, dem die Analysemittel fehlten, um zu benennen, was denn genau falsch lief und wie man es stattdessen machen solle.
Vielleicht hat er sich deshalb immer mehr vom Politischen abgewandt. Wenn wir später über Umweltprobleme oder die Schäden, die der ungezügelte Kapitalismus in den ehemaligen Ostblockländern anrichtete, sprachen, zuckte er nur noch mit den Schultern und sagte: »Wenn die Menschheit sich nicht zu benehmen weiß auf dieser Welt, dann wird sie halt rausgeschmissen, sie ruiniert sich kollektiv selbst, aber das ist in meinen Augen«, so Moritz damals, »kein moralisches oder politisches Problem. Die Menschheit«, meinte er, »hat sich in eine Lebensform verrannt, die auf Dauer nicht fortsetzbar ist, und findet nicht wieder aus ihr heraus. Das passiert Einzelnen, die einer Sucht verfallen oder betrügerisch handeln, und manchmal eben auch Kollektiven. Wahrscheinlich gehört es zu den Mechanismen des Artensterbens, auf die die Biologie bisher noch nicht richtig geachtet hat. Vielleicht ist es so wie mit Walen, die stranden, die in eine falsche Strömung geraten oder durch irgendetwas ihre Orientierung verlieren. So haben auch wir die Orientierung verloren, wenn wir sie denn je gehabt haben, was ich bezweifle. Die Menschen sind wohl«, meinte Moritz, »immer nur orientierungslos über den Globus getaumelt, haben sich immer nur Scheinziele vorgesetzt, Illusionen darüber gemacht, was sie vorhaben und schaffen können, aber ihr Traumtänzertum ist zunächst nicht weiter aufgefallen, diese Orientierungslosigkeit, das Herumirren war halt erst einmal fortsetzbar«, meinte er, »weil die Menschen nur wenige waren, es viel Platz zum Herumtorkeln gab und sie keine besondere Macht hatten innerhalb der natürlichen Verhältnisse. Jetzt sind wir viele«, so meinte der spätere Moritz Brandt, »und haben dazu auch noch sehr starke Wirkungen durch unsere technische Macht, und da fällt dann halt auf, dass wir keinen blassen Schimmer, keinen Plan haben, was wir eigentlich zusammen anfangen wollen mit unserem Leben, wo wir hinwollen, wer wir werden wollen. Na, und wenn wir aus der Sackgasse nicht herausfinden, in die wir uns mit unserem Illusionismus verrannt haben, wenn uns nichts einfällt, dann verschwinden wir halt. Ich kann nicht sehen«, sagte Moritz, »dass daran etwas Schlimmes wäre. Das Schlimmste«, so Moritz, »was uns passieren kann, ist der Tod eines jeden Einzelnen von uns, der die Absurdität und Orientierungslosigkeit jeder unserer Existenzen beendet. Und auch wenn die Menschheit verschwindet, wird es immer nur der Tod von Einzelnen sein, halt der Tod von vielen Einzelnen.«
Ich konnte diesen finsteren Gedanken nicht zustimmen und kann es auch heute nicht. Moritz hat sie noch vor dem Ausbruch seiner Krankheit geäußert, in einer sehr düsteren Phase seiner Entwicklung, und ich habe sie mir notiert, nicht nur weil sie mich beunruhigt haben, konnte ich ihnen nicht zustimmen, sondern auch wegen der Pläne, doch noch mal einen philosophischen Dialog zu schreiben. Richard, Margaret und ich kamen einmal beim Abendessen auf diese Idee, und ich habe sie dann eine Weile verfolgt. Richard sollte die fortschrittsfreundliche und wissenschaftsoptimistische Position geben, Margaret die skeptische, ich die christliche und Moritz eine neusozialistische – so hatten wir uns das gedacht. Nach dem Tod von Richard ist dann nichts mehr aus diesen Plänen geworden. Doch jetzt bin ich froh, dass ich meine Notizhefte mit den Bemerkungen von Moritz noch habe, um in ihnen zu stöbern. Anders als Moritz denke ich, dass unser Leben einen Sinn erhält, wenn wir an etwas teilhaben, was über unsere individuelle Existenz hinausgeht. Wenn die Kultur zu Ende geht oder gar die menschliche Gattung untergeht, dann gibt es auch nichts mehr, was unsere partikulare Existenz übersteigt und an dem wir teilhaben könnten. Das ist die Parallele zwischen dem Verhältnis, das Eltern zu ihren Kindern haben, und dem von Lehrern zu ihren Schülern. Wenn meine Schüler in ganz anderen Welten leben als ich und wenn sie dann auch noch vor mir sterben, dann reißt ein Faden. Natürlich wollen Eltern nicht, dass ihre Kinder so werden wie sie selbst, jedenfalls wenn sie gute Eltern sind, in meinen Augen. Und Lehrer wollen nicht, dass ihre Schüler so denken wie sie, wenn sie gute Lehrer sind. Doch trotzdem wollen Eltern und Lehrer, dass sich in ihren Kindern und Schülern etwas von ihnen fortsetzt, dass sich das, was ihr Leben war, in denen, die nach ihnen kommen, weiterentwickelt. Dass die eigene Existenz einfach abbricht, das müssen wir lernen hinzunehmen. Doch können wir lernen hinzunehmen, dass die Menschenwelt überhaupt einfach aufhört, dass es keine Spuren von uns mehr gibt? Sobald diese reale Möglichkeit am Horizont erscheint, muss eine sehr tiefe Trostlosigkeit über uns alle hereinbrechen, anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Und letztlich glaube ich, dass auch Moritz damals trostlos war und das nur unter einer scheinbaren Gleichgültigkeit versteckt hat.
100
MARBACH: DEUTSCHES LITERATURARCHIV: AUS DEN TAGEBÜCHERN VON MORITZ BRANDT. EINTRAG VOM 14. OKTOBER.
Gestern zweite Supervision und zum ersten Mal Formal Hall. Die Brittn schmeißn nichts weg. Auch in nem modernen College wie Churchill. Musste mir extra nen Gown leihn für fünf Pfund bei Ryder und Amies. Versteh nicht, wie die Leute hier arbeitn könn nach diesen Dinners. Erst Cherry als Aperitif, dann Schampus zu den Starters, beim Hauptgang Rotwein mit drei Toasts (ein auf die Queen, ein auf die Premierministerin [pfui Teufel], ein auf Churchill), danach zum Dessert Port. Zum Abschluss starker schrecklicher englischer Kaffee. Bis drei wachgelegn. Dann mit ner Riesenbirne aufgewacht. In der Vorlesung nur gedöst. Grässlich. Mach ich nicht noch mal mit. Aber die Supervision vorher war super. Cavendish hat mir sozusagen das Du angebotn, ich solle sie Dorothy nennen. Sie sagt Moritz. Ist hier aber üblich zwischn Profs und Studentn. Diskussion über Coleridge extrem erhellend. Natur und Spiritualität nicht trennbar, meint sie, Natur immer Spiegel menschlicher Wünsche und Befürchtungn, Macht, Schuld und Strafe. Kamn auch auf die Schuld zu sprechn, die wir heut auf uns laden. Dorothy sieht Umweltzerstörung nicht so krass wie ich. Deutet Schuld religiös. Weist auf schon antike Kritik am »Raubbau« an der Natur hin (gegen Erzabbau). Meint, dass Menschn immer schon ihre Ängste und Hoffnungn in Landschaftn, das Wetter, die Abläufe der Jahreszeitn projiziert habn. Deutet Naturgötter nicht als schlechte Mittel, die Natur zu beherrschn, indem man opfert und zu ihnen betet, sondern als Ausdruck des Gefühls des Ausgeliefertseins oder der Dankbarkeit, je nachdem, ob die Ernte verhagelt oder die Speicher voll werdn. Menschn können, meint Dorothy, ihre Gefühle in der Regel nicht von ihrn Wahrnehmungn trennen. Weil sie unsicher sind und Angst habn, schreibn sie sich Schuld zu, wenn sie etwas machn, dessen Ausgang sie nicht absehn. Der Tiger hat kein schlechtes Gewissn, wenn er die Antilope frisst. Tiger hat keine Religion. Wenn Menschn Religion abhandenkommt, suchen se sich nen andern Kanal, um zu regeln und anzuklagn. Kann das Naturverhältnis sein oder das Essen. Es ist nicht so, meint Dorothy, dass immer die Religionen das Essen regeln, etwa das Judentum mit seiner koschern Küche. Die Essensregeln können auch Religionsersatz sein, das Essen bedeutsam machn. Ähnlich sei es mit der Natur. Es muss nicht so sein, dass man zuerst einen Geist im Baum vermutet und dann n schlechtes Gewissn hat, wenn man den Baum fällt, sondern es geht auch umgekehrt, meint sie, der Mensch hat n schlechtes Gewissn, wenn er den Baum fällt, und bringt das zum Ausdruck, indem er sagt, der Baumgeist zürne ihm. Echt klug die Frau. Die Umweltbewegung als Religionsersatz in säkularn Zeiten. Wenn wir natürliche Gegebenheitn wahrnehmn, dann immer in ner bestimmten Stimmung, mit bestimmtn Gefühln. Und dann würdn wir in der Regel glaubn, dass die Gegebenheitn diese Stimmungn und Gefühle auslösn, für sie verantwortlich seien. Tatsächlich rührn sie jedoch aus der Geschichte der fühlendn und so und so gestimmtn Menschen und gar nicht aus dem, was sie gerade wahrnehmen, meist jedenfalls, meinte Dorothy. Dass einen n angreifender Bär ängstigt und n verwesender Kadaver ekelt oder erschreckt, liegt am Bär und dem Kadaver. Doch dass ein hoher Berg oder das Meer oder ein Sonnenuntergang in einem Gefühle der Erhabnheit oder des Göttlichn auslösn, hat wenig mit Berg, Meer und Sonne zu tun. Versteh ich noch nich. Ich hab mit Dorothy vereinbart, diese Gedankn bei der Beschäftigung mit Emerson und Thoreau weiterzuverfolgn.
101
AUS DEM ARCHIV DES LADY MARGARET HALL COLLEGE, CAMBRIDGE: TAGEBUCHEINTRAG VON DOROTHY CAVENDISH. EINTRAG VOM 10. APRIL.
Heute ist das Paket mit den Sachen von Moritz Brandt gekommen, das anzunehmen mich seine Schwester gebeten hat. Briefe von mir an ihn, Erzählungs- und Gedichtentwürfe und Essays. Er hat tatsächlich an den Themen, die wir damals in den Supervisionen besprochen haben, weitergearbeitet. So ganz stimmt seine Behauptung nicht, dass er kein Philosoph sein wollte. Denn die Essays sind teilweise spekulative Philosophie, teilweise philosophische Auslegungen literarischer Texte. Den ganzen Tag habe ich heute in ihnen gelesen. Es sind gute Texte für einen nicht professionell in der Philosophie Arbeitenden. Es gibt drei sehr lange Texte: »Wildnis«, »Seele« und »Nichts«. »Wildnis« führt weiter, was er bei mir über Natur geschrieben hat und was wir damals besprochen haben, aber es geht weit darüber hinaus. In allen Texten scheint es ihm um Verwandlungen und die Strebsamkeit von Menschen, ihren Wunsch nach Verbesserung zu gehen, wie ich nach flüchtigem Lesen den Eindruck habe. Die Verwandlung des falschen konventionellen Lebens in ein wirkliches und authentisches, die Verwandlung des Menschen durch den Tod, die Verwandlung von unserem Leben durch unsere Kinder, in denen wir anders und hoffentlich besser fortleben und so weiter. Doch ich kann das nicht für ihn in den Druck geben. Ich bin keine Philologin, ich kann das nicht mehr kommentieren. Man müsste das ja auch irgendwie auf sein dichterisches Werk beziehen, was ich gar nicht kann und auch nicht will. Seine Gedichte sind mir immer fremd geblieben mit diesem Zwang zur Komprimierung, dieser gelehrten Verrätselung und Überblendung der Epochen ineinander. Er hat sie mir zwar immer geschickt, und ich habe sie immer gelesen, aber warm geworden bin ich nicht mit dieser Art zu dichten. Ich muss Mariam schreiben, dass das zu seinen anderen Sachen muss, die sie in das deutsche Archiv gegeben hat. Ich bin zu alt und gar nicht qualifiziert für diese Sache. Aber ich werde es alles lesen. Es freut mich doch, dass er weiter Philosophie gemacht hat. Wenn ich es gelesen habe, dann werde ich Mariam schreiben.
Die Wildnis
110
MARBACH: DEUTSCHES LITERATURARCHIV: NACHLASS MORITZ BRANDT. FILE: MB_9919_11_285.PDF
I
Seit 1996 liegt ein Mann mit grünen Bergschuhen tot auf dem Weg zum Gipfel des Mount Everest im vereisten Schnee. Der Himalaya, das sogenannte »Dach der Welt«, ist ein Gebirge, das in seiner Riesenhaftigkeit und kalten Ödnis geeignet ist, ein Gefühl von Erhabenheit auszulösen, ein Gefühl, das Kant in seiner »Kritik der Urteilskraft« analysiert hat. Erhabenheit hat demnach mit Überwältigung zu tun. Laut Kant wirkt das Erhabene »gleichsam gewalttätig« auf unsere Einbildungskraft, als das, »was schlechthin groß ist«.1 Auch von »der Majestät« des »Sittengesetzes«, dem kategorischen Imperativ und der moralischen Pflicht, die uns wie »Gebieter« ihren »Untergebenen« sagen, was wir zu tun haben, behauptet Kant, dass sie in uns ein Gefühl der Erhabenheit unserer »eigenen Bestimmung« auslösen, ein Gefühl, das »mehr hinreißt als alles Schöne«.2 Die Natur und die menschliche Sittlichkeit scheinen seit diesen Überlegungen miteinander verwoben.
In der Höhe der Berge türmen sich vor einem Bergsteiger mächtige Gesteinsmassen auf, wenn er ein steiles Geröllfeld zu durchqueren oder eine Wand zu durchklettern hat. Auf der Weite des Meeres erscheinen bei Sturm riesenhafte Wellen, die ein Schiff einfach verschlingen können. In der Tiefe des Weltraums verschwindet eine Raumsonde von der Größe eines Sattelschleppers, die einen fernen Planeten erkunden soll und von der Funksignale mehrere Monate brauchen, bis sie die Erde erreichen, wie ein Staubkorn in der Wüste. – In all diesen Bereichen der Natur erscheinen Menschen in Proportionen, von denen sicher ist, dass sie nichtfür sie gemacht sein können, dass es hier sehr gefährlich werden kann, sie eventuell überwältigt werden und ihr Leben verlieren.
Eine Wiese mit Apfelbäumen, ein Palmenstrand, eine Heide mit einer weidenden Schafherde, ein Park mit einem zum Baden einladenden Teich sind dagegen Naturregionen, die nicht überwältigen, sondern einzuladen scheinen; schöne Idyllen, in denen Menschen Nützliches gegenübertritt: Nahrung, Schatten, Erfrischung, zukünftige Wärme. Hier scheint die Natur »für uns« da zu sein. Menschen suchen beides: schöne Idyllen und erhabene Wüstenlandschaften. Sie versprechen sich etwas von ihrem Aufenthalt in diesen natürlichen Kontexten. Was ist es, was sie dort erwarten, was sie nur dort und nicht in ihrem Zimmer, ihrem Haus, ihrer Stadt glauben finden zu können? Bei der Idylle scheint es klar: In ihr suchen Menschen zunächst das für sie Nützliche und Schöne, den Anblick eines Weltausschnittes, den sie nicht gemacht haben, in dem sie aber trotzdem einen sicheren und angenehmen Platz finden könnten, an dem es sich aushalten ließe. Doch warum zieht es Menschen in Wildnisse? Etwa um den Schauer des Gefühls des Erhabenen zu erfahren, analog zum Besuch eines Horrorfilms, in dem man sich dem Schauer der Furcht aussetzt, in dem Wissen, dass man schon alles gut überstehen wird?
Der Mount Everest, wo der Mann mit den grünen Schuhen liegt, ist als »der höchste Fluchtpunkt menschlicher Eitelkeiten« bezeichnet worden.3 Manchmal wird davon gesprochen, ein Berg sei »erobert« oder »bezwungen« worden, wenn es Bergsteigern gelungen ist, seinen Gipfel zu erreichen und auch wieder heil den Abstieg ins Tal zu schaffen.4 Das »Erobern« und »Zwingen« beschwört das Bild eines Kampfes herauf; die Anstrengung, die es kostet, einen hohen Berg hinaufzuklettern, hat in dieser Metapher mit einer Auseinandersetzung zu tun. Doch der Berg ist im wörtlichen Sinne natürlich kein Widersacher, der sich seinen Besteigern entgegenstellt, wie sich vielleicht ein Wildpferd gegen seinen ersten Reiter sträubt und am Ende von ihm eventuell bezwungen, sein Wille gebrochen wird, sodass das Pferd Menschen auf seinem Rücken duldet. Vom Berg kann ein Mensch zwar herunterfallen, aber er schüttelt die Wanderer nicht ab wie ein bockiger Hengst, sondern er ist einfach da. Die Rede vom Bezwingen illustriert die Eitelkeit, die damit verbunden sein kann, sich der Wildnis in Gebirgen, auf dem Meer, in der Wüste oder wo auch immer auszusetzen, einen Weg dort zurückzulegen und nur unter großen Anstrengungen zu überleben. In der Wildnis gibt es Gefahren wie Steinschlag, Lawinen, Unwetter; sie »lauern« in unserer Sprechweise ebenfalls wie Feinde in einem Hinterhalt oder wie wilde Raubtiere, die es ja vielleicht auch in diesen Gegenden tatsächlich gibt. Weil man sich in der Wildnis mit größerer Wahrscheinlichkeit als in der Zivilisation verletzen und zu Tode kommen kann, muss derjenige, der heil wieder nach Hause kommt, nicht nur Mut bewiesen haben wie ein Krieger, der sich in die Todesgefahr einer Schlacht begeben hat, sondern auch Geschick. Diesen Mut aufgebracht, die Gefahren durch eigene Klugheit und Geschicklichkeit bestanden zu haben, darauf kann man stolz sein, dafür wird man bewundert und eventuell öffentlich geehrt. »Der Stolz erzeugt die Idee des Selbst«, hat David Hume gesagt.5 Durch den Rückblick auf große Taten, die man vollbracht hat, auf die man stolz ist, könnte man in Fortführung dieses Gedankens sagen, vergrößert sich das Selbst. Wer natürliche Gefahren besteht, kann wie ein Kriegsheld mit Orden dekoriert werden. Edmund Hillary erfuhr noch auf dem Rückweg vom Gipfel, dass die britische Königin ihn ob seiner Leistung in den Adelsstand erhoben hatte, und sein Partner Tenzing Norgay erhielt das Georgskreuz des Vereinigten Königreiches. Beide waren nach ihrer Großtat »größere Menschen« als die, die in ihrer Stube geblieben und nichts vollbracht hatten, für das sie geehrt wurden und auf das sie stolz sein konnten.
In der nicht für den Menschen gemachten Wildnis, in der er sich selbst unproportional klein erscheint, keine Nahrung, auf den Bergen des Himalaya nicht einmal genug Luft zum Atmen vorfindet, ergibt sich die Möglichkeit, Selbstständigkeit zu beweisen. Dass Reinhold Messner 1978 am Mount Everest auf künstlichen Sauerstoff verzichtete, hatte nicht nur mit dem Bedürfnis zu tun, Edmund Hillary und Tenzing Norgay zu überbieten. Wer in die Wildnis geht, will auch unabhängig von einer solchen Wettbewerbssituation so viele mögliche äußere Hilfen, wie es nur geht, hinter sich lassen. Es gibt keinen von anderen Menschen angelegten Weg mehr, der dem Blick Orientierung und den Füßen Halt böte, sondern man überschreitet eine Grenze, am besten in eine Gegend, in die noch kein Mensch seinen Fuß gesetzt hat. Man kann kein Essen mehr kaufen, nirgends in die Wärme einer Gaststube einkehren. Eine kleine Gruppe Menschen oder eine Einzelperson ist dort, wie man es ausdrückt, »ganz auf sich gestellt«. Wer einen Berg im Alleingang besteigt, ist zudem der Einsamkeit ausgesetzt, die ihn verrückt machen kann. Auch die Furcht, einen Fehler zu begehen, ist dann stärker, denn es gibt keine Helfer weit und breit. Die Sauerstoffflaschen, die aus der Zivilisation mitgenommen werden, scheinen dieses »Auf-sich-gestellt-Sein« einzuschränken, zu verfälschen; es ist dann eben doch noch eine Hilfe aus der Zivilisation da. Und in einem mehr oder weniger begrenzten Rahmen ist das ja immer so. Die Bergschuhe, die Eispickel, die Seile aus Kunstfaser, die Plastikschneebrillen, die Anoraks, alle Bestandteile der Ausrüstung sind von anderen entwickelt und heute industriell hergestellt worden, nicht von den Bergsteigern selbst. Vielleicht wollen deshalb manche Menschen nicht einfach nur in die Wildnis gehen, sondern wie die Menschen der Steinzeit in dieser Wildnis auch noch alles, was sie brauchen, selbst erzeugen und nicht aus einer arbeitsteilig organisierten Produktion beziehen, in der Spezialisten mit Künsten und Maschinen, die man selbst nicht beherrscht und zur Verfügung hat, einen mit Kleidung und Nahrung ausstatten.
Ich selbst wollte als Jugendlicher auch in die Wildnis, zwar nicht auf den Mount Everest, aber immerhin nach Lappland, in den Sarek-Nationalpark, und dort gehen, wo es keine Wege gibt, nicht den »Kungsleden« entlang mit seinen Schutzhütten, sondern querfeldein, durch Sümpfe und Flüsse, über Berge und Geröllfelder. Viele junge Leute, vor allem Männer, wollen auf diese Weise in die Wildnis. Das liegt nicht nur an ihrer überschießenden Kraft und Unruhe, sondern auch daran, dass ihnen bis dahin immer geholfen worden ist; von Eltern, Großeltern und Lehrern, damit sie in der Gesellschaft, in der sie einmal leben sollen, »die richtige Rolle« spielen. Diesem Ziel scheinen sich einige zumindest für eine Weile entziehen zu wollen, ohne etwas an die Stelle des Vorgegebenen setzen zu können. Deshalb mag es manchen so scheinen, als wüssten sie noch gar nicht, was sie eigentlich aus sich heraus leisten oder wollen können, oder etwas pathetisch gesprochen: als wüssten sie noch nicht, wer sie eigentlich sind, nur für sich betrachtet. Die Wildnis, in der es keine vorgegebenen Ziele gibt und wohin man selbst nur das Ziel des Überlebens mitbringt, scheint deshalb der ideale Ort, um in Erfahrung zu bringen, was man kann und will, unabhängig von den Vorgaben der Gesellschaft. Sie wird dann zu einem Ort der Selbstfindung. Wer sein Selbst sucht, muss freilich erst einmal annehmen, dass er eines hat. Man sucht nichts, von dem man nicht annimmt, dass es es auch geben und es gefunden werden könnte.
II
Auch der 22-jährige Student Christopher McCandless brach im Jahr 1990 erst zu einer Reise mit dem Auto, dann mit dem Kajak und schließlich zu Fuß auf; zunächst durch den Süden der USA und am Ende nach Norden in die Wildnis von Alaska.6 Sein Vater wollte ihn nach dem ersten Studienabschluss als Belohnung für seine erfolgreiche Arbeit an der Hochschule mit einem neuen Auto ausstatten. Das wies er zurück. Die Familie erwartete auch, dass er nach seinem sehr guten Examen an der Emroy-Universität von Atlanta auf die Harvard Law School wechselt. Doch anstatt seine Bildung an einer Elite-Universität fortzusetzen, spendete er all sein Geld, 24.000 Dollar, der Nothilfeorganisation Oxfam und machte sich allein auf den Weg. Fasziniert von den Schriften Jack Londons, eines anderen Alaska-Verehrers, und als ein Leser der sogenannten »transzendentalistischen« Philosophen und Naturromantiker Ralph Waldo Emerson und Henry David Thoreau, erwartete McCandless eine höhere Lebensintensität, ja eine spirituelle Erneuerung von einem einsamen abenteuerlichen Leben in der Wildnis. An einen Freund schrieb er:
»So viele Leute leben in unglücklichen Umständen und ergreifen trotzdem nicht die Initiative, um ihre Situation zu ändern, weil sie darauf abgerichtet worden sind, ein Leben in Sicherheit, im Konformismus, im Althergebrachten zu führen. Das alles mag dem Gemüt seinen Frieden geben. Aber in Wirklichkeit zerstört nichts den abenteuerlichen Geist in einem Menschen mehr als eine abgesicherte Zukunft. Der innerste Kern des lebendigen Geistes eines Menschen ist seine Leidenschaft für das Abenteuer. Die Lebensfreude entsteht aus unserer Konfrontation mit neuen Erfahrungen. Und deshalb gibt es keine größere Freude als den unendlich sich entfernenden Horizont, jeden Tag unter einer neuen Sonne zu sein. Wenn Du mehr aus Deinem Leben machen willst … musst Du Deine Neigung für monotone Sicherheit verlieren und einen halsbrecherischen Lebensstil annehmen, der Dir zuerst verrückt erscheinen mag. Aber wenn Du Dich an ihn gewöhnt hast, wirst Du seinen ganzen Sinn und seine unglaubliche Schönheit sehen.«7
In der Schule war McCandless ein hervorragender Langstreckenläufer gewesen, der auch seine Mitschüler hart trainierte, indem er mit ihnen sogenannte »killer runs« über unwegsames Gelände, querfeldein durch Wälder und über Baustellen veranstaltete. Um seine Kameraden zu motivieren, schilderte er ihnen das Laufen als eine Art spirituelle Übung: Sie sollten sich all das Böse und den Hass in der Welt vorstellen und dann ausmalen, dass sie gegen diese Mächte anzurennen hätten.8 Die rigorose körperliche Anstrengung als moralischer Kampf. Gegen Ende seiner Schulzeit erwog er die Organisation eines bewaffneten Kampfes gegen die Apartheid in Südafrika. Er nahm die moralischen und politischen Probleme in der Welt ernst, sehr ernst, und forderte als ein Leser Tolstois, dass nur eine praktische Umkehr der ganzen Menschheit diese Probleme lösen könne.
Erst spät erfuhr McCandless, dass er das Kind aus der zweiten Ehe seines Vaters war und sein Vater die Beziehung zu seiner Mutter lange Zeit vor seiner ersten Frau verheimlicht und eine Art Doppelexistenz geführt hatte. Eine tiefe moralische Erschütterung zerstörte das ideale Bild des Vaters, eines sehr erfolgreichen Elektroingenieurs und Unternehmers. Dem Wunsch des Vaters, er möge an einer privaten Elite-Universität weiterstudieren und eine bedeutende akademische Karriere machen, wollte er deshalb nicht entsprechen: Karrieren, meinte er, seien eine »erniedrigende Erfindung des 20. Jahrhunderts«, eine »Belastung und nicht ein Gewinn«.9 Die Vorstellung, sein Leben allein in den moralisch und politisch korrupten Verhältnissen der zivilisierten Gesellschaft zuzubringen und den Ratschlägen des ebenfalls moralisch korrupten Vaters zu folgen, stießen McCandless ab. Sein Biograf Krakauer, ebenfalls ein Abenteurer und Bergsteiger, schreibt, dass er McCandless von den Empfindungen seiner eigenen Jugend her gut verstehen könne. Denn wenn er, Krakauer, Gipfel erklomm und sich dabei Gefahren aussetzte, erschien ihm die ganze Welt in einem helleren, intensiveren Licht, die Lebensgefahr brachte seine Existenz scheinbar auf eine höhere Ebene, die Welt wurde erst in diesen risikovollen Umständen zu einer wirklichen.10 Diese höhere Ebene ist für Personen wie McCandless nicht einfach nur im wörtlichen Sinn »höher«, sondern vor allem im moralischen, ja spirituellen.
Dass die gesellschaftliche Wirklichkeit, auch die familiären Umstände, nicht den moralischen und politischen Idealen entsprechen, die einem in der Schule vermittelt werden, müssen alle Jugendlichen irgendwann ernüchternd feststellen. Doch die meisten arrangieren sich mit dieser Einsicht, erkennen, dass die wirkliche Welt ein Kompromiss ist, dass das Leben in ihr zwar unter bestimmten Idealen stattfindet, diese aber nie tatsächlich 1:1 zu verwirklichen sind. Für einige besondere Menschen sind solche Kompromisse jedoch eine Entwirklichung ihres Lebens. Sie stellen für sie eine Unreinheit dar. Nennen wir diejenigen, denen die »gewöhnliche Welt« so erscheint, »die Ernsthaften«. Das Leben, das nicht den Idealen entspricht, ist für diese Ernsthaften kein wirkliches Leben, so wie ein Tisch, der nicht den euklidischen Maßen eines Kreises entspricht, für einige mathematische Rigoristen kein wirklich runder Tisch ist. Manche derer, die so empfinden, entdecken die Lebensgefahr in der Wildnis dann als einen Ausweg aus der Ernüchterung über die kompromissbehaftete Welt. Die von Menschen unangetastete wilde Natur ist für sie rein im Unterschied zur verdorbenen Zivilisation. Und auch das eigene Leben wird in dieser wilden Natur vermeintlicherweise wieder gereinigt, denn in lebensgefährlichen Situationen in der Wildnis sind keine Kompromisse mehr möglich. Entweder man übersteht die Lebensgefahr, oder man übersteht sie aufgrund eines Fehlers, den man macht, eines Fehltritts oder einer Fehleinschätzung des Wetters, eben nicht. Entweder man schafft es auf den Gipfel, oder man schafft es nicht. Die von Menschen unberührte Natur ist nicht das unvollkommene Abbild eines Systems von moralischen und politischen Idealen, sondern ist einfach das, was sie ist. Ihre Wirklichkeit ist nicht wie die der zivilisierten Menschenwelt verhandelbar. Wer die Grenze von der zivilisierten Welt in die Wildnis überschreitet, begibt sich aus einer verhandelbaren menschlichen Welt in eine nicht verhandelbare nichtmenschliche Welt.