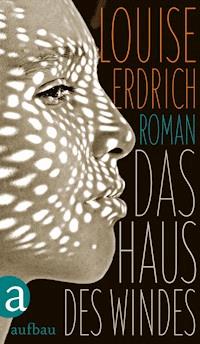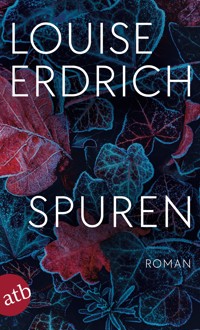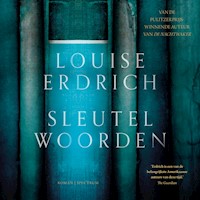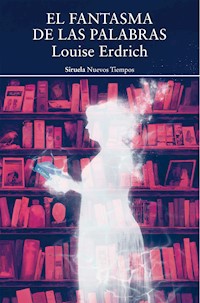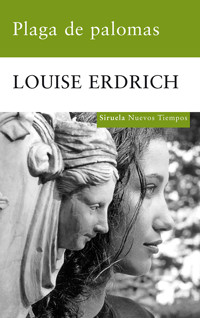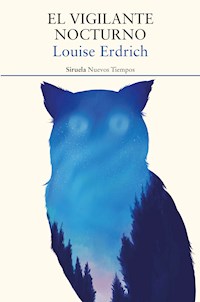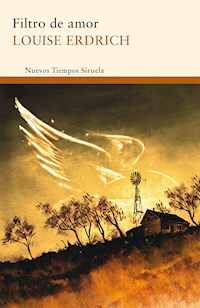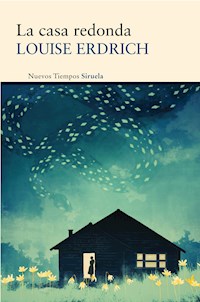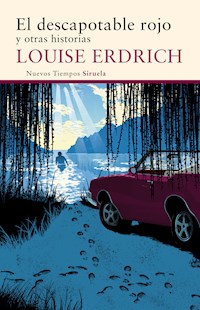15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mehr als ein halbes Jahrhundert hat Vater Damien Modeste sich ganz in den Dienst seines geliebten Stammes der Ojibwe im abgelegenen Reservat Little No Horse gestellt. Nun da sein Leben zu Ende geht, muss er fürchten, dass das große Geheimnis seines Lebens doch noch ans Licht kommen könnte: er ist in Wahrheit eine Frau. In ihrem bislang nichts ins Deutsche übertragenen Meisterwerk erkundet Louise Erdrich das Wesen der Zeit und den Geist einer Frau, die sich gezwungen fühlte, sich selbst zu verleugnen, um ihrem Glauben dienen zu können.
Ein Buch mit Herz, großartig erzählt.
»Lustig und elegisch, absurd und tragisch.« New York Times.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Louise Erdrich
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Sie erhielt den National Book Award, den PEN/Saul Bellow Award und den Library of Congress Prize. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Im Aufbau Verlag ist zuletzt ihr Roman »Der Gott am Ende der Straße« erschienen, und im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Liebeszauber«, »Die Rübenkönigin«, »Der Club der singenden Metzger«, »Der Klang der Trommel«, »Solange du lebst«, »Das Haus des Windes« und »Ein Lied für die Geister« lieferbar.
Gesine Schröder übersetzt seit 2007 aus dem Englischen und hat u.a. Jennifer duBois und Curtis Sittenfield ins Deutsche übertragen. Nach Aufenthalten in den USA, Australien, Indien, England und Kanada lebt sie in Berlin.
Informationen zum Buch
Mehr als ein halbes Jahrhundert hat Vater Damien Modeste sich ganz in den Dienst seines geliebten Stammes der Ojibwe im abgelegenen Reservat Little No Horse gestellt. Nun da sein Leben zu Ende geht, muss er fürchten, dass das große Geheimnis seines Lebens doch noch ans Licht kommen könnte: er ist in Wahrheit eine Frau.
In ihrem bislang nicht ins Deutsche übertragenen Meisterwerk erkundet Louise Erdrich das Wesen der Zeit und den Geist einer Frau, die sich gezwungen fühlte, sich selbst zu verleugnen, um ihrem Glauben dienen zu können. Ein Buch mit Herz, großartig erzählt.
»Lustig und elegisch, absurd und tragisch.« New York Times
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Louise Erdrich
Die Wunder von Little No Horse
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder
Inhaltsübersicht
Über Louise Erdrich
Informationen zum Buch
Newsletter
Figurenstammbaum
Prolog: Der alte Priester – 1996
Teil eins: Die Transfiguration der Agnes
Kapitel 1: Nackte Frau am Klavier – 1910–1912
Kapitel 2: Im Bann der Traube – 20. März 1996, drei Uhr morgens
Kapitel 3: Little No Horse – 1996
Teil zwei: Tödliche Bekehrung
Kapitel 4: Der Weg nach Little No Horse – 1996
Kapitel 5: Geistergespräche – 1912
Kapitel 6: Kashpaws Ehefrauen – 1912
Kapitel 7: Das Fest der Jungfrau – 1912–1913
Kapitel 8: Maries Beichte – 1996
Teil drei: Erinnerung und Verdacht
Kapitel 9: Der Rosenkranz – 1919–1920
Kapitel 10: Geistermusik – 1913–1919
Kapitel 11: Der erste Besuch – 1920–1922
Kapitel 12: Das Publikum – 1922
Kapitel 13: Die Enthüllung – 1923
Kapitel 14: Lulu – 1996
Kapitel 15: Lulus Leidensgeschichte
Teil vier: Die Leidensgeschichten
Kapitel 16: Father Damien – 1921–1933
Kapitel 17: Awun und Mary Kashpaw – 1940
Kapitel 18: Le mooz oder Nanapushs letztes Jahr – 1941–1942
Kapitel 19: Das Wasserglas – 1962
Kapitel 20: Nächtliche Heimsuchung – 1996
Kapitel 21: Des Rätsels Kern – 1996
Kapitel 22: Father Damiens Leidensgeschichte – 1996
Epilog: Eine Faxnachricht aus dem Jenseits – 1997
Nachbemerkungen
Impressum
Nindinawemaganidok
Vier Schichten gibt es über der Erde und vier Schichten darunter. Manchmal bewegen wir uns im Traum oder in unseren Werken durch diese Schichten, die auch Raum und Zeit sind. Indem wir Nindinawemaganidok oder meine Verwandten sagen, sprechen wir von allem, was in der Zeit existiert hat, vom Bekannten und Unbekannten, dem Ungesehenen, dem Offensichtlichen, dem, was vor uns gelebt hat oder jetzt in den Welten darüber und darunter lebt.
Nanapush
Prolog Der alte Priester1996
Auf den Schattenseiten der Hügel und Senken des Reservats lag Raureif, doch die Morgenluft war von milden südlichen Winden beinahe warm. Father Damien erlebte seine besten Stunden spätabends oder kurz nach dem Erwachen, wenn er nur einen Becher heißes Wasser zu sich genommen hatte. Er war alt, sehr alt, aber geistig rege, solange er nichts essen musste. In der museumsreifen Soutane saß er in seinem Lieblingssessel und schaute auf den Friedhof hinaus, der sich gleich hinter dem verwilderten Garten seines Altersruhesitzes über einen flachen Hügel erstreckte. Seine Gedanken durchdrangen die klare Luft, das Gewirr der Äste, die über den Grabsteinen wogten, die Wolken, den Himmel, ja sogar die Zeit – straff und flink sprangen sie aus ihm hervor, einer nach dem anderen, bis er sein winziges Frühstück aus Toastbrot und Kaffee einnahm. Danach erschlaffte sein Verstand. Er pflegte dann wieder ein wenig zu dösen, oft bis in seinen Mittagsschlaf hinein.
In letzter Zeit wurde er oft von Schlaftrunkenheit befallen, meist vor dem Abendessen und manchmal, was am peinlichsten war, während er samstags die Nachmittagsmesse las. Wenn er wieder ganz wach war, zog er sich den Abend über an seinen Schreibtisch zurück und verbat sich dort jegliche Störung. Dann verfasste er glühende politische Streitschriften, strenge geistliche Sendschreiben, Beobachtungen über das Leben im Reservat für Geschichtszeitschriften sowie Gedichte. Zudem brachte er lange Texte zu Papier, die er als Berichte bezeichnete und an den Papst verschickte – seit 1912, seit Beginn seiner Amtszeit im Reservat, hatte er jeden einzelnen Heiligen Vater angeschrieben. Bei dieser Arbeit trank Father Damien stets ein paar Schlückchen Wein, und bis es Zeit wurde, sich schlafen zu legen, war er meist »befriedet«, wie er es nannte. Diesmal allerdings zeigte der Wein die gegensätzliche Wirkung – er verschärfte seinen Eifer noch, statt ihn zu dämpfen, trieb die Spitze seines billigen Füllfederhalters schneller über das Papier und bündelte seine Gedanken.
An Seine Heiligkeit den Papst
Vatikan, Rom, Italien
Letzter Bericht von den Wundern in Little No Horse
Niedergeschrieben von
Father Damien Modeste
Eure Heiligkeit, ich spreche aus unerhörter Ferne zu Ihnen. Ich habe so viel zu erzählen und so wenig Zeit. Mich hat in der letzten Zeit eine entsetzliche Schwere befallen. Das muss wohl bedeuten, dass nun doch noch die Stunde meines Todes naht; deshalb diese Vertraulichkeit und diese Hast. Ich hoffe, Sie können mir meine Unbeholfenheit vergeben, denn zum Korrigieren bleibt mir keine Zeit!
Meine Handschrift ist zum Verzweifeln zittrig, aber hoffentlich dennoch lesbar.
Ich weiß nicht einmal, ob meine bisherigen Berichte bei Ihnen angekommen sind– die Korrespondenz reicht insgesamt bis zum Beginn dieses Jahrhunderts zurück, doch die neuesten gingen naturgemäß an Sie. In meine Briefe sind Zeugnisse aus verschiedensten Quellen eingeflossen, unter anderem aus Beichten. Einmal habe ich die Identität einer Mörderin geheim gehalten, eine Seelenqual, die mich noch heute peinigt. Aeternus Pater, es muss genug Material in Ihrem Besitz sein, um mehrere Tresorräume voller Aktenschränke zu füllen. Darf ich, da dies der letzte meiner Berichte sein wird, diesmal endlich auf Ihre Antwort hoffen?
Hier unterbrach sich Father Damien und rückte gereizt seinen hölzernen Bürostuhl zurecht. In seinem Kopf pulsierten Lichter. Er warf den Füllfederhalter hin, dass es klapperte, und starrte geistesabwesend auf die säuberlich sortierten Umschläge und Karteikarten, das Briefpapier, die Briefmarken und die Akten in den Fächern seines Sekretärs. Er fand es oft tröstlich, Kleinigkeiten zu ordnen, und jetzt, wo er mit seinen Ausführungen unzufrieden war, begann er Papierstapel zu begradigen und Schreibgeräte nebeneinander anzuordnen. Das hielt ihn eine Weile beschäftigt, bis er begriff, was ihn so sehr bedrückte. Offenbar durfte man keine Antwort erwarten, o nein, das wäre schließlich viel zu menschlich! Eine persönliche Antwort des Papstes nach Jahrzehnten treuer Korrespondenz. Konnte man es so überhaupt nennen, wo dieses Wort doch ein Mindestmaß an Gegenseitigkeit suggerierte, zumindest den Anschein eines Austauschs? In all der Zeit hatte Father Damien noch nicht einmal einen Formbrief zurückerhalten. Selbst eine Autogrammkarte wäre besser als nichts gewesen, und nicht einmal die hatte er bekommen. Es war ein einseitiges Gespräch, das er hier führte, ein Monolog, der getreulich und beharrlich nach der Wahrheit strebte und seine Sorgen darüber kundtat, was sich jenseits des mit Eicheln übersäten Rasens, hinter der Hecke, dort drüben zwischen den geweißten Klostermauern zugetragen hatte …
Ein großer Schluck Rotwein. Diese schmerzliche Klarheit – war sie vielleicht dem Rebensaft zu verdanken? Es musste ein besonders potenter Jahrgang sein. Father Damien griff nach der Flasche und betrachtete das Etikett. Ein obskurer Beaujolais, kräftig und fruchtig, den ein fürsorgliches Gemeindemitglied auf seiner Türschwelle hinterlassen hatte. Ja, es war der Wein, französischer Wein, blaurot auf der Zunge und klar, der ihn zu Vorwürfen verleitete, wo jede Schuldzuweisung nutzlos war. Seine Stimmung hob sich. Immerhin – Father Damien lehnte sich, das Glas an den Lippen, zurück und nahm einen kleineren Schluck – war der Papst ein viel beschäftigter Mann! Hatte er etwa Zeit für dieses elende Nest und für einen beharrlichen, nichtsnutzigen Geistlichen, der nicht einmal mehr gerade Zeilen schreiben konnte, ohne ein Lineal zu Hilfe zu nehmen wie ein Schulkind? Keine Zeit, keine Zeit für den Nonsens oder die ungeheuerlichen spirituellen Vorgänge, deren Zeuge ich geworden bin. Keine Zeit.
Wiewohl mir nicht die Ehre einer Antwort zuteilwurde, habe ich jahrzehntelang nie darin nachgelassen, von den ersten Tagen meiner Arbeit auf diesem entlegenen Posten an, jene ungewöhnlichen Ereignisse niederzuschreiben, die zu Spekulationen über den Seligenstatus einer gewissen Schwester Leopolda führten, die jüngst (wenn auch vielleicht nicht vollständig) verstarb. Zwar nicht formell vom Beichtgeheimnis entbunden, habe ich es dennoch nach zahllosen in peinigender Selbstbefragung zugebrachten Nächten für meine Pflicht gehalten, einen Teil der Belege zusammenzustellen, die mir in jenen langen Selbstgesprächen im Beichtstuhl vorgetragen wurden.
Ich hoffe, dass der Ernst meiner Aufgabe es in diesem speziellen Fall rechtfertigt, dass ich gebeichtete Sünden weitererzähle. Wie gesagt, habe ich das in mich gesetzte Vertrauen nicht leichtfertig missbraucht. Ohne irgendeinen Ihrer Vorgänger im Besonderen beschuldigen zu wollen, muss ich doch gestehen, dass es mir sehr geholfen hätte, hätte der eine oder andere Papst es sich angelegen sein lassen, mir in dieser Frage Orientierung zu geben. Zweifellos, o Quell des Glaubens, muss es dafür Gründe außerhalb meines Gesichtsfelds geben, Dinge, die meinen Verstand übersteigen. Mag sein, dass das Schweigen von jenseits meiner bescheidenen Grenzen eine Prüfung gewesen ist, ein Maßnehmen meiner Beständigkeit, meines Glaubens.
Falls ja, soll dieser letzte Bericht meine Standhaftigkeit beweisen.
Und wieder die brennenden Hände, Arthritis, und ein Schreibkrampf dazu. Father Damien legte den Stift diesmal behutsam beiseite und massierte seine linke Hand mit der rechten, als wollte er ein Tuch auswringen. So viel und so konzentriert hatte er lange nicht mehr geschrieben – seit vielen Wochen oder Monaten nicht. Selbst nach zwei Gläsern Wein flossen seine Gedanken noch so reichlich, dass er beschloss weiterzumachen. Wer wusste schließlich, wie viele Abende ihm auf Erden blieben? Seine Hand am Stiel des Weinglases überraschte ihn – langgliedrig und gekrümmt, herrlich abgenutzt und weich, die ovalen Nägel schildpattfarben. Lange Zeit war er alt gewesen; jetzt war er jenseits von alt. Eine wandelnde Mumie. Dass ausgerechnet er sich als so langlebig erweisen sollte! Ausgerechnet! Er fuhr sich über das Haar, die dünnen, schütteren Strähnen, und über die geschwungene Narbe, einen Schnörkel, der viele frühe Erinnerungen durchgestrichen hatte. Das Herz in seiner Brust war so empfindlich, so schreckhaft. Viele einfache Dinge bereiteten ihm jetzt Schwierigkeiten. Kinder zum Beispiel. Er hatte es immer genossen, ihnen zu begegnen, doch jetzt brachte ihr Überschwang ihn durcheinander. Von ihren Stimmen, ihren raschen Bewegungen wurde ihm schwindlig. Er musste sich setzen, sein Herz zur Ruhe bringen und Kraft schöpfen. Auch sein Gehör bereitete ihm Kummer: Manchmal hörte er alles, jeden Unterton der Chopin-Préludes, die er auch jetzt noch, wenn auch linkisch tastend, spielte, jedes Rascheln seiner Laken; dann wieder verschwand alles im Rauschen eines unsichtbaren Meers.
Dennoch war er noch immer ein exzellenter Beichtvater. Sein Hörgerät voll aufgedreht, beugte er sich dicht an das Gitter. Sündenbekenntnisse zu hören, über die Geschichten seiner Mitmenschen nachzusinnen und diese schließlich mit großer Geste von ihren Verfehlungen zu absolvieren, die Sünder rein und frei aus der Kirche zu entlassen, das war Father Damien das Liebste der Sakramente. Er vergab ihnen mit peinlichst genauer Milde, aber immer rückhaltlos, und war stolz auf die originellen Bußen, die er sich passend zu den jeweiligen Sünden überlegte. Den Büßern gefielen sein ehrliches Interesse an ihren Schwächen und sein teilnahmsvoller Sinn für Gerechtigkeit. Außerdem merkte er es, wenn man ihn belog. Er blickte seinen Schützlingen direkt ins Herz. Das machte ihn beliebt. Es gab Gemeindemitglieder, hatte er gehört, die mit ihren Geständnissen warteten, bis sie ihn den Beichtstuhl betreten sahen, und andere gingen gar sofort wieder nach Hause, wenn einer der jüngeren Kollegen, Father Dennis oder Gothilde, durch die schmale Tür trat. Sündenbekenntnisse anzuhören erforderte all das Taktgefühl und das Wissen, das er in den vielen Jahren unter diesen Leuten erworben hatte. Unter seinen Leuten. Er verwies gern darauf, dass ihn eine der Familien adoptiert hatte, die Familie Nanapush, deren vor langer Zeit verstorbener Ältester sein erster Freund in diesem Reservat gewesen war. Dessen Tochter Lulu war jetzt wie eine Tochter für ihn. Aber ob sie oder ob irgendeiner seiner Freunde, seiner Angehörigen und Gemeindemitglieder etwas ahnte? Konnten sie es sich vorstellen? Man konnte durchaus behaupten, dass Father Damien das Siegel des Schweigens gebrochen hatte, das der Herr allen Geständnissen im Beichtstuhl aufprägte – doch nur einem höheren Beichtvater gegenüber. Was er gehört hatte, wog so schwer, dass er nicht wagte, es einem Kirchenmann vor Ort, wie etwa dem zuständigen Bischof, anzuvertrauen. Sich an den Papst zu wenden, fand er, war kaum anders, als sich Gott zu offenbaren. Und dennoch war ihm nicht wohl dabei, solch eine große Verantwortung allein zu tragen.
Wenn Sie sich bequemen könnten, mir zu antworten, dachte Father Damien jetzt, löschte dann aber seine aufflammende Gereiztheit mit dem nächsten Schluck dieses bemerkenswerten Weins.
Es war eine milde Nacht, und Father Damien erhob sich, um die geisterhafte Luft hereinzulassen. Er schob ein kleines Fenster auf, und das Sirren nächtlicher Grashüpfer und Grillen strömte in sein kleines Arbeitszimmer. Ein unschuldiges, willkommenes Geräusch, das einen sanften, erfrischenden Regen ankündigte. Regen, der alles Schlechte fortspülen, die Welt wieder rein waschen würde. Wenn nur auch er selbst geläutert werden und Vergebung finden könnte! Father Damien atmete den alten, geheimen Schmerz in tiefen Zügen und nahm noch einmal den Füller zur Hand.
Wenn Sie nämlich so gütig sein würden, in Ihren Akten nachzuschauen, dann könnten Sie sehen, dass ich in jeder Hinsicht fromm gewesen und meinem Gelübde stets treu geblieben bin, außer eben was das Beichtgeheimnis angeht.
Da wir schon einmal bei dem Thema der Buße sind, muss ich diesem letzten Bericht noch das Geständnis vorausschicken, dass ich mich in tiefer Demut als Sünder und als Betrüger an Sie wende, der auch seinerseits auf Absolution hofft. Doch damit Ihre Einschätzung alles dessen, was ich zu berichten habe, nicht von dem beeinflusst wird, was ich gestehen will, ehe der Tod mir jede Möglichkeit raubt, mich würdevoll zu offenbaren, will ich diese Erklärung noch ein wenig aufschieben. Zunächst erlaube ich mir, damit zu beginnen, dass ich auf die zahlreichen anderen Berichte verweise, die ich getreulich nach Rom versandt habe. Aufgrund der strengen Geheimhaltung, die ich mir auferlegen musste, habe ich natürlich keine Abschriften meiner Briefe zurückbehalten, sondern mich ganz auf die Heerscharen gewissenhafter Kopisten verlassen, von denen ich Eure Heiligkeit stets umgeben wähnte und die jene umfangreichen Dokumente sicher gelesen und mit Anmerkungen versehen haben, sobald sie die Päpste Pius X., Benedikt XV., Pius XI., Pius XII., Johannes XXIII., Paul VI. und Sie selbst, meinen gütigen ewigen Vater, erreichten.
Mit einem Mal verwandelte sich der Wein in Wasser. Father Damien stockte das Herz bei diesem verkehrten Wunder, und er konnte beinahe sehen, wie ihm Verwirrtheit nebelgleich den Verstand umwölkte. Er steckte die Kappe auf den Füller. Langsam und widerstrebend schaltete er seine Schreibtischlampe aus. Er ließ seinen Augen Zeit, sich an das Mondlicht zu gewöhnen, dann prüfte er auf seinem Brief an den Papst die Tinte und schob das Schriftstück unter einen Stapel Akten. Er stand auf, strich sich sorgfältig die Soutane glatt und näherte sich dem einzigen anderen Möbelstück im Arbeitszimmer – einem glänzend dunklen, eckigen Gehäuse voller Saiten und Tasten, das er wie einen Menschen liebte. Zärtlich strich er über den Lack seines Klaviers wie über den Kopf eines schlafenden Kindes, wandte sich ab und trat auf den kleinen Flur hinaus.
Er ging ins Badezimmer, putzte sich die Zähne, wusch sich gründlich und taumelte erschöpft in seine Schlafkammer, die gerade eben Platz für ein Einzelbett aus frisch weiß lackiertem Eisen, einen kleinen, rechteckigen hölzernen Nachttisch, eine Kommode aus rauem lasierten Kiefernholz und einen nach Zeder duftenden, schmalen Kleiderschrank bot. Father Damien zog an der Schnur seiner Nachttischlampe und überzeugte sich, dass die Tür fest verschlossen war. Erst nahm er den gestärkten weißen Kragen ab und legte ihn sorgsam auf die Kommode. Dann knöpfte er die Soutane auf, stieg heraus und hängte sie auf einen Bügel und an einen Haken. Die schwarze Robe war längst nicht mehr zeitgemäß, doch er mochte sich nicht von dem Kleidungsstück trennen, in dem er seine Berufung gefunden hatte. Mit einer Kleiderbürste fuhr er schläfrig über einige Flusen, klopfte etwas Staub heraus und ließ sich dann auf der Bettkante nieder. Unendlich mühsam beugte er sich vor, zog einen seiner Elchleder-Mokassins aus, wartete ein wenig und nahm den zweiten. Er stellte die Schuhe links und rechts von seinen Füßen auf dem Boden ab.
Als er diese Aufgabe bewältigt hatte, war er außer Atem. Er blieb in seinem Unterkleid auf der Bettkante sitzen und rieb seine Füße aneinander. Sie waren sauber, weißhäutig und wirkten mit ihrem hohen Spann und den festen Sohlen jung. Seine Gedanken wogten mächtig hin und her, doch dann, plötzlich, klarte sein Verstand noch einmal auf. Eine zweite Blüte! Ein verzögertes Echo. Der letzte Schluck Wein hatte ihm doch noch Kraft verliehen. Mit begierigen Gebärden holte Father Damien seinen Notfallbleistift und den Notizblock aus der Nachttischschublade.
Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, denn ich bin schließlich über hundert Jahre alt, befasste sich der erste meiner Berichte mit jenem Ereignis, das mir fürderhin die Richtung vorgeben sollte und mich veranlasste, das Amt anzunehmen, in dem ich Ihnen seither treu ergeben diene. Ohne jeglichen Zweifel an Ihrem außergewöhnlichen Erinnerungsvermögen will ich dort beginnen und endlich die Wahrheit sagen.
Father Damien schrieb weiter in sein Notizbuch. Immer wenn eine Seite voll war, riss er sie heraus und stapelte die Blätter neben sich. Die nackten Füße ließ er über die Bettkante baumeln und schrieb rasch alles nieder, was ihm einfiel. »Drei Uhr morgens«, notierte er, und als Überschrift: »Im Bann der Traube«. Eine und eine halbe Stunde lang kritzelte er schnell und energisch gegen die Erschöpfung an. Dann beugte er sich vor, setzte die Füße auf den Boden und fand sein Gleichgewicht. Er stand auf, zog sich das dünne Unterkleid über den Kopf, schüttelte es aus und hängte es an einen Haken an der Rückseite der Tür. Er war so müde, dass sich die Kammer um ihn drehte. Dennoch hielt er sich an seine Gewohnheit. Er nahm ein ordentlich zusammengelegtes Nachthemd aus der obersten Schublade der Kommode und legte es aufs Bett. Dann schaltete er mit einer langsamen Bewegung die Lampe aus und wickelte in der mondbeschienenen Dunkelheit eine breite Elastikbinde von seinem Brustkorb ab. Seine Frauenbrüste waren klein, welk, unscheinbar wie zerdrückte Blüten. Er zog sich das Nachthemd an und atmete erleichtert auf, dann schlüpfte er unter seine Decke. Augenblicklich war er eingeschlafen. Als ihn nachts schwere Träume bedrängten, drehte er sich um, ohne es zu merken, und verstreute den ganzen Zettelstapel über die Bodendielen.
Teil eins Die Transfiguration der Agnes
1 Nackte Frau am Klavier1910–1912
Gut achtzig Jahre zuvor schlängelte sich durch eine Stadt, die florieren sollte, an einer Farm vorüber, die verschwinden würde, der Fluss dahin – mit dieser Bewegung begann alles, was dann geschah. Die Stadt an seinen Ufern war sehr jung, und ihre Hauptstraße folgte in einer langen Kurve dem Willen eines schlammigen Gewässers voller Gestrüpp, Schlick und Mäander, das den gesamten Ort aus dem von der Eisenbahngesellschaft vorgesehenen strengen, sauberen Bebauungsraster schob. Jedes Frühjahr trat der Fluss über die Ufer und riss Gemüsegärten mit sich fort, obwohl man die Böschungen mit Schüttungen verstärkte und Steine aus alten Mauern und Fundamenten daraufhäufte. Es war ein heillos schwieriger Fluss, einer, der trügerisch zufror und schartig aufbrach, der Jahr für Jahr einen oder zwei in seinem Eiswasser ertränkte. In manchen Abschnitten war es ein toter Fluss, in dem nur Karpfen und Welse hausten. Andere, wilde Passagen lockten Elche aus Kanada bis ins Stadtgebiet. Als das Land an seinen Ufern urbar wurde, fuhren Ruderboote und stattliche Lastkähne von seiner Quelle bis nach Winnipeg, denn unergründlicherweise floss das Gewässer nach Norden. Dem Land gegenüber, das einmal zu Kirchenland und zu einem städtischen Park werden sollte, auf dem zu Minnesota gehörigen Ufer, erstreckte sich eine Farm großzügig flussauf und flussab und rückwärts bis in große aufgeheizte Felder.
Die Bonanzafarm gehörte Oststaatlern, die eine Gießerei in Vermont veräußert und mit dem Geld jene am Fluss gelegene plane Weite erstanden hatten. Solange die Böden jung waren, fuhren sie beeindruckende Ernten ein – sechzig Pfund schwere Rüben, unerhört saftige Weizenähren, Mais auf knüppeldicken Kolben. Dann kamen sechs Heuschreckenjahre, in denen selbst die Stiele der Hacken und Rechen gefressen wurden und sogar ein Kavalleriesoldat, der betrunken in der Einfallschneise der Insekten schlief und den sie teilweise vertilgten. Das Unternehmen erlitt heftige Verluste. Schließlich wurde die Farm unter vier Brüdern aufgeteilt, die ihrerseits je die Hälfte ihres Landes verkauften, so dass, als Berndt Vogel dem jüngsten europäischen Krieg entkam, nachdem er von einem Leutnant sechsmal kräftig, aber nicht abschließend mit dem Säbel bearbeitet und von einem Pferd derart getreten worden war, dass seine Kiefer nie wieder richtig schlossen, gerade ein schönes, friedliches Fleckchen Erde zum Verkauf stand. Während er das Geld zusammenklaubte – indem er den Frauen entsagte, nur billiges Bier trank und sich zwanzig Stunden am Tag verdingte –, um das Grundstück der örtlichen Bank abzukaufen, sollte der Preis dieses Gehöfts weiter und noch weiter fallen und die Erde sich zu großer Zerstörungswut erheben. In Staubfahnen wehte die Hälfte von Berndts fetten Böden über den Horizont, doch ihm blieb genug, um sechs Felder zu bestellen und abzuernten.
So brachte Berndt sich durch. Auf seinem Land gab es eine geräumige Scheune, in der einst Gespanne großer stichelhaariger Percherons und Belgischer Kaltblüter gestanden hatten. Von den Pferden war nur eins geblieben, ein altes, ganz aus grobem Samt, doch in der machtvollen Gleichzeitigkeit seiner Träume regten sich die anderen weiter. Im warmen Atem dieses Tiers arbeitete Berndt am liebsten. Die Scheune war so groß, dass es darin hallte, und nur ein kleiner Teil war noch in Gebrauch – als Stall für eine Kuh, eine Hühnerschar, ein trübsinniges Schwein. Doch Berndt hielt das ganze Gebäude ordentlich instand, nicht nur, weil er als guter Deutscher nichts verkommen ließ, sondern auch, weil er in den breiten, staubglitzernden Lichtsäulen etwas Anbetungswürdiges erkannte.
Im versiegten Atem der Pferde war der Geist der Farm zu spüren. Berndt kümmerte sich hingebungsvoll um den letzten Riesen und malte sich sein Gehöft aus, wie es eines Tages aussehen sollte, groß und geschäftig, mit Arbeitern, die er anleiten würde, mit Küchenbau, Schlafbaracke, Gerätschaften, Frau und Kindern, die wacker mit anpackten. Mit einem Garten, in dem die Saat der duftenden Nelken und der feurig roten Geranien seiner Kindheit ausgebracht wurde und gedieh.
Wie erstaunte es ihn da, als eines Morgens, wie vom Wind gesät und von seinen Träumen heraufbeschworen, eine barfüßige, hagere, verlumpte Frau im offenen Tor seiner Scheune stand. Sie war blass, aber kraftvoll, knochig, eine zähe Pflanze, sehr jung, beinahe kahl und trug ein grobes Unterkleid. Er blinzelte die Erscheinung ratlos an. Licht umfloss sie wie Rauch und wurde von ihrer bittenden Geste aufgewirbelt. Ihre Stimme war tief, rau und barsch: »Ich habe Hunger.«
An ihrer Aussprache erkannte er, dass sie Schwäbin war und daher – er versuchte, den Gedanken fortzuschieben – im Bett gewisse ungebärdige Angewohnheiten haben musste. Sie sprach mit heiserer, gebieterischer Stimme weiter. Er fuhr sich über die Augen. Durch den durchscheinenden Musselin konnte er erkennen, dass ihre Brüste mit Stoffstreifen fest an den Körper gebunden waren, was ihn nur umso mehr erregte. Er kniff die Lider zu und öffnete sie wieder. Als ihre Blicke sich trafen, schwindelte es ihn, weil hier ein weibliches Wesen nicht errötend zu Boden schaute, sondern ihm mit ehrlicher menschlicher Gelassenheit standhielt. Berndt glaubte, sie müsse eine Dirne und aus dem Freudenhaus geflohen sein – war Fargo schon so groß geworden? Oder sie sei vielleicht einem bösartigen Ehemann entronnen. Dass sie von Gott kam, konnte er nicht wissen.
Schwester Cecilia
In der Stadt am anderen Ufer des Flusses gab es ein Nonnenkloster aus gelben Ziegeln. Das Baumaterial, von frommen Spediteuren aus der Ziegelei von Little Falls durch halb Minnesota herbeigefahren, bewahrte den eigenartigen schwefeligen Motten-Goldton des Lehms im Umkreis jener Stadt in sich. Auf jedem Ziegel war in flach eingeprägten Lettern das Wort Fleisch zu lesen. Fleisch Company Brickworks. Sie waren den Nonnen zum Selbstkostenpreis überlassen worden. Natürlich wurde das Wort bei jedem Stein, den man ins Mauerwerk fügte, mit Mörtel bedeckt. Doch die jüngste Nonne wusste, weil sie einige hinter dem Haus entsorgte Ziegel als Sockel für ein Vogelbad verwendet hatte, wann immer sie die stumme Ordnung der Klostermauern vor sich sah, dass sie inmitten der heimlichen Wiederholung dieses einen Wortes lebte.
Noch vor sechs Monaten hatte sie Agnes DeWitt geheißen. Jetzt war sie Schwester Cecilia – kahl geschoren, Gott geweiht, in schwarze Wolle gekleidet und mit gestärktem Leinen in wärmelosem Weiß gebunden. Sie unterrichtete Musik nicht nur, sondern lebte in ihr, existierte einzig für jene Stunden, in denen sie ganz ihrem Wesen entsprechen konnte – einem Wesen zur Hälfte aus Musik, zur Hälfte aus göttlichem Licht und nur in dem Maße Fleisch, wie es sich nicht verleugnen ließ. An der Klaviatur, von den Tönen eingenommen, die unter ihren Händen entstanden, trat ihre Essenz zutage, manifestierte sich als fesselnder Klang. Sie hatte langgliedrige, nervige Hände, die sich erschreckend weiß gegen ihren Habit abhoben. Damit sie geschmeidig blieben, rieb die Schwester sie abends mit Schmalz, Schafsfett oder Butter ein – was auch immer sie in der Küche ergattern konnte. Wenn sie tagsüber Arbeiten korrigierte oder an der Tafel stand, zuckten und trommelten ihre Hände, übten wieder und wieder diffizile Fingersätze. Sie machte niemandem Schwierigkeiten, und ihr Gehorsam war absolut. Nur dass sie mit zunehmender Hingabe Brahms, Beethoven, Debussy, Schubert und Chopin interpretierte.
Dabei vernachlässigte sie nie ihre anderen Pflichten, sondern es war das Klavierspiel selbst – ein Destillat der Sehnsucht –, das die anderen Schwestern verstörte. In der Musik erkundete Schwester Cecilia tiefe Emotionen. Aus der Phrasierung sprachen ihr Glaube und ihr Zweifel, ihre Leidenschaft als Braut Jesu, ihre Einsamkeit und Scham und die schlussendliche Erlösung. Brahms klang nachdenklich, wenn sie ihn spielte, und Schubert rätselhaft. Ihr Debussy, den sie im Einband einer Bach-Messe versteckt hielt, war durch und durch künstlich und dennoch anmutig wie der Gesang der Lerche. Beethoven konnte alles bedeuten, doch spielte sie seine Crescendi ohne rechte Überzeugung. Was aber Chopin anging, kam sie ganz ohne die blumigen Ausschmückungen, ohne die ständigen Triller und faden Verzierungen aus, die zu jener Zeit üblich waren. Ihr Spiel war von äußerster Ehrlichkeit. Und ein einfach gespielter Chopin verheert das Herz. Manchmal brachte eine Pause zwischen den schmerzlichen Klagelauten einer Moll-Passage die Schwestern zum Weinen, die gerade den Boden schrubbten, so dass die in Tränen gebadeten Dielen des Klosters fortan mit menschlicher Stimme knarrten. Im ganzen Haus füllte sich die Luft mit Seufzern.
Schwester Cecilia dagegen wurde immer leerer. Dünner. Es war, als würde ihre Seele säuberlich mit einem Strohhalm abgezapft und in den grünen Tümpel der Stille eingeleitet, der unter ihren plätschernden Notenkaskaden lag. Eines Tages packte sie eine süße Qual und ließ wieder nach, packte sie fester und entlud sich stärker, bis eine langsame Hitze ihr in die Hände stieg, die Arme hinauf, ihr in die Spitzen der gebundenen Brüste stach und dann abwärtsrauschte.
Sie riss die Hände von den Tasten los, krümmte sich wie angeschossen, sah gelbe Punkte vor ihren Augen tanzen und erlebte schließlich eine Woge friedvollen Einsseins, die rückhaltlose Kommunion. Sie war ganz von der Musik umschlossen, von ihr gehalten, vollständig erfasst. So unschuldig war sie, dass sie ihr Erlebnis nicht als sexuellen Höhepunkt begriff, sondern glaubte, ihre Gefühle seien die natürliche Folge davon, dass sie diese spezielle Nocturne, so gut sie konnte, gemeistert hatte – und so kam es dann. Chopins Geist wurde ihr Gespiele. Seine Vorzeichen liebkosten sie. Seine ganzen Noten sanken wie blanke Flusskiesel in ihren Leib. Seine lyrischen Triller waren flatternde Zungen. Die Pausen vor einem abfallenden Melodiebogen brachten sie fast um den Verstand.
Die Oberin begriff, dass etwas geschehen musste, als sie selbst eines Morgens, ihr Gesicht von Schweiß und Tränen nass, zu dem suggestiv sanften Largo des Préludes in e-Moll erwachte. Bei den Klängen erinnerte sie sich an den Tod ihrer Mutter und versank im ewigen Nachmittag dieses Verlusts. Den ganzen Tag über wuchs in ihrem Herzen ein Keim der Wut auf einen Gott, der einer Siebenjährigen die Mutter nahm, die vollkommen fraglos ihre Welt gewesen war – Herz, Arme, Rat und Seele –, bis sie abends spürte, wie aus ihrem erhitzten Knochenmark der schiere Hass dampfte, und sich Einhalt gebot.
O Gott, vergib mir, betete die Oberin. Sie erwog Prostrationen zur Buße, eilte dann aber in das Klavierzimmer, sammelte mit der ganzen Kraft ihrer langen alten Arme sämtliche Noten bis auf Bach zusammen und versteckte sie vor Schwester Cecilia.
Einige Wochen lang herrschte Erleichterung. Schwester Cecilia wandte sich den Inventionen und Sinfonien zu. Ihre Finger regten sich mit insektengleicher Präzision. Sie spielte jede der Übungen, als wollte sie einen luftdichten Behälter zimmern. Heimlich holte die Oberin, als die Schwester zu anderen Werken überging, noch Bachs Goldberg-Variationen aus dem Schrank und vernichtete sie – waren sie doch offenbar geeignet, den Geist in untergründige Komplikationen zu verwickeln. Das Klosterleben ging seinen normalen Gang. Die Köchin hörte zur allseitigen Freude auf, die schwere, mit ranzigem Gänseschmalz versetzte Rotrübensuppe ihrer Jugend aufzutischen, und hielt sich wieder an verkochte Brechbohnen, Weißkohl und Kartoffeln. Die Bodendielen schwiegen und wurden frisch gewachst. Die Türen flogen nicht länger unvermittelt auf und ließen sich leise schließen. Es rauschte nicht ständig Wasser durch die Leitungsrohre, weil die Schwestern die neue Installation nicht länger nutzten, um den Ausdruck ihrer Gefühle zu übertönen.
Doch dann erwachte Schwester Cecilia eines Tages mit Beklemmungen im Herzen. Ein Schmerz fuhr ihr in die Brust, und der rote Muskel darin schlug um sich wie ein Wildtier in einer Knochenfalle. Die Kehle schnürte sich ihr zu. Ihre Hände strebten zu den Tasten und verharrten in einem gedehnten Auftakt. Dann fand sie sich jäh in einer treibenden Mazurka wieder. Die Musik kehrte zu ihr zurück. Ein schwacher Duft von Gardenien kam auf – seine Tropenhaus-Boutonnière. Sein seidig schweres braunes Haar. Die scharfe, sinnliche Schweißnote eines Salonlöwen. Auch seine Stimme hörte sie, lebhaft und heiter. Es war, als hätte der Komponist höchstselbst das Klavierzimmer betreten. Und wer weiß? Es konnte ja kein verzweifelteres, bedürftigeres irdisches Herz als Cecilias geben. Es musste ja irgendetwas nach dem Tode übrig bleiben, so kümmerlich es auch sei.
In jedem Fall spielte sie Chopin. Und spielte mit vollkommener Natürlichkeit, bis die Mutter Oberin sich gezwungen sah, den Deckel der Klaviatur zu schließen und sanft den Hocker fortzuziehen. Cecilia hob den Deckel und spielte auf Knien. Die erschrockene Alte riss sie von den Tasten los. Cecilia kroch wieder hin. Die Oberin ließ sich, mit ihrer Weisheit am Ende, neben dem Mädchen zu Boden sinken und ermahnte sie zu beten. Sie redete Cecilia erst noch zögernd, dann mit wachsender Gewissheit zu, es sei der Teufel selbst, der sich durch die klappenden Türen der Sechzehntelnoten in ihre Seele geschlichen habe. Ihre Befürchtung bestätigte sich gleich darauf, als die sanftmütige Schwester ihre Fäuste erhob und auf die Tasten einschlug, als wäre das Instrument ein Fels, der ihren Durst stillen sollte. Doch es kamen nur Missklänge heraus.
»Mein Kind, mein liebes Kind«, beschwor die Mutter Oberin sie, »komm und ruhe dich aus.«
Die junge Nonne widersetzte sich schwer atmend. Ihre ernsten grauen Augen waren rot gerändert, ihre Lippen violett. Sie litt Folterqualen. »Für mich gibt es keine Ruhe«, verkündete sie, und dann löste sie ihren Schleier und legte sorgsam Stück für Stück ihren Habit ab. Ehrfurchtsvoll faltete sie jedes Teil und legte es auf den Klavierhocker. Die Oberin redete ihr bei jedem Schritt in den zärtlichsten und mitfühlendsten Tönen zu. Doch so, wie tief in die Musik versunken die Jungfrau zur Frau geworden war, so wurde nun aus der Frau im Habit eine Frau durch und durch. Sie zog sich bis auf das Unterkleid aus, aber nicht weiter.
»Er würde nicht wollen, dass ich schutzlos hinausgehe«, sagte sie zu der Mutter Oberin.
»Gott?«, fragte diese verwundert.
»Chopin«, antwortete Cecilia.
Sie küsste die bebenden Hände ihrer lieben Mutter und kniete sich hin. Gesenkten Hauptes sprach sie ein Reuegebet, und dann ließ sie das Kloster hinter sich, das aus jenen gelben Ziegeln mit dem vom Mörtel verborgenen geheimen Wort gebaut war, und mit ihm die Musik, ihre Noten, welche die Oberin von da an als Gefahrengut unter Verschluss hielt.
Miss Agnes DeWitt
Schwester Cecilia war es also, oder Agnes DeWitt aus dem ländlichen Wisconsin, die Berndt Vogel in seiner kavernösen Scheune erschien und in der Sprache ihrer Mutter – da sie einen Deutschen erkannte, wenn sie ihn vor sich sah – zu ihm sagte, dass sie hungrig sei. Sie wollte auch fragen, ob er ein Klavier besitze, aber es war offensichtlich, dass dem nicht so war, und außerdem überkam sie die Erschöpfung.
»Jetzt muss ich schlafen«, sagte sie, nachdem sie einen halben Teller angebrannte Hafergrütze mit frischer Milch gegessen hatte.
Also führte er sie zu seinem Bett, dem einzigen, das es gab, in der Ecke einer ansonsten leeren Kammer. Er selbst ging in seine geliebte Scheune, deckte sich mit Heu zu und lag die ganze Nacht wach. Er lauschte dem Rascheln der Mäuse und spürte das lautlose todbringende Gleiten der Schleiereulen und das ungelenke Flattern der Fledermäuse. Gegen Morgen beschloss er, sie zu heiraten, wenn sie ihn nähme, nur damit er von ihren Brüsten die lange Stoffbinde abwickeln dürfte, die ihren Rumpf umschlang. Sie schlug sein Angebot aus, erzählte ihm aber, wer sie war und woher sie kam. Diesen ersten Lebensbericht beendete sie mit den Worten, sie dürfe niemals wieder heiraten, denn sie sei nicht nur mit ganzer Seele eine Braut Christi gewesen, sondern ihm untreu geworden – mit ihrem Phantomgeliebten, dem polnischen Komponisten – und habe daher bereits ein zu schweres Schicksal durchlitten, um je den Bund der Ehe einzugehen. Mit diesen Erläuterungen tat sie nur den Eröffnungszug in einem Spiel der Gesten und der Worte, das sich monatelang zwischen den beiden entspinnen sollte. Sie ahnte nicht, dass sie einen zähen, unnachgiebig Gegenspieler herausgefordert hatte.
Berndt Vogel wurde mit Herz und Verstand von seiner Leidenschaft ergriffen. Er machte sich gefasst. Da er Munitionskisten durch hüfttiefen Schlamm geschleift hatte, nachdem die Pferde qualvoll verendet waren, da sein bester Freund vor seinen Augen in einen brüllenden Klumpen Fleisch umgeschaffen worden war, da er mit Horden eifriger Läuse und an entsetzlicher Nahrung fett gefressener Ratten enge Bekanntschaft hatte schließen müssen, war er für die Qualen der Liebe leidlich gerüstet. Doch sie hatte ebenfalls harte Disziplin gelernt, und außerdem – wird doch das Herz des schwachen Geschlechts von frühester Kindheit an für seine heißen Pflichten gestreckt, geschmiedet, geformt und in der Glut gehärtet – war sie eine Frau.
Die beiden gingen einen vorläufigen Handel ein und teilten sich die Haushaltsführung. Agnes schlief weiterhin im Wohnhaus. Berndt blieb in der Scheune. Ein Monat ging vorüber. Zwei. Jeden Morgen entfachte sie das Herdfeuer und kochte, erhitzte Wasser für die Wäsche und reinigte die kühlen Holzfußböden. Montags nähte sie. Den ganzen Dienstag verbrachte sie mit Backen. Mittwochs butterte sie und putzte. Am Donnerstag verkaufte sie die Butter und die Eier. Schlachtete freitags je eines der Hühner. Samstags überquerte sie die Brücke in den Ort, um im Keller der Volksschule Klavier zu spielen. Sonntags saß sie bei der Messe an der Kirchenorgel und begann am Abend mit der Arbeit der nächsten Woche. Berndt bezahlte sie überreichlich. Anfangs stattete sie sich von dem Lohn noch mit Bekleidung aus. Erst als sie Schuhe, Strümpfe, baumwollene und auch wollene Unterwäsche und den Stoff für zwei Hauskleider beisammenhatte – eines mit blauen Beeren und verschlungenen Blättern gemustert und eines mit einem Gitter aus Efeuranken –, dazu eine Strickjacke und schließlich einen Mantel; als sie eine Decke, ein Kissen und sogar ein Paar Stiefel erworben hatte, entschied sie sich für ein Klavier.
Bei der Gelegenheit versuchte Berndt sie in ein Ehebündnis zu manövrieren, doch sie erwies sich als zu gewandt. Es war früher Abend und der Garten von mildem Grashüpfergezirp erfüllt. Sie saßen auf der Veranda und tranken gezuckertes Zitronenwasser. Hin und wieder blinkte in den alten, mannshohen Gräsern, die am Rande des Gartens gediehen, ein Glühwürmchen auf oder rief eine Taube ihre fünf dumpfen Töne.
»Warum sind es in Vogelliedern so häufig fünf?«, fragte Agnes träge.
»Fünf was?«, fragte Berndt.
Sie tranken gemächlich, sie in ihrem Beeren-und-Blätterkleid, das die Taille versteckte. Er stellte enttäuscht fest, dass sie jetzt normale Unterwäsche trug und aufgehört hatte, ihre Brüste zu binden. Vielleicht, dachte er, konnte er sie überreden, nur gelegentlich und nur für ihn zu ihrer alten Gewohnheit zurückzukehren. Doch es war eine schwache Hoffnung. Sie sah so behaglich aus, so frei. Sie wirkte deutlich kräftiger. Dünn war sie noch immer, doch ohne die anämische Blässe. Sie hatte ein jungenhaft kantiges Kinn und einen starken, eleganten Hals. Ihre Arme waren braun gebrannt und sehnig. Wenn die Sonne schien, sprühte ihr Haar, das in Locken nachwuchs, grüngoldene Funken, und ihre Augen waren trügerisch klar.
»Ich könnte Musikunterricht geben«, sagte sie zu ihm. »Klavier.« Sie hatte beschlossen, dass es nach einer rein praktischen Erwägung klingen sollte, nach einer Verdienstmöglichkeit. Also erwähnte sie nicht, wie gut sie spielen konnte, und ließ sich keinen Eifer, keine Freude anmerken, obwohl schon bei dem Gedanken jeder einzelne winzige Muskel in ihren Händen vor Sehnsucht schmerzte. »Das würde etwas Geld einbringen.«
Darüber ließ sie Berndt erst einmal nachdenken. Er hätte Miss DeWitt ihren Gleichmut auch beinahe abgenommen, hätten ihre ruhelosen Finger sie nicht verraten, deren beharrliches Trommeln er bemerkte. Sie spielte auf den Armlehnen ihres Stuhls das Adagio der Pathétique, ein Stück aus ihrer Kindheit, das hin und wieder von ihren Nerven Besitz ergriff.
»Dazu bräuchtest du ein Instrument«, stellte er fest. Sie nickte und erwiderte seinen Blick auf ihre distanzierte, unerhört erotische Art, die ihn schon zu Anfang ins Herz getroffen hatte.
»So etwas schenkt ein Mann seiner Ehefrau«, wagte er zu sagen.
Ihre Hände erstarrten. Sie schlug voller Abscheu die Augen nieder.
»Ich kann in den Ort gehen und auf dem Schulklavier spielen. Mit dem Direktor habe ich schon gesprochen.«
Berndt betrachtete ihren Fußknöchel, der schimmerte wie ein drei viertel voller Mond, und ihre braunen Schuhe mit den dicken Sohlen. Er wollte diesen Fuß in seinen Schoß legen, mit den Zähnen die Schnürung lösen, ihre Wade mit Küssen bedecken, seine Hände aufwärtswandern lassen und in die zarten Falten belaubten Stoffes atmen.
Er bot ihr zum zweiten Mal die Heirat an. Sein Herz. Seine Treue. Seine Farm. Sie verschmähte alles. Das Klavier. Sie wollte einfach in den Ort hinüberlaufen. Er beteuerte, er habe nichts dagegen, ein Klavier zu kaufen, so sei es nicht, aber es gebe im Umkreis von vielen Meilen keinen Laden, der so etwas führte. Sie wusste es besser und beschrieb voller hitziger Ungeduld, wie sie, wenn sie nur das Geld von ihm bekäme, das beste Instrument zum günstigsten Preis ausfindig machen und beschaffen würde. Sie erklärte, dass sie es nicht in Fargo, sondern in Minneapolis kaufen wollte. Von dort könnte sie es günstiger liefern lassen als zu üblichen Preisen. Sie wollte mit dem Zug dorthin fahren, den Kauf innerhalb eines Tages abwickeln und noch in der Nacht zurückkehren, so dass sie keinen Cent für zusätzliche Verpflegung oder eine Unterkunft auszugeben brauchte. Als er sich dennoch nicht überzeugen ließ, sagte sie, sie werde ihn verlassen. Sie wolle sich im Ort ein kleines Zimmer nehmen und dort Schüler empfangen und Stunden geben.
Ihre Verzweiflung wurde offensichtlich. Sie verriet sich mit ihren verkrampften Fingern. Berndts unverbrüchliche Liebe zu ihr und sein Wunsch, sie glücklich zu machen, bewegten ihn vielleicht noch eher zum Nachgeben als die Angst, sie könnte ihn verlassen. In den Monaten, seit er Agnes DeWitt kannte, war sie zu einer festen Größe geworden. Selbst für ihn, der mit Selbstaufgabe und Leid wohlvertraut war, war die Nähe zu ihr schwer zu ertragen. Er arbeitete bis zur Erschöpfung, und seine Farm florierte. In der Scheune zu schlafen war unbequem, doch er baute in eine der Wände eine Schlafkammer für sich und einen Hofknecht ein. Darin stellte er einen Ofen auf, der in besonders kalten Nächten auf kleiner Flamme brannte. Manchmal allerdings, wenn er vor dem Einschlafen auf die glutroten Rundungen dieses Ofens schaute, fuhren seine Hände unwillkürlich über die Matratze, wie sie eines Tages über ihre Hüften gleiten würden, wenn sie ihn je ließe. Auch er hatte zu üben begonnen.
Der Caramacchione
Der letzte Flügel aus dem Hause Caramacchione war nach Minneapolis verschifft worden und ein Ladenhüter geblieben, bis Agnes DeWitt mit ihrem Sparstrumpf das Geschäft betrat. Sie lernte einen Spediteur aus Morris kennen, der ihr einen günstigen Preis für den Transport im Lastkarren machte. Zu zweit brachten sie das Instrument während der Hundstage zur Farm zurück. Feuchtheißes Wetter behagte diesem Klavier. An schwülen Tagen stimmte es sich selbst. Während der Flügel durch die planen, von Dürre ausgezehrten Weizenfelder dahinzog wie ein Schild, ein umgestürztes schwarzes Etwas, eine Heuschrecke aus Ebenholz, stieg Miss Agnes DeWitt hinten auf den Wagen und spielte den Wolken etwas vor.
Eine Hauswand musste herausgestemmt werden, um den Flügel in die gute Stube zu bekommen, und es brauchte am nächsten Tag vier starke Männer dazu. Als das Instrument seinen Platz am Fenster eingenommen hatte, war Berndt schon von seiner Notwendigkeit überzeugt und sogar stolz. Er schickte die Männer weg, obwohl eine Seite des Hauses noch immer das wirbelnde Sternenlicht hereinließ. Eine dunkle Brise bauschte die Vorhänge; er bat Agnes zu spielen. Sie tat es. Die Musik packte sie, und sie hörte nicht auf, konnte nicht aufhören.
Spätnachts erst wandte sie sich von dem letzten Akkord der einfachen Nocturne in c-Moll Berndts aufmerksamem Lauschen zu. Drei langsame Klatscher seiner großen Hände erstarben in der erwartungsvollen Stille. Seine Augen ruhten auf ihr, und sie erwiderte den Blick, indem sie ihn lange mit einem rätselhaft zärtlichen Ausdruck betrachtete. Die offene Wand ließ einen großen Schwall Mondlicht ein. Spinnen webten ihre schimmernden Netze in die schwarze Leere. Berndt ging alles durch, was er wusste – heiraten würde sie ihn nicht, denn zumindest in ihren eigenen Augen war sie vermählt und treulos gewesen. Er wollte sie um keinen Preis abschrecken, vergraulen, die Stimmung verderben, die mit dem Sausen der herabstoßenden, wieder fortflatternden Nachtfalken kam, mit dem Rascheln der Färbereichen und Weiden, dem Duft der letzten aufgeplatzten Wildrosenblüten. Ihm sank der Mut so tief wie nie. Aus schierer Not und Ergriffenheit trat er schließlich vor Agnes hin und sagte leise: »Schlaf mit mir. Bitte. Schlaf mit mir.«
Agnes schaute ihm offen in die Augen, ließ endlich die große Gefühlslast durchblicken, die sie in sich trug, wenn auch nicht für ihn. Wie im Angesicht der Mutter Oberin legte sie ihre Kleidung ab und faltete sie sorgsam, nur dass sie diesmal nicht beim Unterkleid aufhörte, sondern zuletzt auch die hauchdünne Pluderhose auszog und sich nackt an den Flügel setzte. Ihr Körper war ein blasser Silberschimmer, und als sie die Hände regte, hoben und senkten sie sich so leicht wie Wasser.
Berndt Vogel begriff, als die Musik ihn umhüllte, dass er für das, was ihm hier geboten wurde, einer Fargoer Hure, falls es in Fargo denn tatsächlich Huren gab, eine Menge Geld hätte zahlen müssen. Eine dunkle, bewegte Schlange zuckte ihren Rücken hinunter. Ihre Hinterbacken schienen über der unsichtbaren Bank zu schweben. Ihre Beine pumpten wie die eines Schwimmers, und Berndt glaubte sie stöhnen zu hören. Er sah ihre Finger wie bleiche Schatten über die Tasten huschen und spürte, dass sein Körper reagierte, als lägen sie eng umschlungen unter einer Decke aus Musik und Sternen. Sein Atem ging schnell und schneller, heiser, keuchend. Hilflos stöhnte er auf und ergoss sich schmerzhaft in einen verborgenen Spalt aus Halbtönen und Ärger, der sich unterhalb der Eiseskälte hoher Noten auftat.
Erschrocken, benommen und feucht stand Berndt auf und schlich durch die offene Wand ins Freie. Er trat wirre Fußpfade in seine Felder, bis er sich endlich erlaubte, in der gedämpften Wucht nächtlichen Weizens hinzusinken. Auf dem Rücken liegend, biss er eine spelzige Ähre ab und kaute auf den süßen Kernen. Dann stimmte es also, dachte er, dass das Herz ein Lügner und Betrüger war. Und da die Stücke, die Chopin komponiert hatte, nicht weniger zu dem Mann gehörten als sein Körper, hatte Berndt soeben dabei zugesehen, wie die Frau, die er liebte, sich einem Toten hingab. Nicht genug damit, hatte er sich gegen seinen Willen in eine seltsame Erregung hineingesteigert und den Boden befleckt, der von Agnes frisch geschrubbt und gewachst war. Als er jetzt aus der Distanz wieder ihrem Klavierspiel lauschte, überlegte er, zurückzukehren. Stellte sich das Festmahl ihrer weißen Schultern vor. Schloss die Augen und erkundete die verstörende Tiefe zwischen ihren Beinen.
Segnungen
Dann kam ihre beste Zeit. Sie schufen sich ein gutes Leben und verschmolzen das Sexuelle so mit dem Alltäglichen, dass jede Arbeit, jede kleine Aufmerksamkeit mit erotischer Spannung aufgeladen war. Agnes DeWitt war vielleicht zu weltfremd, um zu begreifen, was für eine kostbare Gabe sie und Berndt verband. Sie erlebte mühelos eine Form der Liebe, die viele niemals kennenlernen und für die sie dennoch zu sterben oder den Verstand zu verlieren bereit wären. Und Agnes hatte nichts weiter dafür tun müssen, als in der Scheune eines guten Mannes aufzutauchen, der für gewöhnliche Zärtlichkeiten ebenso begabt war wie für die tieferen Tonlagen menschlicher Liebe.
Den Herbst und den Winter über gab Agnes Musikunterricht, und obwohl sie nicht verheiratet waren und Miss DeWitt, da sie in Sünde lebte, nicht die heilige Kommunion empfangen wollte, schrieben sich selbst Katholiken und deren Kinder für ihre Stunden ein. Es war weithin bekannt, dass Miss DeWitt sich in erster Ehe dem Heiland versprochen hatte. Da schien es verständlich, dass sie nicht noch einmal heiraten wollte, und wenn sie auch an der Eucharistie nicht teilnahm, kam sie doch zuverlässig und fromm zu jeder Morgenmesse in die Kirche. Als daher der Priester von der Kanzel sprach, wussten alle, auf wen er sich bezog.
»Jesus hat darauf bestanden, Maria Magdalena in den heiligen Leib seiner Kirche aufzunehmen, und mancher sagt über sie, aus ihren Händen sei himmlische Musik geflossen. In ihrem Herzen brannte die Flamme wahren Glaubens, und man liebte sie und vergab ihr.«
So kam es, dass Miss DeWitt jeden Morgen die Kirchenorgel spielte. Natürlich spielte sie Bach in größter Reinheit, ohne jegliche abgründigen Gefühle, strikt und einzig für Gott.
Arnold »der Mime« Anderson
Ihr Glück währte noch nicht lange, da wurden die Farmen und die kleinen Städte der Umgebung von einer Bankräuberbande mit einem schnellen Overland-Automobil geplündert. Damals hatten viele Kleinstädte keinen eigenen Sheriff, geschweige denn ein Fahrzeug, mit dem man die Vorreiter solcher Verbrecher wie Basil »die Eule« Banghart, Ma Bakers Jungs, Alvin Karpis oder Henry LaFay hätte stellen können. Der Erste und Heimtückischste von ihnen war Arnold »der Mime« Anderson.
Der Mime und seine Kumpane zogen kreuz und quer durch die Lande, erschienen wie aus dem Nichts und suchten mit gnadenloser Leichtigkeit die Dörfer heim. Das Automobil – dessen Farbe mal als Weiß, dann als Grau und vom Nächsten gar als Blau beschrieben wurde – hielt immer mit laufendem Motor vor den Türen der Bank. Der Passagier, der ihm entstieg, konnte ein alter Mann sein, eine Schwangere oder ein Krüppel, aber immer jemand, der in anderen Hilfsbereitschaft weckte. Bald öffnete ein barmherziger Samariter ihm die Tür, begleitete den Mimen gar zum Schalter, woraufhin der Adressat dieser Wohltaten sich aufrichtete, seine Verkleidung abwarf, mit gellender Stimme seine Komplizen rief und sämtliche Wertsachen raubte. Im Nu war alles wieder vorbei. Dann und wann kam es vor, dass ein Bankangestellter oder ein unrettbarer Weltverbesserer ihm Widerstand entgegenbrachte, und dann konnte es passieren, dass es ein, zwei Tote gab – denn der Mime, der die Kostüme entwarf und die Raubzüge seiner Bande plante, war ein skrupelloser Mann, dem ein Menschenleben nichts bedeutete. Man sagte ihm nach, er habe eine charmante, ja humorvolle Art, die Leute zu erschießen. In den zwei Jahren zuvor waren acht Menschen laut lachend gestorben.
Eines heiteren, aber schlammfeuchten Tages im Frühjahr holte Miss Agnes DeWitt ihre Einnahmen vom Verkauf der Butter und der Eier aus einer Lücke zwischen zwei Steinen im Kartoffelkeller. Sie sagte zu Berndt, dass sie zur Bank gehen wolle, um mit dem Geld einen Teil des Darlehens zu tilgen. Er nickte zerstreut. Berührte sie am Arm. Sie hatten eine atemlose Woche hinter sich. Morgens taumelten sie benommen aus der Schlafkammer, von dem Duft und dem animalischen Verlangen des anderen noch wie betrunken. Solche fieberhaften Phasen ereilten sie wie Wetterumschwünge von Zeit zu Zeit. Dann versanken sie, magisch angezogen, bis zum Verschwinden in ihrer Gier aufeinander, bis die Kuh nach ihren Melkern brüllte oder der Knecht fluchend an die Haustür pochte. Wenn niemand sie störte, konnte nur die Erschöpfung sie zum Aufhören bewegen. Dann musterten sie einander mit scheelen, fragenden Blicken wie zwei Wildfremde und nahmen erst allmählich wieder ihren normalen Umgang auf, die beiläufige, zerstreute und doch vertrauliche Art zweier Menschen, die ähnlich denken. Selbst wenn sie stritten, wirkten sie ungeduldig und nicht ganz bei der Sache. Sie konnten es nicht erwarten, zum erregenden Teil ihres Disputs zu kommen, wenn sie die Beherrschung verloren und wenn Zornesschauer in Begierde umschlugen, damit sie ein wenig grausam zueinander sein und sich dann der Zärtlichkeit hingeben konnten.
Er schob sie gegen die Wand, hielt mit einer Faust ihr Kinn und ließ die andere Hand unter ihre Röcke gleiten, bis sie nach Luft schnappte und seinem Drängen scheinbar nachgab. Als er dann allerdings seinen Gürtel löste, um in sie einzudringen, schubste sie ihn weg, duckte sich unter seinem Arm hindurch, rannte zur Tür hinaus und lachte über seine ungelenken Hüpfer und sein Protestgeschrei. Sie verlangsamte ihre Schritte auf dem nassen, tief gefurchten Weg und dachte tief atmend an die nächste Nacht. Die Nacht, in der sie ihn nicht wieder von sich stoßen würde. Das weite Himmelsgewölbe hatte sich im Nordwesten bedrohlich bleigrau verdunkelt, doch das Unwetter war noch fern und ein unschlüssiger Wind bewegte die klare, feuchte Luft. Wie ein zartgrüner Schleier sprangen Knospen auf. Die ersten Tulpen waren an den Rändern ihrer grünen Lippen rosig, zum Blühen bereit. Unter den zähen Steppengräsern sammelten neue Triebe Kraft. Agnes dachte an Berndts Kopf, wenn er ihn in den Nacken warf und die Sehnen an seinem Hals sich spannten. Daran, wie er beinahe weinte, wenn er seinen ausgehungerten Leib wieder und wieder mit ganzem Gewicht gegen ihren warf, und wie er sie wenig später mit begehrlichen Seitenblicken streifte, bis sie von vorn begannen. Ihr Verlangen nach ihm überspülte sie wie eine Welle, und sie blieb stehen, fuhr sich zerstreut mit der Hand über das Gesicht, hätte den Gang in den Ort um ein Haar verschoben und lief dann doch weiter.
Die Bank war ein massiver Kasten aus Nebraska-Kalkstein mit tiefen goldgelben Simsen vor den großzügigen Fenstern und Messingbeschlägen an den Türen. An der Zinnplatten-Decke der Schalterhalle gruppierten sich kunstvoll gearbeitete Kronen um eine Mittelrosette aus Weizengarben. Den Sommer über wälzten große Ventilatoren die träge Hitze um, und dann verharrten die Samtkordeln und Spucknäpfe, die Schaltertresen aus grauem und rosafarbenem, glimmerfleckigem Granit und die Schalterkäfige in einer gedämpften, stummen Ordnung, während draußen die Stadt unvermindert weiterlärmte. Der Erwerb des Geldes, ein mühseliges, chaotisches Unterfangen, kontrastierte mit seiner Verwahrung – einem Vorgang, der auf der beruhigenden Prämisse beruhte, alles menschliche Streben und Leiden, ja selbst die Zeit könne gemessen und gezählt und ordentlich gestapelt in einem Safe eingeschlossen werden.
An jenem Tag, als Miss DeWitt zügig in den Ort marschierte, waren die Straßen ungewöhnlich ruhig und wohlgeordnet. Selbst der Stadtstreicher, der an einer jungen Ulme lehnte, hatte im Schlaf die Arme akkurat gekreuzt, und das einsame Automobil, das mit laufendem Motor vor dem Bankgebäude parkte, war ein elegantes Modell, wie es – ja, seltsam, das dachte sie tatsächlich –, wie es ein Bischof benutzen würde. Und wirklich war es ausgerechnet ein Priester, der seine schwarze Soutane raffte, um sich von der Rückbank zu erheben. Mild und zaghaft blinzelnd, blickte er durch kleine randlose Brillengläser zur Eingangstür auf und begann die Stufen zu erklimmen. Dabei verneigte er sich vor Miss DeWitt, die respektvoll hinter ihn zurückfiel. Als sie beide dem mit Kordeln markierten Weg durch die Schalterhalle folgten, sprach sie ihn in amüsiertem Tonfall laut und deutlich an: »Was soll die Maskerade, Sir? Sie sind kein Priester.«
Woraufhin der gebeugte Alte sich streckte, wie von Zauberhand breitschultriger wurde und sich so über das Gesicht fuhr, wie sie es auf dem Weg in die Stadt getan hatte, um ihre lüsternen Gedanken abzustreifen – nur dass er seine ganze Persönlichkeit abstreifte. Auch die Brille nahm er ab und zog unter seiner Tracht einen Taschenrevolver hervor, mit dem er sodann auf Miss DeWitts Stirn zielte.
»Stimmt auffallend«, sagte er.
Sonst war kein Signal auszumachen, doch im nächsten Moment hatte auch ein anderer Kunde eine Waffe gezückt, die er erst auf das Kinn einer erschrockenen rotschopfigen Schalterbeamtin richtete, dann auf die Brust ihres empörten schwarzhaarigen Kollegen. Diesem jungen ehemaligen Baseball-Star schwoll gleich das Herz in besagter Brust. Er wollte ein Held sein und wusste nur noch nicht, wie. Töricht! Töricht!, hätte Miss DeWitt ihm am liebsten zugerufen. Ihr war gleich klar, dass er genau das richtige Maß Tapferkeit besaß, um sich totschießen zu lassen. Was er dann auch tat. Als er hinter seinem Eisengitter zusammenbrach, den Mund in Erwartung einer brillanten Pointe leicht geöffnet, wurde es schwieriger, an das Geld zu kommen. Der Rotschopf bekam einen Sack gereicht und wurde angewiesen, das Schubfach zu öffnen, ohne den Alarm auszulösen. Als sie es dennoch tat, trieb man alle achtzehn Kunden, darunter auch Agnes, in einer Ecke hinter einer Samtkordel zusammen. Wie eine Herde tumber Schafe, dachte Miss DeWitt. Draußen ertönten Rufe. Der Sheriff des Ortes, Slow Johnny Mercier, der seinem Spitznamen alle Ehre machte, und sein Hilfssheriff kamen mit Pistolen im Anschlag zur Bank gelaufen. Sie gingen vor dem Eingang in Stellung und riefen den Ganoven zu, sie sollten herauskommen.
Agnes DeWitt begriff, und mit ihr auch die anderen Kunden, dass der Sheriff ein Amateur war und der einzige Profi sich mit ihnen in der Bank befand. Der Mime nämlich wies die Rothaarige ruhig an, mehr und immer mehr Geldbündel in den Sack zu häufen. Dann sprang er mit wölfischer Gewandtheit in seiner mattschwarzen Soutane mit den verräterischen Falten, mit denen ihn keine Haushälterin oder Nonne von Ehre vor die Tür hätte treten lassen, und in seinen lächerlichen braunen Pontifikalschuhen auf die eingepferchten Menschen zu und wählte die Dame gleich hinter der Kordel: Miss Agnes DeWitt.
Er wählte sie, wie man seine Tanzpartnerin auswählen würde. Nur eine Verbeugung hätte noch gefehlt – er trat auf sie zu und ergriff ihre Hand mit einer höflichen, aber bestimmten Geste, die ebenso angemessen gewesen wäre, hätten sie im nächsten Augenblick einen langsamen Walzer aufs Parkett gelegt. Und wirklich vollführten sie eine Art Tanz, während sie die Eingangstür durchschritten, nur dass die Dame falsch herum gehalten wurde. Als sie strauchelte, absichtlich vielleicht, und sich seiner Führung widersetzte, zerrte er sie unsanft näher zu sich heran. Er stieg in den Wagen, ließ sie draußen auf dem Trittbrett balancieren und rief: »Wenn Sie mir folgen, Sheriff, puste ich ihr das Hirn weg!«
Dann ließ der Stadtstreicher, der eben noch unter der Ulme geschlafen hatte, den Motor aufheulen und brauste los. Slow Johnny, der Sheriff, blieb auf der Stelle stehen, hob seine Waffe, zielte sorgfältig, drückte ab und traf Miss DeWitt. Die Kugel drang ihr in die Hüfte. Es geschah so vieles auf einmal – weitere Schüsse, schlingernde Ausweichmanöver vor einem Eistransporter, zwei Kinder, die sich unter einen Fliederbusch retten mussten, die schiere Geschwindigkeit –, dass sie den Treffer nur als Schlag wahrnahm, der sie bis ins Mark erschütterte, ohne dass es schmerzte, bis das Auto über einen Huckel fuhr, der Miss DeWitt fast zum Wagenfenster hineingeschleudert hätte. In dem Moment befiel sie ein beinahe mystischer Zustand der Qual. Der Himmel tat sich auf. Schwarze Sterne regneten auf sie herab. Agnes hörte den Motor und später noch weitere Schüsse wie aus weiter Ferne. Vor ihrem inneren Ohr entspannen sich verschlungene, prachtvolle Melodien. Von einem Arm wie von unbarmherzigen Drähten auf dem Trittbrett festgehalten, sauste sie in traumartiger Geschwindigkeit auf den ordentlich planierten Ausfallstraßen der Stadt dahin und sagte sich in einem Augenblick der Klarheit und konzentrierten Geistesschärfe: Ich werde entführt. Man hat mich angeschossen.
Während das Automobil sie ruckelnd davontrug, begann ihre Zuversicht zu schwinden. Sie flüchtete sich vor dem Schmerz in Gedanken in ihre winzige Zelle im Nonnenkloster. Dort schloss sie die Tür, verkroch sich wie ein Hund in das Gestrüpp der Ohnmacht, kauerte sich klein und unwissend darin zusammen. Dann wieder gab es Atempausen, in denen sie aufrecht stehen konnte. Feierlich ließ sie ihren Blick über die Landschaft schweifen, die sie durchmaß, und entdeckte in den zarten Wolken frühlingshaften Grüns eine rohe Schönheit. Der Bankräuber umklammerte ihre Taille. Sie klammerte sich an den Gepäckträger des Wagens. Ihr aus den Spangen gelöstes Haar flog in der frischen, feuchten Luft wie ein kurzes Banner hinter ihr her.
Der Mime folgte der Patterson Road, woraus Agnes schloss, dass er sich in der Gegend auskannte, und woraus sie außerdem schloss, dass er, wenn er der Abzweigung folgte, an einem von Berndts Feldern – von ihren Feldern – vorbeikommen musste, auf dem Berndt sehr wahrscheinlich arbeiten würde. Ihr Herz begann hoffnungsvoll zu klopfen. Doch der in Lumpen gekleidete Fahrer bog nicht ab, und Agnes war zutiefst erleichtert, dass Berndt nicht in Gefahr geraten würde. Gerade als sie das dachte, tauchten der Knecht und ein Stück weiter Berndt auf seinem großen alten Pferd auf. Er ließ das Tier gemächlich eine Egge ziehen, die repariert werden musste. Agnes wollte sich vor ihm verbergen, doch sie fuhr ja noch immer auf dem Trittbrett. Berndt sah sie schon von Weitem auf sich zukommen wie die Galionsfigur eines Schiffes. Sie war kerzengerade aufgerichtet, und ihr Bein leuchtete blutrot. Berndt hielt. Ihm entgleisten die Gesichtszüge vor Bestürzung. Sie brauste auf Armeslänge an ihm vorüber, dann war sie fort, von der Ferne verschlungen.
Berndt Vogel
Berndt folgte dem Automobil, nicht weil er Angst in Agnes’ Augen gesehen hätte – da war keine, nur verträumte Konzentration –, sondern weil er die Situation erfasste. Er machte die Egge los und wendete sein Pferd, ohne sich Rechenschaft darüber abzulegen, welche Gefahr ihr drohte oder wie er sie retten sollte, rein instinktiv und aus der Absurdität heraus. Er machte sich keine Sorgen um Agnes. Zumal er sie bei ihrer ersten Begegnung halbnackt im rauchigen Glanz seiner Scheune vorgefunden hatte, wusste er, dass sie auch diese Prüfung überstehen würde. Es gab Teile von ihr, an die er nie herankam. Ihm war, als bestünde diese Frau ganz und gar aus Unmöglichkeiten.
Obwohl er sein Pferd zu einem flotten Trab anhielt, geriet das Automobil bald außer Sicht. Er musste den Blick auf die Fahrbahn geheftet halten, um bei jeder Abzweigung an den Reifenabdrücken abzulesen, ob die Räuber weiter der Hauptstraße folgten. Das taten sie und gewannen dadurch einen immer größeren Vorsprung. Er fragte sich, während er sie verfolgte, in nutzloser Verzweiflung, wo Slow Johnny blieb. War er der Bande auf den Fersen?
Nein, noch nicht. Der Sheriff und sein Stellvertreter waren beim Versuch, ein Verfolgungsfahrzeug zu requirieren, nicht so sehr deshalb auf Widerstand gestoßen, weil die Besitzer die Notwendigkeit nicht eingesehen hätten, sondern weil sie von Slow Johnnys erbärmlichen Fahrkünsten wussten. Außerdem fürchteten die zwei, drei Stadtbewohner, an die er sich wandte, er könnte beim Versuch, den Mimen zu stellen, mehr Schaden als Nutzen anrichten und Miss DeWitt könnte am Ende noch vollends getötet werden, sowie womöglich er selbst, der Hilfssheriff und jeder zufällige Passant im Umkreis von zwanzig Metern.