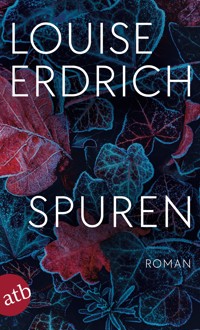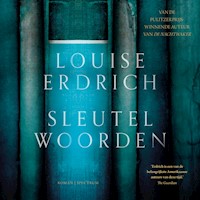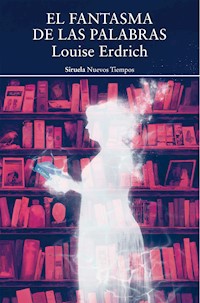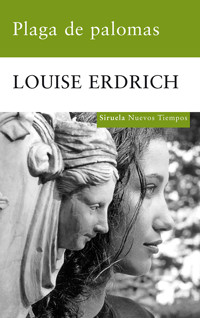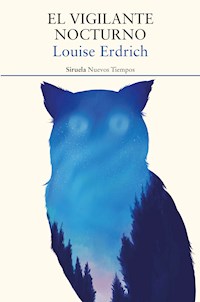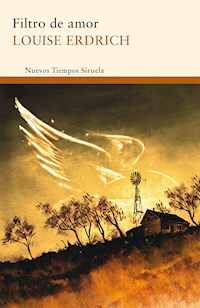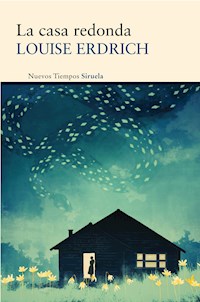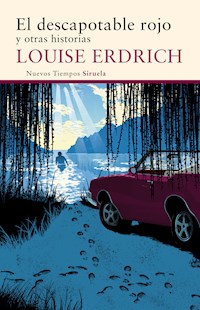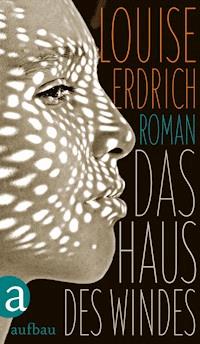
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem National Book Award als bester Roman des Jahres.
Ein altes Haus, eine ungesühnte Schuld und die Brüste von Tante Sonja – Louise Erdrich führt uns nach North Dakota. Im Zentrum ihres gefeierten Romans steht der 14jährige Joe, der ein brutales Verbrechen an seiner Mutter rächt und dabei zum Mann wird.
Monatelang auf der New-York-Times-Bestsellerliste überhäuft mit Kritiker- und Leserlob: Eine der großen Autorinnen unserer Tage hat ein brillantes Buch geschrieben – zart, sehr traurig und doch auch sehr lustig.
»Erdrich erzählt mal deftig, mal zum Weinen traurig, mal unglaublich komisch, aber immer so packend, dass man das Buch kaum aus der Hand legen mag.« SWR3.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Louise Erdrich
DAS HAUSDES WINDES
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Gesine Schröder
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel
The Round House
erschien 2012 bei Harper, New York.
ISBN 978-3-8412-0765-4
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2014
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2014 bei Aufbau, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © 2012, Louise Erdrich
All rights reserved
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung hißmann, heilmann, Hamburg
unter Verwendung eines Motivs von © Hélène Desplechin/getty-images
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Für Pallas
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
KAPITEL EINS – 1988
KAPITEL ZWEI – DIE GEHEIMNISVOLLE KRAFT
KAPITEL DREI – DAS GESETZ
KAPITEL VIER – DER STUMME VERMITTLER
KAPITEL FÜNF – GEDANKENGIFT
KAPITEL SECHS – DAS DUPLIKAT
KAPITEL SIEBEN – PLANET ANGEL ONE
KAPITEL ACHT – RIKERS VERSUCHUNG
KAPITEL NEUN – DER GROSSE ABSCHIED
KAPITEL ZEHN – DIE SCHWARZE SEELE
KAPITEL ELF – DAS KIND
NACHBEMERKUNG
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
KAPITEL EINS1988
Junge Bäume hatten am Haus meiner Eltern das Fundament angegriffen. Es waren bloß Sämlinge mit ein oder zwei kräftigen, gesunden Blättern. Trotzdem hatten die schlanken Sprosse es geschafft, sich durch Spalten in der braunen Schindelverkleidung zu zwängen, die den Beton verdeckte. Sie waren in die dahinter verborgene Hauswand hineingewachsen, und sie loszubekommen war nicht leicht. Mein Vater wischte sich die Stirn und verfluchte sie für ihre Zähigkeit. Ich benutzte einen rostigen alten Unkrautjäter mit geborstenem Griff; mein Vater hantierte mit einem langen, schmalen eisernen Schürhaken, der wahrscheinlich mehr schadete als nutzte. Er stocherte blindlings überall hinein, wo er Wurzeln vermutete, und produzierte dabei lauter praktische neue Löcher im Mörtel für die Keime vom nächsten Jahr.
Immer wenn ich es geschafft hatte, eins der winzigen Bäumchen herauszuziehen, legte ich es wie eine Trophäe auf den schmalen Gehweg, der das Haus umgab. Eschenpflänzchen waren dabei, Ulmen, Ahorn, Eschenahorn und sogar ein größerer Trompetenbaum, den mein Vater in einen Eiscremebottich pflanzte und goss, falls sich ein Platz finden sollte, um ihn wieder auszusetzen. In meinen Augen war es ein Wunder, dass die Bäumchen den Winter in North Dakota überstanden hatten. Wasser hatten sie vermutlich gehabt, aber wenig Sonne und nur ein paar Krümel Erde. Trotzdem hatte jeder einzelne Samen es geschafft, eine hakenförmige Wurzel in die Tiefe zu treiben und einen tastenden Spross ans Licht.
Mein Vater stand auf und streckte seinen schmerzenden Rücken. Das reicht jetzt, sagte er, obwohl er sonst so perfektionistisch war.
Ich mochte aber nicht aufhören, und als er hineinging und meine Mutter anrief, die ins Büro gefahren war, um eine Akte zu holen, spürte ich weiter den verborgenen Wurzeln nach. Er kam nicht wieder, und ich dachte, er hätte sich ein bisschen hingelegt, wie er es neuerdings öfter tat. Spätestens dann, sollte man meinen, hätte ich als dreizehnjähriger Junge Besseres zu tun gehabt. Doch je weiter der Nachmittag voranschritt, je stiller und leiser es im Reservat wurde, desto wichtiger nahm ich es, jeden dieser Eindringlinge loszuwerden, bis hin zu seiner Wurzelspitze, in der sich die Wachstumskräfte bündelten. Anders als so viele achtlos hingeschluderte Haushaltspflichten wollte ich diese Aufgabe gewissenhaft erledigen. Es erstaunt mich bis heute, wie konzentriert ich bei der Sache war. Ich schob meinen gegabelten Eisenstab so dicht wie möglich an dem holzigen Stängel entlang. Jedes Bäumchen erforderte eine eigene Strategie. Es war fast unmöglich, die Wurzeln im Ganzen aus ihrem uneinnehmbaren Versteck zu zupfen, ohne den Trieb abzubrechen.
Schließlich gab ich doch auf, ging ins Haus und schlich mich in das Arbeitszimmer meines Vaters. Ich nahm das juristische Fachbuch aus dem Regal, das er Die Bibel nannte. Felix S. Cohens Handbook of Federal Indian Law. Mein Vater hatte es von seinem Vater geerbt; der rostrote Einband war abgeschabt, der lange Buchrücken gebrochen, und auf jeder Seite gab es handschriftliche Notizen. Ich hatte Mühe, mich an die altertümliche Sprache und die vielen Fußnoten zu gewöhnen. Auf Seite 38 hatte entweder mein Vater oder mein Großvater ein Ausrufezeichen neben den kursivierten Titel eines Falles gesetzt, der mich naturgemäß auch interessierte: Vereinigte Staaten vs. Dreiundvierzig Gallonen Whiskey. Ich vermute, dass einer der beiden den Titel genauso lächerlich gefunden hatte wie ich. Trotzdem bestärkte mich auch dieser Fall in der Überzeugung, dass unsere Verträge mit der Regierung wie Bündnisse zwischen zwei Nationen waren. Dass die Größe und Kraft, von denen mein Mooshum immer sprach, nicht ganz verloren waren, weil sie, bis zu einem gewissen Grad zumindest, noch immer unter dem Schutz des Gesetzes standen.
Ich hatte mich mit einem Glas kalten Wassers in die Küche gesetzt und las, als mein Vater aufwachte und desorientiert und gähnend zur Tür hereinschlurfte. Trotz seiner großen Bedeutung war Cohens Handbuch kein schwerer Wälzer, und ich zog es schnell auf meinen Schoß, unter den Tisch. Mein Vater leckte sich die trockenen Lippen und nahm Witterung auf, nach dem Geruch von Essen vielleicht, dem Geklapper von Töpfen, dem Klirren von Gläsern oder sich nähernden Schritten.
Was er dann sagte, erschreckte mich, obwohl die Worte für sich genommen belanglos waren.
Wo ist deine Mutter?
Seine Stimme klang heiser und rau. Ich ließ das Buch auf den Stuhl neben mir gleiten, stand auf und gab ihm mein Wasserglas. Er leerte es in einem Zug. Er wiederholte seine Frage nicht, sondern wir wechselten einen Blick, der mir irgendwie erwachsen vorkam, so als wüsste er, dass ich sein Buch gelesen und seine Welt betreten hatte. Er sah mir in die Augen, bis ich den Blick senkte. Eigentlich war ich gerade erst dreizehn geworden. Vor zwei Wochen war ich noch zwölf gewesen.
Bei der Arbeit?, fragte ich, um seinen Blick abzuschütteln. Ich war davon ausgegangen, dass er wusste, wo sie war, dass er es bei seinem Anruf herausgefunden hatte. Mir war klar, dass sie nicht wirklich arbeitete. Jemand hatte sie angerufen, und dann hatte sie gesagt, sie wolle im Büro ein, zwei Ordner holen. Als Spezialistin für Fragen der Stammeszugehörigkeit beschäftigte sie sich wahrscheinlich gerade wieder mit einem Antrag. Sie war die Leiterin einer Ein-Mann-Abteilung. Es war Sonntag, deshalb diese Stille. Die Sonntagsnachmittags-Flaute. Selbst wenn sie anschließend noch bei ihrer Schwester Clemence vorbeigeschaut hätte, wäre Mom inzwischen heimgekommen, um Abendbrot zu machen. Das wussten wir beide. Frauen ahnen gar nicht, wie wichtig den Männern ihre Gewohnheiten sind. Ihr Kommen und Gehen senkt sich uns in jede Körperfaser, ihre Rhythmen in unser Knochengerüst. Unser Pulsschlag gleicht sich ihrem an, und wie an jedem Wochenende warteten wir darauf, dass meine Mutter uns auf den Abend einstimmte.
Und deshalb stand ohne sie die Zeit einfach still.
Was sollen wir tun, fragten wir gleichzeitig, was mich schon wieder beunruhigte. Zumindest übernahm mein Vater diesmal die Initiative.
Wir holen sie ab, sagte er. Als ich meine Jacke überzog, war ich trotz allem froh darüber, wie bestimmt das klang – sie abholen, nicht nur suchen, nicht nachsehen, wo sie bleibt. Wir würden losziehen und sie holen.
Sie hat einen Platten, erklärte er. Hat wahrscheinlich noch jemanden nach Hause gebracht und dann einen Platten gekriegt. Diese verdammten Schotterpisten. Wir gehen runter zu deinem Onkel, leihen uns sein Auto und holen sie ab.
Sie abholen, schon wieder. Ich lief neben ihm her. Wenn er erst einmal in Schwung kam, war er noch immer kraftvoll und schnell.
Er war spät Anwalt und dann Richter geworden und hatte spät geheiratet. Auch für meine Mutter war ich überraschend gekommen. Mein alter Mooshum nannte mich Oops; das war sein Spitzname für mich, und leider fanden andere Verwandte ihn witzig. Deshalb werde ich manchmal selbst heute noch Oops genannt. Wir liefen den Hügel runter zum Haus meines Onkels und meiner Tante – einem blassgrünen HUD-Haus, das von schützenden Pappeln und drei edel wirkenden Blaufichten umstanden war. Auch Mooshum lebte dort in einem zeitlosen Dunst. Wir waren alle stolz auf seine extreme Langlebigkeit. Er war uralt, kümmerte sich aber immer noch um den Garten. Wenn er sich draußen verausgabt hatte, legte er sich zum Ausruhen auf ein Feldbett am Fester – ein Reisighaufen, der vor sich hin döste und manchmal ein trockenes, keckerndes Geräusch von sich gab, wahrscheinlich ein Lachen.
Als mein Vater Clemence und Edward erzählte, meine Mutter hätte einen Platten und wir bräuchten ihr Auto, als hätte er diesen mysteriösen kaputten Reifen mit eigenen Augen gesehen, hätte ich fast losgelacht. Anscheinend hatte er sich selbst eingeredet, dass seine Vermutung richtig war.
Wir fuhren im Chevrolet meines Onkels rückwärts die kiesbedeckte Auffahrt runter und machten uns auf den Weg zum Stammesbüro. Umrundeten den Parkplatz. Leer. Die Fenster dunkel. Am Ende der Zufahrt bogen wir rechts ab.
Ich wette, sie ist nach Hoopdance gefahren, sagte mein Vater. Brauchte noch was fürs Abendbrot. Vielleicht wollte sie uns überraschen, Joe.
Ich bin der zweite Antone Bazil Coutts, aber ich würde es jedem zeigen, der ein Junior oder eine Zahl hinter meinen Namen setzt. Oder mich Bazil nennt. Ich hatte schon mit sechs beschlossen, Joe zu heißen. Mit acht fiel mir auf, dass ich den Namen des Vaters meines Vaters gewählt hatte, meines Großvaters Joseph, von dem ich nur die Eintragungen in den Büchern mit den bernsteingelben Seiten und den trockenen Ledereinbänden kannte. Er hatte uns gleich mehrere Regale dieser Antiquitäten vererbt. Es ärgerte mich, dass ich keinen nagelneuen Namen hatte, der mich von der langweiligen Ahnenreihe der Coutts abgehoben hätte – lauter verantwortungsbewussten, aufrechten, gelegentlich sogar heldenhaften Männern, die in aller Stille tranken, hier und da mal eine Zigarre rauchten, ein vernünftiges Auto fuhren und nur dadurch ihren Kampfgeist unter Beweis stellten, dass sie klügere Frauen heirateten. Ich selbst hielt mich für anders; ich wusste nur noch nicht, wie. Ich wusste bloß, während ich meine Sorgen hinunterschluckte und wir nach meiner Mutter suchten, die einkaufen gefahren war – nichts weiter, bestimmt nichts weiter –, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Die Mutter verschwunden. Das war etwas, das dem Sohn eines Richters einfach nicht passierte, nicht einmal in einem Reservat. Ich hoffte vage darauf, dass zumindest irgendetwas passieren würde.
Ich war ein Junge, der es fertigbrachte, einen halben Sonntagnachmittag lang Baumsämlinge aus dem Fundament seines Elternhauses zu pulen. Also hätte ich mich mit der Tatsache abfinden sollen, dass ich eines Tages auch genauso ein Erwachsener werden würde, aber noch wehrte ich mich dagegen. Trotzdem meinte ich, als ich wollte, dass etwas passierte, nichts Schlimmes damit, nur irgendetwas eben. Etwas Seltenes. Eine Entdeckung. Einen Bingogewinn. Allerdings war Sonntag kein Bingo-Tag, und es hätte auch überhaupt nicht zu meiner Mutter gepasst mitzuspielen. Und genau das wünschte ich mir – etwas Ungewöhnliches. Weiter nichts.
Auf halbem Weg fiel mir ein, dass der Laden in Hoopdance sonntags geschlossen hatte.
Natürlich! Mein Vater reckte das Kinn vor, und seine Hände umschlossen das Lenkrad fester. Sein Profil hätte auf einem Filmplakat indianisch gewirkt und auf einer Münze römisch. In seiner kräftigen Nase und dem markanten Kiefer lag etwas Klassisches, Stoisches. Er fuhr weiter, denn vielleicht, so sagte er, hatte sie ja ebenfalls vergessen, dass Sonntag war. In dem Moment kam sie uns entgegen. Da! Sie raste auf der anderen Spur an uns vorbei, voll konzentriert, weit über dem Limit, in Eile, zu uns nach Hause zu kommen. Aber wir waren hier! Wir lachten über ihr verkniffenes Gesicht, machten kehrt und fuhren ihr hinterher.
Sie ist sauer, sagte mein Vater und lachte erleichtert. Siehst du, ich hab’s ja gesagt. Sie hat es vergessen. Ist einkaufen gefahren und hat vergessen, dass der Laden zu ist. Jetzt ist sie sauer wegen dem verschwendeten Benzin. Oh, Geraldine!
Heiterkeit, Bewunderung und Staunen lagen in seiner Stimme, als er das sagte. Oh, Geraldine! Allein diese zwei Wörter zeigten, dass er meine Mutter immer schon und immer noch liebte. Er war ihr unendlich dankbar, dass sie ihn geheiratet und ihm dann auch noch einen Sohn geschenkt hatte, als er längst glaubte, der Letzte in seiner Ahnenreihe zu sein.
Oh, Geraldine.
Er schüttelte den Kopf, lächelte beim Fahren vor sich hin, und alles war wieder in Ordnung, mehr als in Ordnung. Wir konnten jetzt zugeben, dass uns die ungewöhnliche Verspätung meiner Mutter Angst eingejagt hatte. Wir konnten uns wachrütteln lassen und begreifen, wie sehr wir unsere heiligen kleinen Routinen zu schätzen wussten. So wild ich mir auch im Spiegel oder in meinen Gedanken vorkam – diese einfachen Freuden des Alltags bedeuteten mir viel.
Und jetzt waren wir an der Reihe, ihr Angst einzujagen. Nur ein bisschen, sagte mein Vater, nur damit sie einen kleinen Eindruck davon kriegt, wie das ist. Wir ließen uns Zeit damit, das Auto zurückzubringen, und gingen zu Fuß den Berg hoch, diesmal voller Vorfreude auf die entrüstete Frage meiner Mutter: Wo wart ihr denn? Ich sah es schon vor mir, wie sie die Fäuste in die Hüften stemmte. Wie ein Lächeln hinter ihrem strengen Gesichtsausdruck aufblitzte. Sie würde lachen, wenn wir ihr die Geschichte erzählten.
Wir gingen die unbefestigte Auffahrt hoch. Daneben hatte Mom in einer schnurgeraden Reihe Stiefmütterchen angepflanzt, die sie in Milchkartons vorgezogen hatte. Sie hatte sie schon früh ins Freie gesetzt – die einzige Blume, die Frost vertrug. Als wir näher kamen, sahen wir, dass sie noch im Auto saß. Im Fahrersitz, mit Blick auf das glatte Garagentor. Mein Vater rannte los. Jetzt bemerkte ich es auch, wie sie dasaß – irgendwie steif, erstarrt, verkehrt. Am Auto angekommen, öffnete er die Fahrertür. Ihre Hände hielten das Lenkrad umklammert, und sie starrte blind vor sich hin, genau so, wie sie es getan hatte, als sie uns auf der Straße nach Hoopdance entgegenkam. Wir hatten ihren unbewegten Blick bemerkt und darüber gelacht. Sie ist sauer wegen dem Benzin!
Ich war dicht hinter meinem Vater. Trotz allem bemüht, nicht auf die welligen Blätter und die Knospen der Stiefmütterchen zu treten. Er legte seine Hände auf ihre und löste vorsichtig ihren Griff. Dann umschloss er ihre Ellbogen, hob sie aus dem Wagen und stützte sie, als sie, noch immer gekrümmt, in seine Richtung kippte. Sie sackte gegen seine Brust, sah durch mich hindurch. Kotze klebte vorn an ihrem Kleid, und ihr Rock und der graue Bezug des Fahrersitzes waren mit dunklem Blut getränkt.
Lauf zu Clemence, sagte mein Vater. Lauf hin und sag Bescheid, dass ich deine Mutter sofort nach Hoopdance in die Notaufnahme bringe. Sie sollen nachkommen.
Mit einer Hand öffnete er die hintere Tür, und dann manövrierte er Mom, als tanzten sie eine Art grausigen Tanz, auf die Kante der Sitzbank und legte sie ganz behutsam hin. Half ihr, sich auf die Seite zu drehen. Sie schwieg, aber fuhr sich mit der Zungenspitze über die aufgeplatzten, blutigen Lippen. Ich sah, wie sie blinzelte, die Brauen zusammenzog. Ihr Gesicht begann anzuschwellen. Ich lief um den Wagen herum und stieg neben ihr ein. Ich hob ihren Kopf an und glitt mit den Beinen darunter. Saß nah bei ihr und legte ihr den Arm um die Schulter. Sie zitterte leicht, vibrierte, als hätte jemand in ihr einen Schalter umgelegt. Ein scharfer Geruch ging von ihr aus, nach Kotze und nach noch etwas anderem, Benzin oder Petroleum vielleicht.
Ich setze dich da unten ab, sagte mein Vater und bog mit quietschenden Reifen aus der Auffahrt.
Nein, ich komme mit. Ich muss bei ihr bleiben. Wir können vom Krankenhaus aus anrufen.
Ich hatte mich meinem Vater, ob in Worten oder Taten, fast nie widersetzt. Aber es fiel uns nicht einmal auf. Da war schon dieser merkwürdige Blick gewesen, wie zwischen zwei Erwachsenen, für den ich noch nicht bereit gewesen war. Aber das spielte keine Rolle. Jetzt saß ich auf der Rückbank und hielt meine Mutter ganz fest. Ihr Blut klebte an mir. Ich griff nach hinten und zog den alten karierten Quilt herunter, der immer vor der Heckscheibe lag. Sie zitterte so sehr, dass ich dachte, es würde sie zerreißen.
Schneller, Dad.
Schon gut, sagte er.
Und dann flogen wir hin. Er jagte das Auto auf über 140 hoch. Wir flogen einfach.
Mein Vater konnte seine Stimme donnern lassen; das hatte er sich so angeeignet, sagte man. Als Jugendlicher hatte er das nicht gekonnt, aber im Gerichtssaal hatte er es dann gebraucht. Jetzt donnerte seine Stimme durch die Notaufnahme. Sobald die Sanitäter meine Mutter auf eine Trage gelegt hatten, sagte mein Vater, ich solle Clemence anrufen und dann warten. Als sein Zorn knisternd und klar die Luft erfüllte, ging es mir gleich besser. Was auch immer geschehen war, würde wieder in Ordnung kommen. Wegen seiner Wut, die so selten hervorbrach und immer Wirkung zeigte. Er hielt die Hand meiner Mutter, als sie sie auf die Station fuhren. Dann schloss sich die Tür hinter ihnen.
Ich setzte mich auf einen orangefarbenen Plastikstuhl. Eine dürre schwangere Frau war an unserer offenen Autotür vorbeigegangen und hatte meine Mutter angestarrt, hatte sich alles genau angesehen, bevor sie sich anmeldete. Jetzt ließ sie sich mir gegenüber neben eine schweigsame alte Dame fallen und griff nach einer Ausgabe der People.
Habt ihr Indianer nicht ein eigenes Krankenhaus? Baut ihr nicht gerade ein neues da drüben?
Die Notaufnahme ist noch im Bau, sagte ich.
Trotzdem, sagte sie.
Was trotzdem? Ich ließ meine Stimme schneidend und sarkastisch klingen. Darin war ich nicht so wie die meisten indianischen Jungs, die trotz ihrer Wut schweigend den Blick gesenkt hätten. Mich hatte meine Mutter anders erzogen.
Die Schwangere schürzte die Lippen und schaute wieder in ihre Zeitschrift. Die ältere Frau strickte an dem Daumen eines Fausthandschuhs. Ich stand auf und ging zu dem Münztelefon, aber ich hatte kein Geld dabei. Ich fragte die Schwester an der Rezeption, ob ich ihren Anschluss benutzen dürfe. Es war ein Ortsgespräch, und sie hatte nichts dagegen. Aber es nahm keiner ab. Also war meine Tante mit Edward losgefahren, um vor dem Allerheiligsten zu beten, wodurch sich die beiden sonntags abends ein bisschen Bewegung verschafften. Edward sagte immer, während Clemence das Allerheiligste anbetete, grüble er darüber nach, wie es sein könne, dass die Menschen von den Bäumen gestiegen waren, bloß um anschließend einen runden weißen Keks anzugaffen. Mein Onkel war Naturkundelehrer.
Ich setzte mich wieder in das Wartezimmer, so weit wie möglich von der Schwangeren weg, aber der Raum war ziemlich klein, und es war nicht weit genug. Sie blätterte in ihrem Magazin. Auf dem Cover war ein Bild von Cher. Ich konnte die Worte neben ihrem Wangenknochen lesen: Ihr »Moonstruck« ist ein Megahit, ihr Lover erst 23, und sie ist taff genug zu sagen: »Wenn mir einer krumm kommt, mach ich ihn kalt.« Aber Cher wirkte überhaupt nicht taff. Sie wirkte wie ein verschrecktes Plastikpüppchen. Die hagere, kugelige Frau spähte an Cher vorbei und sprach die strickende Dame an.
Ich wette, die Arme hatte einen Abort oder – sagte sie mit verschlagener Stimme – eine Vergewaltigung.
Die Oberlippe der Frau legte ihre Hasenzähne frei, als sie mich ansah. Ihre hässliche gelbe Frisur bebte. Ich blickte ihr direkt in die wimpernlosen braunen Augen. Dann tat ich instinktiv etwas Seltsames. Ich stand auf und nahm ihr die Zeitschrift aus der Hand. Ohne den Blick von ihr abzuwenden, riss ich das Cover ab und ließ den Rest zu Boden fallen. Dann zerriss ich das Cover mitten zwischen Chers identischen Augenbrauen hindurch. Die strickende Dame schürzte die Lippen und zählte ihre Maschen. Ich gab der Frau die zwei Hälften zurück, und sie nahm sie entgegen. Dann tat mir Cher plötzlich leid. Was hatte sie mir denn getan? Ich wandte mich ab und ging vor die Tür.
Von draußen hörte ich die schrille, triumphierende Stimme der Frau, die sich bei der Schwester beschwerte. Die Sonne war fast untergegangen. Sie wärmte nicht mehr, und mit der hereinbrechenden Dunkelheit kroch mir eine hinterhältige Kälte unter die Haut. Ich hüpfte auf der Stelle und ruderte mit den Armen. Egal was passierte, ich würde nicht wieder reingehen, bis die Frau weg war oder bis mein Vater zurückkam und sagte, dass es meiner Mutter wieder gutging. Ich konnte nicht aufhören, an die Frau zu denken. Diese zwei Wörter, die sie gesagt hatte, krallten sich, genau wie sie es gewollt hatte, in meinen Gedanken fest. Abort. Das Wort verstand ich nicht genau, aber es hatte mit Babys zu tun. Und die konnte es nicht geben. Vor sechs Jahren, als ich meine Mutter um ein Geschwisterkind anbettelte, hatte sie mir erklärt, der Arzt habe dafür gesorgt, dass sie nicht noch einmal schwanger werden konnte. Das ging einfach nicht. Blieb also nur das andere Wort.
Einige Zeit später sah ich, wie die Schwester mit der Schwangeren durch die Stationstür ging. Ich hoffte, dass sie meiner Mutter nicht zu nahe kommen würde. Ich ging rein und rief noch einmal bei meiner Tante an, die sagte, sie würde Edward bei Mooshum lassen und gleich rüberkommen. Dann fragte sie mich, was passiert sei.
Mom blutet, sagte ich. Dann schnürte es mir die Kehle zu.
Ist sie verletzt? Hatte sie einen Unfall?
Ich würgte mühsam hervor, dass ich es nicht wüsste, und Clemence legte auf. Eine Schwester kam mit unbewegtem Gesicht durch die Tür und sagte, ich solle zu meiner Mutter kommen. Der Schwester passte es nicht, dass meine Mutter mehrmals nach mir gefragt hatte. Wiederholt, sagte sie. Ich wäre am liebsten vorweggerannt, ging aber der Schwester hinterher, einen hellerleuchteten Gang entlang und in ein fensterloses Zimmer mit Stahlvitrinen an den Wänden. Hier war das Licht heruntergedimmt, und meine Mutter trug ein flattriges Krankenhaushemd. Über ihre Beine hatten sie eine Decke gebreitet. Blut war keins zu sehen, nirgends. Mein Vater stand neben dem Bett und hatte die Hand auf die Metallumrandung des Kopfendes gelegt. Ich sah ihn zuerst gar nicht an, sondern nur meine Mutter. Sie war eine schöne Frau – das hatte ich immer gewusst. Jeder wusste das, in meiner Familie ebenso wie außerhalb. Sie und Clemence hatten milchkaffeefarbene Haut und tiefschwarze, glänzende Locken. Waren selbst nach der Geburt ihrer Kinder schlank. Ruhig und direkt, mit selbstsicherem Blick und Filmstar-Mund. Nur wenn sie in Lachen ausbrachen, verloren sie ihre Selbstbeherrschung, keuchten, grunzten, rülpsten, japsten, pupsten sogar und lachten nur noch hysterischer. Meistens lösten sie gegenseitig solche Lachanfälle aus, aber gelegentlich brachte auch mein Vater sie so weit. Selbst dann waren sie schön.
Jetzt war ihr Gesicht verquollen, mit Striemen bedeckt und hässlich verzogen. Sie spähte durch kleine Schlitze zwischen ihren geschwollenen Lidern hervor.
Was ist passiert?, fragte ich dümmlich.
Sie antwortete nicht. Aus ihren Augenwinkeln kamen Tränen. Sie betupfte sie mit ihrer bandagierten Hand. Es geht mir gut, Joe. Schau mich an. Siehst du?
Und das tat ich – ich schaute sie an. Aber es ging ihr nicht gut. Da waren überall Spuren von Faustschlägen und diese grausige Schieflage in ihrem Gesicht. Ihre Haut hatte jede Wärme verloren; sie war aschfahl. Um den Mund war ein Rand aus verkrustetem Blut. Die Schwester kam herein und kurbelte das Fußende hoch. Legte noch eine Decke auf ihre Beine. Ich senkte den Blick und beugte mich zu ihr runter. Strich ihr über das bandagierte Handgelenk und die trockenen Finger. Sie schrie auf und zog die Hand weg, als hätte ich ihr wehgetan. Das gab mir den Rest. Ich sah meinen Vater an, und er winkte mich zu sich. Legte den Arm um mich und führte mich in den Flur.
Es geht ihr nicht gut, sagte ich.
Er sah auf die Uhr und dann wieder zu mir. In seinem Blick lag die verhaltene Wut von jemandem, der gar nicht schnell genug denken kann.
Es geht ihr nicht gut. Ich sagte es, als müsste er dringend die Wahrheit erfahren. Und einen Moment lang dachte ich, er würde zusammenbrechen. Irgendetwas bäumte sich in ihm auf, aber er besiegte es, atmete aus und beherrschte sich. Joe. Er sah schon wieder so komisch auf seine Uhr. Joe, sagte er, deine Mutter ist angegriffen worden.
Wir standen im Flur unter den fleckigen, sirrenden Leuchtstofflampen, und ich fragte das Erste, was mir einfiel.
Wegen was denn? Und von wem?
Absurderweise fiel uns beiden auf, dass die übliche Reaktion meines Vaters gewesen wäre, erst einmal meine Grammatik zu korrigieren. Wir sahen einander an, und er schwieg.
Der Kopf, der Nacken und die Schultern meines Vaters sind die eines starken Mannes, aber sonst wirkt er vollkommen durchschnittlich. Sogar ein wenig ungelenk und weich. Wenn man es sich recht überlegt, ist das der perfekte Körperbau für einen Richter. Er thront imposant auf dem Richterstuhl, aber bei Gesprächen im Besprechungszimmer (eigentlich einer besseren Besenkammer) wirkt er nicht bedrohlich, und die Leute vertrauen ihm. Außer dem Donnerhall beherrscht er auch jede andere stimmliche Nuance bis hin zu sehr sanften Tönen. Genau diese Sanftheit beunruhigte mich jetzt, und wie leise er sprach. Fast flüsternd.
Sie weiß nicht, wer der Mann war, Joe.
Und werden wir ihn finden?, fragte ich genauso leise.
Das werden wir, sagte mein Vater.
Und was dann?
Sonntags rasierte mein Vater sich nie, und es waren ein paar graue Bartstoppeln nachgewachsen. Da war wieder dieses Etwas, das sich in ihm zusammenballte und ausbrechen wollte. Stattdessen legte er mir die Hände auf die Schultern und sprach mit dieser säuselnden Stimme, die mir so unheimlich war.
So weit kann ich im Moment nicht vorausdenken.
Ich legte meine Hände auf seine und sah ihm in die Augen. Seine beruhigenden braunen Augen. Ich wollte sicher sein, dass derjenige, der meine Mutter angegriffen hatte, gefunden, bestraft und getötet wurde. Mein Vater sah es mir an. Seine Finger gruben sich in meine Schultern.
Wir kriegen ihn, sagte ich schnell. Ich hatte Angst dabei; mir wurde schwindlig.
Ja.
Er ließ meine Schultern los. Ja, sagte er noch einmal. Er tippte auf seine Armbanduhr. Wenn nur die Polizei schon da wäre. Sie müssen ihre Aussage aufnehmen. Sie sollten längst hier sein.
Wir machten kehrt und gingen zum Zimmer zurück.
Welche Polizei?, fragte ich.
Da fragst du was, sagte er.
Die Schwester wollte uns noch nicht wieder reinlassen, und während wir warteten, kam die Polizei. Drei Männer traten durch die Stationstür und blieben schweigend im Flur stehen. Ein State Trooper, ein Beamter aus Hoopdance und Vince Madwesin von der Stammespolizei. Mein Vater hatte darauf bestanden, dass jeder von ihnen die Aussage meiner Mutter aufnahm, weil unklar war, wo das Verbrechen verübt worden war – auf staatlichem Boden oder Stammesland – und wer es begangen hatte – ein Indianer oder ein Nicht-Indianer. Ich wusste schon ansatzweise, dass diese Fragen ständig um die Fakten herumschwirren würden. Ich wusste auch, dass die Fragen an den Fakten nichts änderten. Aber sie würden die Art und Weise verändern, wie wir nach Gerechtigkeit strebten. Mein Vater berührte mich an der Schulter und ging zu den Männern hinüber. Ich lehnte mich an die Wand. Die anderen waren alle ein wenig größer als mein Vater, aber sie kannten ihn und beugten sich herab, um keins seiner Worte zu verpassen. Sie hörten ihm konzentriert zu, ohne je den Blick abzuwenden. Mein Vater sah beim Sprechen hin und wieder zu Boden und faltete die Hände hinter dem Rücken. Dann sah er einen nach dem anderen unter seinen dichten Brauen an und senkte wieder den Blick.
Jeder der drei Polizisten betrat mit Notizblock und Stift das Krankenzimmer und kam eine Viertelstunde später mit ausdruckslosem Gesicht wieder heraus. Sie schüttelten meinem Vater die Hand und verschwanden.
Der diensthabende Arzt war ein junger Mann namens Dr. Egge. Er hatte meine Mutter untersucht. Als mein Vater und ich in das Zimmer zurückwollten, war Dr. Egge gerade wiedergekommen.
Ich denke nicht, dass der Junge …, begann er.
Ich fand es komisch, dass sein rundlicher, halbkahler, eierförmiger Kopf so gut zu seinem Namen passte. Das ovale Gesicht mit dem schwarzen Brillengestell kam mir bekannt vor, bis mir einfiel, dass meine Mutter solche Gesichter früher manchmal auf mein Frühstücksei gemalt hatte, damit ich es aufaß.
Meine Frau hat darauf bestanden, dass Joe zu ihr kommt, sagte mein Vater zu Dr. Egge. Sie will, dass er sieht, dass es ihr gutgeht.
Dr. Egge schwieg. Er sah meinen Vater hinter seinen kleinen runden Brillengläsern durchdringend an. Mein Vater trat einen Schritt zurück und sagte zu mir, ich solle im Wartezimmer nachsehen, ob Clemence schon da sei.
Ich möchte wieder zu Mom.
Ich hole dich gleich, sagte mein Vater beschwörend. Geh jetzt.
Dr. Egge starrte meinen Vater noch eindringlicher an. Ich wandte mich zutiefst widerstrebend von den beiden ab. Mein Vater und Dr. Egge sprachen leise miteinander. Ich wollte nicht gehen, also drehte ich mich vor der Flügeltür zum Wartezimmer noch einmal um und beobachtete sie. Vor dem Krankenzimmer blieben sie stehen. Dr. Egge hörte auf zu sprechen und schob sich mit einem Finger die Brille hoch. Mein Vater ging auf die Wand zu, als wollte er durch sie hindurch. Er presste die Stirn und die Hände dagegen und schloss die Augen.
Dr. Egge wandte den Kopf und bemerkte mich an der Tür. Er zeigte mit dem Finger in Richtung Wartezimmer. Ich war zu jung, schien er mit dieser Geste zu sagen, um diese Reaktion meines Vaters mitzuerleben. Aber ich war seit ein paar Stunden immer resistenter gegen Autoritäten geworden. Statt mich höflich in Luft aufzulösen, rannte ich an Dr. Egge vorbei zu meinem Vater. Ich schlang die Arme unter der Jacke um seinen weichen Rumpf und klammerte mich an ihm fest, ohne ein Wort zu sagen. Im Gleichtakt mit ihm atmete ich in tiefen Schluchzern ein und aus.
Sehr viel später, als ich selbst Jurist geworden war und noch einmal alle Unterlagen, alle Aussagen durchging, an die ich herankommen konnte, als ich jeden Augenblick dieses Tages und der Tage danach noch einmal durchlebte, begriff ich, dass mein Vater in diesem Moment von Dr. Egge die Art und das Ausmaß der Verletzungen erfahren hatte. An dem Tag selbst, als Clemence mich von meinem Vater trennte und mich wegbrachte, wusste ich nur, dass der Flur steil bergauf führte. Ich schleppte mich durch die Flügeltür und ließ Clemence mit meinem Vater reden. Ich verbrachte ungefähr eine halbe Stunde im Wartezimmer, bis Clemence kam und sagte, dass meine Mutter operiert werden würde. Sie hielt meine Hand. Wir starrten beide auf ein Bild an der Wand, auf dem eine junge Siedlerin am Berghang in der Sonne saß. Neben ihr lag ihr Kind im Schatten eines schwarzen Regenschirms. Wir waren uns einig, dass wir das Bild noch nie besonders gemocht hatten. Ab sofort würden wir es hassen, obwohl das Bild eigentlich nichts dafür konnte.
Ich fahre dich besser heim, dann kannst du in Josephs Zimmer schlafen, sagte Clemence. Du kannst morgen von uns aus zur Schule gehen. Ich komme dann wieder her und warte hier.
Ich war müde, mein Hirn tat mir weh, aber ich sah sie an wie eine Verrückte. Es war verrückt, zu glauben, dass ich in die Schule gehen würde. Nichts würde sein wie bisher. Die Steigung im Flur hatte mich an diesen Ort, in dieses Wartezimmer geführt, und hier würde ich warten.
Du könntest wenigstens ein bisschen schlafen, sagte Tante Clemence. Das könnte wirklich nicht schaden. Dann vergeht die Zeit, und du musst dieses verdammte Bild nicht ansehen.
War es eine Vergewaltigung?, fragte ich.
Ja, sagte sie.
Aber da war noch was, sagte ich.
In meiner Familie reden sie nicht um den heißen Brei herum. Meine Tante war Katholikin, aber sie nahm trotzdem kein Blatt vor den Mund. Als sie antwortete, sprach sie flüssig und ebenmäßig.
Vergewaltigung heißt erzwungener Sex. Ein Mann kann eine Frau dazu zwingen, Sex zu haben. Genau das ist passiert.
Ich nickte. Aber ich wollte noch etwas anderes wissen.
Wird sie daran sterben?
Nein, sagte Clemence schnell. Sie wird nicht sterben. Aber manchmal …
Sie biss sich von innen auf die Lippen, dass die Mundwinkel runterhingen, und sah mit zusammengekniffenen Augen die Siedlerin an.
… ist es komplizierter, sagte sie schließlich. Du hast doch gesehen, dass jemand ihr sehr, sehr wehgetan hat? Clemence berührte ihre eigene, für den Kirchgang zart gepuderte Wange.
Ja, habe ich.
Uns traten Tränen in die Augen, und wir sahen beide weg, auf Clemences Handtasche, in der sie nach Kleenex wühlte. Wir weinten ein bisschen. Es war eine Erleichterung. Dann trockneten wir unsere Gesichter, und Clemence sprach weiter.
Manchmal kann es besonders brutal sein.
Brutal vergewaltigt, dachte ich.
Ich wusste schon, dass diese Wörter zusammengehörten. Vielleicht hatte ich sie aus einer der Fallbeschreibungen in den Büchern meines Vaters oder aus der Zeitung oder einem der tollen Taschenbuch-Thriller, die mein Onkel Whitey in einem selbstgezimmerten Regal hortete.
Da war Benzin, sagte ich. Warum hat sie nach Benzin gerochen? War sie in Whiteys Tanke?
Clemence starrte mich an. Ihre Hand mit dem Kleenex verharrte neben ihrer Nase, und ihre Haut wurde fahl wie angetauter Schnee. Plötzlich klappte sie vornüber und legte den Kopf auf die Knie.
Alles okay, sagte sie durch das Kleenex. Ihre Stimme klang normal, fast gleichgültig sogar. Keine Sorge, Joe. Ich dachte, ich falle in Ohnmacht, aber es geht schon wieder.
Sie nahm sich zusammen und kam wieder hoch. Tätschelte mir die Hand. Ich fragte sie nie wieder nach dem Benzin.
Irgendwann schlief ich auf einer Plastikbank ein, und irgendjemand deckte mich mit einer Krankenhausdecke zu. Ich schwitzte im Schlaf, und beim Aufwachen klebten meine Backe und mein Arm an der Sitzbank. Ich schälte mich mühsam ab und stützte mich auf den Ellbogen.
Gegenüber stand Dr. Egge und redete mit Clemence. Ich erkannte gleich, dass jetzt alles besser aussah, dass es meiner Mutter besser ging, dass mit der Operation irgendetwas besser geworden war. So schlimm alles auch sein mochte, es wurde zumindest im Augenblick nicht mehr schlimmer. Also legte ich den Kopf auf die klebrige Plastikbank, die sich jetzt gut anfühlte, und schlief wieder ein.
KAPITEL ZWEIDIE GEHEIMNISVOLLE KRAFT
Ich hatte drei Freunde. Mit zweien halte ich bis heute Kontakt. Der andere ist ein weißes Kreuz an der Montana Hi-Line. Das markiert jedenfalls den Ort seines körperlichen Todes. Was seine Seele angeht – die habe ich in Form eines runden schwarzen Steins immer bei mir. Er hat ihn mir gegeben, als er hörte, was mit meiner Mutter passiert war. Virgil Lafournais hieß er, oder Cappy. Er sagte, der Stein sei heilig, er sei unter einem Baum gefunden worden, den der Blitz getroffen hatte. Ein Donnervogel-Ei, sagte Cappy. Er schenkte es mir, als ich wieder in die Schule kam. Immer wenn mich die anderen Kinder oder die Lehrer neugierig oder mitleidig anstarrten, berührte ich Cappys Stein.
Seit wir meine Mutter in der Auffahrt gefunden hatten, waren fünf Tage vergangen. Ich hatte mich geweigert, in die Schule zu gehen, bevor sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Sie konnte es selbst kaum erwarten und war erleichtert, als sie wieder zu Hause war. Am nächsten Morgen schickte sie mich vom Elternschlafzimmer aus los.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!