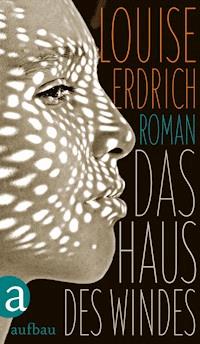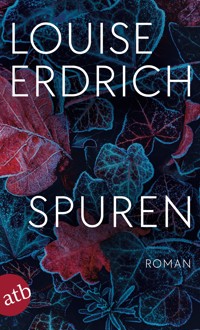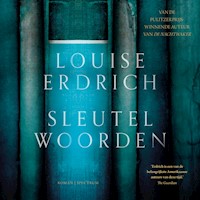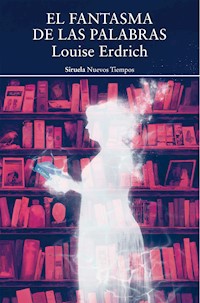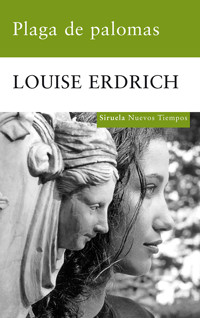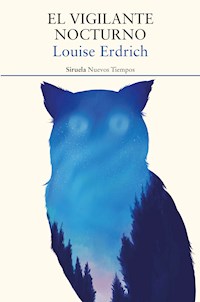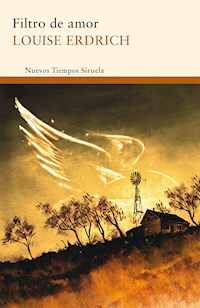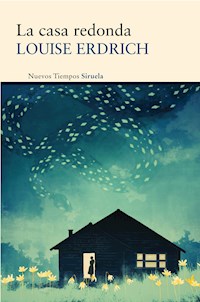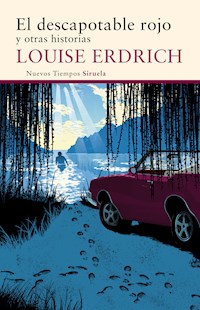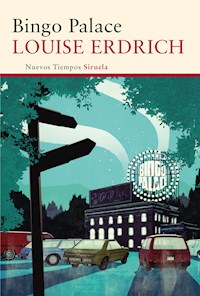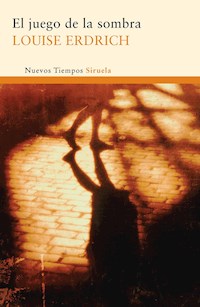8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine abenteuerliche Literaturreise in das bibliophile Herz Amerikas.« Die Welt
Ojibwe Country: eine magische, nahezu unberührte Seenlandschaft mit Tausenden Inseln, darunter auch die legendäre Bücherinsel, die aus kaum mehr als einer Bibliothek mit über 11.000 Bänden besteht. Hierher reist Erdrich mit ihrer kleinen Tochter und deren Vater, einem Ojibwe-Medizinmann. Dabei entdeckt sie die spirituelle Heimat ihrer Ahnen noch einmal ganz neu, erkundet deren Geschichten und versteht immer besser, warum sie sich von Büchern – jedes von ihnen ist ihr eine Insel – so unwiderstehlich angezogen fühlt.
»Ein hinreißendes Buch über die Kultur und Geschichte der Ojibwe, über jahrhundertealte Felsmalereien, über Geister und die magische Insel der 11.000 Bücher.« Brigitte Woman
»Es gibt kaum eine so gefühlvolle und zugleich scharfsinnige Autorin wie Louise Erdrich.« Anne Tyler
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
»Eine abenteuerliche Literaturreise in das bibliophile Herz Amerikas.« Die Welt
Ojibwe Country: eine magische, nahezu unberührte Seenlandschaft mit Tausenden Inseln, darunter auch die legendäre Bücherinsel, die aus kaum mehr als einer Bibliothek mit über 11.000 Bänden besteht. Hierher reist Erdrich mit ihrer kleinen Tochter und deren Vater, einem Ojibwe-Medizinmann. Dabei entdeckt sie die spirituelle Heimat ihrer Ahnen noch einmal ganz neu, erkundet deren Geschichten und versteht immer besser, warum sie sich von Büchern – jedes von ihnen ist ihr eine Insel – so unwiderstehlich angezogen fühlt.
»Ein hinreißendes Buch über die Kultur und Geschichte der Ojibwe, über jahrhundertealte Felsmalereien, über Geister und die magische Insel der 11.000 Bücher.« Brigitte Woman
»Es gibt kaum eine so gefühlvolle und zugleich scharfsinnige Autorin wie Louise Erdrich.« Anne Tyler
Über Louise Erdrich
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Sie erhielt den National Book Award, den PEN/Saul Bellow Award und den Library of Congress Prize. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Im Aufbau Verlag sind zuletzt ihre Romane »Der Gott am Ende der Straße«, »Die Wunder von Little No Horse« und »Der Nachtwächter« erschienen.
Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Liebeszauber«, »Die Rübenkönigin«, »Der Club der singenden Metzger«, »Der Klang der Trommel«, »Solange du lebst«, »Das Haus des Windes« und »Ein Lied für die Geister« lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Louise Erdrich
Von Büchern und Inseln
Aus dem Amerikanischen von Adelheid Zöfel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
1 – Bücher und Inseln
Wie eine Mutter packt
Zu Hause
Ojibwe
Der blaue Minivan
Nenaa’ikiizhikok
Asema, Alter und Dankbarkeit
2 – Inseln
Von den Schwierigkeiten, sich im Ojibwe-Land zu treffen
Der See und Tobasonawkwut oder Tobasonawkwut, der See
Niiyaawaangashing
Tobasonakwuts Erinnerung
Nagamonan
Die vier Steine
John Tanner und die Landschaft des Hungers
3 – Felsbilder
Mehr über das Alter
Akawe asema
Der Wildreis-Geist
Der gehörnte Mann
Die Bucht der Baby-Geister
Scheininseln
Massacre Island
Atisikan
Obabikon
Whitefish Bay
Wiikenh
Spirit Bay
Binessi
Binessiwag
Die Eternal Sands
Nameh
Wellen
Opfer
Ojibwemowin
Gigaa-waabamin
4 – Bücher
Das Skylark Motel
Kay-Nah-Chi-Wah-Nung
Der Grenzübergang
Wiedersehen
Ernest Oberholtzer
Oberholtzers Haus und seine Bücher
Oberholtzer und die Elche
Ein Festmahl
Maang
Die Bibliothek
Oberholtzer und die Ojibwe
5 – Zuhause
Das Telefon
Rückkehr
Leseabstand
Hundezecken
Bücher. Warum?
Dank
Impressum
Für Nenaa'ikiizhikok und ihre Brüder und Schwestern
1 Bücher und Inseln
Meine Reisen konzentrieren sich inzwischen so auf Bücher und Inseln, dass die beiden für mich verschmelzen: Bücher, Inseln. Inseln, Bücher. Der Lake of the Woods in Ontario und Minnesota hat 14 000 Inseln. Manche sind bemalte Felsen, bemalt mit Zeichen, die einige hundert oder auch über tausend Jahre alt sind. Das heißt, diese Inseln, die ich unbedingt lesen möchte, sind selbst Bücher.
Und dann gibt es noch eine ganz besondere Insel im Rainy Lake, die Tausende seltener Bücher beherbergt, von vergilbten Ausgaben der Schriften des Erasmus auf Französisch und Heloises Briefen an Abelard aus dem Jahr 1723 bis hin zu signierten Erstausgaben von Mark Twain und einer faszinierenden Sammlung ethnographischer Werke über die Ojibwe, die wahrscheinlich auch die Bücherinseln im Lake of the Woods erklären helfen.
Ich reise nicht allein. Zuerst wollen meine anderthalbjährige Tochter, die ich noch stille, und ich über die Grenze nach Kanada fahren, um den Lake of the Woods und das Land ihrer Großmutter und Namenspatin zu besuchen. Dann geht es wieder zurück über die Grenze und nach Osten zum Rainy Lake. Wir werden etwa tausend Meilen im eigenen Wagen zurücklegen und einige hundert in den Booten anderer Leute.
Ich bin achtundvierzig, und ich kann nicht ohne Ziel reisen. Irgendwie trage ich immer eine Frage mit mir herum, die ich beantworten möchte. Und immer öfter ist es dieselbe Frage. Es ist die Frage, die mein Leben bestimmt, die Frage, die mir das Leben gerettet hat und die vor kurzem zu einem höchst riskanten Unterfangen führte: der Gründung eines Buchladens. Die Frage lautet: Bücher. Warum? Die Inseln ergaben sich eher zufällig. Ich habe keine besondere Vorliebe für Inseln. Ich bin in den Great Plains aufgewachsen, ringsum Hunderte von Meilen nichts als Festland, aber ich habe Menschen kennen gelernt, die mit den Seen Jeben. Und seither haben mich die Inseln nicht mehr losgelassen, vor allem die mit den vielen Büchern.
Mazina'iganan ist auf Ojibwemowin oder Anishinaabemowin das Wort für Bücher und mazinapikiniganan das Wort für »Felsmalereien«. Ojibwemowin ist die Algonquin-Sprache, die von den Ojibwe, die in Michigan, Minnesota, Ontario, Manitoba und North Dakota leben, gesprochen wurde. Wie man sieht, beginnen beide Wörter mit mazina, dem Stamm von Dutzenden von Wörtern, die alle mit Bildern zu tun haben oder mit den Materialien, auf die Bilder gemalt werden, vor allem Papier und Wandflächen. Als die Ojibwe anfingen, fernzusehen und ins Kino zu gehen, erwies sich das Wort als ausgesprochen praktisch. Mazinaatesewigamig – Kino. Mazinatesijigan – Fernsehapparat. Sie verfügten über einen Wortstamm, mit dem sie sofort ein Verb bilden konnten, als damals vor vielen Jahren Edward Curtis und später Ernest Oberholtzer kamen, um sie zu fotografieren. Mazinaakizo – fotografiert werden. (Keine Spur von »geraubten Seelen« in diesem Wort. Die Fotografen haben die Seelen der Ojibwe nicht weggenommen, so einfach ging das nicht. Für Seelenraub war ein systematischeres, gnadenloses Vorgehen nötig – die einfallsreichen Demütigungen und Misshandlungen durch die Regierung und durch katholische Nonnen und Priester.)
Die Ojibwe hatten das Wort mazinabaganjigan schon lange Zeit verwendet, um die Zahnabdrücke in Birkenrinde zu beschreiben, bei denen es sich vermutlich um die ersten Bücher Nordamerikas handelt. Wahrscheinlich wurden in dieser Gegend Bücher geschrieben, seit irgendwann ein Mensch auf die Idee kam, in Birkenrinde zu beißen oder mit einem angespitzten Stock etwas hineinzuritzen. Bücher sind eigentlich gar nichts Neues. Vermutlich schreiben die Menschen in Nordamerika seit mindestens 2000 vor Christus Bücher. Oder bemalen Inseln. Man kann sich die Seen also als Bibliotheken vorstellen. Dabei ist 2000 vor Christus nur die Datierung der ältesten archäologischen Spuren, die Menschen in der Region, die wir aufsuchen wollen, hinterlassen haben. In den Augen traditionsbewusster Anishinaabe können nur Nichtindianer der Landbrückentheorie etwas abgewinnen. Sie selbst sind überzeugt, dass sie schon immer hier gelebt haben. Und da die von den Alten überlieferten Schriftstücke und Malereien von den heute am Lake of the Woods lebenden Menschen immer noch verstanden werden, muss man zu dem Schluss kommen, dass sie nicht die Vorfahren der heutigen Ojibwe waren. Sie waren und sind die heutigen Ojibwe.
Bücher. Warum?
Weil uns der Kopf wehtut.
Wie eine Mutter packt
Ehe ich eine Reise antrete, bin ich eine ganze Woche lang zerstreut und mache mir Sorgen. In letzter Minute erledige ich Sachen, die ich Monate oder sogar Jahre vor mir hergeschoben habe. Jedes Mal ändere ich mein Testament, dann räume ich die Schränke auf und hefte alte Briefe ab. Ich achte darauf, dass für alle genügend Unterwäsche da ist, dass die richtigen Leute Geld und Telefonnummern haben, dass der Hund gegen Lyme-Arthritis geimpft wird, dass das Manuskript des letzten Buches im Satz ist und das Baby alle Impfungen bekommen hat. Dann kümmere ich mich konkreter um die Reise. Ich lese Bücher über Piktographie und entscheide, was für Notizbücher ich mitnehme; mache einen Ölwechsel; versorge meine älteren Töchter mit Postkarten und Shampoo. Und ich kaufe Tabak – nicht zum Rauchen, sondern als Opfergabe für die Geister des Sees und die Geister der Felsbilder, die wir besuchen werden. Ich sammle Geschenke für die Gemälde – ein Fransenhemd, ein Stück roten Stoff, Salbeibündel. Ich kaufe 124 Wegwerfwindeln und einen Laufgurt für das Baby, wie ich ihn bei anderen Müttern im Einkaufszentrum gesehen habe. Falls das Baby aus dem Boot oder von einer Insel fällt, kann ich es daran wieder hochziehen. Ich gehe die Pläne durch, wer wann auf das Haus aufpasst, kontrolliere die Kontoauszüge und vergewissere mich, dass ich im Buchladen nicht gebraucht werde. Tausend Kleinigkeiten! Und genau die machen mich fertig: das Sonnenschutzmittel; die Ulmen, die mit einem Fungizid behandelt werden müssen; die Schuhe, die unzähligen Arten und Größen von Schuhen, die Mädchen im Lauf ihres Lebens tragen. Ich sage mir, dass Gott und der Sinn des Lebens ebenso in den kleinen Dingen zu finden sind wie in den großen. Aber wo ist Gott im Schuhdschungel? In den Schnürsenkeln? In den Gummikappen? In den Absätzen, die im Alter von zwölf Jahren schlagartig höher werden?
Andererseits ist das alles völlig nebensächlich. Die Beschäftigung mit dem ganzen Krimskrams dient nur dazu, vom eigentlichen Problem abzulenken: Ich gehe schrecklich ungern von zu Hause weg.
Zu Hause
Mein hundertunddrei Jahre altes Haus ist von wunderbaren Bäumen umgeben. Ich habe jedem Baum einen Namen gegeben. Da ist Guardian Elm, die Wächterulme, die sich gleich hinter dem blauen Tor nach Westen neigt. Daneben Tiny Offshoot of the Great Wahpeton Maple, der kleine Schössling des großen Wahpeton-Ahorn, nur zwei Meter hoch. Er sieht immer noch aus wie ein Trommelschlegel. Ich habe ihn selbst aus einem Samen gezogen, der in einem Blumentopf meiner Mutter Wurzeln schlug. Awkward und Shy, Linkisch und Scheu, heißen die Ulmen, die diese beiden Bäume flankieren, und der alte Kämpe Old Stalwart, der größte Baum im ganzen Viertel, hält um die Ecke vor dem Haus Wache. Und natürlich haben auch die vier Robinien, die in krummer Reihe am Gartenrand stehen, eigene Namen. Ich bewundere diese Bäume, weil sie unverwüstlich sind und ihre Äste mit den gezackten Flatterblättern ein sich ständig veränderndes, bebendes Schattenmuster auf die alten cremefarbenen Innenwände des Hauses werfen. Außerdem schlagen sie als Letzte aus und verlieren im Herbst als Letzte ihre Blätter, so dass sie bis zum Schluss, bis kurz vor dem Winter, noch immer eine herrlich leuchtende Phalanx bilden.
Unser Haus hat ein Vater als Hochzeitsgeschenk für seine geliebte Tochter gebaut. Sein eigenes Haus hat den gleichen Grundriss und steht nebenan. Es wurde gebaut, als der See östlich von uns noch ein Sumpf war, ehe er ausgebaggert wurde. Unser Haus, verziert mit gedrechselten Holzgeländern, geschnitzten Bögen über den Fenstern, einem Band aus Eierstab-Ornamenten und zwei runden Gucklochfenstern, erinnert tatsächlich ein bisschen an eine Hochzeitstorte. Vielleicht stellen wir ja eines Tages ein fünf Meter hohes kitschiges Brautpaar aus Plastik aufs Dach. In den sechziger Jahren wurde unser Haus entkernt und in eine Art Gästehaus umgewandelt, später in ein Zweifamilienhaus. Das ganze hübsche Zierwerk im Innern ging dabei verloren, und am Schluss war das Haus nur noch seltsam. Gäste haben im oberen Stockwerk ein Gespenst gesehen, und die Mädchen hören es herumlaufen. Sie glauben, es sei ein verwirrter Mann, deshalb nennen wir das Gespenst jetzt so. Manchmal, wenn eine der drei älteren Töchter länger fort ist, schlafen das Baby und ich in ihrem Zimmer, damit sich der Geist des Verwirrten Mannes nicht dort einquartiert. Ich beschreibe das alles, weil es keine Reise ohne Abschiednehmen gibt. Und je schwerer der Abschied fallt, desto ernster nimmt man die Reise. Mir tut das Weggehen weh. Hier wohnen vier für mich lebenswichtige Menschen. Meine Töchter. Selbst wenn sie nicht da sind, sind doch alle ihre Sachen hier. Wir wollen unser Herz nicht an materielle Dinge hängen, aber wir tun es, und statt alles vollzustellen, sortieren wir ständig aus, geben weiter, werfen weg.
Wir haben viele Bücher in unserem Haus. Sie sind unsere wichtigste Dekoration – Bücherstapel auf dem Couchtisch, gerahmte Buchumschläge, zu Türmen aufgeschichtete Bücher auf jeder verfügbaren Fläche und natürlich Bücher in Regalen an fast allen Wänden. Neben den sichtbaren Büchern gibt es noch die Kartons, die in den Kulissen warten, die Kellerbücher, die Garagenbücher, die Stauraumbücher. Sie dienen als eine Art Dämmschicht, stützen alles Mögliche ab, und mit Decken verhüllt fungieren sie als Tischehen. Anzahl und Art der Bücher sind ständig im Fluss; wie aufgeregte Verwandte treffen sie mit der Expresspost ein, nur um dann neben dem überquellenden Posttisch herumzulungern. Leseexemplare versammeln sich neben dem Bett, um pflichtbewusst geprüft zu werden – sie zu ignorieren und statt ihrer Henry James oder Barbara Pym zu lesen, macht dann besonders viel Spaß, aber auch ein schlechtes Gewissen. Ein Haus, das nicht von Büchern überquillt, kann ich mir nicht vorstellen. Mit Büchern verhält es sich folgendermaßen: Man hat immer viel zu viele, denkt aber trotzdem immer, man habe nicht genug oder nicht die richtigen für jeden Augenblick; aber es kann auch vorkommen, dass man abends vor dem Einschlafen Asperns Nachlass von Henry James lesen möchte – und da ist es auch schon.
Bücher. Noch ein Grund. Ich kann mein Zuhause in Gestalt eines Buches überallhin mitnehmen, und genau das tue ich auch. Ich packe W. G. Sebalds Roman Austerlitz ein; nehme von Jim Crace Die Versuchung in der Wüste und Ein Mann, eine Frau und der Tod mit; lege noch Saints and Strangers von Angela Carter dazu und Das Tagebuch der Daisy Goodwill von Carol Shields, das alle anderen schon gelesen haben. Mit Belletristik bin ich also versorgt. Was die Sachbücher betrifft – ohne mein Concise Dictionary of Minnesota Ojibwe von John D. Nichols und Earl Nyholm gehe ich nirgendwo hin. Und ich nehme Joe Paddocks Buch über Ernest Oberholtzer mit, Keeper of the Wild. Dann stopfe ich eine Tasche mit den Büchern meiner kleinen Tochter voll, die ich großenteils mit Tippex bearbeitet habe: Ich habe den englischen Text weiß überpinselt und durch Ojibwe-Wörter ersetzt.
Ojibwe
Ojibwe hat sich im Amerikanischen auch zu dem Wort chippewa verschliffen. In seiner ursprünglichen Form, anishinaabe, wird es Ah-nisch-in-ah-be ausgesprachen. Das Wort ist sehr vielseitig und lässt ganz verschiedene Deutungen, Interpretationen und Theorien zu. Zum Beispiel habe ich gehört, ojibwe bezeichne das Zusammenziehen des Saums traditioneller Mokassins oder makazinan. Oder es bedeute, dass die Ojibwe ihre Feinde geröstet haben, bis sie »ganz zusammenschnurrten«. Wie grässlich! Ich habe auch gehört, anishinaabe heiße, »von wo der männliche Teil der Spezies herunterkommt«, aber das gefallt mir nicht sonderlich. Und dann gibt es noch die eher mystische Deutung »spontane Wesen«. Mir gefallt am besten die Erklärung, dass Ojibwe von dem Verb ozhihii'ige, schreiben, kommt. Die Ojibwe haben schon immer begeistert geschrieben und führten mündliche und schriftliche Tradition zusammen, indem sie beschriftete Birkenrinderollen aufbewahrten. Das erste Papier, die ersten Bücher.
Der blaue Minivan
Zu meinem blauen Windstar Minivan, Baujahr 1995, habe ich ein enges Verhältnis. Ich glaube an ihn, und uns verbindet eine lange Geschichte. Ich weiß ganz genau, wie ich diesen Wagen packen muss, und ich spüre seine Persönlichkeit, wenn ich die Ritzen zwischen, unter und hinter den blau bezogenen Sitzen voll stopfe. Der blaue Windstar ist geräumig und nett wie eine Schwester. Und ein galanter Transporter. Früher kam es öfter vor, dass ich sechs kleine Mädchen, zwei Hunde, große Australian Shepherds, und mich selbst samt Lebensmitteln, Kleidern, Spielen und Malzeug für eine Woche in diesen Wagen gequetscht habe, und dann fuhren wir zu einer anderen Insel im Lake Superior, wo ich Recherchen machte, während die Mädchen eine oder zwei Wochen lang schwammen, herumschrien, aßen, herumschrien, Marshmallows rösteten, herumschrien, »Wonder Woman«- und »Catwoman«-Comics lasen, schliefen, herumschrien, aufwachten und vergnügt herumschrien. Ich habe keine Ahnung, wie ich trotzdem etwas zustande brachte. Der Minivan war auch schon häufig in North Dakota, in Wahpeton, wo meine Eltern leben, und in South Dakota, bei meinem Lieblingssonnentänzer, dem Vater meines Babys. Wenn man den Rücksitz ausbaute, konnte er bequem auf einem Futon schlafen. Wenn der Windstar zurückkam, war er immer etwas blutverschmiert und voll gepackt mit Pfeifensteinstücken und riesigen Salbeibüscheln. An der Antenne wehte eine kleine Gebetsflagge. So wurde der Wagen zu einem fahrenden Zuhause für den Sonnentänzer, den Mann, der nach den tief über den Wassern des Sees hängenden Wolken benannt wurde und zu dem wir jetzt fahren werden.
Nenaa’ikiizhikok
Man hat mir erzählt, dass es vier Geisterfrauen gibt, die sich um die Wasser der Welt kümmern. Eine Frau sorgt für die Ozeane mit ihrem Salzwasser. Die zweite Frau achtet auf die Süßwasserseen, die Ströme und Flüsse. Die dritte bewacht das Wasser im Innern der Frauen, das die Babys umgibt und abpolstert. Die vierte Frau kümmert sich um den Regen, die Wolken, die Unwetter, die Wasser des Himmels. Nach einem Gewitter räumt sie den Himmel auf und sorgt dafür, dass die Wolken weiterziehen. Dass die Sterne an der richtigen Stelle stehen. Sie ist ständig damit beschäftigt, am Himmel alles zu heilen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Von dieser Geisterfrau, dieser Nenaa'ikiizhikok, hat das Baby im Kindersitz direkt hinter mir seinen Namen. Seine Großmutter väterlicherseits hieß auch so. Man nannte sie Kiizhikok, Himmelsfrau, oder kurz Kiizhik, Himmel.
Die ursprüngliche Nenaa'ikiizhikok war eine imposante Erscheinung, groß und unglaublich intelligent. Das einzige Bild, das ich von ihr habe, ist ein Klassenfoto aus dem Internat; sie steht in der letzten Reihe, und man sieht sie nur verschwommen, aber sie ist zweifellos schön – nicht einfach nur hübsch, dazu sind ihre Gesichtszüge zu markant und zu klug. Von dieser Nenaa'ikiizhikok spricht man auf Ojibwemowin immer als Nenaa'ikiizhikokiban. Die Endung »iban« versetzt sie in die Vergangenheit, in die Geisterwelt, wo sie, stelle ich mir vor, immer noch in ihrem Glöckchenkleid tanzt. Sie war eine berühmte Glöckchenkleid-Tänzerin und kam sogar zum Powwow in die Turtle Mountains. Meine Mutter, Rita Gourneau Erdrich, wuchs in den Turtle Mountains auf. Meine Familie lebt noch dort, weshalb ich hinfahre, so oft es geht. Ich male mir gern aus, wie Nenaa'ikiizhikokiban mit einer der Tanten meiner Mutter tanzt, vielleicht mit Jane oder Shyoosh.
Die kleine Nenaa'ikiizhikok heißt auch wie meine Mutter: Rita. Sie ist also ein sehr großmütterliches Baby. Auf ihrem Hinterkopf sprießt sogar ein einzelnes graues Haar. Ich bin uralt für eine »junge Mutter«, und ihr Vater ist ein uralter junger Vater. Unser Baby war bei der Geburt bereits Großtante. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Wie mein Bruder Ralf mit besorgter Miene sagte: »Sprich nicht drüber! Ich hab's doch gewusst, dass sie schon mindestens Großtante ist! Ich will's gar nicht wissen!«