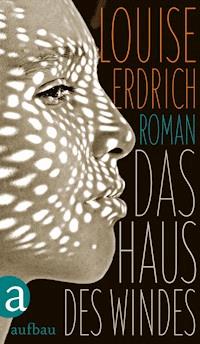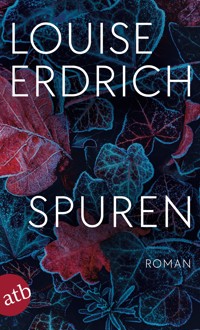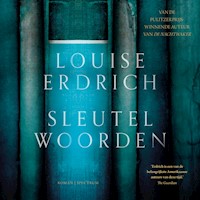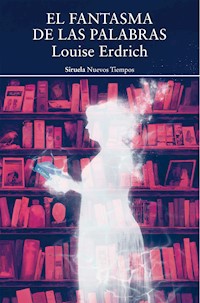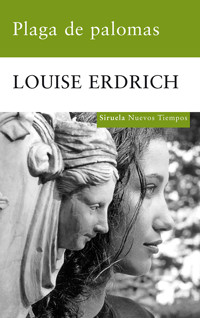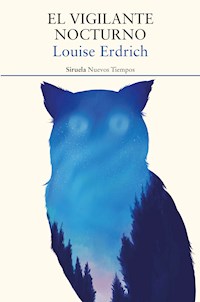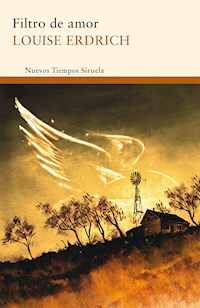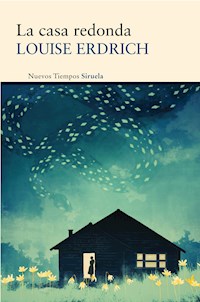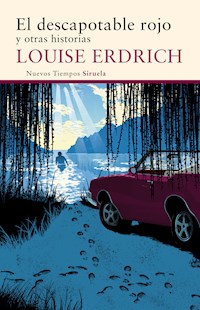10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pulitzer Prize for Fiction 2021.
Kann ein Einzelner den Lauf der Geschichte verändern? Kann eine Minderheit etwas gegen einen übermächtigen Gegner, den Staat, ausrichten? »Der Nachtwächter«, der neue Roman der mit dem National Book Award ausgezeichneten Autorin Louise Erdrich, basiert auf dem außergewöhnlichen Leben von Erdrichs Großvater, der den Protest gegen die Enteignung der amerikanischen UreinwohnerInnen vom ländlichen North Dakota bis nach Washington trug. Elegant, humorvoll und emotional mitreißend führt Louise Erdrich vor, warum sie zu den bedeutendsten amerikanischen Autorinnen der Gegenwart gezählt wird - und zeigt, dass wir alle für unsere Überzeugungen kämpfen sollten und dabei manchmal sogar etwas zu verändern vermögen.
»Mir stockte der Atem, als ich begriff, was meinem Großvater von seinem Nachtwächter-Schreibtisch aus gelungen war.«Louise Erdrich.
»Ein meisterhaftes Epos. Nach der Lektüre ist man tief bewegt und vermisst diese Figuren, als wären sie echte Menschen.«New York Times Book Review.
»Mit diesem Roman ist Louise Erdrich auf der Höhe ihrer genialischen Schaffenskraft angelangt.«Washington Post.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Pulitzer Prize for Fiction 2021.
Kann ein Einzelner den Lauf der Geschichte verändern? Kann eine Minderheit etwas gegen einen übermächtigen Gegner, den Staat, ausrichten? »Der Nachtwächter«, der neue Roman der mit dem National Book Award ausgezeichneten Autorin Louise Erdrich, basiert auf dem außergewöhnlichen Leben von Erdrichs Großvater, der den Protest gegen die Enteignung der amerikanischen UreinwohnerInnen vom ländlichen North Dakota bis nach Washington trug. Elegant, humorvoll und emotional mitreißend führt Louise Erdrich vor, warum sie zu den bedeutendsten amerikanischen Autorinnen der Gegenwart gezählt wird - und zeigt, dass wir alle für unsere Überzeugungen kämpfen sollten und dabei manchmal sogar etwas zu verändern vermögen.
»Mir stockte der Atem, als ich begriff, was meinem Großvater von seinem Nachtwächter-Schreibtisch aus gelungen war.« Louise Erdrich.
»Ein meisterhaftes Epos. Nach der Lektüre ist man tief bewegt und vermisst diese Figuren, als wären sie echte Menschen.« New York Times Book Review.
»Mit diesem Roman ist Louise Erdrich auf der Höhe ihrer genialischen Schaffenskraft angelangt.« Washington Post.
Über Louise Erdrich
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Sie erhielt den National Book Award, den PEN/Saul Bellow Award und den Library of Congress Prize. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Im Aufbau Verlag sind zuletzt ihre Romane »Der Gott am Ende der Straße« und »Die Wunder von Little No Horse« erschienen.
Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Liebeszauber«, »Die Rübenkönigin«, »Der Club der singenden Metzger«, »Der Klang der Trommel«, »Solange du lebst«, »Das Haus des Windes« und »Ein Lied für die Geister« lieferbar.
Gesine Schröder übersetzt seit 2007 aus dem Englischen und hat u.a. Jennifer duBois und Curtis Sittenfield ins Deutsche übertragen. Nach Aufenthalten in den USA, Australien, Indien, England und Kanada lebt sie in Berlin.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Louise Erdrich
Der Nachtwächter
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
September 1953
Lagersteinfabrik Turtle Mountain
Schmalz auf Brot
Der Wächter
Das Hautzelt
Drei Männer
Der Boxtrainer
Noko
Wasser Erde
Juggies Junge
Valentines Tage
Pukkons
Parfüm
Das Bügeleisen
Die Obstkiste
Ein Platz im Zug
Ein Gesetz
Du?
Indianerhumor
Du?
Fahnen
Das Log Jam 26
Die Weckrasur
Der alte Bisam
Der Wasserochse
Linker Haken
Louis Pipestone
Ajax
Eiserne Tulpe
Unverdorbene Schönheit
Die durchschnittliche Frau und der leere Tank
Die Missionare
Der Anfang
Der Tempelbettler
Hahn im Korb
Arthur V. Watkins
Heiter, kühl
Der Torus
Metalljalousien
X = ?
Zwillingsträume
Das Sternen-Powwow
Schmerz wäre ihr Name
Homecoming
Das Tanzfest
Strohkopf
Zack
Die Rachenmandeln
Ein Brief an die University of Minnesota
Die Chippewa-Gelehrte
Was sie brauchte
Der alte Winter
Das Wiegenbrett
Die Boxgala
Die zweitägige Reise
Kampf um die Oberherrschaft
Die Beförderung
Edith, übersinnlich begabt
Das Männerfrühstück
Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten
Über den Schnee dahin
Fallenstellen
Wiege und Bahre
Die Nachtwache
Zwei Monate
Neujahrssuppe
Die Namen
Elnath und Vernon
Der Nachtvogel
U.S.I.S.
Der Läufer
Missionarsfüße
Die Spiritus-Druckerpresse
Nachtgebet 1954
Geister kann man nicht assimilieren
Clark Kent
Karo
Die Lamaniten
Der Ratschluss des Herrn
Die Delegation
Hänfling
Die Reise
Falkenaugen
Terminierung der Staatsverträge und der Vereinbarungen mit ausgewählten Indianerstämmen
Der Heimweg
Wenn
Tosca
Der Salisbury
Der See, der Brunnen, die Grillen im Gras
Die Zimmerdecke
Größere Freuden
Die Eulen
Der Bärenschädel in der Astgabel war mit roter Farbe bemalt und schaute nach Osten
Druckerpressen-Spiritismus
À ta santé
Roderick
Thomas
Nachbemerkungen und Dank
Impressum
Für Aunishenaubay, Patrick Gourneau;für seine Tochter Rita, meine Mutter;und für sämtliche indigenen Führungspersönlichkeiten,die sich der Terminationspolitik entgegengestemmt haben.
Am 1. August 1953 verabschiedete der Kongress der Vereinigten Staaten die House Concurrent Resolution 108, mit welcher Verträge zwischen souveränen Nationen, gültig, »solange das Gras wächst und die Flüsse fließen«, für nichtig erklärt wurden. Der Beschluss sah vor, langfristig sämtliche indianischen Nationen aufzulösen, zu »terminieren«, und für fünf Stämme, darunter der Turtle Mountain Band of Chippewa, sollte dies mit sofortiger Wirkung geschehen.
Mein Großvater wehrte sich als Vorsitzender des Stammesrats tagsüber gegen die Terminationspolitik, und nachts arbeitete er als Wachmann. Wie meine Romanfigur Thomas Wazhashk bekam er wenig Schlaf. Dies ist ein fiktionales Werk. Dennoch habe ich mich bemüht, das außergewöhnliche Leben meines Großvaters getreulich abzubilden. Sämtliche Fehler sind mir zuzuschreiben. Außer Thomas und der Lagersteinfabrik von Turtle Mountain gibt es nur eine weitere Figur, die einer lebenden oder toten Person nachempfunden ist: Senator Arthur V. Watkins, ein unermüdlicher Verfechter der Enteignung indigener Gruppen und der Mann, der meinen Großvater befragt hat.
Pixie – oder, Pardon, Patrice – ist frei erfunden.
September 1953
Lagersteinfabrik Turtle Mountain
Thomas Wazhashk nahm seine Thermoskanne unter dem Arm hervor und stellte sie neben der abgewetzten Aktentasche auf den stählernen Bürotisch. Seine Arbeitsjacke kam auf den Stuhl, die Blechbüchse mit dem Essen auf die kühle Fensterbank. Als er die gefütterte Schirmmütze abnahm, rollte aus einer der Ohrenklappen ein Wildapfel hervor. Ein Geschenk von seiner Tochter Fee. Er fing den Apfel auf und legte ihn gut sichtbar auf den Tisch. Dann schob er seine Zeitkarte in die Stechuhr. Mitternacht. Er nahm den Schlüsselring, eine firmeneigene Taschenlampe und drehte eine Runde um die große Werkhalle.
In dieser stillen, immerzu stillen Weite beugten sich tagsüber die Turtle-Mountain-Frauen in das kalte Licht ihrer Arbeitsleuchten. Sie klebten mikroskopisch dünne Scheiben aus Rubin, Saphir oder dem weniger wertvollen Granat auf dünne senkrechte Spindeln, um sie für die Bohrung vorzubereiten. Die fertigen Lagersteine waren teils für den Bedarf des Verteidigungsministeriums bestimmt, teils für den Uhrenhersteller Bulova. Es war das erste Mal, dass sich in der Nähe des Reservats eine Fabrik angesiedelt hatte, und die meisten der begehrten Arbeitsplätze hatten Frauen ergattert. Sie hatten in den Prüfungen zur Fingerfertigkeit viel besser abgeschnitten.
Die Regierung schrieb ihre Konzentrationsfähigkeit dem indianischen Erbe und ihrer Erfahrung mit der Perlenstickerei zu. Thomas glaubte, es läge eher an ihren Augen – die Frauen seines Stammes konnten einen mühelos mit Blicken durchbohren. Seine eigene Stelle hatte er nur mit Glück erhalten. Er war verständig und ehrlich, aber jung und schlank war er nicht mehr. Den Job hatte man ihm wegen seiner Verlässlichkeit gegeben und weil er alles daransetzte, jeden Arbeitsschritt so präzise auszuführen wie nur möglich. Seine Kontrollgänge erledigte er unverrückbar gründlich.
Als Nächstes betrat er den Raum mit den Bohrmaschinen, überprüfte sämtliche Schlösser, stellte das Licht an und aus. Zwischendurch vollführte er, um seinen Kreislauf in Schwung zu bringen, einen kleinen Fancy Dance, gefolgt von einem Red River Jig. Erfrischt trat er durch die Panzertür des Säurebad-Raums mit den durchnummerierten Bechergläsern, mit Druckanzeige, Schlauch, Waschbecken und den Reinigungsstationen. Er kontrollierte die Büros und die grün-weiß gekachelten Toilettenräume und kehrte wieder in den Maschinensaal zurück. Auf seinen Tisch ergoss sich das Licht einer Lampe, die er defekt gefunden und instand gesetzt hatte, in deren Kegel er seitdem las, schrieb, nachdachte und sich ab und zu ohrfeigte, um wach zu bleiben.
Thomas verdankte seinen Nachnamen der Bisamratte, Wazhashk, jenem bescheidenen, fleißigen, dem Wasser verbundenen Nager. In den Sumpfgebieten des Reservats waren Bisamratten allgegenwärtig. Die kleinen, geschmeidigen Gestalten glitten in der Dämmerung geschäftig durchs Wasser, vervollkommneten fortwährend ihre Bauten und fraßen (wie sie das Fressen liebten!) praktisch alles, was in den Tümpeln wuchs und schwamm. So zahlreich und alltäglich die Wazhashkag sein mochten, waren sie doch unverzichtbar. Im Anbeginn, nach der großen Flut, war es eine Bisamratte gewesen, mit deren Hilfe die Erde neu geschaffen wurde.
Insofern trug Thomas, wie sich herausstellen sollte, genau den richtigen Namen.
Schmalz auf Brot
Pixie Paranteau tupfte Klebstoff auf einen Edelsteinrohling, um ihn zum Bohren zu fixieren. Sie nahm den vorbereiteten Stein mit der Pinzette auf und legte ihn auf der Bohrkarte in eine winzige Vertiefung. Wenn sie wütend war, neigte sie zur Perfektion. Ihr Blick wurde schärfer, die Gedanken konzentrierter, die Atmung ruhig. Den Spitznamen Pixie trug sie seit ihrer Kindheit wegen ihrer feenhaft schräg stehenden Augen. Seit dem Highschool-Abschluss versuchte sie alle daran zu gewöhnen, sie Patrice zu nennen. Nicht Patsy, nicht Patty, nicht Pat. Aber selbst ihre beste Freundin weigerte sich, Patrice zu sagen. Und ihre beste Freundin saß direkt neben ihr und platzierte ebenfalls winzige Edelsteinrohlinge in endlosen Reihen. Nicht ganz so schnell wie Patrice, aber am zweitschnellsten von allen Mädchen und Frauen. Bis auf das Summen der Deckenleuchten war es in der Halle still. Patrice’ Puls verlangsamte sich. Nein, sie war kein Feenwesen, auch wenn sie zierlich war und die Leute manchmal »Wawiyazhinaagozi« zu ihr sagten, was man übelwollend als »Ist die niedlich!« übersetzen konnte. Patrice war nicht niedlich. Patrice hatte eine Festanstellung. Patrice stand weit über lächerlichen Zwischenfällen wie der Fahrt ins Nirgendwo, zu der Bucky Duvalle und seine Kumpel sie mitgenommen hatten, die seitdem überall herumerzählten, wie willig sie etwas mitgemacht hätte, das nie stattgefunden hatte. Das nie stattfinden würde. Und wenn man Bucky jetzt ansah … Nicht, dass sie etwas damit zu tun gehabt hätte, was mit seinem Gesicht passiert war. So etwas tat Patrice nicht. Patrice wollte auch darüberstehen, das braune Erbrochene ihres versoffenen Vaters auf der Bluse zu finden, die sie zum Trocknen neben den Ofen gehängt hatte. Er war von einer seiner Sauftouren zurück, geiferte, spuckte, drängte, heulte, drohte ihrem kleinen Bruder Pokey und flehte Pixie um nur einen Dollar an, nein, einen Quarter, um einen Dime bloß. Nicht mal einen winzigen Dime? Wollte zwei Finger aufeinanderlegen und brachte sie nicht zusammen. Nein, sie war nicht diese Pixie, die das Messer versteckt und ihrer Mutter geholfen hatte, ihn auf ein Feldbett im Schuppen zu verfrachten, damit er schlafen konnte, bis er das Gift los war.
Heute Morgen hatte sie eine ihrer alten Blusen angezogen, war zur Straße vorgelaufen und zum ersten Mal bei Doris Lauder und Valentine Blue mitgefahren. Ihre beste Freundin hatte so einen poetischen Namen und gönnte ihr noch nicht einmal Patrice. Im Auto hatte Valentine vorn gesessen und gesagt: »Pixie, sitzt du gut auf der Rückbank? Ich hoffe, du hast es bequem.«
»Patrice«, sagte Patrice.
Keine Antwort.
Valentine! Da plauderte sie nun mit Doris Lauder über Kuchen mit Kokosraspeln. Kokosraspeln? Wuchsen etwa in tausend Meilen Umkreis irgendwo Kokosnüsse? Valentine. In ihrem orange-goldenen Tellerrock. Schön wie der Abendhimmel. Und drehte sich nicht ein Mal um. Reckte die Finger in ihren schicken neuen Handschuhen, damit Patrice sie bewundern konnte, aber bloß von hinten. Und dann tauschte sie sich mit Doris darüber aus, wie man Rotweinflecken aus einer Serviette entfernen konnte. Als hätte Valentine je eine Serviette besessen! Und hätte je Rotwein getrunken, außer heimlich, draußen. Behandelte Patrice, als ob sie sich kaum kannten, bloß weil Doris Lauder eine Weiße war, neu im Betrieb, eine Sekretärin, die mit dem Auto ihrer Familie zur Arbeit fahren durfte. Doris hatte Valentine angeboten, sie mitzunehmen, und Valentine hatte gesagt: »Meine Freundin Pixie wohnt auch auf dem Weg, könntest du …«
Und hatte sie teilhaben lassen, wie man es von einer Freundin auch erwarten würde, sie dann aber ignoriert und sich geweigert, ihren richtigen Namen zu benutzen, unter dem sie gefirmt war, der Name, unter dem sie – vielleicht war es peinlich, das zu denken, aber sie tat es trotzdem – es eines Tages noch weit bringen würde.
Mr Walter Vold schritt, die Hände hinter dem Rücken, die Reihe der Frauen ab und begutachtete lauernd ihre Arbeit. Alle paar Stunden verließ er sein Büro und inspizierte jede einzelne Station. Alt war er nicht, hatte aber hagere, steife Beine. Bei jedem Schritt schnellten seine Knie mit einem Ruck nach vorn. Heute ertönte dabei ein stockendes Kratzen. Von der Hose wahrscheinlich, die aus einem schwarz glänzenden, festen Stoff war. Das Quietschen von Schuhsohlen auf dem Boden. Er blieb hinter ihr stehen. Hob seine Lupe. Dann senkte er seinen schwitzigen Schuhkarton-Kiefer über ihre Schulter und verströmte muffigen Kaffee-Atem. Patrice arbeitete weiter, mit ruhigen Händen.
»Ausgezeichnete Arbeit, Patrice.«
Ha, seht ihr?
Er ging weiter. Kratz. Quietsch. Doch Patrice wandte nicht den Kopf, um Valentine zuzuzwinkern. Patrice kostete es nicht aus. Sie spürte, dass ihre Monatsblutung anfing, aber sie hatte einen sauberen gefalteten Stoffrest an ihrer Unterhose befestigt. Selbst das. Ja, selbst das.
Mittags versammelten sich die Frauen und die wenigen männlichen Fabrikarbeiter in einem Raum, der die Kantine darstellen sollte. Es gab eine Küche, aber es waren noch keine Köche angeheuert worden, die das Mittagessen hätten zubereiten können, also setzten sich die Arbeiterinnen an die Tische und aßen, was sie mitgebracht hatten. Manche hatten Brotbüchsen, andere Schmalztöpfe. Wieder andere brachten mit einem Stück Sackleinen bedeckte Teller. Aber das hieß meistens, dass sie teilen wollten. Patrice hatte einen gelben Siruptopf dabei, der bis auf das Metall blank geschrubbt und heute mit rohem Brotteig gefüllt war. Ja, mit Teig. Sie hatte auf dem Weg zur Tür danach gegriffen, von der Raserei ihres Vaters so erschüttert, dass sie fast rannte, und hatte vergessen, dass sie vorgehabt hatte, ihn vor dem Frühstück in der Pfanne ihrer Mutter auszubacken. Und gefrühstückt hatte sie auch nicht. Seit zwei Stunden zog sie schon den Bauch ein, um das Magenknurren zu unterdrücken. Valentine hatte es natürlich trotzdem bemerkt. Aber jetzt plauderte sie natürlich mit Doris. Patrice aß einen Happen Teig. Er schmeckte nicht schlecht. Valentine warf einen Blick in den Topf, sah den rohen Teig und lachte.
»Ich habe vergessen, ihn zu backen«, sagte Patrice.
Valentine schaute sie mitleidig an, aber eine andere Kollegin, eine verheiratete Frau namens Saint Anne, lachte über Patrice’ Geständnis. Es machte die Runde, dass sie rohen Teig in ihrem Siruptopf hatte. Dass sie vergessen hatte, ihn zu backen oder zu braten. Patrice und Valentine waren die jüngsten Mädchen im Werk, gleich nach dem Schulabschluss waren sie angeheuert worden. Mit neunzehn Jahren. Saint Anne schob für Patrice ein Butterbrötchen über den Tisch. Jemand anderes reichte einen Haferkeks zu ihr durch. Doris gab ihr ein halbes Schinkensandwich. Patrice hatte einen Witz gerissen. Gleich würde sie darüber lachen und sofort den nächsten reißen.
»Du hast doch nie was anderes mit als Schmalz auf Brot«, sagte Valentine.
Patrice klappte den Mund zu. Alles schwieg. Valentine hatte sagen wollen, dass Schmalz auf Brot ein Arme-Leute-Essen war. Aber jeder mochte Schmalzschnitten mit Salz und Pfeffer.
»Das klingt lecker. Hat jemand so was dabei?«, fragte Doris. »Gebt mir doch ein Stückchen zum Probieren.«
»Hier«, sagte Curly Jay, die ihren Namen den Engelslöckchen verdankte, die sie als Kind gehabt hatte. Er war ihr geblieben, obwohl ihre Haare ganz glatt geworden waren.
Alle schauten Doris zu, wie sie das Schmalzbrot probierte.
»Gar nicht schlecht!«, verkündete sie.
Patrice schaute Valentine mitleidig an. Oder war es Pixie, die das tat? Jedenfalls war die Mittagspause vorüber, und ihr Magen würde sich bis zum Abend nicht mehr beschweren. Sie bedankte sich laut bei allen am Tisch und ging ins Bad.
In der Frauentoilette waren zwei Kabinen. Patrice erkannte Valentine an den braunen Schuhen mit den übermalten Kratzern. Sie hatten alle beide ihre Tage.
»O nein«, sagte Valentine hinter der Trennwand. »Oh, es ist schlimm.«
Patrice klappte ihre Handtasche auf, rang ein wenig mit sich und reichte eins ihrer gefalteten Stoffstücke unter dem Holz durch. Es war blitzsauber, weiß, gebleicht. Valentine nahm es ihr ab.
»Danke.«
»Danke, wer?«
Ein Zögern.
»Ich schulde dir meinen verdammten Dank, Patrice.« Sie lachte. »Du hast mir den Arsch gerettet.«
»Deinen flachen Arsch.«
Wieder Gelächter. »Deiner ist flacher.«
In der Hocke befestigte Patrice das nächste Tuch. Das benutzte wickelte sie in Toilettenpapier und dann in ein Stück Zeitungspapier, das sie eigens dafür aufbewahrt hatte. Als Valentine weg war, verließ sie die Kabine und versenkte das Bündel tief unten im Müllbehälter. Sie wusch sich mit Seifenpulver die Hände, rückte die Wäscheschoner unter ihren Achseln zurecht, glättete ihr Haar, zog den Lippenstift nach. Als sie herauskam, saßen die meisten anderen schon wieder auf ihren Plätzen. Schnell schlüpfte sie in den Kittel und schaltete ihr Licht an.
Als der Nachmittag zur Hälfte um war, begannen ihre Schultern zu brennen. Ihre Finger krampften, ihr flacher Arsch war taub. Reihenaufseherinnen ermahnten die Frauen regelmäßig, aufzustehen, sich zu strecken und die gegenüberliegende Wand anzuschauen. Dann rollten die Arbeiterinnen mit den Augen. Schauten noch einmal in die Ferne. Nachdem sie die Augen erfrischt hatten, bewegten sie die Hände, reckten die Finger, massierten die schmerzenden Knöchel. Schon ging es wieder an die zähe, hypnotische Arbeit. Unerbittlich kamen die Schmerzen wieder. Aber bald war es Zeit für die Pause, fünfzehn Minuten, die eine Reihe nach der anderen antrat, damit alle auf die Toiletten gehen konnten. Manche Frauen trafen sich im Pausenraum, um dort zu rauchen. Doris hatte eine kostbare Kanne Kaffee zubereitet. Patrice trank ihn im Stehen, hielt die Untertasse in der Luft. Als sie sich diesmal wieder setzte, ging es ihr besser, und sie verfiel in tranceartige Konzentration. Solange Schultern und Rücken nicht zu sehr schmerzten, konnte dieser Geisteszustand sie über die nächsten ein, zwei Stunden retten. Es erinnerte sie daran, wie es sich angefühlt hatte, wenn sie und ihre Mutter gemeinsam mit Perlen stickten. Die Stickerei versetzte sie in eine Sphäre der Ruhe. Während sie Perlen wählten und auf Nadeln spießten, sprachen sie träge miteinander. Auch in der Fabrik wurde leise und verträumt geredet.
»Ladys. Bitte.«
Mr Vold untersagte jegliches Geplauder. Und sie redeten dennoch. Hinterher hätten sie nicht sagen können, worüber sie sich unterhielten, doch sie redeten von morgens bis abends. Kurz vor Feierabend brachte Joyce Asiginak neue Boules zum Schneiden, und der ganze Prozess ging immer weiter und weiter.
Doris Lauder fuhr sie auch wieder nach Hause. Und diesmal drehte Valentine sich um und bezog Patrice ins Gespräch mit ein, was gut war, weil Pixie sich von den Gedanken an ihren Vater ablenken musste. Würde er noch da sein? Doris’ Eltern bewirtschafteten eine Farm im Reservat. Sie hatten das Land 1910 von der Bank erstanden, als das Land alles war, was Indianer noch verkaufen konnten. Verkaufen oder verhungern. Überall war das Land der Indianer spottbillig zu haben. Es gab nur wenige gute Böden im Reservat, und die Lauders besaßen ein hohes silbriges Getreidesilo, das man bis in den Ort sah. Doris setzte Patrice als Erste ab und bot ihr an, auch das letzte Stück bis zum Haus zu fahren, doch die lehnte dankend ab. Sie wollte nicht, dass Doris den abgesackten Türdurchgang sah oder das angehäufte Gerümpel. Und womöglich würde ihr Vater das Auto hören, aus dem Haus taumeln und Doris bedrängen, dass sie ihn in den Ort fahren sollte.
Patrice lief die grasbewachsene Fahrspur hinunter und hielt unter den Bäumen inne, um nach ihrem Vater Ausschau zu halten. Die Schuppentür stand offen. Sie schlich daran vorbei und ging gebückt ins Haus. Ein simples Bohlenhaus mit irdenem Boden, ohne Umbauten, niedrig und schief. Irgendwie hatte ihre Familie es nicht auf die Förderliste des Stammesrats geschafft. Das Herdfeuer brannte, und Patrice’ Mutter hatte Teewasser aufgesetzt. Außer den Eltern gab es noch ihren schlaksigen Bruder Pokey. Ihre Schwester Vera hatte sich beim Arbeits- und Umsiedelungsamt beworben und war mit ihrem Mann nach Minneapolis gezogen. Sie hatten Geld für den Übergang und eine berufliche Fortbildung bekommen. Viele kehrten vor Ablauf eines Jahres zurück. Und andere – von denen hörte man nie wieder.
Vera hatte ein lautes, helles Lachen. Patrice vermisste, wie sie alles verwandeln konnte – wie sie die Spannungen im Haus durchbrach und die Düsternis erhellte. Vera konnte über einfach alles lachen, selbst über den Toiletteneimer, in den sie im Winter pissten, oder darüber, dass ihre Mutter wütend wurde, wenn die Schwestern über die Sachen der Männer hinwegstiegen oder wenn sie kochen wollten, obwohl sie ihre Tage hatten. Sie lachte auch über ihren Vater, wenn er völlig shkwebii nach Hause gewankt kam. Weggetreten wie ein halb gares Hähnchen, sagte Vera dann.
Er war auch jetzt zu Hause, und keine Vera, die sich über seine gürtellos herabhängende Hose lustig machte oder über sein zerzaustes Haar. Keine Vera, die sich mit blitzenden Augen die Nase zuhielt. Keine Chance, in ihm etwas anderes zu sehen als eine bodenlose Schande. Ihn sich vom Leib zu halten. Und alles andere: Den Erdboden, der sich bucklig durch das dünne Linoleum drückte. Patrice nahm eine Tasse Tee mit hinter den Vorhang, in das Bett, das sie sich immer mit ihrer Schwester geteilt hatte. Dort gab es ein Fenster, was im Frühling oder Herbst gut war, weil sie dann den Ausblick auf den Wald genossen, und im Winter und Sommer war es schrecklich, weil sie entweder froren oder die Fliegen und Mücken sie in den Wahnsinn trieben. Sie konnte ihre Eltern reden hören. Er bettelte beharrlich, war aber noch zu elend, um richtig gemein zu werden.
»Nur einen Penny oder zwei. Einen Dollar, Herzliebste, und du bist mich los. Dann bin ich weg. Dann lass ich dich alleine. Und du hast Zeit für dich, wie du es immer wolltest. Ich bleibe weg, versprochen. Ich werde dir nie wieder unter die Augen treten.«
So schwadronierte er weiter und weiter, während Patrice ihren Tee trank und auf die Birken hinaussah, deren Laub sich gelb verfärbte. Als sie den leicht gesüßten letzten Schluck ausgetrunken hatte, stellte sie die Tasse weg und zog sich eine Jeans, durchgelaufene Schuhe und eine karierte Bluse an. Sie steckte sich das Haar hoch und trat hinter dem Vorhang hervor. Ihren Vater ignorierte sie – krumme Waden, schlackernde Schuhe – und zeigte ihrer Mutter den rohen Teig in ihrem Blechtopf.
»Der ist noch gut«, sagte ihre Mutter und verzog den Mund zum Ansatz eines Lächelns. Mit einer einzigen fließenden Bewegung löste sie den Teig aus dem Behälter und breitete ihn flach in die Pfanne. Manchmal sahen Dinge, in denen ihre Mutter lebenslange Übung hatte, wie Zauberkunststücke aus.
»Pixie! O Pixie, mein Püppchen?«, heulte ihr Vater auf. Patrice ging zur Tür hinaus, marschierte zum Holzhaufen, zog die Axt aus dem Baumstumpf und spaltete einen Kloben. Dann hackte sie eine Weile Scheite. Sie trug das Brennholz sogar zum Haus und stapelte es neben der Tür. Das war Pokeys Aufgabe, aber er übte nach der Schule Boxen. Also machte sie weiter. Wenn ihr Vater zu Hause war, konnte sie Beschäftigung gebrauchen. Sie mochte zierlich sein, doch sie war von Natur aus kräftig. Ihr gefiel der Widerhall der Schläge von Metall auf Holz auf Holz in ihren Armen. Und wenn sie die Axt schwang, kamen ihr Ideen. Sie stellte sich vor, was sie tun wollte. Wie sie sich verhalten würde. Wie sie es schaffen würde, sich mit bestimmten Leuten anzufreunden. Das Holz stapelte sie nicht einfach nur so, sondern schichtete es zu einem Muster. Pokey machte sich über ihre kunstvollen Brennholzstapel lustig. Doch er blickte auch zu ihr auf. Sie war die Erste in der Familie, die eine richtige Stelle hatte. Die nicht nur Fallen stellte, jagte oder Beeren sammelte, sondern die so arbeitete wie die Weißen. Im Nachbarort. Ihre Mutter sagte nichts dazu, ließ aber durchblicken, dass sie es zu schätzen wusste. Pokey hatte Schuhe für die Schule. Vera hatte ein kariertes Kleid, eine Toni-Dauerwelle zur Selbstanwendung und weiße Söckchen für die Reise nach Minneapolis bekommen. Und Patrice legte von jedem Wochenlohn ein wenig beiseite, um Vera zu folgen, denn die war möglicherweise verschollen.
Der Wächter
Zeit, zu schreiben. Thomas setzte sich zurecht, führte die Atemübungen nach der Palmer-Methode aus, die er im Internat beigebracht bekommen hatte, und zog die Kappe vom Füllfederhalter. Vor ihm lag ein frisch beim Händler erstandener Schreibblock aus angenehm hellgrün getöntem Papier. Seine Hand war ruhig. Zunächst wollte er die amtliche Korrespondenz erledigen und danach zur Belohnung Briefe an seinen Sohn Archie und seine Tochter Ray verfassen. Gern hätte er seinem Ältesten, Lawrence, einen Brief geschrieben, doch von ihm hatte er noch keine Adresse. Als Erstes wandte sich Thomas an Senator Milton R. Young, den er zu seinen Anstrengungen beglückwünschte, das ländliche North Dakota mit Elektrizität zu versorgen, und um ein Treffen bat. Dann schrieb er dem Landrat, beglückwünschte ihn zur erfolgreichen Reparatur einer asphaltierten Straße und bat ihn um ein Treffen. Seinem Freund, dem Zeitungskolumnisten Bob Cory, schlug er ein Datum für eine Besichtigung des Reservats vor. Mehreren Leuten, die sich aus Neugier an das Stammesbüro gewandt hatten, antwortete er ausführlich.
Damit waren seine Amtsgeschäfte erledigt, und er begann mit dem Brief an Ray und ihrer Glückwunschkarte zum Geburtstag. Ist denn wirklich schon ein Jahr vergangen? Es kommt mir wie gestern vor, dass ich Dein winziges Gesichtchen und Deinen braunen Haarflaum bestaunt habe. Ich könnte schwören, dass Du, als Du mich zum allerersten Mal erspähtest, mir zugezwinkert hast, wie um zu sagen: »Keine Bange, Daddy, ich binall die Mühen, die Mama mit mir hatte, zu 100 Prozent wert.« Dieses Versprechen hast Du gehalten, sogar zu 200 Prozent, wie Deine Mama und ich finden … Rasch füllten sich sechs Seiten in seiner fließenden Handschrift mit Gedanken und Neuigkeiten. Doch als er innehielt, um alles noch einmal durchzulesen, konnte er sich nicht daran erinnern, es geschrieben zu haben, so ordentlich seine Schreibschrift auch aussah. Verflucht. Er tippte sich mit dem Stift an den Kopf. Er hatte im Schlaf geschrieben. Und heute war es schlimmer als in anderen Nächten. Denn gleich als Nächstes erinnerte er sich nicht mehr, was er gelesen hatte. So ging es hin und her – er schrieb, las, vergaß, was er geschrieben hatte, vergaß dann, was er gelesen hatte, und dann fing er von vorn an. Aufzugeben kam nicht infrage, doch allmählich begann ihm unbehaglich zu werden. Es kam ihm vor, als wäre da jemand in den dunklen Ecken der Halle. Als beobachtete ihn jemand. Langsam legte er den Federhalter beiseite, wandte den Kopf und schaute sich über die Schulter nach den stillstehenden Maschinen um.
Auf der Bandsäge hockte ein zottelhaariger kleiner Junge. Thomas schüttelte den Kopf und blinzelte, doch der Junge war immer noch da. Das dunkle Haar stand ihm in verfilzten Strähnen vom Kopf ab. Er trug Hemd und Hose aus gelblich braunem, grobem Drillich, genau wie Thomas sie als Drittklässler im staatlichen Internat in Fort Totten getragen hatte. Der Junge erinnerte ihn an jemanden. Thomas schaute die stachelhaarige Gestalt an, bis sie sich in einen Motorblock zurückverwandelte. »Ich sollte mir mal den Kopf waschen«, sagte Thomas. Er schlich ins Bad. Hielt den Kopf unter den kalten Wasserstrahl und wusch sich das Gesicht. Stempelte dann seine Karte für den zweiten Kontrollgang.
Diesmal bewegte er sich langsam, schlurfend, wie bei starkem Gegenwind. Er zog die Füße nach, doch am Ende der Runde war sein Kopf wieder klar.
Thomas lupfte die Hosenbeine, damit sie nicht ausbeulten, und setzte sich an den Schreibtisch. Rose machte ihm auch Bügelfalten in die Ärmel. Sparte nicht an Stärke. Selbst in der schmucklosen, lehmig grünen Arbeitskleidung wirkte er respektabel. Nie hing sein Hemdkragen schlaff herunter. Doch er wollte sich hängenlassen. Sein Stuhl war gepolstert, bequem. Zu bequem. Thomas schraubte die Thermoskanne auf. Es war eine sehr gute von Stanley, ein Geschenk von seinen älteren Töchtern. Mit der Kanne hatten sie ihm zu der festen Anstellung gratuliert. Er goss schwarzen Kaffee in den Deckel der Kanne, der auch als Becher diente. Das warme Metall lag mit den sanften Rillen und der weiblichen Rundung am Becherboden gut in der Hand. Bei jedem Schluck gönnte er seinen Augenlidern ein langes, genüssliches Blinzeln. Wäre beinahe weggesackt. Fuhr wieder hoch. Befahl dem letzten Rest Kaffee, gefälligst seine Pflicht zu erfüllen.
Er sprach bei der Arbeit öfter mit Gegenständen.
Thomas packte seine Brotbüchse aus. Er nahm sich jeden Tag vor, wenig zu essen, damit er davon nicht schläfrig wurde, doch von der Anstrengung, wach zu bleiben, bekam er Hunger. Kauen machte ihn ein paar Augenblicke lang munter. Er aß ein Sandwich aus kaltem Hirschbraten und Rose’ legendärem Hefebrot. Eine riesige Möhre, die er selbst gezogen hatte. Der kleine saure Apfel hob seine Laune. Ein Stück Schmelzkäse und ein durchgeweichtes Marmeladenbrötchen ließ er für das Frühstück übrig.
Das reichhaltige Sandwich erinnerte ihn an die kläglichen Fleischfasern zwischen dünnen Brotfladen, die sein Vater und er in jenem harten Jahr auf dem Weg nach Fort Totten gegessen hatten. Dem Hunger verdankte er Momente, die er nie vergessen würde. Wie köstlich diese von den Knochen geschabten fasrigen Fleischreste gewesen waren. Wie er sich mit Tränen des Hungers in den Augen auf die Mahlzeit stürzte. Sie hatte ihm noch besser geschmeckt als dieses Sandwich. Er aß es auf, fegte sich die Krumen in die Handfläche und ließ sie sich in den Mund rieseln – eine Angewohnheit aus den mageren Zeiten.
Einer seiner Lehrer drüben in Fort Totten war ein fanatischer Anhänger der Palmer-Schreibmethode. Stunde um Stunde hatte Thomas damit verbracht, perfekte Kreise zu zeichnen, von rechts nach links zu schreiben und dann andersherum, die nötige Handmuskulatur und die richtige Haltung zu entwickeln. Und mit den Atemübungen natürlich. All das war ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Die Großbuchstaben bereiteten ihm am meisten Freude. Er formulierte oft Sätze, die mit seinen Lieblingen begannen. Rs und Qs beherrschte er am besten. Er schrieb und schrieb, bis es ihn in Trance versetzte, bis er einnickte und davon erwachte, dass ihm Speichel auf die Faust troff. Gerade rechtzeitig, um seine Karte zu stempeln und den letzten Kontrollgang anzutreten. Bevor er nach der Taschenlampe griff, zog er die Jacke über und nahm eine Zigarre aus der Aktentasche. Er wickelte sie aus, sog ihren Duft ein und ließ sie in seine Brusttasche gleiten. Die wollte er am Ende seiner Runde draußen rauchen.
Es war die dunkelste Stunde. Die Nacht jenseits des Lichtscheins seiner Lampe eine schroffe Masse. Thomas schaltete sie aus und lauschte dem charakteristischen Tönen und Knarren des Fabrikgebäudes. Es war ungewöhnlich ruhig. Eine windstille Nacht, eine Seltenheit in der Prärie. Am großen Hinterausgang der Halle steckte er sich die Zigarre an. Manchmal rauchte er am Schreibtisch, aber es gefiel ihm, wie die frische Luft seine Gedanken klärte. Er überzeugte sich, dass er die Schlüssel dabeihatte, und trat über die Schwelle. Draußen ging er ein paar Schritte. Einzelne Grillen zirpten noch im Gras, ein Geräusch, das ihn rührte. Es war dieselbe Jahreszeit, in der Rose und er einander kennengelernt hatten. Jetzt stand Thomas abseits des Flutlichts auf einem Flecken Beton. Schaute in den kalten Himmel und die darübergebreiteten Sterne.
Wenn er den Nachthimmel betrachtete, war er Thomas, der die Sternbilder aus der Internatsschule kannte. Und er war Wazhashk, den sein Großvater, der erste Wazhashk, über die Sterne unterrichtet hatte. Das Herbststernbild Pegasus war Teil des großväterlichen Elchs. Thomas nahm einen bedächtigen Zug von der Zigarre. Ließ den Rauch aufwärts strömen wie ein Gebet. Buganogiizhik, das Loch, durch das der Schöpfer gesaust war, glomm und blinkte. Thomas sehnte sich nach Ikwe Anang, der Sternin. Eben begann sie als Lichthauch über den Horizont zu steigen. Ikwe Anang war sein tägliches Zeichen, dass die Quälerei bald vorbei sein würde. In den Monaten, seit er die Nächte als Wachmann verbrachte, hatte Thomas sie lieben gelernt wie einen Menschen.
Als er wieder hineinging und sich an seinen Bürotisch setzte, fiel die Benommenheit gänzlich von ihm ab, und er las in den Zeitschriften und den Rundbriefen anderer Stämme, die er gesammelt hatte. Verdrängte die Furcht vor einem Gesetzesentwurf, an dem abzulesen war, dass der Kongress die Indianer loswerden wollte. Schon wieder. Nicht der geringste Ansatz einer Strategie. Und keine Panik, aber die würde noch kommen. Noch etwas Kaffee zu seinem leichten Frühstück, dann stempelte er aus. Er stellte erleichtert fest, dass die Morgenluft warm genug war, um vor dem ersten Termin des Tages ein wenig auf dem Fahrersitz zu dösen. Sein geliebtes Auto war ein kittgrauer Nash, ein Gebrauchtwagen, und dennoch schimpfte Rose, er habe zu viel Geld dafür ausgegeben. Sie hätte nie zugegeben, wie sehr sie es genoss, sich im behaglichen Beifahrersitz zurückzulehnen und dem Autoradio zu lauschen. Jetzt, wo er eine reguläre Stelle hatte, konnte er den Kaufpreis in Raten abbezahlen. Musste sich nicht darum sorgen, wie das Wetter sich auf die Ernte auswirken würde. Vor allem war es ein Auto, das ihn nicht im Stich ließ, wenn er zur Arbeit musste. Diesen Job wollte er unbedingt behalten. Außerdem würde er eines Tages verreisen, scherzte er manchmal, in die zweiten Flitterwochen mit seiner Rose, denn die Rücksitze ließen sich zu einem Bett ausklappen.
Jetzt glitt er auf seinen Sitz. Im Handschuhfach bewahrte er einen dicken Schal auf, den er sich um den Hals schlang, damit ihm das Kinn nicht auf die Brust sank und ihn weckte. Er lehnte sich ins Schafswoll-Polster und schlief ein. Und war sofort hellwach, als LaBatte besorgt an die Scheibe klopfte.
LaBatte war ein kleiner Mann mit der rundlichen Statur eines Bären. Er schaute durch die Scheibe, die Mopsnase an das Glas gedrückt. Sein Atem zeichnete einen Kreis aus Dampf. LaBatte war der Hauswart für die Abendstunden, erledigte aber auch tagsüber kleine Reparaturen. Thomas hatte seine dicklichen, kräftigen, klugen Hände schon alle möglichen Apparaturen in Ordnung bringen sehen. Sie waren zusammen zur Schule gegangen. Er kurbelte die Scheibe herunter.
»Musste wieder Schlaf nachholen?«
»War ’ne aufregende Nacht.«
»Ah ja?«
»Ich hab mir eingebildet, da würde ein Junge auf der Bandsäge sitzen.«
Zu spät fiel ihm ein, wie abergläubisch LaBatte war.
»War es Roderick?«
»Wer?«
»Der verfolgt mich ständig. Roderick.«
»Nein, es war bloß der Motor.«
LaBatte runzelte skeptisch die Stirn, und Thomas ahnte, dass er noch einiges über Roderick zu hören bekommen würde, wenn er sich nicht beeilte. Also ließ er den Motor an und rief über den Lärm hinweg, er müsse zu einem Termin.
Das Hautzelt
Eine Armbanduhr, eines Tages. Patrice sehnte sich nach einer Möglichkeit, die Zeit akkurat zu messen. Denn bei ihr zu Hause existierte keine Zeit. Besser gesagt existierte dort keine Zeitmessung, die Arbeits- oder Schulzeiten erfasste. Ein kleiner brauner Wecker stand auf dem Hocker neben ihrem Bett, doch der ging mit jeder Stunde fünf Minuten nach. Das musste sie herausrechnen, wenn sie ihn stellte, und wenn sie ihn aufzuziehen vergaß, war gleich alles verloren. Ihre Stelle hing außerdem davon ab, dass jemand sie zur Fabrik fuhr. Dass sie Doris und Valentine abpasste. Ihre Familie besaß kein altes Auto, das man hätte reparieren können. Nicht einmal einen klapprigen Gaul zum Reiten. Der Highway, auf dem zweimal am Tag ein Bus fuhr, war meilenweit weg. Wenn niemand sie mitnahm, bedeutete das dreizehn Meilen Schotterpiste. Sie durfte nie krank werden. Wenn doch, besaß sie kein Telefon, um es irgendwem zu sagen. Man würde sie feuern. Sie müsste wieder ganz von vorn anfangen.
Manchmal fühlte sich Patrice, als wäre sie auf einen Rahmen gespannt, wie ein Hautzelt. Sie versuchte zu vergessen, wie leicht sie fortgeweht werden konnte. Und wie leicht ihr Vater alles ruinieren konnte. Dieses Gefühl, als einzige Barriere zwischen ihrer Familie und dem Verhängnis zu stehen, war nichts Neues, aber seit sie fest angestellt war, hatten sie es so weit gebracht.
Da sie wusste, wie wichtig Patrice’ Job war, hatte ihre Mutter Zhaanat unter der Woche die Aufgabe übernommen, nachts mit der Axt hinter der Tür zu warten. Solange nicht sicher war, wohin es den Vater diesmal verschlagen hatte, mussten sie auf der Hut sein. An den Wochenenden wechselten Zhaanat und Patrice sich ab. Mit der Axt auf dem Tisch und einer Petroleumlampe las Patrice ihre Zeitschriften oder ihre Gedichte. Zhaanat ging, wenn sie an der Reihe war, eine endlose Folge von Liedern durch, die alle verschiedenen Zwecken dienten, summte sie leise nach und trommelte dazu mit einem Finger auf dem Tisch.
Zhaanat war geschickt und schlau. Sie war unübersehbar, vierschrötig und stark, mit markanten Zügen. Sie war traditionell, eine Indianerin wie aus den alten Zeiten, von den Großeltern ausschließlich auf Chippewa erzogen, von klein auf in Zeremonien und Lehrgeschichten unterwiesen. Zhaanats Wissen wurde als so unentbehrlich erachtet, dass man sie versteckt gehalten hatte, um sie vor dem Internat zu bewahren. Das Lesen und Schreiben hatte sie gelernt, indem sie hin und wieder die Reservatsschule besuchte. Sie fertigte Körbe und Perlenstickereien, die sie verkaufte. Doch Zhaanats eigentliche Arbeit bestand darin, ihr Wissen weiterzuvermitteln. Die Leute kamen von weit her und campierten vor der Haustür, um von ihr zu lernen. Früher war dieses tiefgründige Wissen Teil eines Geflechts von Überlebensstrategien gewesen, die auf reichlich Jagdwild, genügend essbaren Pflanzen, Gärten voller Kürbisse und Bohnen sowie viel, viel Land beruhten, auf dem sie umherstreifen konnten. Jetzt blieb der Familie nur Patrice, die mit Chippewa aufgewachsen war, der aber das Englische leichtfiel, die die mütterlichen Traditionen befolgte, aber auch Katholikin war. Patrice kannte die Lieder ihrer Mutter, aber sie war auch Klassenbeste geworden und hatte dafür einen Gedichtband von Emily Dickinson geschenkt bekommen. Eins der Gedichte handelte vom Erfolg, aber aus dem Blickwinkel des Versagens. Patrice hatte oft genug erlebt, wie rasch sich junge Frauen aufrieben, wenn sie heirateten und Kinder kriegten – schon mit unter zwanzig. Für die gab es nichts als Schinderei im Leben. Die großen Chancen bekamen andere Leute. Die verheirateten Mädchen, die waren verloren. Die fernen Klänge des Triumphs. So wollte Patrice nicht enden.
Drei Männer
Moses Montrose saß gelassen hinter einer Tasse bitteren Tees. Der Stammesrichter war ein zierlicher, gepflegter, gut gealterter Mann von 65 Jahren. Thomas und er hatten sich in ihrem Besprechungsraum verabredet, dem Henry’s Café – ein paar Sitzecken und eine winzige Küche. Ihre Tagesordnung: Der einzige Teilzeitpolizist des Stammes war für eine Beerdigung in den Norden verreist. Das Gefängnis musste repariert werden. Als solches diente ein robuster, weiß gestrichener Holzschuppen. Eddy Mink hatte die Tür eingetreten, als er wieder einmal eine Nacht damit zubrachte, dort im betrunkenen Freudentaumel seine Ständchen zu singen. Er hatte Weindurst bekommen und beschlossen zu gehen. Sie berieten drüber, die Tür zu ersetzen. Doch der Stamm war wie immer pleite.
»Neulich musste ich Jim Duvalle verhaften«, sagte Moses. »Den habe ich ins Klohaus gesperrt.«
»Hat er sich wieder geprügelt?«
»Und zwar übel. Wir haben ihn abgeholt. Mein Sohn musste mir helfen, ihn da reinzubugsieren.«
»Ziemlich kalte Nacht für Duvalle.«
»Hat ihm nicht geschadet. Er hat auf dem Donnerbalken geschlafen.«
»Das müssen wir anders lösen«, sagte Thomas.
»Am nächsten Morgen habe ich mein Richterhemd übergezogen und ihn in meine Verhandlungsküche zitiert. Und geurteilt, dass er mit einer Geldbuße davonkommt. Er hatte nur einen Dollar bei sich, also habe ich den genommen und ihm gesagt, wir wären quitt. Ich hatte den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Seiner Familie das Essen vom Teller zu nehmen … das Ende vom Lied war, dass ich hin bin und den Dollar Leola in die Hand gedrückt habe. Ich brauche auch mein Gehalt. Aber es muss anders gehen.«
»Wir brauchen unser Gefängnis.«
»Mary war vielleicht sauer, dass ich ihn in unser Scheißhaus gesperrt habe! Sie wäre in der Nacht fast geplatzt, hat sie gesagt.«
»Das wollen wir lieber vermeiden, dass Mary platzt. Ich habe den Inspektor gefragt, aber er sagt, es wäre finanziell verdammt eng.«
»Bei dem ist was ganz anderes verdammt eng. So wie der den Arsch zukneift.«
Das hatte Moses auf Chippewa gesagt – auf Chippewa war alles gleich doppelt so komisch. Ihr Gelächter fegte die Spinnweben aus Thomas’ Kopf, und auch der Kaffee begann Wirkung zu zeigen.
»Das mit Jim sollte in den Rundbrief. Also vergiss nicht, die Details aufzuschreiben.«
»Er steht diesen Monat sowieso schon drin.«
»Es bringt nichts, die Leute bloßzustellen«, sagte Thomas.
»Bei ihm nicht. Die arme Leola ist diejenige, die sich schämt.«
Thomas schüttelte betrübt den Kopf, aber im Stammesrat hatte die Mehrheit dafür gestimmt, alle Verhaftungen und Bußgelder im Rundbrief aufzuführen. Moses kannte einen der Mitarbeiter im Regionalbüro des Amts für Indianerangelegenheiten in Aberdeen, North Dakota, und dieser Freund hatte ihm eine Kopie der Gesetzesvorlage geschickt, die für eine Emanzipation der Indianer sorgen sollte. So hieß es jedenfalls in den Zeitungsartikeln. Emanzipation. Thomas hatte den Text noch nicht gelesen. Moses gab ihm den Umschlag und sagte: »Die wollen uns fertigmachen.« Der Umschlag war nicht besonders schwer.
»Fertigmachen? Ich dachte, emanzipieren.«
»Kommt aufs Selbe raus«, sagte Moses. »Ich hab’s alles gelesen, Wort für Wort. Die machen uns fertig.«
An der Benzinpumpe vor dem großen Laden wurde Thomas von Eddy Mink angesprochen. Dessen langes graues Haar war zu dicken Placken verfilzt, die unter einem ausgebeulten Armeemantel verschwanden. Sein Gesicht war mit geplatzten Äderchen gesprenkelt. Seine Nase knollig und violett. Eddy war früher gut aussehend gewesen und trug noch immer ein elegant geknotetes gelbes Seidentuch um den Hals wie ein Filmstar. Er fragte Thomas, ob er ihm einen ausgeben wolle.
»Nein«, sagte Thomas.
»Ich dachte, du trinkst wieder.«
»Hab’s mir anders überlegt. Und du schuldest der Verwaltung eine neue Haustür.«
Eddy wechselte das Thema, indem er Thomas fragte, ob er die Sache mit der Emanzipation schon mitbekommen habe. Ja, sagte Thomas, aber mit Emanzipation hätte es nichts zu tun. Es war bemerkenswert, dass Eddy als Erster von dem Gesetzesentwurf wusste – aber so war er. Ehemals ein kluger Kopf und noch immer das Ohr auf der Schiene.
»Na, da habe ich aufgehorcht. Klingt wirklich gut, die Sache«, sagte Eddy. »Dann könnte ich mein Land verkaufen. Zwanzig Morgen, alles, was ich habe.«
»Aber dann hättest du kein Krankenhaus mehr. Keine Ärzte, keine Schule, keine Landwirtschaftsagentur, gar nichts. Nicht mal mehr einen Platz zum Schlafen.«
»Ich brauche auch nichts.«
»Keine Lebensmittelzuteilungen von der Regierung.«
»Mit dem Geld aus dem Verkauf könnte ich mir selbst was zu essen kaufen.«
»Du wärst gesetzlich gesehen kein Indianer.«
»Das Gesetz kann mir den Indianer nicht austreiben.«
»Mag sein. Und was, wenn das Geld aufgebraucht ist? Was dann?«
»Ich lebe im Hier und Jetzt.«
»Du bist genau die Sorte Indianer, die die sich wünschen«, sagte Thomas.
»Ein Säufer bin ich.«
»Wenn das hier umgesetzt wird, werden wir alle welche.«
»Dann sollen sie’s umsetzen!«
»Das Geld würde dich umbringen, Eddy.«
»Tod durch Whiskey? Hm, Nijii?«
Thomas lachte. »Der ist nicht halb so schön, wie du es dir vorstellst. Und was ist mit den Alten, die ihr Land behalten wollen? Denk mal an die, Nijii.«
»Ich weiß ja, dass du recht hast«, sagte Eddy. »Ich hab bloß gerade keine Lust, das zuzugeben.«
Eddy wandte sich noch im Reden ab. Er lebte auf dem Land seines Vaters allein in einer kleinen Hütte. Selbst die Teerpappe auf dem Dach war lose. Das Reservat war alkoholfreie Zone, deshalb war er von schlecht gepanschtem Whiskey halb blind geworden. Wenn Juggie Blue ihren Traubenkirschenwein kelterte, gab sie Eddy immer einen Krug ab, um ihn von den Panschern fernzuhalten. Im Winter schickte Thomas Wade auf ihrem letzten Pferd los, um zu schauen, ob Eddy noch lebte, und falls ja, für ihn Holz zu hacken. Früher einmal waren Thomas und sein Freund Archille mit Eddy tanzen gegangen, denn er spielte Geige wie ein Engel oder ein Teufel, egal, wie viel er trank.
Die meisten Häuser waren direkt an der Hauptstraße gebaut worden, doch die Farm der Familie Wazhashk lag hinter einer grasbewachsenen Anhöhe am Ende einer langen, kurvenreichen Zufahrt. Ihr altes, zweistöckiges Häuschen bestand aus handbehauenen, von der Witterung ausgebleichten Eichenbohlen. Das neue war ein gemütliches, von der Regierung finanziertes Cottage. Die Landparzelle mitsamt dem alten Haus hatte Wazhashk 1880 gekauft, bevor das Reservat geschrumpft war. Er hatte es sich leisten können, weil dem Grundstück ein Brunnen fehlte. Dieser Brunnen, das war eine Geschichte für sich. Vor zehn Jahren jedenfalls hatte die Familie das Cottage bewilligt bekommen und war sofort begeistert gewesen, als es von einem schweren Sattelschlepper gezogen bei ihnen ankam. Den Winter über schliefen Thomas, Rose, ihre Mutter Noko und eine wechselnde Kinderschar – darunter ihre eigenen, die noch zu Hause lebten – in dem behaglichen Neubau. Heute war es warm genug, dass Thomas sich im alten Haus ein wenig hinlegen konnte. Als er den Nash abstellte und ausstieg, sehnte er sich schon danach, unter die warme Wolldecke zu schlüpfen.
»Dass du dich ja nicht wieder davonschleichst!«
Rose und ihre Mutter stritten, und Thomas überlegte kurz, ob er direkt im alten Haus verschwinden sollte. Doch Rose lehnte sich zur Tür hinaus und rief: »Du bist zurück, alter Mann!« Dabei lächelte sie kaum merklich. Türenknallend verschwand sie wieder im Cottage, aber Thomas hatte trotzdem mitbekommen, dass bei Rose gutes Wetter herrschte. Er prüfte immer erst einmal ihre Wetterlage, bevor er sich rührte. Heute war sie stürmisch, aber heiter, also ging er ihr nach. Die Kleinkinder, auf die Rose gerade aufpasste, saßen brabbelnd im Gitterbett. Zwei Zimtwecken mit Zuckerguss standen für ihn auf dem Tisch. Eine Schüssel Porridge. Irgendjemand hatte Hühner, die immer noch legten, also gab es ein Ei. Rose röstete zwei Scheiben Brot in Schmalz und legte sie ihm auf den Teller, als er sich setzte. Er goss sich aus dem letzten vollen Kanister Wasser ein.
»Ich gehe Wasser holen, wenn ich wieder wach bin«, sagte er.
»Wir brauchen jetzt welches.«
»Ich bin k.o. Total am Boden.«
»Dann warte ich mit der Wäsche.«
Das war ein großes Zugeständnis. Rose wusch in einer Trommel mit Handkurbel und erledigte den Waschgang gern frühmorgens, um die Kraft der Sonne zum Trocknen auszunutzen. Thomas wrang sich Liebe aus ihrer Rücksichtnahme und aß überwältigt weiter.
»Meine Liebste«, sagte er.
»Liebste dies, Liebste das«, grollte Rose.
Er sah zu, dass er rauskam, ehe sie sich das mit der Wäsche anders überlegte.
Sonnenlicht flutete durch die kleine Schlafetage des alten Hauses. Ein paar letzte Fliegen warfen sich gegen die Fenster oder drehten sich sterbend auf dem Boden im Kreis. Die Oberseite der Flickendecke war warm. Thomas zog sich die Hose aus und legte sie entlang der Bügelfalten zusammen, damit sie in Form blieb. Er bewahrte eine lange Unterhose unter dem Kissen auf. Die zog er über, drapierte sein Hemd über einen Stuhl und legte sich unter die schwere Decke. Sie bestand aus den Resten von Wolljacken, die im Familienbesitz gewesen waren. Hier war ein marineblauer Flicken aus dem Mantel seiner Mutter. Er war damals aus einer Tauschhandel-Wolldecke geschneidert worden und jetzt wieder zu einer Decke geworden. Hier die gefütterten, karierten Wolljacken der Jungs mit ihren Rissen und Scheuerstellen. Diese Jacken waren durch Felder gerannt, vereiste Abhänge hinuntergerodelt, hatten sich mit Hunden gebalgt und waren zurückgeblieben, als ihre Besitzer in der Großstadt Arbeit fanden. Und hier Rose’ Mantel vom Beginn ihrer Ehe. Blaugrau und fadenscheinig war er jetzt und trug noch immer den Abdruck jenes schicksalsträchtigen Moments, als sie im Davongehen innehielt, sich zu ihm umdrehte, lächelte und ihn unter der Krempe ihres nachtblauen Glockenhuts herausfordernd ansah. Sie waren so jung damals. Sechzehn. Seit dreiunddreißig Jahren verheiratet inzwischen. Die meisten Mäntel hatte Rose von den Benediktinerinnen bekommen für die Mitarbeit in ihrer Kleiderkammer. Aber seinen eigenen kamelbraunen Zweireiher hatte sich Thomas von dem Lohn als Erntehelfer gekauft. Seine älteren Söhne hatten ihn aufgetragen, nur der dazugehörige Hut war ihm geblieben. Wo der wohl war? Zuletzt gesehen in der Hutschachtel auf der schmalen Kommode. Es half ihm beim Einschlafen, die fest verwobenen Wollflicken zu befühlen, die ihn so angenehm schwer bedeckten, jedenfalls solange er Falons Militärmantel ausließ. Dieser Flicken raubte ihm den Schlaf, wenn er zu viel daran dachte.
Seine letzten bewussten Gedanken richtete Thomas auf den braunen, stillen alten Mantel seines Vaters. Den Hügel hinunter, durch den Sumpf, über ein abgeerntetes, gepflügtes Feld und durch den Birken- und Eichenwald verlief ein grasbewachsener Pfad von einem Grundstück zum anderen und führte direkt bis zur Haustür seines Vaters. Thomas’ Vater war so alt, dass er inzwischen die meiste Zeit im Bett verbrachte. Vierundneunzig Jahre. Wenn Thomas an seinen Vater dachte, breitete sich Frieden über seine Brust und wärmte ihn wie die Sonne.
Der Boxtrainer
Lloyd Barnes’ bester Matheschüler kämpfte unter dem Namen Wood Mountain. Er hatte letztes Jahr die Schule abgeschlossen, trainierte aber weiterhin in dem Studio, das Barnes in der Garage des Gemeindezentrums eingerichtet hatte. Von ihm hieß es, er könnte berühmt werden, wenn er sich nur vom Alkohol fernhielt. Barnes wiederum, ein hochgewachsener Mann mit dichtem strohblondem Haar, trainierte immer mit seinen Schülern zusammen. Sie trainierten im Dreierrhythmus: Drei Minuten Seilspringen, Pause, wieder drei Minuten, Pause, und noch drei. So strukturierte Barnes sämtliche Trainingseinheiten. In Intervalle, wie die Runden beim Kampf. Er machte selbst den Sparringspartner für die Jungen, damit er ihre Technik korrigieren konnte. Barnes hatte in Iowa boxen gelernt, bei seinem Onkel Gene »Musikus« Barnes, einem ungewöhnlichen Sportler. Barnes konnte nicht mit Sicherheit sagen, ob sein Onkel diesen Beinamen seinem Brotberuf als Leiter einer Blaskapelle verdankte, seiner Angewohnheit, vor sich hin zu summen, wenn er einen Gegner umtanzte, oder dem Umstand, dass er so gut war und die Sportreporter unweigerlich vor jedem seiner Kämpfe schrieben, dem Gegner würde sicher »der Marsch geblasen«. Barnes war nie so weit gekommen wie sein Onkel und hatte nach einem besonders heftigen Kopftreffer beschlossen, seine Bestimmung sei die pädagogische Hochschule in Moorhead. Die G.-I.-Bill hatte ihm als Kriegsveteran den Zugang eröffnet, und seine Studiendarlehen wurden getilgt, als er zusagte, im Reservat zu unterrichten. Er hatte drei Mal seinen Posten gewechselt, aus Grand Portage nach Red Lake, aus Red Lake nach Rocky Boy, und jetzt war er seit zwei Jahren in Turtle Mountain. Hier gefiel es ihm. Außerdem hatte er ein Auge auf eine der Turtle-Mountain-Frauen geworfen und hoffte, dass sie ihn bemerken würde.
Am vorigen Wochenende hatte Barnes sich in Grand Forks ein Golden-Gloves-Match angesehen, zwischen Kid Rappatoe und Severine Boyd. Während er jetzt mit seinen Schülern Ausdauertraining machte, ließ er Revue passieren, wie Boyd und Rappatoe katzengleich aus ihren Ecken hervorgesprungen waren und aufeinander eingeschlagen hatten. Sie waren beide so schnell, dass keinem mehr gelang als ein paar Streifschläge. Fünf Runden blieb es dabei – blitzschneller Schlagabtausch, Clinch, ein Schritt zurück, und dann boxten sie wieder ins Leere. Rappatoe war dafür bekannt, dass er seine Gegner mürbe machte, doch Boyd ging häufig über die volle Distanz und wirkte frisch. In der sechsten Runde tat Boyd etwas, das Barnes für fragwürdig hielt und doch bewundern musste. Er wich einen Schritt zurück, ließ die Deckung sinken, zog seine Shorts hoch und schaute ins Leere, nur um Rappatoe im selben Moment einen überraschenden langen linken Haken an den Kopf zu knallen. Von Anfang an hatte Boyd das Manöver vorbereitet. Hatte in den seltsamsten Momenten die Deckung fallenlassen. So getan, als gäbe es ein Problem mit der Hose. Und dann der leere Blick. Mehrere Male, als wäre er weggetreten. Es sah aus wie lauter harmlose Tics, bis Boyd mit noch einer Linken nachsetzte, ein Körpertreffer diesmal, und mit einer Rechten, die Rappatoe vorübergehend auf die Bretter schickte, ihn dauerhaft aus dem Konzept brachte und Boyd den Sieg bescherte.
Barnes hatte sich auf seinem Platz am Ring zu Reynold Jarvis umgedreht, dem Englischlehrer, der mit den Schülern auch Theaterstücke inszenierte.
»Wir brauchen einen Schauspiellehrer«, sagte Barnes.
»Ihr braucht bessere Ausrüstung«, sagte Jarvis.
»Wir sammeln Spenden für Handschuhe.«
»Und was ist mit einer Boxbirne? Einem Sandsack?«
»Sackleinen, Sägespäne. Und alte Reifen.«
»Ah, verstehe. Ihr braucht wirklich gute Schauspielkünste.«
Man konnte vieles vortäuschen, selbst Ausdauer oder Kraft. Noch entscheidender war, was man verbergen konnte. Ajijaak zum Beispiel, einer von Barnes’ vielversprechendsten jungen Schülern, sah aus wie sein Namensvetter, der Reiher. Er ähnelte Barnes, war hochgewachsen und schlaksig und so nervös, dass man ihn zittern zu sehen glaubte. Ajijaaks Körperhaltung war eine ständige Bitte um Verzeihung. Doch der Junge hatte einen verblüffenden linken Haken und die Reichweite eines lauernden Vogels. Dann war da Pokey Paranteau, ein Naturtalent ohne klare Richtung. Revard Stone Boy, Calbert St. Pierre, Dicey Asiginak, Garnet Fox und Case Allery machten sich allesamt gut. Wade Wazhashk bearbeitete gerade seine Mutter, damit sie ihm sein erstes echtes Match erlaubte. Auch er zeigte Potenzial, obwohl ihm die richtigen Instinkte fehlten. Denken konnte nicht schaden, aber Wade überlegte zweimal, bevor er zuschlug. Barnes verbrachte viel Zeit damit, die Jungs zu Kämpfen in den umliegenden Städten zu chauffieren – Städten außerhalb des Reservats, wo die Zuschauer Kriegsgeheul nachahmten und buhten, wenn ihr Favorit unterlag. Nach den Matches chauffierte er sie wieder nach Hause, und auch nach dem Training, das viel länger dauerte, als der Schulbus verkehrte.
Jetzt gerade hoben seine Schüler Gewichte und machten alles falsch. Barnes korrigierte. Er war dagegen, den linken Arm zu sehr zu belasten, denn jeder seiner Schüler sollte einen so schnellen linken Haken haben wie Gene Musikus bei seiner sagenumwobenen »Paukenschlagsinfonie«, einer unvorhersehbaren Kombination harter, schneller Schläge, die damals Ezzard Charles in die Seile geschickt hatte. Natürlich bevor Charles groß rausgekommen war und es schließlich an die Spitze geschafft hatte. Der Musikus war ein Künstler unter den Kämpfern und landete schließlich mit einem Kneipenschläger im Ring, der ihm einen Milzriss beibrachte.
Wood Mountain hatte Schweißen gelernt und für den Boxclub Gewichte hergestellt, indem er Blechdosen mit Sand füllte und verschloss. Die Gewichte waren nicht geeicht, also stemmten die Jungs 1½, 3, 7¼, 12, 18 oder 23 Pfund Sand. Aber für die Geschwindigkeit hatte Barnes sich etwas überlegt.
»Schaut mal her«, sagte er.
Er ballte die rechte Hand zur Faust und drückte mit den Knöcheln gegen die Wand.
»Macht das nach.«
Die Jungs ballten alle die Fäuste und drückten.
»Druck, mehr Druck«, sagte Barnes. Der dichte Haarschopf fiel ihm in die Stirn, und er presste die Faust gegen die Wand, bis seine Unterarme schmerzten. »Fester … okay, und Schluss.«
Die Jungs traten zurück und lockerten ihre Hände.
»Jetzt mit links.«
Sein Ziel war, nur genau die Muskeln zu trainieren, die den Schlag ausführten. Sein Onkel war von Tempo und Überraschungseffekten besessen gewesen. Er hatte Barnes auch mentale Techniken beigebracht. Barnes gab das Signal für eine Pause. Die Jungs reihten sich hinter dem Trinkbrunnen auf und scharten sich dann um ihren Trainer.
»Geschwindigkeitstraining«, sagte Barnes. »Nennt mir das Allerschnellste, was euch einfällt.«
»Blitze«, sagte Dicey.
»Schnappschildkröten«, sagte Wade, der einmal von einer gebissen worden war.
»Klapperschlangen«, sagte Revard, dessen Familie immer wieder Zeit in Montana verbrachte.
»Ein Niesen«, sagte Pokey, und alle lachten.
»Ein heftiges Niesen«, sagte Barnes. »Eine Explosion! So soll euer Schlag aussehen. Ohne Vorwarnung. Stellt es euch vor, stellt euch das Schnellste vor, das ihr je gesehen habt. Drei Minuten Schattenboxen. Dann Pause. Drei Mal, wie immer.«
Barnes zog seine Stoppuhr hervor und tigerte hinter ihnen auf und ab, während sie antäuschten, Kombinationen boxten, wieder antäuschten und wieder schlugen. Er unterbrach Case, tippte ihn auf den Arm.
»Nicht den Ellbogen ausfahren! Den Haken seh ich von Weitem!«
Er nickte, wenn sie Fortschritte machten.
»Nie nach hinten ausholen mit dem Arm! Hört ihr, nie!«
Er selbst stellte sich vor Pokey und täuschte Schläge an, damit der Junge üben konnte, nicht zurückzuzucken. Barnes wusste, wo das herkam. Oder von wem.
Er ließ sie Steigerungsläufe machen, dann zum Abkühlen ein paar langsame Runden. Calbert und Dicey wohnten dicht bei und konnten zu Fuß gehen. Alle anderen quetschten sich in Barnes’ Auto. Unterwegs erzählte er ihnen, wie Boyd seinen Sieg über Rappatoe errungen hatte. Er konnte es nicht richtig erklären. Nicht so, dass sie es sich vorstellen konnten.
»Das muss euch Mr Jarvis zeigen«, sagte er schließlich.
Pokey brachte er als Letzten nach Hause. Er wohnte am weitesten entfernt und abseits der Straße, aber Barnes bestand darauf, ihn bis zur Tür zu bringen, obwohl er dann auf der langen unbefestigten Zufahrt zurücksetzen musste. Erst hatte er das getan, weil er über Paranteau Bescheid wusste und sichergehen wollte, dass Pokey nichts passierte. Dann hatte er Pixie gesehen. Seitdem fuhr Barnes jedes Mal bis zur Haustür, weil er hoffte, dass Pixie wieder Holz hacken würde. Pixie. Diese Augen!
Barnes erreichte die Lehrerkantine, als gerade alles abgeräumt wurde. Er lebte in einer »Junggesellenwohnung«, einem kleinen weißen Bungalow zu Füßen einer Pappel. Die Lehrerinnen und andere Beamtinnen wohnten in einem zweistöckigen Backsteingebäude mit vier großzügig geschnittenen Zimmern im Obergeschoss, zweien im Erdgeschoss und einer Gemeinschaftsküche; dazu gab es einen Aufenthaltsraum im gut ausgebauten Keller, in dem auch Juggie Blue, die Hausmeisterin und Köchin, ein kleines Zimmer hatte. Sie hatte gerade den Abwasch erledigt und wollte zum Abschluss den Boden wischen, wie jeden Tag um sieben. Juggie war eine untersetzte, aber wohlproportionierte, scharfsinnige Frau um die vierzig. Sie gehörte dem Stammesrat an, genau wie Thomas. Und wie Barnes versuchte sie immerzu, sich das Rauchen abzugewöhnen, und wenn einer von ihnen rückfällig wurde, wurden sie es beide. Aber heute nicht. Oder wahrscheinlich nicht. Er wollte später noch mit Wood Mountain trainieren.
Juggie behielt immer eine große Portion Essen für ihn übrig. Heute zog sie einen Teller Pie aus dem Warmhalteofen ihres heiß geliebten sechsflammigen Herds. Er hatte nicht einen oder zwei, sondern drei Ofenröhren mit gesprenkelt schwarz emaillierter Innenwandung und Seitengittern aus Edelstahl. Juggie hatte darauf bestanden, ihn aus Devils Lake liefern zu lassen. Sie hatte bei Inspektor Tosk einen Stein im Brett. Mit ihrem teuren Herd konnte sie mehrere Gerichte auf einmal zubereiten und sogar ihren sagenumwobenen Rindereintopf bei niedriger Temperatur über viele Stunden garen. Am liebsten aber kochte sie den Eintopf in einem antiken niederländischen Ofen, den im vorigen Jahrhundert ein Ochsengespann herbeigeschafft hatte. Sie verwendete eine ganze Flasche von ihrem Traubenkirschenwein und Thomas’ Möhren, die er für den Winter im Keller in einem Kübel voller Sand versenkte. Sie bekam von jedem aus dem Reservat, was sie wollte. Und das war erstaunlich, denn an ihrem Charme lag es nicht.
»Potpie«, sagte sie und ging ihren Wischeimer füllen.
O Gott. Barnes war so hungrig. Er war immer hungrig. Und Potpie war ihm das liebste, zumindest das zweit- oder drittliebste Gericht aus Juggies Repertoire. In der saftigen Kruste war Schmalz aus St. John, und die Hühner kaufte sie von den Hutterern jenseits der Grenze. Die Pembina-Kartoffeln, die sie jedes Jahr selbst anbaute und einmietete, waren klein und frisch, denn es war September. Die Möhren perfekt durch, aber nicht zu weich. Dazu die leicht gesalzene goldbraune Bratensoße. Die weichen, vorher angebratenen Zwiebeln. Sie hatte eine ordentliche Menge Sansibar-Pfeffer mit hineingegeben. Als Barnes fertig war, senkte er den Kopf. Einige der Lehrer verlängerten nur wegen Juggie ihre Verträge, und man konnte sich denken, warum Inspektor Tosk auf sie hörte.
Barnes seufzte und brachte seinen Teller zum Tresen.
»Du hast dich selbst übertroffen.«
»Hm. Hast du ’ne Kippe?«
»Nein. Diesmal schaffe ich’s wirklich.«
»Ich auch.«
Beide warteten kurz, nur für den Fall.
»Ich muss jetzt wischen«, sagte Juggie. Dann richtete sie sich hoch auf, spähte nach allen Seiten und holte ein eingewickeltes Päckchen unter dem Tresen hervor. Das Abendessen für ihren Sohn. Sie schob es Barnes hin.