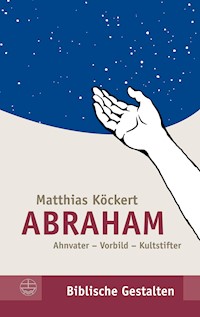7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Zehn Gebote gehören zu den bekanntesten Texten der Bibel. Sie haben in der Kulturgeschichte tiefe Spuren hinterlassen. Ihnen verdanken sich unser Wochenrhythmus und der wöchentliche Ruhetag. Bis heute berufen sich Politiker auf dieses Grundgesetz der Menschheit. Matthias Köckert erklärt anschaulich, wie Die Zehn Gebote entstanden sind und was ihr ursprünglicher Sinn war, und beschreibt ihre Wirkungsgeschichte in Judentum, Christentum und Islam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Matthias Köckert
DIE ZEHN GEBOTE
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Die Zehn Gebote gehören zu den bekanntesten Texten der Bibel. Sie haben in der Kulturgeschichte tiefe Spuren hinterlassen. Ihnen verdanken sich unser Wochenrhythmus und der wöchentliche Ruhetag. Bis heute berufen sich Politiker auf dieses Grundgesetz der Menschheit. Matthias Köckert erklärt anschaulich, wie die Zehn Gebote entstanden sind und was ihr ursprünglicher Sinn war, und beschreibt ihre Wirkungsgeschichte in Judentum, Christentum und Islam.
Über den Autor
Matthias Köckert, geboren 1944, ist em. Professor für Altes Testament an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Für meine KinderCharlotte, Ulrike und Hansjochen
Inhalt
1. Einführung:Die Zehn Gebote als Erbe unserer Kultur
2. Viele «Satzungen», aber nur «Zehn Worte»:Besonderheiten der Zehn Gebote
Erzählte Einzigartigkeit
Die Zehn Worte und das Recht
Kundgabe Gottes statt Gesetze des Königs
3. Zehn Worte auf zwei Tafeln:Zählung und Komposition
Verschiedene Weisen, bis zehn zu zählen
Exodus 20: Bewahrung der Freiheit durch Bindung an Gott und den Mitmenschen
Deuteronomium 5: Feier der Freiheit im wöchentlichen Ruhetag des Sabbats
4. Von der Gottesrede am Sinai zu Moses Abschiedsrede:Doppelüberlieferung und Entstehung der Reihe
Zwei Fassungen und ihr Verhältnis zueinander
Eine Kurzbiographie des Dekalogs
5. Die Zehn Worte:Ursprünglicher Sinn und Bedeutung
Ich bin Jhwh, dein Gott
Du sollst keine anderen Götter haben an meiner Statt
Du sollst dir kein (Kult-)Bild (von mir) machen
Du sollst den Namen Jhwhs, deines Gottes, nicht zum Trug aussprechen
Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen
Ehre deinen Vater und deine Mutter
Du sollst nicht töten
Du sollst nicht ehebrechen
Du sollst nicht stehlen
Du sollst nicht gegen deinen Nächsten als falscher Zeuge aussagen
Du sollst nicht trachten nach …
6. Das «Grundprinzip der Tora»:Jüdische Deutungen
Das zehnte Gebot der Samaritaner
Der Dekalog in der Septuaginta
Philo und das hellenistische Judentum
Frömmigkeit und Gottesdienst
7. Das «natürliche Gesetz»:Der Dekalog in der Alten Kirche
Die Zehn Gebote im Neuen Testament
Der Dekalog vor Konstantin
Katalog der «Pflichten» oder «Gesetz der Gnade»
Vom Sabbat zum Sonntag
8. Der «rechte Weg»:Spuren der Zehn Gebote im Koran
Mose und das Gesetz im Koran
Die Gebotsreihen und ihre Adressaten
9. «Handwerksregeln» eines Christen:Die Zehn Gebote bei Luther
10. Epilog:Zehn Gebote, Menschenrechte und Menschenpflichten
Nachweise der Zitate
Literaturhinweise
Die beiden Fassungen des Dekalogs
1. Einführung:Die Zehn Gebote als Erbe unserer Kultur
Weniges aus dem Fundus jüdisch-christlicher Überlieferung hat die abendländische Kultur bis heute so geprägt wie die Zehn Gebote. Sie sind wahrscheinlich neben der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium der bekannteste Text der Bibel, auch wenn immer weniger Menschen ihren Wortlaut oder gar ihren ursprünglichen Sinn kennen. Immerhin, die meisten kennen sie wenigstens noch dem Namen nach. Wirklich bekannt sind vor allem die Gebote, die das Verhältnis zum Nächsten betreffen, allen voran: «Du sollst nicht töten!»
Gewöhnlich identifiziert man das «Du sollst …!» und mehr noch jenes «Du sollst nicht …!» mit dem, was man für jüdisch-christliche Moral hält, und rümpft die Nase über ihren vermeintlich repressiven Charakter. Doch sagt der repressive Gebrauch noch nichts über die Zehn Gebote selber aus. Vor vorschnellen Urteilen können Einsichten in den ursprünglichen Sinn der Reihe und einige Blicke in deren Wirkungsgeschichte bewahren.
Den schärfsten Widerspruch gegen die Zehn Gebote haben die Nationalsozialisten eingelegt, wenn man Hermann Rauschning glauben darf. Er berichtet 1943 von einer Unterhaltung Hitlers mit dessen Chefideologen Goebbels und anderen Vertrauten in der Reichskanzlei, in deren Verlauf man auch auf die Zehn Gebote zu sprechen kam. Hitler kann sie nur als «Perversion unserer gesundesten Instinkte» und als «Peitsche eines Sklavenhalters» wahrnehmen. «Dieses teuflische ‹Du sollst, du sollst!›. Und dieses dumme ‹Du sollst nicht!›. Er muß heraus aus unserem Blut, dieser Fluch vom Berge Sinai! Dieses Gift, mit dem sowohl Juden wie Christen die freien, wunderbaren Instinkte des Menschen verdorben und beschmutzt und sie auf das Niveau hündischer Furcht herabgedrückt haben.» Hitler kündigt an, der Tag werde kommen, an dem er «gegen diese Gebote die Tafeln eines neuen Gesetzes aufrichten werde», und er ist davon überzeugt, dass «die Geschichte» dereinst die nationalsozialistische Bewegung «als die große Schlacht für die Befreiung der Menschheit … vom Fluche des Sinai» rechtfertigen werde. «Dagegen kämpfen wir: gegen den masochistischen Geist der Selbstquälerei, gegen den Fluch der sogenannten Moral, die man zum Idol gemacht hat, um die Schwachen vor den Starken zu schützen, angesichts des ewigen Gesetzes des Kampfes, des großen Gesetzes der göttlichen Natur. Gegen die sogenannten Zehn Gebote kämpfen wir.»
Mit den Zehn Geboten steht mehr auf dem Spiel als lediglich die Sondermoral einer gesellschaftlichen Randgruppe. Zu Recht gelten sie als universales Sittengesetz, gültig zu allen Zeiten und an jedem Ort. Das haben die Nazis durchaus gespürt und sie gerade deshalb verachtet. Thomas Mann hat Hitlers Verachtung der Zehn Gebote als Schändung der Humanität begriffen, denn in ihnen erkennt er die «Quintessenz des Menschenanstands», wie er formuliert. Deshalb war er im amerikanischen Exil bereit, den ersten Beitrag in einem Buch mit dem Titel The Ten Commandments zu übernehmen, zu dem der aus Wien stammende Literaturagent Armin L. Robinson neben Thomas Mann noch neun andere Autoren um Mitarbeit gebeten hatte, darunter Sigrid Undset und Franz Werfel. Thomas Mann schrieb dafür 1943 in wenigen Monaten jene Novelle, die in der englischen Version unter dem Titel des ersten Gebots «Du sollst keine anderen Götter haben neben mir» lief und ein Jahr später auf Deutsch mit dem Titel Das Gesetz separat in Stockholm erschien. In ihr erzählt er die Geschichte von der Entstehung der Zehn Gebote als eine Geschichte der Menschwerdung des Menschen durch die Ausbildung dessen, was er «Menschenbenehmen» nennt. Die Zehn Gebote sind dessen Alphabet. Dem Anlass des Auftragswerkes entsprechend stellt er darin «das Ewig-Kurzgefaßte, das Bündig-Bindende, Gottes gedrängtes Sittengesetz» der Barbarei des Nationalsozialismus entgegen. Denn die Zehn Gebote sind nichts Geringeres «als Grundweisung und Fels des Menschenanstandes unter den Völkern der Erde». Mag Gottes Rede auch an Israel gerichtet sein, so ist sie doch «ganz unwillkürlich eine Rede für alle», so dass jeder Mensch «wohl weiß, die Worte gelten». Die Erzählung spielt am Schluss auf die von Rauschning überlieferten blasphemischen Äußerungen Hitlers an, die damals als authentisch galten, und endet ganz folgerichtig mit einem Fluch aus Moses Mund: «Aber Fluch dem Menschen, der da aufsteht und spricht: ‹Sie gelten nicht mehr.›» Moses Hörer nehmen ihn auf: «Und alles Volk sagte Amen.» In ihn sollen auch die Leser der Novelle und mit ihnen «eine der Religion und Humanität noch anhängliche Welt» einstimmen.
Dieses Verständnis der Zehn Gebote als universales Grundgesetz der Menschheit hatte mehr als 400 Jahre vor Thomas Mann schon Lucas Cranach 1516 in einem großen Wandbild für den Gerichtssaal des Rathauses in Wittenberg gestaltet. Zehn Bildfelder stellen jeweils ein Gebot in den Alltag der Zeit. Alle Felder aber werden durch einen großen Bogen verbunden, der an den «Bogen in den Wolken» nach der Sintflut in Gen 9 als Gottes Friedenszeichen für alle Menschen erinnert. Durch den Regenbogen erscheinen die Zehn Gebote für Israel hier geradezu als Grundordnung für die gesamte Menschheit nach der Flut. Am ursprünglichen Ort des Bildes, dem Wittenberger Gerichtssaal, führen sie jedem das «Grundgesetz» vor Augen, das den Gesetzen zugrunde liegt, nach denen hier Recht gesprochen wird. Ähnlich mögen Ende des 19. Jahrhunderts die Bremer Stadtväter gedacht haben, als sie die Zehn Gebote in goldenen Lettern auf der Fassade ihres Landgerichts über dem Hauptportal anbringen ließen. Sie befinden sich an den äußeren Fensterbrüstungen des Saales, in dem das Schwurgericht tagt. Nachdem die Nazis die Macht übernommen hatten, mussten die Zehn Gebote 1936 von der Fassade verschwinden. Doch einige «der Religion und Humanität noch anhängliche» Bürger Bremens sorgten dafür, dass die Mosaiken lediglich mit steinernen Tafeln verdeckt wurden. Deshalb können sie auch heute noch auf zehn Feldern zwischen den Fenstern von allen gelesen werden, die hier Recht suchen und Recht sprechen.
Aber täuschen wir uns nicht, die Zehn Gebote sind gegenwärtig keineswegs unumstritten, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Der Streit entbrennt weniger an ihrer Herkunft oder ihrem Inhalt, sondern an der Möglichkeit, sie als Symbole jüdischer wie christlicher Religion zu deuten. Als solche scheinen sie im Kontext eines weltanschaulich neutralen und säkularen Staates keinen Platz zu haben. Jedenfalls meinen das viele Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und gehen auf unterschiedliche Weise gegen sie vor. Die einen übermalen entsprechende Monumente vor öffentlichen Gebäuden mit dem Hinweis «Not on public land». Andere führen Prozesse. So haben die Richter des Supreme Court nach heftigen Kontroversen mit knapper Mehrheit entschieden, dass die in den sechziger Jahren vor dem Parlamentsgebäude in Austin, Texas, aufgestellten Stelen an ihrem Ort bleiben dürfen. Das Gericht begründete seine positive Entscheidung mit dem Hinweis darauf, dass die Zehn Gebote nicht nur ein religiöses Symbol sind, sondern darüber hinaus auch eine allgemeine historische Bedeutung haben. Dieses Argument konnte freilich nicht verhindern, dass in Kentucky die Zehn Gebote aus zwei Gerichtsgebäuden entfernt werden mussten.
Im kulturellen Gedächtnis der Gegenwart ist am wirksamsten die äußere Form geworden, die Zehnzahl und die Anreihung von Verboten und Geboten in bunter Mischung. Vor allem die Zehnzahl hat stilbildend gewirkt. Das ist selbst dort der Fall, wo man unter den zehn Wichtiges vermisst und deshalb meint, noch dies und das ergänzen zu müssen.
Unter den Nachahmungen der Zehn Gebote finden sich eindrückliche Beispiele. Man denke nur an die Zehn Gebote aus der Idee zu einem Katechismus der Vernunft für edle Frauen von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher aus dem Jahre 1798, der nicht nur die äußere Form zum Vorbild nimmt, sondern sich auch in der Sache auf die einzelnen Gebote bezieht. An die Stelle des Gebots der Ehrung der Eltern stellt Schleiermacher: «Ehre die Eigentümlichkeit und die Willkür deiner Kinder, auf dass es ihnen wohl gehe und sie kräftig leben auf Erden.» Dem Ehebruchverbot entspricht: «Du sollst keine Ehe schließen, die gebrochen werden müsste.»
Neben manch Eindrücklichem gibt es vor allem viel Läppisches: Zehn Gebote für Redner, zehn zum Glücklichsein, zehn für dies und zehn für das. Kürzlich präsentierte ein Verlagsprospekt ein Buch mit dem Titel Die (!) 10 Gebote der Erziehung. Bei alledem handelt es sich weder um Recht oder Gesetz noch um Regeln der Moral, sondern um das, was man Ratgeberliteratur zu nennen pflegt. Sie bietet Hilfe an nach der Art von: Fassen Sie sich kurz und formulieren Sie treffend, wollen Sie als Redner Erfolg haben. Oder: Behandeln Sie Ihr Kind mit Respekt, soll Erziehung gelingen. Sind auch die Zehn Gebote (nur) Ratschläge nach der Weise: Töte nicht, wenn dein Leben gelingen soll? Oder handelt es sich eher um ethische Maximen?
Als besonders skurriles Beispiel ihrer Fernwirkung können «Die Zehn Gebote der sozialistischen Moral» gelten, die Walter Ulbricht 1958 auf dem V. Parteitag der SED verkündet hat. An erster Stelle steht der Einsatz für die «internationale Solidarität der Arbeiterklasse» und für die «unverbrüchliche Verbundenheit aller sozialistischen Länder». Das zweite Gebot legt Vaterlandsliebe als stete Bereitschaft aus, «deine ganze Kraft und Fähigkeit für die Verteidigung der Arbeiter- und Bauern-Macht einzusetzen». Das vierte fordert dazu auf, «gute Taten für den Sozialismus» zu vollbringen. Dieses Gebot verstand sich offenbar so wenig von selbst, dass man ihm als einzigem eine Begründung beigegeben hat: «… denn der Sozialismus führt zu einem besseren Leben für alle Werktätigen.» Weitere Gebote fordern: «Du sollst… das Kollektiv achten und seine Kritik beherzigen»; «Du sollst sparsam sein und die sozialistische Arbeitsdisziplin festigen»; «Du sollst deine Kinder … zu allseits gebildeten, charakterfesten und körperlich gestählten Menschen erziehen.» Den Gipfel bildet die Forderung, «sauber und anständig» zu leben und seine Familie zu achten. Wie man sieht, verstanden sich diese Gebote nicht als wohlmeinende Ratschläge, sondern als moralische Appelle. In dieser Gestalt kam die Bibel, wenn auch nur als leere Form, sogar ins Parteistatut der SED, aus dem sie 1976 wieder verschwand. Wie man nicht zuletzt an diesem merkwürdigen Beispiel sieht, bleiben die Nachahmungen in den meisten Fällen hinter der Dichte und Gedankentiefe des biblischen Vorbilds weit zurück.
Lapidare Kürze, statuarische Prägnanz der Formulierung und die Evidenz des Verbotenen, das auch der schlechteste Wille anerkennen muss, zeichnen das Vorbild aus. Doch haben diese Vorzüge den Aufstieg der Zehn Gebote nicht ohne weiteres befördert. Selbst im antiken Judentum spielen sie nicht die herausragende Rolle, die man nach ihrer Auszeichnung im Alten Testament erwarten würde. Im Neuen Testament werden sie nur in Auswahl zitiert, und in der Geistes- und Kulturgeschichte stehen sie bis ins Spätmittelalter eher im Schatten. Populär geworden sind sie im Abendland erst durch Martin Luther. Er hat ihnen 1529 mit seinem Kleinen Katechismus eine ungeheure Breitenwirkung verschafft. Seither gehören sie nicht nur ins Archiv der abendländischen Geistes- und Kulturgeschichte. Seither gehören sie zu unserem Kulturerbe.
Aber nicht jedes Erbe weckt eitel Freude. Manches Erbe löst bei den Erben zwiespältige Gefühle aus. Auch die Zehn Gebote werden heute von vielen als durchaus ambivalent erfahren; denn sie tragen eine lange, zum Teil auch eine belastende Geschichte mit sich. Daran sind ein moralinsaurer, lebensferner Katechismusunterricht und eine schwarze Pädagogik nicht unschuldig. Die haben häufig die Zehn Gebote als Prügel der Moral missbraucht und dafür gesorgt, dass sie eher als zehn große Plagen denn als Regeln zur Bewahrung der Freiheit erfahren worden sind. Schon Johann Wolfgang von Goethe lässt 1809 in seinem Roman Die Wahlverwandtschaften bezeichnenderweise einen ehemaligen Geistlichen mit dem sprechenden Namen Mittler propagieren, dass in der Kindererziehung wie im Verhältnis unter den Völkern «nichts ungeschickter und barbarischer sei als Verbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen». Viel lieber solle man die entgegengesetzten Tugenden gebieten. Deshalb findet allenfalls das Elterngebot als «ein ganz hübsches, vernünftiges, gebietendes Gebot» Gnade vor Mittlers (und vor Goethes) Augen. Nachdem das 20. Jahrhundert mit seinen beispiellosen Kriegen und Gräueln hinter uns liegt, ist jener Optimismus wohl endgültig verloren gegangen, den Goethe durch Mittler als seine Erfahrung ausgibt, der Mensch tue «recht gern das Gute, das Zweckmäßige, wenn er nur dazu kommen kann». Ja «wenn …» – darin liegt das Problem. Offenbar versteht sich das Tun des Guten nicht von selbst.