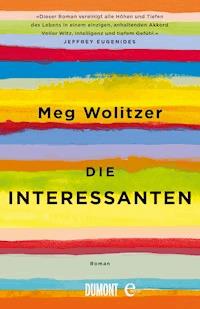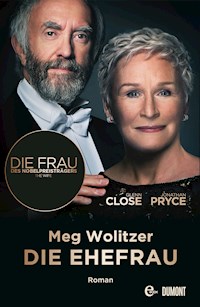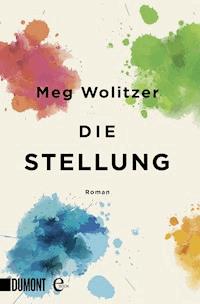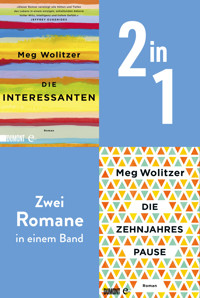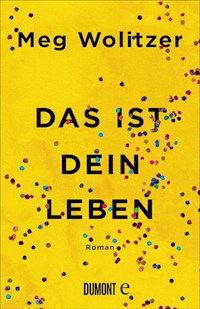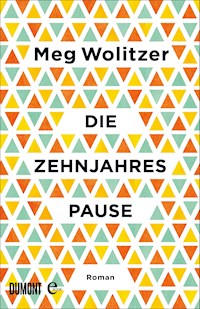
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In schöner Regelmäßigkeit kommen Amy, Roberta, Jill und Karen im »Golden Horn«, ihrem Stammlokal und Zufluchtsort im hektischen New Yorker Alltag, zusammen. Alle sind sie Mütter, Anfang vierzig und jede von ihnen kann ein Lied davon singen, wie es ist, wenn sich die Rückkehr in den Beruf als schwieriger erweist als gedacht. Trotz der besten Ausbildung. Und so plagen Amy Geldsorgen, Jills Doktorarbeit liegt auf Eis, und Roberta, die früher mal Künstlerin war, begnügt sich mit Bastelnachmittagen in der Grundschule. Allein Karen geht gelegentlich zu Vorstellungsgesprächen, allerdings vor allem, um im Training zu bleiben. Doch während ihre Kinder mit jedem Tag selbstständiger werden, müssen die vier neue Perspektiven finden. Zum Glück haben sie einander. Und das »Golden Horn«. Meg Wolitzer widmet sich in diesem Roman der Frau in ihrer Rolle als Mutter – und vier Menschen, aus deren Leben nicht das geworden ist, was sie sich erhofft hatten. Gewohnt pointiert und unterhaltsam erzählt sie in ›Die Zehnjahrespause‹ von häuslichem Glück, Unglück und allem, was dazwischen liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
In schöner Regelmäßigkeit kommen Amy, Roberta, Jill und Karen im »Golden Horn«, ihrem Stammlokal und Zufluchtsort im hektischen New Yorker Alltag, zusammen. Alle sind sie Mütter, Anfang vierzig und jede von ihnen kann ein Lied davon singen, wie es ist, wenn sich die Rückkehr in den Beruf als schwieriger erweist als gedacht. Trotz der besten Ausbildung. Und so plagen Amy Geldsorgen, Jills Doktorarbeit liegt auf Eis, und Roberta, die früher mal Künstlerin war, begnügt sich mit Bastelnachmittagen in der Grundschule. Allein Karen geht gelegentlich zu Vorstellungsgesprächen, allerdings vor allem, um im Training zu bleiben. Doch während ihre Kinder mit jedem Tag selbstständiger werden, müssen die vier neue Perspektiven finden. Zum Glück haben sie einander. Und das »Golden Horn«.
Meg Wolitzer widmet sich in diesem Roman der Frau in ihrer Rolle als Mutter – und vier Menschen, aus deren Leben nicht das geworden ist, was sie sich erhofft hatten. Gewohnt pointiert und unterhaltsam erzählt sie in ›Die Zehnjahrespause‹ von häuslichem Glück, Unglück und allem, was dazwischen liegt.
© Nina Subin
Meg Wolitzer, geboren 1959, veröffentlichte 1982 den ersten von zahlreichen preisgekrönten und erfolgreichen Romanen. Viele ihrer Bücher standen auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Bei DuMont erschienen der SPIEGELBestseller ›Die Interessanten‹ (2014), ›Die Stellung‹ (2015), ihr Roman ›Die Ehefrau‹ (2016), der mit Glenn Close in der Hauptrolle verfilmt wurde, und zuletzt, ebenfalls SPIEGEL-Bestseller, ›Das weibliche Prinzip‹ (2018).
Michaela Grabinger arbeitet seit 1985 als Übersetzerin. Zu den von ihr übersetzten Autoren zählen u.a. P. D. James, Michael Crichton, Elif Shafak, Tan Twan Eng, Jeanette Winterson und Anne Tyler.
Meg Wolitzer
DIE ZEHNJAHRESPAUSE
Roman
Aus dem Englischen von Michaela Grabinger
Von Meg Wolitzer sind bei DuMont außerdem erschienen: Die Interessanten Die Stellung Die Ehefrau Das weibliche Prinzip
eBook 2019
Die englische Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel ›The Ten-Year Nap‹ bei Riverhead Books, New York.
All rights throughout the world reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. © Meg Wolitzer, 2008
© 2019 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Übersetzung: Michaela Grabinger Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN eBook 978-3-8321-8475-9
www.dumont-buchverlag.de
Eins
Im ganzen Land erwachten die Frauen. Ein Wecker nach dem anderen setzte mit sanftem Gedudel, schrillem Geläut oder dem Lieblingssong ein. Es summte, es piepste, und hier und da plärrte das Radio los. Windspiele erklangen, Brandung begann zu tosen, elektronisches Vogelgezwitscher und andere dezente Tierlaute ertönten annähernd realitätsgetreu. Die Begleitmusik der auf Flüssigkristallanzeigen vorangleitenden Zeit. Fast alles in den Häusern und Wohnungen dieser Frauen benötigte Stecker. Strom floss durch gewundene Kabel, und hätte man das Ohr an eine der komplizierten Uhren in den Schlafzimmern gelegt, hätte man es tief im Inneren emsig rumoren hören. Da ging in aller Stille etwas vor sich.
PIEPPIEPPIEP. An diesem Montagmorgen im Herbst klingelte der erste Wecker in einer kleinen, blitzblanken Vorstadt an einem Bett in einem holzverkleideten Haus, und eine Frau setzte sich auf, den gesamten Tag bereits vor Augen. TUTTUTTUT. Drei Ortschaften weiter brachte ein anderer, eine Oktave tiefer gestimmter Wecker eine Frau in ihrem klassizistischen Haus dazu, langsam die Lider aufzuschlagen. »WERFEN WIR EINEN BLICK AUF DEN VERKEHR – WAS TUT SICH DA DRAUSSEN, RANDY?« In der ganzen Region und in anderen, ähnlichen Gegenden des Landes erwachten die Frauen – die einen in breiteren, weiter auseinanderstehenden Häusern, andere in kleineren, dichter gedrängten. In den fernen Wohntürmen der Stadt, jenseits undurchschwimmbarer Gewässer und des Geflechts aus Brücken und Autobahnen, piepsten und zwitscherten, heulten und riefen noch einmal ganz andere Wecker.
Sie ertönten überall, auf den Nachttischen der Vororte und der Stadt, neben aufgeschlagenen, umgedreht abgelegten Büchern, Lesekreislektüre mit zerknicktem Rücken und Titeln wie »Briefe eines im Irak kämpfenden Vaters an seinen neugeborenen Sohn« und eingerollten Elternbriefen (»Ich, , erkläre mich mit der Teilnahme meines Kindes an der Exkursion zur Recyclinganlage einverstanden«). Der anschwellende Weckergesang drängte die Frauen, ihr Bett zu verlassen und sich auf den Weg zu machen, den ihr Tag nehmen würde. Die einen würden ihre Kinder in bestens ausgestattete spießig-amerikanische Familienkutschen verfrachten, den Spiegel einstellen, zurücksetzen und vom Bordstein weg in die Welt hinausfahren, andere ihre Kinder an den kleinen weichen Händen packen und wie Ziehtiere ins Fußgängergewühl der Großstadt zerren.
Eine nach der anderen nahmen die Frauen ihre vertraute Alltagsroutine auf. Die Präsentationen, die Angst, etwas den ganzen Vormittag über im Kopf behalten und Punkt elf vor der versammelten Kollegenschaft wiedergeben zu müssen – damit war es vorbei. Denn Kollegen gab es nicht mehr – ebenso wenig wie Telefonkonferenzen oder »Mittagessen mit Kunden«. Das war Vergangenheit. Wenn die Frauen morgens von den Weckern aus dem Schlaf gerissen wurden, dachten sie manchmal kurz an das, was hinter ihnen lag, und schoben die Erinnerung erleichtert oder bedauernd beiseite.
GURR GURR GURR GURR GURRRRRR. In einer mit Sonnenflecken getüpfelten Wohnung in der Third Avenue in New York, auf der elften Etage eines relativ neuen wuchtigen Klinkerbaus, gab der Wecker in Amy Lambs Schlafzimmer Alarm. Wie immer, wenn er losging, war sie allein, denn Leo hatte sich schon eine Stunde zuvor von seiner Timex wecken lassen und war unbeholfen durch die bläulichen Schatten ins Bad und in den Lift, ins Fitnessstudio und von dort ins Büro getapst. Wenn die Tauben Amy riefen, saß Leo Buckner schon an seinem Schreibtisch in Midtown und heftete den Blick auf eine Videovorrichtung, die ein leicht konvexes Abbild seines Gesichts in den Konferenzraum eines Pittsburgher Gewerbeparks sandte, wo sich seine Kunden um einen Teller mit Keksen versammelt hatten.
Während der Arbeitstag ihres Mannes begann, wachte Amy langsam auf. Der Wecker, den Leo im Katalog von Domestic Edge ausgesucht und ihr zum letzten Geburtstag geschenkt hatte, ließ sich auf verschiedene Tierlaute einstellen und klang an diesem Tag wie gurrende Tauben. Weil Leo und ihr gemeinsamer Sohn Mason ganz wild auf technische Spielereien waren, gab es in der ganzen Wohnung blinkende, surrende, Tierlaute ausstoßende Geräte. Einige sprachen mit gepresster Computerstimme sogar ganze Sätze und sagten Dinge wie: »Die-Schlü-ssel-lie-gen-hier«, wobei man deutlich hörte, wie egal es ihnen war, wo sich die Schlüssel befanden. Amys Mann und ihrem Sohn machte die unpersönliche Art der Geräte nichts aus; sie waren nicht darauf angewiesen, von ihnen geliebt und umarmt zu werden. Das besorgte Amy, und mehr brauchten sie nicht.
»Aufstehen, Mason!«, rief sie mit trockener, unergiebiger Morgenstimme und erhielt keine Antwort. Effektiver wäre es gewesen, in sein Zimmer zu gehen und sich nach Mutterart über sein Bett zu hängen wie ein Schakal über einen Ast. »MASON!«, rief sie noch einmal, heiser, aber laut. Als wieder keine Reaktion erfolgte, ließ sie es gut sein, stellte sich in die Mitte des in hellen Tönen gehaltenen Zimmers, drehte den Kopf nach links und nach rechts und lauschte dem Knirschen und Knacken im Nacken. Ihr vierzigjähriger Körper machte weit mehr Lärm und forderte mehr Aufmerksamkeit als früher. Sie war zwar noch immer schlank, doch das Alter hinterließ bereits Spuren. Amy hob die Arme über den Kopf. Durch Leos viel zu großes Unterhemd, das sie im Bett trug, weil er das vor langer Zeit als erotisch bezeichnet hatte, schienen ihre Brustwarzen durch. Aus unerfindlichen Gründen standen viele Männer darauf, wenn sich ihre Frauen in Herrenklamotten schmissen, auch wenn sich Amy nicht erinnern konnte, wann Leo sie das letzte Mal heftig begehrt hatte. Vielleicht sollte sie sich mit Elektrospielzeug behängen. Jedenfalls lagen sie nach dreizehn Jahren Ehe und in der Mitte ihres gemeinsamen Lebens nachts oft wie zwei müde Urzeittiere im Bett, die, jedes für sich, draußen in der Welt stundenlang ums Überleben gekämpft hatten.
»Ein wahnsinnig blöder Tag«, hatte Leo vergangene Nacht im Dunkeln gesagt, und seine Hand war halbherzig, fast zufällig an ihre Brust gestoßen und dort liegen geblieben. »Stutzman wollte wissen, wann wir endlich vor Gericht gehen. Ich habe ihm gesagt, dass ich keine Wunder vollbringen kann, schließlich bin ich nicht Wischnu. Darauf er: ›Ist das ein neuer Partner in der Kanzlei?‹«
»O mein Gott. Ja, an so was kann ich mich auch erinnern.«
»Es ist schlimmer geworden. Ständig muss man erklären, was man meint. Und ständig muss man alle beruhigen. Pausenlos geht das so. Es ist zum Verrücktwerden. Findet Corinna auch.«
Corinna Berry war seine beste Freundin im Büro. Früher, vor langer Zeit, war Amy seine engste Vertraute bei der Arbeit gewesen, die Frau, die gemeinsam mit ihm so manches zum Verrücktwerden fand, doch diese Rolle hatte sie abgegeben. »Das tut mir leid«, sagte sie.
»Alle anderen kommen damit zurecht. Als würden sie ständig Zuckerbrot bekommen und ich sehe nur die Peitsche.« Trübselig fügte er hinzu: »Ich möchte auch ein bisschen Zuckerbrot.«
Wenn Leo mit seiner Arbeit unglücklich war, versuchte Amy ihn zu trösten, und sei es mit einer Anekdote über sie selbst, damit die eheliche Symmetrie wiederhergestellt wurde. »Mein Tag war auch mies. Das Wartezimmer bei der Kinderärztin – die reine Typhushölle. Eine volle Stunde haben wir dort gesessen.«
Abends im Bett erzählten sie sich anhand kleiner nachgestellter Szenen von ihrem Tag. Leos Schilderungen und Imitationen seiner Erlebnisse in Kenley Shubers Kanzlei, in der auch Amy früher gearbeitet hatte und in der sie sich kennengelernt hatten, beschworen in ihr sofort die Erinnerung an die beige gestrichenen Gänge und den Besprechungsraum mit dem Eichenholztisch und den eingebauten Deckenleuchten herauf. Erzählte sie ihm von ihrem Tag, stieß er nur höfliche, unspezifische Laute aus. Ihr war klar, dass er sich das Wartezimmer von Dr.Andrea Wishstein, in dem bakterienverseuchte, quenglige Kinder auf dem Boden mit Motorikschleifen spielten und an dessen Wänden Pastellbilder mit Einrad fahrenden Clowns hingen, nur schwer vorstellen konnte und eigentlich auch nicht wollte.
Obwohl Leo sie über alles liebte, interessierte er sich paradoxerweise keineswegs immer dafür, wie sie ihre Zeit verbrachte. Jill Hamlin, seit Collegezeiten Amys beste Freundin, war im Frühjahr von der Stadt in den Vorort Holly Hills gezogen und hatte ihr neulich von einer neuen Bekannten erzählt. Der Ehemann dieser Frau war so weit gegangen, jeden Abend während der Heimfahrt im Pendlerzug das Ritalin des hyperaktiven Sohns zu schlucken, um abends, wenn ihm seine Frau von ihrem Tag berichtete, die nötige Konzentration aufzubringen. »Ohne das Zeug konnte er ihr nicht zuhören«, hatte Jill erklärt. »Er liebt sie wirklich sehr, hat er zu ihr gesagt, aber kaum macht sie den Mund auf, denkt er an etwas anderes. Er hat sich wahnsinnig geschämt.«
»Was Männer erzählen, ist natürlich von vornherein interessanter …«
»Ja, ist so.«
»Wirklich? Meinst du das ernst?«
»Während meiner sehr überschaubaren Filmkarriere wurde die ganze Zeit oder zumindest ganz am Schluss ständig vom Vier-Quadranten-Konzept gesprochen, fast wie vom aristotelischen Prinzip. Älterer Mann, jüngerer Mann, ältere Frau, jüngere Frau – das sind die vier Quadranten. Man hat herausgefunden, dass sich sowohl ältere und jüngere Männer als auch ältere und jüngere Frauen, das heißt alle vier Quadranten, Filme über Männer ansehen, aber nur zwei Quadranten, nämlich junge und alte Frauen, Filme über Frauen. Eine Riesendiskrepanz. Aber so ist es nun mal.«
Amy sah sich selbst auf einer Leinwand. Sie ging durch eine nachmittagshelle New Yorker Straße zur Reinigung und saß anschließend auf einem Kinderstuhl in Masons Schule, um sich die Evakuierungsmaßnahmen im Falle eines Terroranschlags erklären zu lassen. Beide Szenen boten so wenig dramatische Spannung, dass es kein Wunder gewesen wäre, hätten die Männer im Publikum bei diesem Film unruhig mit den Füßen gewippt und nacheinander das Kino verlassen.
Mason rührte sich noch immer nicht. Es blieb still in der Wohnung. Weil Amy morgens einen zeitlichen Puffer einplante, konnte sie jetzt noch rasch ihren Laptop vom Boden aufheben und sich auf die Bettkante setzen, um im morgendlichen Halbdunkel ihre E-Mails zu lesen. Freundinnen aus der Stadt und von außerhalb hatten ihr ebenso geschrieben wie die Schule ihres Sohns – »ZUR ERINNERUNG: HEUTE SICHERHEITSBEGEHUNG« lautete der Betreff –, doch die einzige Mail, die sie öffnete, stammte von ihrer Mutter. Antonia Lamb schrieb ihrer Tochter ungefähr ein Mal pro Woche von ihrem Haus in Montreal aus. Sie war Verfasserin historischer Romane, und weil sie erst vor Kurzem von der Schreibmaschine zum Computer gewechselt hatte, waren Mails für sie etwas ganz Neues, so wie Jahrzehnte zuvor Anrufbeantworter neu für sie gewesen waren. Antonia hatte damals in feierlichem Ton die letzte Strophe von Sylvia Plaths Gedicht [1] »Lady Lazarus« als Ansage aufs Band gesprochen: »›Mit meinem roten Haar/Steig ich aus Asche und Gruft/Und ich esse Männer wie Luft.‹ Bitte hinterlassen Sie nach dem Signalton eine Nachricht. Danke.«
Heute war bereits der Betreff ihrer Mail provokant und einer Mitteilung an ihre Tochter nicht angemessen:
WAS DU BALD MAL MACHEN KÖNNTEST
Amy öffnete die E-Mail und las:
A.,
ich habe folgende Idee: Wie wäre es mit Pflichtverteidigerin? Darüber sollten wir mal sprechen. Ich bereite mich gerade auf meine Teilnahme an der NAFITAS (der Frauenkonferenz in NYC im Winter) vor und kann es kaum erwarten, bei euch auf der Luftmatratze zu schlafen und viel Zeit mit dir und L. und v.a. mit dem süßen Mason zu verbringen.
Alles Liebe
Mom
Offenbar hatte sich ihre Mutter erfolgreich eingeredet, Amy habe ihr irgendwann ein Geständnis mit folgendem Wortlaut gemacht: Ich stecke gerade in einer Phase völliger Orientierungslosigkeit. Dir ist es ähnlich ergangen, deshalb sag mir bitte, was ich tun soll. Dass ihre mittlere Tochter keinen Beruf mehr ausübte und ihr ganzes Potenzial womöglich bereits ausgeschöpft hatte, beschäftigte Antonia Lamb sehr. Amys Schwestern waren in Kanada geblieben. Jennifer verdiente ihr Geld als Sozialarbeiterin in der Geriatrie, während Naomi im Namen der Slow-Food-Bewegung agrarische Biodiversität promotete. Besonders Naomi sprach sehr viel über ihren Job. Sie konnte ziemlich anstrengend sein, weil sie alles unheimlich genau nahm. Die kanadische Slow-Food-Bewegung durfte sich allerdings glücklich schätzen, sie in ihren Reihen zu haben. Sie befasste sich intensiv mit Heringsrogen und speziellen Weizensorten und unterbrach ihre Tätigkeit immer nur kurz, um Kinder auf die Welt zu bringen, kam aber sofort zurück, sobald die Kleinen tagsüber betreut wurden. »Ihr könnt später so ziemlich alles machen, was ihr wollt«, hatte Antonia ihren drei kleinen Töchtern einmal gesagt und dabei an ihrer ersten Zigarette des Tages gezogen. Kurz zuvor hatte der Feminismus in Kanada Einzug gehalten. Der Wunsch und die Fähigkeit, historische Romane zu schreiben, hatten wohl schon immer in Antonia gesteckt; doch um beides zum Ausdruck bringen zu können, war ein politischer Umbruch nötig gewesen. Schlagartig änderte sich das Leben im Haus. Antonia erklärte den Kindern, dass sie nun nach der Schule nicht mehr den ganzen Nachmittag mit ihnen verbringen könne. Sie arbeite jetzt, und ihre Arbeit sei eine Arbeit wie jede andere auch. Sie wandelte das Gästezimmer in ein Büro um, sorgte dafür, dass die Mädchen mit Hausaufgaben, einem Spiel oder einem Buch beschäftigt waren, verkündete: »Das ist jetzt meine Zeit!«, ging in ihr neues Zimmer und schloss die Tür.
Anfangs standen die Töchter wie unter Schock. Es war seltsam, die eigene Mutter so nah und doch nicht verfügbar zu haben. Antonias Abwesenheit traf sie tief; sie nahmen es persönlich. Gemeinsam brachten sich Amy, Naomi und Jennifer die Zubereitung von Käsetoast und No-bake-Haferflockenkeksen sowie den Umgang mit dem Staubsauger selbst bei. Die mutterlosen Kinder stritten miteinander und liefen kreischend und türenschlagend durchs Haus. Sie suhlten sich in Selbstmitleid. Sie taten so, als wären sie blind, und lavierten bei ihren Streifzügen durch die Zimmer nur knapp an den Möbeln vorbei. Sie setzten sich zusammen und sangen die traurigsten Lieder, die sie kannten, und stellten die Szenen aus »Jane Eyre« nach, die in der Kindheit des armen Waisenmädchens spielten. Antonia hatte ihnen schonend erklärt, man dürfe sie tagsüber nur noch stören, wenn es um »Leben und Tod« gehe. Irgendwie überstanden sie diese Monate und Jahre und behelligten Antonia tatsächlich äußerst selten und nur aus wichtigem Anlass, klopften jedoch selbst dann recht zögerlich an, denn dass Antonia wegen der Unterbrechung ihrer Konzentrationsphase erst einmal sauer sein würde, stand fest.
Eines Spätnachmittags, als ihre Mutter im Arbeitszimmer saß, bekam Amy ihre erste Periode. War das eine Sache von »Leben und Tod«? Lange standen Naomi, Jennifer und sie im schräg durchs hohe Flurfenster einfallenden Sonnenlicht und diskutierten die Frage im Flüsterton.
»Na ja, man kann daran verbluten«, sagte Naomi gelassen. Sie war ein Jahr älter als Amy. »Der Kreislauf kann zusammenbrechen – hat es alles schon gegeben. Halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Wie stark ist denn deine Menstruation?«
Amy wusste nicht, was »Menstruation« bedeutete. Sie war noch nicht versiert in der Sprache der Weiblichkeit und wollte es auch nicht sein. Es gab schönere Themen. Außerdem wollte sie keine Hilfe von ihren Schwestern, schließlich war sie kein Waisenkind. Sie stellte sich vor, wie Jane Eyre eines Morgens in Lowood School Blut in ihrer Unterhose entdeckte und den Beistand der armen Helen Burns in Anspruch nehmen musste und wie die beiden Mädchen gemeinsam das Eis im Waschbecken zerstießen, damit Jane sich säubern konnte. Jetzt standen die drei Schwestern vor dem Arbeitszimmer ihrer Mutter, die zu Fäusten geballten Hände dicht vor der Tür erhoben. Erst nach langem Zögern klopften sie. Als es drinnen still blieb, klopften sie nochmals, und schnell wurde daraus ein Trommelfeuer.
»Wer ist da?«, fragte Antonia.
»Wir.«
»Was gibt’s?«
»Wir müssen mit dir reden.«
Antonia öffnete die Tür. Zwischen ihren Zähnen klemmte ein Bleistift wie eine Rose beim Tango. Im ersten Moment schien es, als wären sie in etwas Sexuelles hineingeplatzt. Ihre Mutter zog den Stift hastig weg. »Was ist los? Warum stört ihr mich bei der Arbeit?«
»Amy hat die rote Pest bekommen«, verkündete Naomi ohne Umschweife.
»Die was?«
»Meine Periode«, murmelte Amy und senkte aus einem abstrusen Schamgefühl heraus den Blick.
»Ihre Periode«, wiederholte Jennifer überflüssigerweise.
»Oje … Habt ihr Binden aus meinem Bad geholt? Sie liegen im Schränkchen unter dem Waschbecken.«
»Nein«, sagte Amy und begann zu weinen, obwohl sie schon zwölf war. Durch die offene Tür sah sie den Schreibtisch, die Schreibmaschine und die leeren rosa Diätlimonade-Dosen, und die Tränen flossen. Sie wünschte sich nur, ihre Mutter würde ihr das Bindenversteck zeigen – damals übliche Binden, dick wie Jumbo-Sandwiches –, sich mit ihr hinsetzen und irgendetwas Abgedroschenes übers Erwachsenwerden sagen, worüber sich Amy später mit ihren Schwestern lustig machen könnte. Das Leben sollte wieder so sein wie früher, bevor all die Mütter wie hypnotisiert in Gästezimmern, Makleragenturen oder Reisebüros verschwunden waren und ihren Kindern gesagt hatten: »Das ist jetzt meine Zeit!«
Antonia stieß einen erstickten Laut aus, lief rot an und sagte sehr viel freundlicher: »Ach, meine Süße, du bist ja völlig durcheinander.«
»Bin ich nicht«, entgegnete Amy schluchzend.
Ihre Mutter zog sie hastig an sich. »Ich habe es nicht gleich kapiert, ich war ganz in Gedanken. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Gut, dass du dich gemeldet hast!«
»Wirklich?«
»Ja klar. Herzlichen Glückwunsch! Das hätte ich als Erstes sagen sollen.«
Den restlichen Tag verbrachten die drei Mädchen gemeinsam mit ihrer Mutter. Sie gingen zu Steinberg’s und kauften sowohl große Binden als auch Mini-Tampons, die so dünn wie Rührstäbchen waren, und dann nahm sich Antonia kurzerhand frei, saß mit ihren Töchtern zusammen, machte Popcorn und glättete ihnen die Haare. Am nächsten Tag kehrte sie in ihr Arbeitszimmer zurück, und die Tür ging wieder zu.
Im Lauf der Jahre verschwamm die Erinnerung an das einstige Leben mit einer ständig verfügbaren Mutter – einer Ikone wie die Freiheitsstatue, einer Gestalt, die ein Glas Milch ergriff und es ihrem Kind in aller Ruhe reichte. Hatte Antonia ihnen jemals ganz gehört? Ja, hatte sie, und es war ein exklusiver, wenn auch für selbstverständlich erachteter Besitz gewesen. Tagsüber hatte ihre Mutter ihnen gehört, nachts ihrem Vater, und dieses System hatte ziemlich gut funktioniert. Jetzt gehörte sie allen: ihrer »Muse«, wie sie es ironisch nannte, ihrem Verleger und ihren ernsten Freundinnen aus der Selbsterfahrungsgruppe. Ihre Töchter bekamen sie nie wieder ganz zurück. Aber sie waren inzwischen ja auch viel selbstständiger, wie Naomi betonte. Die beiden älteren hatten ihr Hauptaugenmerk auf das Verhalten und die Eigenarten von Jungs gerichtet, und alle drei waren in der Lage, sich eine Kleinigkeit zu essen zu machen und gegenseitig ihre Hausaufgaben zu überprüfen. Dennoch war der Verlust schmerzlich gewesen – so verstörend wie Blut im Slip –, und dieser Schmerz hatte erst nach einer Weile nachgelassen. Es war, wie mit tränennassem Gesicht aus einem Traum zu erwachen. Ohne den Grund der eigenen Traurigkeit zu kennen, stellte man voller Erleichterung fest, dass es vorbei war.
Antonia Lamb war auch jetzt, mit neunundsechzig, noch produktiv, obwohl sich ihre größtenteils weibliche Leserschaft in den letzten Jahren verkleinert hatte. Die Lektüre der dicken, kompromisslos feministischen Historienromane, die jahrelang Schlag auf Schlag erschienen waren, so als wäre irgendwo ein Bücherregal gekippt und der Inhalt unerbittlich allen auf den Kopf gefallen, hatte bei den Leuten im Lauf der Zeit wohl zu einer gewissen Ermüdung geführt. Antonia war Trägerin aller wichtigen Literaturpreise Kanadas. Ihr Werk sei Zeugnis der Sehnsüchte und Frustrationen von Frauen weltweit, hatte Mitte der Siebzigerjahre ein Jurymitglied auf dem Podium eines Literaturfestivals in Toronto über ihren Debütroman »Umkehr und Heimkehr« gesagt.
Damals war Antonia Lamb in einem metallgrauen Knautschsamtkleid auf die Bühne gegangen und hatte in gedehntem, intellektuellem Tonfall die Preisträgerrede gehalten. »Ich werde hier heute über Gender, Macht und die Perfidie der Selbstzensur sprechen. Wahrscheinlich denken Sie jetzt, das hätte nichts mit Ihnen zu tun, aber da liegen Sie falsch.« Die Frauen im Publikum schauten andächtig zu ihr nach oben und lauschten aufmerksam. In einer Zeit, als der Feminismus wie ein Stromschlag in die Welt gefahren war und sie auf Dauer erschütterte, sahen sie Antonia als so etwas wie eine Heldin an. Danach aber waren sie aus dem gedämpft beleuchteten Saal hinausgeschlurft und in ihr Leben zurückgekehrt, das die einen als annehmbar, die anderen als grauenhaft empfanden, und was aus ihnen allen geworden war, wusste niemand.
Jetzt stand Antonia Lambs mittlere Tochter viele Jahre später an einem herbstlichen Montagmorgen in ihrem Schlafzimmer, eine Vierzigjährige, die im Gegensatz zur Mutter die eigene Arbeit nie wirklich geliebt hatte. Juristin zu werden war Amy lange Zeit plausibel erschienen. Im Debattierclub ihrer Highschool hatte sie die Aufregung und Anspannung während der Wettkämpfe und die sich im Team abspielenden Dramen genossen. Sie hatte eine längere Liebschaft mit dem Mannschaftskapitän, einem selbstgefälligen Idioten namens Alan Bredloe, der ein paar Häuser weiter wohnte und das gesamte Theaterstück »Wer den Wind sät« auswendig konnte. Sie trafen sich zu gemeinsamen Trainingsdebatten über Themen wie Euthanasie, Pestizide und Quebecs Unabhängigkeit, und als es einmal um die Frage ging: »Gibt es so etwas wie ›Liebe‹, und wenn ja, lässt sie sich messen?«, endete das Rededuell mit einem langen Kuss und wilden Handbewegungen unter den Kleidern auf der Bredloe’schen Wohnzimmercouch.
Ihr gefiel die Ästhetik des Debattierens, die Möglichkeit, einen anderen so lange anzuherrschen, bis er mürbe war und man gewonnen hatte. »Du argumentierst derart mies, dass du einem nur noch leidtun kannst, Bredloe«, sagte sie etwa zu Alan, und der erwiderte: »Ach, wirklich, Lamb? Findest du das?« – »Ja, allerdings«, gab sie zurück, »und in den nächsten zwei Minuten werde ich es dir beweisen.« Obwohl sie erst fünfzehn waren und es nur um Rededuelle an einer Highschool ging, hatten sie das Gefühl, gleichzeitig für einen größeren, erst sehr viel später stattfindenden Kampf zu trainieren. Wenn Amy debattierte, wurde ihr Gesicht heiß, und sie fühlte sich so von sich selbst erfüllt wie Menschen, wenn sie Sport trieben oder – zumindest nahm sie das an – Sex hatten.
Jahre später, nach der Highschool und dem College, war sie eine der mutigen Studentinnen mit Abschluss in Englischer Literatur gewesen, die sich für einen Studienplatz im Fach Jura bewarben, obwohl sie wussten, dass die Literatur ein weites Feld, die Juristerei dagegen ein Stück umzäuntes Weideland war. Aber sie sahen die Sache pragmatisch. Sie würden nicht ewig versorgt sein; die Welt würde nicht nur mit Liebe und Sicherheit aufwarten. Man musste etwas können. Mit Leidenschaft für den Beruf hatte das nichts zu tun, und obwohl es natürlich besser war, diese Leidenschaft zu besitzen, konnte sie einem niemand schenken oder sagen, wie man sie in sich weckte.
Während des Jurastudiums versiegte der sportliche Ehrgeiz der lang zurückliegenden Teenagerdebatten ebenso wie die selbstinszenierte Abgeklärtheit, mit der sie früher auf einem Stuhl gesessen und die großen Romane der Weltliteratur gelesen hatten. Stattdessen hieß es nun, passiv zu sein und die eigene Winzigkeit im Vergleich zur schieren Größe des Rechts zu akzeptieren. Man musste lernen, wie ein Jurist zu denken, was einige mit großer Begeisterung taten. In Amys Jahrgang gab es Frauen, die schon als Kind den Berufswunsch Anwältin gehabt und mit sechs Jahren aus dem Stegreif sicher argumentieren konnten, was ihre stolzen und erstaunten Mütter veranlasste, in ihnen die nächste Clarencina Darrow zu sehen. Vielleicht waren diese Mütter selbst Anwältinnen gewesen, Pionierinnen mit Schwerpunkt Arbeitsrecht, die ständig beklagten, dass »das System«, diese Escher-Zeichnung mit Treppen und Türmchen und undenkbaren Winkeln, kaum zu kontrollieren sei. Einige wirklich brillante Kommilitoninnen begeisterten sich an dem intellektuellen Gewinn, den sie aus bestimmten Gesetzestexten zogen. Über den Scharfsinn und die Euphorie dieser Frauen konnte Amy nur staunen. Eine Studentin namens Maura war vom Konzept Gerechtigkeit geradezu besessen. In ihrer Kindheit hatte man ihren Vater wegen Drogenhandels zu einer vierzigjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Er saß noch immer im Knast, ein ergrauter Mann, ein Schatten seiner selbst. Nach dem Studium hatte Maura im Büro eines Richters am Obersten Gerichtshof gearbeitet und war inzwischen Dekanin der juristischen Fakultät an einer Uni im Mittleren Westen. Ihre Liebe zur Juristerei gründete auf dem Marihuana, das ihr Vater zu Hause ballenweise gehortet hatte, so als wäre das Vorstadthäuschen ein Silo.
Wenn man keine Leidenschaft entwickle, sei man geliefert, behauptete eine andere frühere Englischstudentin in Amys erstem Studienjahr an der University of Michigan abends beim Pizzaessen. Entgegen Amys Erwartungen weckte Jura an sich überhaupt keine Leidenschaft. Man musste sie selbst in sich entfachen und kultivieren, denn ohne sie wäre man gezwungen, nur so zu tun, als läge einem der Beruf am Herzen. Was sonst blieb einer Englischstudentin nach dem College übrig, fragte eine andere Jurakommilitonin damals beim Pizzaessen – für Beowulf zu arbeiten? Genau, erwiderte eine andere, für »Beowulf, Grendel & Schwartz«, und alle lachten sarkastisch und machten noch ein paar literarische Witze mit juristischem Bezug, um ihr fragiles, bereits rasant im Schwinden begriffenes Überlegenheitsgefühl zu schützen. »Mr.Kurtz – er tot. Er gestorben wegen Langeweile in Vertragsrecht«, sagte Amy, und eine andere: »Ich hatte eine Farm in Afrika, wo ich nach meinem im Jurastudium erlittenen Nervenzusammenbruch hinzog.«
Ja, sie lachten Tränen, während ihr Englischstudium wie ein Küstenstreifen in der Ferne verschwand, und betrauerten insgeheim den Verlust. Doch dann begann die Büffelei. Den ganzen Winter hindurch schneite es auf den Campus der University of Michigan, und die Gruppe der Englischabsolventinnen löste sich auf, denn jetzt fühlte sich jede nur noch als Jurastudentin. Genauso tüchtig und erschöpft wie alle anderen hängten sie ihre nassen Mäntel über die Lehnen in der Juristischen Bibliothek und vertieften sich mit gesenkten Köpfen in die Fachliteratur, aus der sich beim besten Willen keine Metaphern herauslesen ließen.
Amy arbeitete für die Kanzlei von Kenley Shuber im Bereich Treuhand- und Nachlassverwaltung – ein Gebiet, das ihrer Vermutung nach deshalb mehr Frauen als Männer anzog, weil zwischenmenschliche Beziehungen darin eine große Rolle spielten. Trotz der beruhigenden Gewissheit, nach drei Jahren Studium eine gute Juristin geworden zu sein, gab sie, als der Augenblick gekommen war, die Arbeit in der Kanzlei bereitwillig auf, um sich zur allgemeinen Verwunderung lange, mittlerweile bereits überlang, als Mutter zu betätigen. Ihr Sohn Mason war zehn und brauchte weder ständige Betreuung noch jemanden, der die ganze Zeit ein Auge auf ihn hatte. Sie musste nicht mehr pausenlos für ihn da sein, aber sie war es. Morgens ging es zwar oft zäh voran, und manchmal wurde der Ton ruppig, doch die Stunden nach der Schule, die gemeinsame Zeit ohne Hektik, fand sie noch immer wunderschön.
»Kennst du die Geschichte von Achilles? Den haben sie als Baby in den Styx getaucht, aber seine Ferse ist trocken geblieben«, sagte Mason beispielsweise auf dem Heimweg, und Amy antwortete: »Nein, kenne ich nicht, erzähl mal.« Die Möglichkeit, sich die Geschichte des mutigen, tragischerweise jedoch verwundbaren Achilles in der Version ihres Sohnes anzuhören, war zwar kein Grund, nicht arbeiten zu gehen, oder sollte es zumindest nicht sein, aber Mason – und damit auch sie – war nie so klarsichtig und munter wie nachmittags zwischen drei und sechs.
Die Geschichten über Achilles waren in letzter Zeit weniger geworden. Der Tag wies plötzlich Lücken auf, die Amy deutlich spürte. In Masons ersten Lebensjahren hatte sie es nur selten bedauert, zu Hause zu sein. Manchmal hatte sie die Langeweile gepackt, und manchmal war sie fast durchgedreht, aber es hatte eben auch Momente gegeben, in denen er nur nach ihr verlangte, und hin und wieder war etwas Unerwartetes passiert. Sie hatte immer so viel zu tun gehabt. Listen, Pläne, Termine, ohne die es im Haushalt nicht lief und die zugleich lächerlich, ja zum Totlachen öde waren. Ausgerechnet sie, die Blitzgescheite, Unruhige, hatte dafür zu sorgen, dass das Familienleben weiterrollte wie ein Panzer. Ausgerechnet sie musste sich um Nachmittagssnacks kümmern. Während ihre Hände die Plastikfolie eines Sechserpacks Saftkartons aufrissen, hielt ihr verrenkter Kopf das schnurlose Telefon, in das sie »Maureen? Hi, ich bin die Mom von Mason Buckner. Ich würde gern für Mason ein Spieldate mit Jared vereinbaren« hineinsprach.
Man musste dieses Unwort verwenden, das so schnell Eingang in den Sprachschatz gefunden hatte – »Spieldate«. Und man durfte es niemals mit ironischem Unterton sagen. Natürlich blieb es einem unbenommen, die dicke, scharfe Linse des eigenen Intellekts auch auf die große weite Welt zu richten, wenn man wollte. Man konnte sich Sorgen wegen des Kriegs machen, der auf einem fernen Kontinent geführt wurde – und tagsüber dachte Amy des Öfteren, wenn auch ohne Hoffnung, über solche Dinge nach –, doch das ging nur in der eigenen Zeit, zwischen den Erledigungen. Sie war die Torwächterin, das Nervenzentrum und das pulsierende, permanent pumpende Herz der Familie, diejenige, zu der alle kamen, wenn sie etwas brauchten. Sie war diejenige, die das schlafende Kind Tag für Tag aus dem Bett kriegen musste.
Sie holte tief Luft und rief: »MASON, DU STEHST JETZT AUF, FREUNDCHEN!«
In letzter Zeit hatte sie erstaunt einen leicht gereizten Ton an sich festgestellt, wenn sie morgens mit ihrem Sohn sprach. »Geht dir das auch so?«, hatte sie vor einigen Tagen Jill gefragt, die mit dem Zug in die Stadt gefahren war. Sie saßen in der hintersten Sitznische im »Golden Horn«, wo sie und ihre Freundinnen sich mehrmals pro Woche zum Frühstück trafen und sie oft mit Jill gesessen hatte, bevor Jill nach Holly Hills übergelaufen war.
Wenn die Welt am späten Vormittag zur Ruhe kam und der Raum hinter der Glasfassade von Dampf und Gewürzduft erfüllt war, blieben die Frauen oft lange. Der Wirt und die Bedienungen kannten ihre Gewohnheiten und störten oder drängten nie. »Ertappst du dich auch manchmal dabei, dass du Nadia wie ein Feldwebel anbrüllst, obwohl du nicht mal weißt, warum, und es selbst schrecklich findest?«, fragte Amy.
Jill hob erstaunt den Blick. »Ja, stimmt. Manchmal sage ich: ›Dalli jetzt, Nadia!‹ oder: ›Komm endlich in die Gänge!‹ Diese ganzen grauenhaften Befehle.«
»Ich auch. Was ist nur aus uns geworden …«
»Junge Frauen, die mitbekommen, wie wir leben, denken sich garantiert: Nie, nie, nie will ich Kinder haben«, sagte Jill. »Wir sind ein abschreckendes Beispiel. Warum auch sollten sie ihr freies Leben, den ganzen Spaß und den unverbindlichen Sex für unseren despotischen, durchgetakteten Alltag aufgeben?«
»Deine fiktiven jungen Frauen können mich mal«, erwiderte Amy. »Die haben doch keine Ahnung.« Sie lachten ein bisschen. Dann stocherten sie eine Zeit lang schweigend im Rührei auf ihren glänzenden Tellern herum.
War man mit seinem Kind draußen in der Welt unterwegs, wurde man nur selten gelobt oder gewürdigt. Amy dachte an einen Vorfall zurück, der sich Jahre zuvor ereignet hatte, als Mason noch nicht einmal den Kindergarten besuchte. Draußen war es nach mehrtägigem Dauerregen so nass und ungemütlich gewesen, dass alle nichtberufstätigen Mütter, alle Kleinkinder und Nannys zu Hause bleiben mussten. Mason und sie konnten sich nur in der Wohnung und in dem mit Teppichboden ausgelegten Spielzimmer im obersten Stock des Gebäudes bewegen. Eines Morgens beschloss Amy vor lauter Verzweiflung, mit Mason ins Museum zu gehen, obwohl er damals die Art Junge war, der man mit ziemlicher Sicherheit durch Bildersäle und auf klappernden Feuertreppen nachlaufen musste.
Es gab gerade eine Magritte-Ausstellung in der Stadt, und Amy liebte Magritte. Zu ihrer Verblüffung stand Mason, ohne zu zappeln, vor »Der Sohn des Mannes« und vertiefte sich in das Bild des Herrn mit dem grünen Apfel vor dem Gesicht. Einen Moment lang kam ihr der absurde Gedanke, ihr Sohn könnte Autist sein, dabei war er einfach nur interessiert. Sie erzählte ihm in schlichten Worten etwas über den Surrealismus, und er hörte aufmerksam zu und stellte Fragen. Da kam eine alte Frau, die in der Nähe gestanden hatte, und sagte zu Amy: »Entschuldigen Sie, aber ich habe gehört, wie Sie mit Ihrem Sohn gesprochen haben. Er ist ein wundervoller Junge, und Sie gehen wundervoll mit ihm um. Sie haben sicher viel Freude miteinander.« Dann folgte das Sahnehäubchen: »Sie beide wirken sehr glücklich.«
Amy hatte sich unglaublich gefreut. Sie war geradezu selig gewesen und hatte die Worte der alten Frau jahrelang wie einen Schatz in sich getragen. Und während sie an diesem Morgen in ihrem Schlafzimmer stand und durch die Wohnung brüllte, rief sie sich die Worte wieder in Erinnerung, denn solche Momente waren rar. Sie hatte kein Büro, in dem alle alles sahen und bewerteten und ihr auf die Schulter klopften. Mason und sie waren immer allein, und abgesehen von vereinzelten Bemerkungen, die von Fremden, Freunden oder hin und wieder von der Kinderärztin Dr.Andrea Wishstein kamen – »Du hast den Mund ganz toll aufgemacht, Mason! Manche Kinder brechen mir fast das Handgelenk, wenn ich mit dem Tupfer anrücke.« –, blieben so gut wie alle freudigen Momente unkommentiert, weil sie niemand miterlebte.
Amy war stolz auf ihr Kind. Nicht nur, wenn es etwas Kluges sagte – das konnte man in Anekdoten packen, mit denen sich die eigene Eitelkeit befriedigen ließ –, sondern gerade wegen der kleinen, unscheinbaren Dinge. Als Mason beispielsweise auf der Straße abrupt vor einem Obdachlosen stehen blieb und Amy energisch zuflüsterte: »Wir müssen ihm unbedingt was geben, Mom!«
Amy, die den Anblick von Armut und Wahnsinn auf den glitzernden Straßen der Stadt längst gewohnt war und den Obdachlosen im Lauf der Zeit immer weniger und schließlich gar nichts mehr gegeben hatte, sondern verbissen an ihnen vorbeiging und ein Mal im Jahr einen Spendenscheck über eine moderate Summe ausschrieb, hatte damals durch ihren Sohn eine unbequeme Lektion in Sachen Menschenfreundlichkeit erfahren. Er zwang sie dazu, den Leuten das Geld direkt in die Hand zu drücken, und sie tat es. Sie war sich nicht sicher, ob es letztendlich nicht doch falsch und nur einem Reflex zu verdanken war, wenn man stehen blieb, ein paar Münzen gab und weiterging. Aber Mason beschwatzte sie, sodass sie keine Chance hatte, in Ruhe darüber nachzudenken. Sie spendierten den Männern, die rauchend auf den Gittern vor der Subway saßen, Ein-Dollar-Scheine, ohne dass es jemand sah. Ihr gemeinsames Leben mit seinem speziellen Rhythmus, seiner speziellen Dramatik blieb allen anderen praktisch verborgen. Manchmal verglich sie Mason und sich mit Flöhen im Flohzirkus, die in den Vorstellungspausen ihre mikroskopisch kleinen Kunststücke nur füreinander vollführten.
»MASON, BIST DU AUFGESTANDEN?«, rief sie noch einmal aus dem Schlafzimmer. »ZIEH DIE SACHEN AN, DIE ZUSAMMENGEFALTET AUF DEM SCHREIBTISCHSTUHL LIEGEN!« Es blieb feierlich still. »ZIEHST DU DICH AN?«
Er war garantiert noch nicht angezogen. Wahrscheinlich lag er mit schlafheißer Haut reglos im Bett, alles gut durchgewärmt, die Decke, sein Oberkörper und die langen Füße. »MASON, DU GIBST JETZT BESSER SOFORT GAS!«
Während seine Mutter brüllte und sein Vater im Büro mit Mandanten in Pittsburgh sprach und dabei Quittungen für die Reisespesenabrechnung zusammensuchte, schlief Mason in seinem abgelegenen Zimmer weiter. Amy schlüpfte in ein Hemd, stieg in eine Hose und machte sich auf den Weg, um ihn höchstpersönlich zu wecken. Aus dem dunklen Schlafzimmer trat sie in den düsteren, mit Familienfotos bestückten Gang. Sie und Leo, verträumt und mit leichtem Sonnenbrand auf der Hochzeitsreise. Daneben Mason in unterschiedlichen Altersstufen, jeweils ein Bild von Amys und Leos Eltern sowie eines von Amy – brünett, niedlich, durchschnittlich hübsch – und der großen, blonden, aristokratisch wirkenden Jill, aufgenommen vor drei Jahren während eines Wellness-Wochenendes in einem Hotel namens »Wildwood Spur«. Ein Last-Minute-Schnäppchen, online gebucht. »Klar macht ihr das«, hatte Leo gesagt.
Sie hatte sich wahnsinnig darauf gefreut, mit Jill wegzufahren. Wie in alten Collegezeiten! Damals hatten sie noch nicht gewusst, dass Jill bald darauf die Stadt verlassen und es mit den zwei, drei Treffen pro Woche vorbei sein würde. Nach Jills Umzug war es Amy sehr schlecht gegangen, was aber niemand sehen sollte. Mit vierzig hatte man sich gut zu fühlen, solange man sich im Kreis der Familie befand. Als Familie zusammenzuleben war, wie in einer kleinen Siedlerhütte zu hausen, die durch die Welt gewirbelt wurde und Sturm und Verwüstung trotzen musste, doch solange alle darin zusammenblieben, war man sicher und froh.
In dem Wellnesshotel hatten sie abends auf ihren Doppelbetten gelegen und sich bedeutsame Begebenheiten aus ihrem früheren Leben erzählt, die sie einander bisher verschwiegen hatten. Jill berichtete, wie ihre depressive Mutter einmal, den Kopf in die Hände gestützt, schluchzend am Küchentisch gesessen hatte und sie, Jill, damals noch ein Teenager, einfach aus dem Raum gegangen war, ohne zu fragen, was los sei, und ohne die Sache jemals wieder anzusprechen. »Du darfst dir keine Vorwürfe machen«, sagte Amy. »Depressionen lagen auch damals schon an einem chemischen Ungleichgewicht im Gehirn, das wusste man nur noch nicht.«
»Ich weiß. Aber ich sehe sie immer noch so vor mir. Ich werde das Bild nicht mehr los. Es hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt.«
»Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Schließlich war sie nun mal so. Es hat zu ihr gehört.«
»Du hättest meine Mutter gemocht. Sie war zwar labil, aber ein herzensguter Mensch.« Jill strich sich mit den Fingerspitzen über die Augen und sagte: »Jetzt du!«
Amy erzählte von einer Party in ihrem und Jills erstem College-Jahr an der University of Pennsylvania. Sie hatte in einer Ecke gesessen, als plötzlich eine wunderschöne Frau auf sie zukam und sich mit ihr zu unterhalten begann. Nach kurzer Zeit saß die Frau auf der Armlehne des Stuhls, und plötzlich beugte sie sich zu Amy hinunter, küsste sie auf den Mund, und Amy erwiderte den Kuss. Eine Lesbe, sehr androgyn, stylish gekleidet mit einem nietenbesetzten Herrensmokinghemd, die Ärmel hochgerollt, sodass man ihre langen, schlanken Handgelenke sah. Das hinten kurz geschnittene Haar fiel ihr vorn in die Augen, ein bisschen wie bei James Dean.
»War das die, die im French House gewohnt hat?«, fragte Jill verblüfft. »Und war der Kuss auch französisch?«
»Ja.«
»War es schön?«
»Ja, schon«, antwortete Amy. »Aufregend.«
»Unglaublich, dass du mir das nie erzählt hast.«
»Ich war damals ziemlich durcheinander. Ich wusste nicht, dass einen etwas erregen kann, ohne dass man es begehrt hat.«
»Zumindest nicht bewusst begehrt.«
»Ich bin bestimmt nicht lesbisch«, sagte Amy, »aber mal was anderes auszuprobieren hätte mir gefallen.«
»Würde ich auch gern machen. Ein paar Tage ein anderes Leben führen. Eigentlich genau das, was wir gerade tun. Daran könnte ich mich gewöhnen.«
Dabei war ihnen klar, dass das nicht stimmte, dass der Sirenengesang ihres eigentlichen Lebens sie schon wieder leise zurückrief. Sie hatten ihre BlackBerries in das kleine Hotel in den Berkshire Mountains von Massachusetts mitgenommen und nicht nur von ihren Männern und Kindern bereits SMS und Mailboxnachrichten mit grundlegenden hauswirtschaftlichen Fragen erhalten, sondern auch ihrerseits anfallsartig elektronische Liebes- und Sehnsuchtsbekundungen verschickt. Das Wochenende war erholsam, zog sich aber in die Länge. Umgeben vom Stimmengewirr anderer Frauen saßen sie in dem hell getäfelten Speisesaal, durch dessen Fenster man die Berge wie gezeichnet sah. Auf den Tellern fanden sich spärliche, wie zufällig hingewehte Salatblätter. Mehrere Frauen am Tisch in der Ecke machten eine Saftfastenkur und umringten stoisch eine Karaffe mit meergrüner Flüssigkeit.
An diesem Abend sagte Jill, die in ihrem Bett lag: »Manchmal kommen mir Donald und Nadia völlig hilflos vor. Ich weiß, ich bilde mir das nur ein, aber ich habe einfach das Gefühl, dass sie ohne mich kaum überlebensfähig sind. Als hätte ich zwei Neugeborene allein gelassen.«
Amy nickte. Leo und Mason waren zum ersten Mal seit zehn Jahren ein ganzes Wochenende lang auf sich gestellt. Wenn die beiden auch nur ein paar Stunden ohne sie verbringen mussten, rüstete sie sie mit allem Nötigen aus. Sie hatten gelernt, dass alles, was sie brauchten, stets wie durch Zauberhand vor ihnen erschien. Bekamen sie etwa während eines Ausflugs in den Park Durst, griffen sie in die Kühlbox und zogen die von Amy hineingestellte Flasche mit einem grell blauen oder orangen Sportgetränk heraus. Fiel Mason hin und schürfte sich das Knie auf, kramte Leo das von ihr bereitgelegte Pflaster und die antibiotische Salbe aus dem Raumtemperaturfach der Kühlbox hervor. Amy hätte ihnen im Notfall Proviant für einen ganzen Winter zusammengepackt. Leo und Mason wurden immer fündig und bedienten sich. Sie kannten es nicht anders.
Wie ein Fluss strömte das Dunkel des Gangs ins Wohnzimmer und mündete in das glasige Licht des frühen Morgens. Die Wohnung war zu teuer, aber Amy verließ sich in diesen Dingen auf ihren Mann. Der verwaltete die Familienfinanzen in dem winzigen Arbeitsraum, der ihrer Mutter während der Frauenkonferenz im Winter als Gästezimmer diente, und saß oft an dem schlichten Schreibtisch mit dem Katalognamen Sven, dessen Fächer sämtliche Rechnungen in sich bargen. Solange Leo nicht die Hände in die Luft warf und »Wir sind im Arsch!« rief, konnte es weitergehen wie bisher. Amy hatte keine Lust auf die finanziellen Details; ein grobes Bild dessen, was sie sich leisten konnten und was nicht, genügte ihr. Die Wohnung sei »ein Albtraum«, sagte Leo manchmal, aber irgendwie kamen sie über die Runden. Das Wellnesswochenende wiederum war »machbar« gewesen. Solche mysteriösen Äußerungen und vagen Beschwichtigungen holte sich Amy oft bei ihm ab.
Sobald sie sich etwas gründlicher mit dem gemeinsamen Geld beschäftigte, bekam sie Angst und schreckte vor ihrer eigenen Neugier zurück. Das hatte sie sich angewöhnt, obwohl es kindisch und verantwortungslos war. Der Umgang mit den Finanzen gehörte in ihrer Ehe zu den Dingen, die sich im Lauf der Zeit irgendwie eingespielt hatten. Auch ihr Sexleben zählte dazu. Anfangs waren sie vorbildlich offen gewesen und hatten alle früheren Sexpartner aufgezählt. »Wenn du mir sagst, wie die Typen heißen, bringe ich sie einen nach dem anderen um«, hatte Leo verkündet, und Amy hatte überrascht festgestellt, dass ihr das gefiel. Auch ihre Vorlieben und Abneigungen im Bett hatten sie sich gestanden. Peinlich berührt, aber tapfer hatte Leo zugegeben, dass er es mochte, wenn seine Brustwarzen beim Vorspiel »ein bisschen gelutscht« wurden. »Wahnsinn – ich habe gerade die Wörter ›Brustwarzen‹ und ›gelutscht‹ verwendet, um etwas über mich zu erzählen«, hatte er gleich darauf gesagt und ein bisschen ängstlich gelacht.
Leo Buckner war ein kräftiger, gedrungener, schwerfälliger Mann, ein Wirtschaftsanwalt mit schwarzen Locken und einem etwas flachen Gesicht, das ihn wie einen leicht benommenen Boxer aussehen ließ. Zu Beginn, kurz nach ihrer Begegnung in der Kanzlei, hatten sie hin und wieder das Thema Geld gestreift, wenn sie nach dem Sex verschwitzt und selig nebeneinanderlagen. Sie erzählten sich, wie viel sie verdienten und wie viel sie eines Tages zu verdienen hofften. Keiner von ihnen stammte aus einer reichen Familie. Leos Vater hatte einen Zeitungskiosk im Foyer eines Bürogebäudes betrieben, seine Mutter war Hausfrau. Trotz des großen Unterschieds zu Amys Kindheit mit zwei Schwestern, einer schreibenden Mutter und einem Wirtschaftsprofessor als Vater hatten sich beide Familien in finanzieller Hinsicht kaum etwas genommen. Die Lambs hatten nie viel Geld besessen beziehungsweise das vorhandene für jährliche Reisen nach Frankreich ausgegeben, wo sie in billigen Hotels wohnten und sich einen Citroën mieteten, den Henry Lamb im Madrashemd äußerst angespannt über kurvenreiche Bergstraßen lenkte. Die Lambs waren weder arm noch reich, und über Geld wurde nie gesprochen.
Allerdings hatte damals alles viel weniger gekostet. Jetzt, zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts, war das Leben wesentlich teurer und die finanzielle Lage der meisten Menschen ein offenes Geheimnis. Im Gegensatz zu früher versteckte sich das Geld nicht mehr. Amy Lamb, Leo Buckner und ihr Sohn wohnten in diesem riesigen, hässlichen Haus mit hoher Mieterfluktuation im Osten der Stadt. Auf der Markise vor dem Eingang stand »The Rivermere«, obwohl die Straße weit von jedem Fluss entfernt lag. Die Namen der Häuser, in denen Amys Freundinnen wohnten – sofern der Eigentümer oder die Hausverwaltung die Eitelkeit beziehungsweise Energie besessen hatte, sich einen auszudenken –, waren genauso nichtssagend. Eine Freundin wohnte in »The Cardiff«, eine in »The Chanticleer«. In der Lobby des »Rivermere« zog es wie in einem Windkanal – manchmal musste man die Fahrstuhltür regelrecht aufstemmen. Die hellen Wohnungen hatten Marmorböden und große, quadratische Fenster mit Blick auf die Stadt. In der höchsten Etage des Gebäudes befand sich ein Spielzimmer, auf dessen Teppichboden der kleine Mason oft herumgewatschelt war und in dem es trotz unzähliger Duftspender an der Wand immer nach Windeln stank. Still und gelangweilt hockten die Mütter und Nannys auf den ebenfalls mit Teppich bezogenen Fenstersimsen, blätterten in einer Zeitschrift oder im Katalog einer Kinderbekleidungsfirma aus Vermont, wechselten gelegentlich ein paar Worte und versuchten im Übrigen, flach zu atmen.
Das Spielzimmer war für Amys und Leos Einzug ein entscheidendes Argument gewesen, weil Amy der Vorstellung aufsaß, Mason würde es ewig benutzen. Sie hatte ihn als immerwährendes Kleinkind vor sich gesehen, das sie stets in ihrer Nähe haben, beaufsichtigen und bei Regen in eine Magritte-Ausstellung mitnehmen könnte. Damals war ihr noch nicht klar gewesen, dass er älter werden und in die Welt hinausstapfen würde und eine neue Kindergeneration das Spielzimmer daraufhin übernähme, um darin herumzuwatscheln und herumzukrabbeln, alles abzuschlecken, nach allem zu greifen und verdutzt in dem sonnenhellen, nach Kacke stinkenden Adlerhorst zu sitzen.
Für die meisten Amerikaner war New York eine unerreichbare Insel. Der Horror und die Angst von 2001 hatten der Stadt etwas Lädiertes, Vergängliches verliehen und sie nur noch kostbarer gemacht, so wie die Zerbrechlichkeit eines schönen Gegenstands seinen Preis erhöhte. Die Wohnung in der klotzigen, wenig schönen Festung hatten sie auf dem Höhepunkt von Leos Anwaltskarriere gemietet. Die überteuerten Apartments im »Rivermere« waren für junge, aufstrebende Familien gedacht und nicht dazu, jahrelang von denselben Mietern bewohnt zu werden. Doch Amy und Leo konnten es sich nicht leisten, irgendwo etwas zu kaufen und auszuziehen.
Natürlich gab es Alternativen zu dieser Form von zehrendem Großstadtleben. Wer unbedingt in der Stadt bleiben wollte, konnte es wie die Pragmatischen und Abenteuerlustigen machen und in einen anderen Bezirk ziehen, in dem es sich anständig leben ließ. Amy kannte von früher mehrere Paare, die sich weit nach Brooklyn hineingewagt hatten. Die Mittelschicht vergrößerte ihre Reichweite, verlagerte ihr Territorium. Neben Scheckeinlösestellen und heruntergekommenen Zahnarztpraxen ohne Terminzwang eröffneten winzige Kunstgalerien und Internetcafés. Auf den holprigen Gehwegen im steilen Schatten der Brooklyn Bridge sah man immer mehr Kinderwagen. Diese Gegenden wurden von Familien überrannt. Die neuen Bewohner brachen den einkommensschwachen Altmietern dabei das Genick, versuchten darüber jedoch möglichst wenig nachzudenken, weil das ihr Mitgefühl geweckt und ihren gesamten Lebensplan über den Haufen geworfen hätte. Die weniger mutigen Paare in Amys Bekanntenkreis zogen in relativ nah gelegene Vorstädte oder gleich in idyllische, aber weit entfernte Orte mit einer einzigen schmalen Hauptstraße und einem einzigen, nicht besonders guten Restaurant, das abends um acht schloss und alle Gäste nach Hause trieb, als gäbe es wegen frei herumlaufender Ganoven eine nächtliche Ausgangssperre.
In diesen Orten konnte nur leben, wem wirklich etwas am Beisammensein mit der Familie lag, dachte Amy. Wenn die Nacht hereinbrach, musste man sich bereitwillig in die dunklen, holzverkleideten Zimmer alter Häuser verkriechen. Doch Amy und Leo würden weder nach Brooklyn ziehen noch in einem entlegenen Kaff ein Haus erwerben. So unvernünftig es war, in der Wohnung zu bleiben, sie blieben.
»Wir sind wie die Berliner Juden vor dem Krieg«, hatte Leo einmal gesagt. Amy hatte den Vergleich als fürchterlich bezeichnet, als eine Beleidigung seiner Großtante Talia, die in Dachau gewesen war. »Ich will damit nur sagen, dass wir das Offensichtliche leugnen«, hatte er erwidert. »Wir verhalten uns völlig irrational.« Trotzdem zogen sie nicht weg.
Die Mieten im »Rivermere« waren in den letzten Jahren beängstigend steil angestiegen. Man musste im Augenblick leben, dachte Amy, die es verstand, dem Immobilienmarkt eine existenzialistische Dimension abzuringen. Die Miete beutelte sie, entriss ihnen jeden Monat das Geld, als wäre es in der zugigen Lobby gelagert. Auch Masons Schulgebühren machten ihnen zu schaffen, und dass ihr Sohn im Gegensatz zu den anderen Kindern im Land keine öffentliche Schule besuchte, bereitete Amy nach wie vor Unbehagen. Sie hatten versucht, ihn in einem öffentlichen Hochbegabtenprogramm unterzubringen (»Das ist wie ein verdammter Lottogewinn!«, hatte der Vater eines angenommenen Kindes unter Freudensprüngen gerufen). Doch Mason war beim Test nur auf 97 statt auf 98Prozent gekommen und ausgeschieden.
Am Informationsabend der öffentlichen Grundschule standen Amy und Leo mit hundert anderen Eltern in einem niedrigen Raum mit über Putz liegenden Rohren, Kesseln und flackernden Neonröhren, der als Cafeteria wie auch als Turnhalle diente. Für die Fächer Kunst und Musik hatte diese Schule kein Geld. Mason würde dort nie etwas malen oder töpfern oder ein Instrument erlernen. Ein kunstloser Mensch würde er bleiben, im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Auch nennenswerte sportliche Aktivitäten umfasste das Angebot nicht, und die Klassengrößen waren erschreckend.
»Meinst du, wir können ihn auf eine Privatschule schicken?«, hatte sie zaghaft gefragt, als Leo und sie nach der Besichtigung auf die Straße traten.
»Weiß nicht«, hatte er gereizt und erschöpft geantwortet.
Hätte ihnen diese integrative, demokratische Schule nur besser gefallen! Über den Türen waren die altertümlichen, vor hundert Jahren in Stein gemeißelten Inschriften »Mädchen-Eingang« und »Knaben-Eingang« zu lesen. Doch die Zeiten waren vorbei, in denen Mädchen und Knaben unter Aufsicht einer streng blickenden, mit einem Stock bewehrten Frau durch diese Türen strömten. Rein theoretisch war die Schule ein umzäuntes Utopia. Doch sie lag in New York, wo das Leben hart und teuer war und sich alle Schulen in einem unhaltbaren Zustand befanden, wenn man von den wenigen absah, an denen sich die Eltern zusammentaten, als Lehrer einsprangen, die Bibliothek am Laufen hielten und die Schule mithilfe eines einzigen, nie endenden Kuchenbasars vor der völligen Mittellosigkeit bewahrten.
»Können wir es wenigstens mal durchrechnen?«, fragte Amy.
»Jetzt sofort?«
»Nein, natürlich nicht sofort. Warum bist du eigentlich so sauer auf mich?«
Leo ignorierte die Frage, doch an der Ecke zur First Avenue aktivierte er die Taschenrechnerfunktion seines BlackBerrys und tippte im Nieselregen, die Schultern unter der Last der Zukunft gebeugt, ein paar Zahlen ein, seufzte theatralisch auf und sagte Ja, es sei wohl zumindest eine Zeit lang zu schaffen. »Wahrscheinlich ist es ein Riesenfehler«, fügte er warnend hinzu. »Vielleicht müssen wir ihn irgendwann runternehmen. Dann wird es noch schwieriger.«
Leo verdiente vergleichsweise gut, aber sein Einkommen als angestellter Mitarbeiter in einer kleinen, zweitklassigen Kanzlei – er war kein Partner, nicht besonders einflussreich – platzierte die Familie in die schwindende, sich mühsam durchbeißende Mittelschicht der Stadt. Die Jungenschule, in die sie Mason letztlich gaben, wirkte fast wie eine Entschädigung für das miese Gefühl in der düsteren Cafeteria. Sie war schön und gut organisiert, die Lehrer zeigten sich engagiert und zugewandt. Doch das halbjährlich fällige Schulgeld und die American-Express-Abrechnungen, dick wie ein langer, mit Gefühlen aufgeladener Roman, dessen zahlreiche Seiten den Wahnsinn des Vormonats in allen Details beschrieben, schockierten Amy und Leo immer wieder. Sie gaben ständig zu viel aus, unterschrieben Schecks, beglichen Restaurantrechnungen und Einkäufe per Kreditkarte, ließen Geld bei Taxifahrern und Handwerkern und Berge von Münzen bei den verständnisvollen hispanischen Bedienungen im »Golden Horn«. Es war, als würden sie permanent »Da, nehmt am besten gleich alles!« rufen. In der zugigen Lobby wurde ihnen das Geld entrissen; dann drehte plötzlich der Wind und wehte wieder welches herbei.
Mason schlief natürlich noch. Über ihm hingen Kampfflugzeuge an Angelschnüren, und im Regal stapelten sich selten hervorgeholte Brettspiele. Eltern und Großeltern kauften zwar weiterhin stur die neuesten Versionen von »Battleship« und »Stratego«, um die Kinder an die verlöschende Glut der Welt vor Erfindung des Mikrochips zurückzulocken, doch die Kleinen griffen fast nur noch zu Videospielen.
»Mason, mein Schatz, du musst aufstehen«, sagte Amy sanft, wie um Buße für ihr Gebrüll zu tun.
Sie betrachtete sein breites, schönes Gesicht, die schmale Nase und das hellbraune Haar. Er schlug die Augen auf und sagte mit belegter Stimme: »Noch fünf Minuten?«
»Nein, Süßer, tut mir leid. Die hattest du schon.«
»Ach so.« Er blinzelte. »Kannst du alle amerikanischen Präsidenten aufzählen, die Linkshänder waren?«
»Was? Nein, kann ich nicht.«
»Versuch’s mal.«
»So etwas kann man nicht versuchen.«
»James Garfield, Herbert Hoover, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush der Erste und Bill Clinton«, platzte es schwallartig aus ihm heraus.
»Sehr gut«, sagte Amy und empfand es auch so, wusste aber nichts Rechtes zu erwidern. Mason überfiel sie manchmal mit Fakten, die ihr willkürlich erschienen, für ihn jedoch Teil seiner wundervollen Gedankenwelt waren, in der etwa bestimmte Präsidenten mit Stiften oder Schreibfedern in der Linken auf- und abmarschierten.
Seufzend löste er sich aus der Backstubenwärme und der Wolke aus Menschengeruch unter seiner Bettdecke. Am liebsten hätte Amy ihn ins Bett zurückgezogen und ihn sich auf den Schoß gesetzt. Aber das ging nicht, weil er schon zehn war und lange, schlaksige Beine hatte und es hart an der Grenze zum Inzest gewesen wäre. Sie sehnte sich nach ihm, aber auch nach sich selbst in der Zeit als Mutter des kleinen Mason. Sie hätte ihn gern gefragt, ob er sich an das Magritte-Bild erinnere, an den Mann mit dem grünen Apfel. Vielleicht erinnerte er sich sogar, und beide würden sie grundlos zu weinen beginnen.
Doch Mason war endlich aufgestanden und pinkelte lautstark im Stehen in dem schmalen Bad, das zu seinem Zimmer gehörte. Es klang, als würde er mit dem Hammer auf Glas einschlagen. Er war wach und hatte kein Bedürfnis, mit seiner Mutter zu kuscheln, sondern dachte an den vor ihm liegenden Schultag. Irgendwann, sagte sich Amy, und die Vorstellung versetzte ihr einen unerwartet heftigen Stich, würde ihr kleiner Junge – der ihr alles über linkshändige Präsidenten und über Achilles mit der nicht eingetauchten Ferse erzählte, der bis vor Kurzem auf der Straße an ihrer Hand gegangen und ihr manchmal so unglaublich nah war, dass ihr das Leben in diesen Augenblicken nicht nur nicht sinnlos, sondern sinnvoll erschien –, irgendwann würde ihr kleiner Junge wahrscheinlich hinter einem abgedichteten Bürofenster mit Blick auf eine Stadt oder ein Gewerbegebiet sitzen. Sie dachte an den Blick aus ihrem Fenster in Kenley Shubers Kanzlei. Manchmal hatte sie nachmittags kurz Pause gemacht und ihre Stirn und die Handflächen an die Scheibe gelegt.
Anfangs hatte in der Kanzlei ein reservierter, kollegialer Ton geherrscht. Man hatte ihr immer mehr Arbeit zugeteilt, die sie auch schaffte, doch dann setzte eine unangenehme Vertraulichkeit ein, die sie zu ignorieren versuchte, weil es so gut wie überall im Leben ähnlich zuging. Die Aufgaben in der Kanzlei waren zeitweise austauschbar, und sogar die Mandanten, mit denen sie zu Mittag aß, ähnelten sich wie Geschwister. Alle Anwälte trugen graue Anzüge und eisblaue Krawatten oder maßgeschneiderte cremefarbene Blazer. Einer entpuppte sich als der »Firmenclown«, eine als »Mimose«, und irgendwann kam ihr die Kanzlei vor wie ein kleines, in sich geschlossenes Dorf. Amy zählte zu den »netten« Kolleginnen, was sie nicht störte. Man schaute bei ihr vorbei, lehnte sich an den Türrahmen und sagte: »Na, wie läuft’s, Amy?« oder: »Wir gehen heute Abend alle ins ›Umbrella Sushi‹«, oder nahm auf der Schreibtischkante Platz, um sich ganz direkt mit ihrer Nettigkeit zu versorgen.
Als Leo und sie sich ineinander verliebten, wurde im Job plötzlich alles anders. Sie hatte den fülligen Leo Buckner oft auf dem Gang und bei Besprechungen gesehen, obwohl es zwischen ihren Arbeitsbereichen kaum Berührungspunkte gab. Er hatte ein Jahr vor ihr angefangen, ein beliebter junger Anwalt, kräftig, dunkelhaarig, mit einer lässigen, leicht melancholischen Art, die allgemein gut ankam. Die Frauen flirteten ständig mit ihm, kletterten auf ihm herum wie auf einem gutmütigen Onkel, der sein Mittagsschläfchen hielt.
Als die Beziehung zwischen Amy und Leo begann, zogen sich die anderen Frauen wie bei einer höfischen Gavotte vornehm zurück. Durch die Büroaffäre bekam die Arbeit etwas Flirrendes, Aufregendes. Jede Begegnung mit ihrem lockenköpfigen Geliebten auf dem Gang rief in beiden die Erinnerung an die vergangene Nacht zurück.
Dann waren sie eines Tages verheiratet und genossen ihren Status als frischvermählte Kollegen. Die Arbeit selbst blieb erträglich, machte hin und wieder sogar großen Spaß. Während sie abends im Bett geliefertes Essen aßen oder auf dem durchgelegenen Futon in ihrer ersten gemeinsamen Wohnung Fernsehen guckten, gaben sie sich berufliche Tipps und lästerten über die Eigenarten und Pläne ihrer Kollegen. Als Amy schwanger wurde, kamen sie überein, dass sie die bewilligten zwölf Wochen Urlaub nehmen und danach zurückkehren würde. Am Tag ihrer Abschiedsparty regnete es, der Himmel vor dem Besprechungsraum war ganz schwarz. Der Raum hatte schon viele Abschiedspartys gesehen; im Lauf der Jahre waren zahlreiche junge Kolleginnen und Kollegen verschwunden, sei es aufgrund besserer Angebote, eigenen Versagens oder weil die Mutterschaft sie vereinnahmt hatte.
»In zwölf Wochen bin ich wieder da«, hatte Amy in ihrer kurzen, verschämt gehaltenen Rede erklärt. »Bis dahin gilt: Hände weg von meinem Kaffeebecher!«
Die zwölf Wochen erwiesen sich als viel zu kurz. Als nach ihrem Ablauf gewissermaßen ein Wecker losging und elektronische Tauben zum Gurren, Hühner zum Gackern, Pferde zum Galoppieren, ja das gesamte Tierarsenal zum Lärmen brachte, als stünde eine Scheune in Flammen, schaffte es Amy nicht aufzustehen. Sie sah sich nicht in der Lage, die Wohnung zu verlassen, diese verrückte Welt voller Spucktücher, ungebügelter Babysachen, Geburtsgeschenke in Form von Rasseln und weichen Stoffbüchern, die mitsamt Verpackung herumlagen. Der Müll nahm überhand, das Kind verwechselte die Nacht mit dem Tag, und jeder Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte hätte dem Chaos entfliehen und in die Wohlgeordnetheit und angenehme Luft eines Büros zurückkehren wollen, zum Teppichboden aus Nadelfilz und zu den flimmernden Leuchtstoffröhren, die einen morgens wachrüttelten wie ein unter die Nase gehaltener Kolben mit Ammoniak.
Doch junge Mütter waren nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Amy hatte das Gefühl, dieses Baby vor irgendetwas retten zu müssen wie ein Superheld, der mit ausgebreiteten Armen am Großstadthimmel dahinflog. Selbst der kurze Gang zum Koreamarkt, um Joghurt und Saft zu kaufen, erschien ihr so endlos, dass sie auf dem Rückweg die drei kurzen Häuserblocks bis zum »Rivermere« im Laufschritt zurücklegte. Sie konnte Mason nicht verlassen, sie liebte ihn zu sehr. In die Obhut einer Frau aus Jamaica, Guyana oder Mount Olympus konnte sie ihn auch nicht geben. Nicht der freundlichsten, warmherzigsten Frau der Welt hätte sie ihn anvertrauen können; nicht einmal eine riesige, weiche, in der Luft schwebende Brust wäre gut genug gewesen. Nur sie konnte ihn retten; nur ihr Knochenmark passte zu seinem. Sie war die einzige Spenderin, und er trank direkt aus ihr. Die Ruhe im Büro, die Briefings, Meetings und Mandanten bedeuteten ihr nichts mehr.
Kolleginnen von Amy hatten nach der Rückkehr aus dem Mutterschutz die Ungeduld, gelegentlich auch Abneigung der anderen offen zu spüren bekommen. Einmal hatte sie miterlebt, wie eine völlig entnervte junge Mutter kurz vor einer Besprechung ihrem Kinderarzt am Telefon nervös zuflüsterte: »Gestern Abend hatte er 37,9, und als ich heute Morgen zur Arbeit ging, waren es nur noch 37,7, aber unsere Babysitterin hat mir gerade mitgeteilt, dass die Temperatur wieder gestiegen ist und dass er viel weint …« Die anwesenden Kollegen hatten auf ihre Uhren geblickt. Einer hatte sich lässig in die Tür gestellt und freundlich lächelnd mit den Lippen den Satz »Lass dir ruhig Zeit« geformt.
So eine Frau wollte Amy noch nicht sein. Keine Kanzlei, kein Unternehmen der Welt konnte einem geben, was man vom eigenen Baby bekam. Von keiner Kanzlei und keinem Unternehmen wurde man gebraucht und geliebt. Keine Kanzlei und kein Unternehmen schmeichelte einem so sehr oder gab einem zu verstehen: »Du bist alles für mich, Amy.« Dort war man nur ein winziges Rädchen, und empfand ein Rädchen jemals Stolz oder Befriedigung? Es wurde erwartet, dass man sich mit Haut und Haar dem Job verschrieb und spät nach Hause ging, und dann blieben abends fünf Minuten mit dem eigenen Kind, so als wäre der kleine Junge, das kleine Mädchen ein mit Terminen überfrachteter Firmenchef. Wenn man schon so viel von dieser zarten Babyzeit verpasste, dann doch höchstens wegen eines außergewöhnlich tollen Jobs. Wie konnte man eine Wirtschaftskanzlei oder irgendein seelenloses Unternehmen oder auch nur deren langweilige Bestandteile oder Produkte – die Mandanten, die Textilien, die Pharmazeutika oder Airbags – allen Ernstes einem Baby mit seiner offenen, hoffnungsvollen Art vorziehen? Wie konnte einem irgendetwas mehr bedeuten als die Stelle am Köpfchen, an der die Knochen noch nicht zusammengewachsen waren, oder der aufgeworfene kleine Mund mit seinen kalligrafisch schönen Konturen?