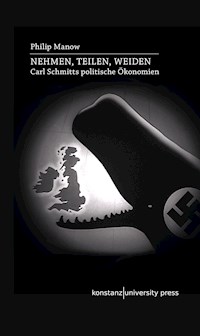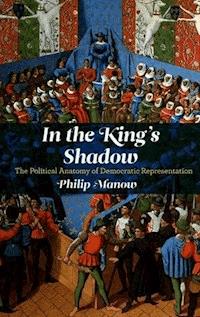9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Dieses Buch handelt von unserer Demokratie – und von Aufsitzrasenmähern, Milbenkäse, Inkontinenzwindeln sowie von Zwergschnauzern mit seidenweichem Haarschleier. Außerdem noch von zu viel Gel in den Haaren, von Sherry mit geschlagenem Ei, « Fördern und Fordern », den Tücken elektronischer Abstimmungssysteme und vielem anderen mehr. Dass man anhand der Nebensächlichkeiten der Demokratie Wesentliches über die Demokratie erfährt und dass das sogar sehr unterhaltsam sein kann, ist die zentrale These dieses Buches. Es versammelt von A wie Applausminuten über F wie Flechtslipper bis Z wie Zehnpunkteplan scheinbar Abseitiges aus dem politischen Betrieb. Welche Orte, Dinge, Gesten und Worte zeichnen den politischen Alltag aus, und wie nehmen wir Bürger und Wähler an ihm teil? Und was sagen uns diese Orte, Dinge, Gesten und Worte über die medialen Vermittlungszwänge, das ewige Abgrenzungsspiel, die leidenschaftliche Intensität und die manchmal auch nur absurde Komik der Politik?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Ähnliche
Philip Manow
Die zentralen Nebensächlichkeiten der Demokratie
Von Applausminuten, Föhnfrisuren und Zehnpunkteplänen
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Dieses Buch handelt von unserer Demokratie – und von Aufsitzrasenmähern, Milbenkäse, Inkontinenzwindeln, sowie Zwergschnauzern in den Varianten Nackthund oder powder puff mit seidenweichem Haarschleier. Und außerdem noch von zu viel Gel in den Haaren, Sherry mit geschlagenem Ei, von Fördern und Fordern und den Tücken elektronischer Abstimmungssysteme. In 33 Einträgen von Applausminuten bis Zehnpunkteplan zeigt sich: Alles ist politisch.
Und: Politik ist eine Intensität. Alles kann in dieses Kraftfeld hineingezogen werden. Wer wissen möchte, warum Politiker sprechen, wie sie sprechen, warum sie gehen, wie sie gehen, warum sie das essen, was sie essen, und die Kleidung anziehen, die sie anziehen, findet hier Antworten.
Über Philip Manow
Philip Manow, geboren 1963, ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bremen, mit vorherigen Stationen an den Universitäten Konstanz und Heidelberg sowie dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln und dem Wissenschaftskolleg in Berlin. Er schreibt regelmäßig für das Magazin MERKUR. Er lebt in der Nähe von Köln.
A, B, C, D, mokratie – Vorwort
Auch wenn nicht jeder Eintrag in diesem Wörterbuch demokratischer Nebensächlichkeiten völlig ernst genommen werden sollte und ernst genommen werden will, so ist das Anliegen des Buches doch ein ernsthaftes. Auf zwei – miteinander zusammenhängende – Mängel in unserem gegenwärtigen Verständnis von Politik will es reagieren: auf das weitgehende Desinteresse an ihren prozeduralen, praktischen Seiten einerseits, und auf das Fehlen einer angemessenen Reflexion über «die dargestellte Wirklichkeit der Politik» andererseits. Was ist damit gemeint?
Zunächst: Wie stellt sich uns Politik dar? Uns, die wir im Regelfall nicht Politiker sind, begegnet die Politik selten, die dargestellte Politik hingegen äußerst intensiv, tagtäglich. Man kann sich ihr kaum entziehen. Es erscheint geradezu als eine Hauptaktivität der Politik, sich darzustellen: «Was als ‹Politik› in den Raum der Öffentlichkeit tritt […] ist immer schon Produkt [einer] Ökonomie der Darstellung».[1] Diese Ökonomie erfährt allerdings – so zumindest mein Eindruck – selten eine angemessene Behandlung. Sie läuft in der journalistischen Berichterstattung so mit, in der Presse immer mal wieder erwähnt, aber selten systematisch reflektiert, im Fernsehen ja sowieso nur reproduziert und affirmiert. Von Seiten der Politikwissenschaft gibt es hierzu wenig – dort werden solche Fragen gerne ans Feuilleton delegiert, wo sie dann allerdings meist nur auf Trivialniveau abgehandelt werden: Was sagt uns Merkels aktuelle Blazerfarbe über die Einigungschancen beim EU-Ministerrat? (Einfache Antwort: gar nichts). Und wo hat sie bloß diese Halskette her?
Was das offensichtliche Desinteresse an der Politik als Betrieb anbetrifft, um Max Weber zu paraphrasieren, und zu dieser Praxis gehört ja einerseits die Ökonomie der Darstellung, darüber hinaus gehören aber eben auch Plätze dazu, auf denen sich Menschen versammeln, Urnen, in die Wahlzettel geworfen werden (die zuvor in Wahlkabinen ausgefüllt wurden), Audiofiles, auf denen Politikerstimmen mitgeschnitten werden, elektronische Abstimmungsverfahren im Parlament und vieles anderes mehr – was also das Desinteresse an dieser Betriebsseite des politischen Alltags angeht, so erklärt sie sich vielleicht so: In wessen Vorstellungswelt die Demokratie allenfalls als Stuhlkreis möbliert ist, der muss sich mit solchen Details auch nicht weiter belasten.
Das sind zwei Seiten eines Desinteresses an der Praxis der Politik, das wohl darauf zurückzuführen ist, dass Politik heute entweder nur als Anwendungsfall der Moralphilosophie erscheint oder als reines Oberflächenphänomen behandelt wird.[2] Folgt man der moralphilosophischen Perspektive, geht es in der Politik um das ethisch Gerechtfertigte oder sachlich Richtige, und wenn sich das nicht so wie vorgestellt oder gefordert realisiert, wird’s halt an der Dummheit der Leute oder an den moralischen Defekten der Welt gelegen haben. Wir leben in Zeiten, in denen der Satz «Entrüstung ist kein politischer Begriff» offenbar nichts als Entrüstung hervorruft – wenn nicht, mit einem gewissen Zynismus, Politik sowieso nur als Teil der Unterhaltungsindustrie und des celebrity-Geweses verstanden wird.
Gegen diese Tendenzen wendet sich dieses Buch. Seine Einträge haben die Praxis demokratischer Politik zum Gegenstand. Sie wollen ein kleines, selbstverständlich nicht vollständiges Inventar demokratischer Dinge und Orte, Institutionen und Verfahren erstellen. Der Vorschlag lautet, sich vermittels der Beschäftigung mit dieser Betriebsseite der Politik dem vorherrschenden Diskurs über Politik zu entziehen. Stattdessen etwas anderes, in der Hoffnung auf neue Fragen, Sichtweisen und möglicherweise ein neues Vokabular. Ich folge dabei der Programmatik Durkheim’scher Religionssoziologie: Willst du eine Religion verstehen, schaue auf ihre Rituale, nicht auf ihre Theologie.[3] Willst du die Demokratie – oder zumindest ganz wesentliche ihrer Aspekte – verstehen, schaue auf ihre Alltagspraxis, nicht auf ihre Theorie.
Die Fragen nach der dargestellten Wirklichkeit der Politik und nach der Politik als Betrieb, wenn man sich auf sie einlässt und sie für einleuchtend hält, dann erscheinen weitere Entscheidungen ganz folgerichtig, nahezu zwangsläufig. Mir erschienen sie zumindest so und ich hoffe, der Leser, die Leserin kann dem folgen. Etwa die Entscheidung, eine Antwort oder Antworten auf diese Fragen über die möglichst exakte Betrachtung und Beschreibung politischer Einzelphänomene zu suchen: Wie präsentiert sich uns die repräsentative Demokratie? Welches Erscheinungsbild hat sie? Konkreter: wie sprechen Politiker und warum sprechen sie so, wie sie es tun? Wie gehen Politiker? Was ziehen sie an – und warum? Was essen sie – oder was behaupten sie üblicherweise zu essen? Wer darf wann und wo wie lange zu wem reden? Welche politische Topographie präsentiert sich uns, im Parlament mit seiner Sitzordnung (unter einer Parlamentskuppel und mit einer vorgelagerten Bannmeile), im Wahllokal mit Wahlkabine und Urne, in den internationalen Verhandlungen mit ihren festgelegten Sequenzen aus Ankunftsstatement, dem formellen und informellen Zusammenstehen, der Verhandlung «hinter verschlossenen Türen», der Verkündigung und Bewertung der Ergebnisse vor der Presse und schließlich dem Abtritt in die Kulisse? Die Frage nach der Darstellung von Politik schließt aber auch Fragen zu unserer eigenen politischen Tätigkeit, dem Wählen, ein: wie wird gewählt, wann wird gewählt, warum wird an einem Wahltag und in Wahlkabinen gewählt? Und welche Rolle spielt die Wahlurne? Und so weiter und so fort.[4]
Mein Zugang zur politischen Praxis folgt also dem Rat, nicht «vom allgemeinen Problem» auszugehen, sondern «von einem gut und griffig gewählten Einzelphänomen». Das «kann gar nicht klein und konkret genug sein, und es darf niemals ein von […] Gelehrten eingeführter Begriff sein, sondern etwas, was der Gegenstand selbst bietet.»[5] Der Gegenstand selbst – die Evidenz der Dinge, der demokratischen Dinge, Orte und Praktiken ist das, von dem die verschiedenen Beobachtungen im Folgenden ihren Ausgang nehmen. Die intensive Beschreibung der politischen Einzelphänomene soll es ermöglichen, zunächst einmal zu fragen, was uns denn der Gegenstand selbst bietet, mit dem Anspruch, dass sich die Wissenschaft auch jedesmal ganz in jedem einzelnen Behandelten erweisen sollte. Das aber idealerweise ohne Preisgabe eines gewissen Reflexionsniveaus, und natürlich auch nicht als theorieloses oder auch nur theoriefernes Unterfangen. Aber die Theorie-Anstrengungen sollen eher nebenher laufen, vor allem in den Anmerkungen und im Literaturverzeichnis. Man kann das gerne konsultieren, aber fürs jeweilige Verständnis sollte man es nicht konsultieren müssen. Die Einzelphänomene sind dabei auch unter der Maßgabe ausgewählt worden, etwas von der Intensität der Politik vermitteln zu können, vom Willen zur kreativen Regelauslegung und -umgehung, etwas vom Unterhaltsamen und nicht zuletzt dann auch häufig sehr Komischen der Politik zu dokumentieren, das ja in gängigen Beiträgen auch kaum eine Rolle spielt.
Einer Chronologie folgen die Einträge nicht. Man kann einsteigen, wo immer man will. Schließlich: Da das Buch sein Material dem fortlaufenden politischen Geschehen entnimmt, spiegelt sich in den Beispielen und Anekdoten die Zeit. Sichtbare Spuren haben die Themen der letzten Jahre hinterlassen – die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, Brexit, Trump. Diese Themen sind im Folgenden vornehmlich Beobachtungsanlass, nicht selbst Erörterungsgegenstand.
Applausminuten
Ich applaudiere dir, du applaudierst mir, wir applaudieren uns – Applaus-Deklinieren auf Nordkoreanisch.
Nun hat sich also doch jemand einmal die Mühe gemacht, nachzumessen und zu vergleichen. Die neun Minuten Beifall für Merkels Rede auf dem CDU-Parteitag vom Dezember 2015 lagen knapp über dem Mittel ihrer dreizehn Parteitagsreden aus fünfzehn Jahren. Deren durchschnittliche Beifallslänge: 7,7 Minuten. Als sich der Vorsitzende der italienischen Kommunisten, Enrico Berlinguer, 1976 in Moskau am vierten Tag des XXV. Parteitags der KPdSU vor fünftausend Delegierten zu Demokratie und Pluralismus bekannte, fand das die eisigste Aufnahme: exakt sieben Sekunden Beifall – obwohl der Simultanübersetzer besonders provokante Passagen bereits entschärft hatte.
Was verrät der Applaus über die Politik? Das scheint nicht so eindeutig zu sein. 2012 auf dem CDU-Parteitag «nur» acht Minuten Beifall für Merkel, dann aber 97 Prozent der Stimmen bei der Wahl zum Parteivorsitz, ein – wie es etwas bösartig hieß – «sowjetisches» Ergebnis. Bei dem CDU-Parteitag 2015 dann, vor dem Hintergrund rapide sinkender Zustimmungswerte und tiefgreifender parteiinterner Konflikte über die Flüchtlingskrise: neun Minuten Applaus. Aber nur wenige Wochen nach Merkels Parteitagsrede attestierte der CDU-Abgeordnete Wolfgang Bosbach der Kanzlerin in der Bundestagsdebatte über die Flüchtlingskrise in aller Öffentlichkeit Kontrollverlust und erklärte einen grundlegenden Politikwechsel für absolut überfällig: «Wir stehen vor einer Überforderung unseres Landes […] Deswegen brauchen wir eine politische Kurskorrektur. Diesen Kontrollverlust, den wir seit Sommer vergangenen Jahres haben, müssen wir so rasch wie möglich beenden.» Das stenographische Protokoll verzeichnet: Beifall bei der CDU/CSU. Die FAZ ergänzte: das war «ein großer Teil der Fraktion und nicht bloß eine kleine Minderheit gewesen. Schon lange werden die Verhältnisse in der Unions-Fraktion beim Koalitionspartner SPD registriert. Sogar bis zu einem ‹Eigentlich hat Merkel in ihren Reihen keine Mehrheit mehr› reichen manche Wahrnehmungen».[1] Schließlich fragte im September 2016 die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt im Plenum spitz: «Die Chefin welcher Regierung sind Sie eigentlich?» Merkel hatte für mehrere Redepassagen den meisten Applaus von den Grünen und den wenigsten von der Union bekommen. Auf dem Parteitag der CDU im Dezember 2016, als sich intern weiterer Unmut über ihre Flüchtlingspolitik aufgestaut hatte, war der Applaus nun fast schon nordkoreanisch: elf Minuten. Das Ergebnis war nun aber nicht mehr sowjetisch: Die symbolisch so wichtige 90-Prozent Grenze wurde mit 89,5 Prozent knapp unterschritten.
Applaus, so scheint es, gibt es also mal für dieses, mal für jenes, mal für diese, mal für jenen. Melissa Schwartzberg unterscheidet Ab- und Zustimmung, Aggregation und Akklamation.[2] Im ersten Fall geht es um das präzise more – um die Mehrheit. Im zweiten Fall geht es um ein eher unpräzises most – um die Einheit. Die Akklamation, die Zustimmung, gilt eher der Person, die Aggregation, die Abstimmung, eher der Sache. Früher versuchte man auch in Sachfragen die Mehrheit über die Lautstärke des Beifalls zu ermitteln, aber das erwies sich schnell als problematisch. Heute will man die Einheit über die Dauer des Beifalls signalisieren. Wenn es um die Demonstration von Einheit geht, kann die Applausdauer dann im Extremfall auch zum «sowjetischen» Dauerapplaus werden. Aus Solschenyzins «Archipel Gulag» stammt folgende Episode:
«Eine Bezirkskonferenz … Am Ende wird ein Schreiben an Stalin angenommen, Treuebekenntnisse und so weiter. Selbstredend stehen alle auf (wie auch jedesmal sonst der Saal aufspringt, wenn sein Name fällt). Im kleinen Saal braust ‹stürmischer, in Ovationen übergehender Applaus› auf. Drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten – noch immer ist er stürmisch … Doch die Hände schmerzen bereits. Die erhobenen Arme erlahmen. Die Älteren schnappen nach Luft. Und es wird das Ganze unerträglich dumm selbst für Leute, die Stalin aufrichtig verehren. Aber: wer wagt es als erster? … Denn im Saal stehen und klatschen auch NKWD-Leute, die passen schon auf, wer als erster aufgibt! … Im kleinen, unbedeutenden Saal wird geklatscht … Und Väterchen kann’s gar nicht hören … 6 Minuten! 7 Minuten! 8 Minuten! … Hinten, in der Tiefe des Saales, im Gedränge, kann einer noch schwindeln, einmal aussetzen, weniger Kraft, weniger Rage hineinlegen – aber nicht im Präsidium, nicht vor aller Augen! 9 Minuten! 10! … Verrückt. Total verrückt! Sie schielen mit schwacher Hoffnung einer zum anderen, unentwegt Begeisterung auf den Gesichtern, sie klatschen und werden klatschen, bis sie hinfallen, bis man sie auf Tragbahren hinausbringt! … Und so setzt der Direktor in der elften Minute eine geschäftige Miene auf und läßt sich in seinen Sessel … fallen. Und – o Wunder! – wo ist der allgemeine, ungestüme und unbeschreibliche Enthusiasmus geblieben? Wie ein Mann hören sie mitten in der Bewegung auf und plumpsen ebenfalls nieder. … Der Bann ist gebrochen! … Allein, an solchen Taten werden unabhängige Leute erkannt … In selbiger Nacht wird der Direktor verhaftet.»[3]
Warum geht es aber überhaupt in erster Linie um die Dauer? Weil Lautstärke ein unzuverlässigeres Maß der politischen Zustimmung oder Ablehnung ist. Auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner im Juli 2016 geraten Trump-Anhänger und -Gegner aneinander. Die Gegner wollen eine Abstimmung über die Geschäftsordnung im Plenum, die «anderen skandieren: Trump! Trump! Trump!» Die Parteitagsregie übergeht die Gegner, obwohl «viele in der Halle [bezweifeln], dass das ‹Ja› zur Geschäftsordnung tatsächlich aus mehr Kehlen kam als das ‹Nein› der Kritiker. Die Rufe nach einem ‹roll call›, bei dem die Delegationen der Staaten einzeln abgefragt worden wären, wurden in Musik ertränkt».[4] So viel hat sich über die Jahrhunderte also offensichtlich nicht geändert: Die Germanen, so kann man es zumindest bei Tacitus nachlesen, hätten auf ihren Stammesversammlungen Ablehnung durch Murren geäußert, Zustimmung durch das Gegeneinanderschlagen der Waffen signalisiert.[5] Die Lautstärke des Waffenklangs sollte allen mit hinreichender Klarheit darüber Auskunft geben, welchen Ausgang die Sache nähme, wenn man «die Waffen sprechen» lassen würde. Für die Minderheit ist das eigentlich alles, was sie an Information benötigt. Klingt also im Abstimmungslärm der Waffenlärm nach?[6]
Das wird zumindest oft behauptet, verbunden mit der inhaltlichen Deutung, dass politische Gemeinschaften das Mehrheitsprinzip als gewaltloses und damit sozial weniger kostenträchtiges Substitut für den zuvor praktizierten Modus kollektiver Entscheidungsfindung – den blutigen Kampf – «erfinden». «Die Abstimmung ist […] eine Projizierung der realen Kräfte und ihrer Abwägung auf die Ebene der Geistigkeit, eine Antizipation des Ausgangs des konkreten Kämpfens und Zwingens in einem abstrakten Symbole», so bereits Georg Simmel 1908 in seinem Exkurs über die Überstimmung. Identisch argumentiert Elias Canetti in Masse und Macht gut 50 Jahre später: Die parlamentarische Abstimmung sei «der Rest des blutigen Zusammenstoßes […] die Zählung der Stimmen ist das Ende der Schlacht. Es wird angenommen, dass 360 Mann über 240 gesiegt hätten.»[7] Und das wird auch noch heute gern behauptet,[8] obwohl die These von der Geburt der Demokratie aus der Gewalt wenig plausibel erscheint.
Carl Schmitt war daran gelegen, diese These durch Inversion lächerlich zu machen. Für ihn ist gerade der Zustand der Gewalttätigkeit demokratisch: Im Hobbes’schen Naturzustand – so Schmitt – kann jeder jeden töten, «es herrscht also Demokratie». Bei Hobbes liest sich das allerdings etwas differenzierter. Nicht nur im Naturzustand, sondern auch im civil state herrscht Gleichheit. Die alles gleich machende Gewalt des state of nature ist nun überwunden durch ihre Monopolisierung im Souverän. Nun herrscht Gleichheit unter den Bürgern durch ihre unterschiedslose Macht- und Gewaltlosigkeit gegenüber der einen, vereinheitlichenden Herrschergestalt mit ihrer unbegrenzten Herrschergewalt. Ist diese Gestalt, was Hobbes durchgängig als Möglichkeit in Erwägung zieht, durch eine demokratische Versammlung («assembly of men») repräsentiert, so herrscht das Mehrheitsprinzip, und die Mehrheit wird durchaus «im Kampf» – aber einem Kampf der Stimmen – ermittelt: «Und wenn die Vertretung aus vielen Menschen besteht, so muß die Stimme der Mehrzahl als die Stimme aller angesehen werden. Denn stimmt zum Beispiel die Minderheit mit ‹ja› und die Mehrheit mit ‹nein›, dann sind mehr als genug verneinende Stimmen da, um die bejahenden aufzuheben, und dadurch wird der Überschuß an verneinenden Stimmen, der unwidersprochen bleibt, zur einzigen Stimme der Vertretung.»[9] Nachdem die Zahl der ablehnenden Stimmen die gleiche Zahl der zustimmenden «zerstört» hat, wie es in der englischen Leviathan-Ausgabe heißt (enough to destroy), dann bleibt allein der Überschuss der ablehnenden Stimmen zur Artikulation des Willens der repräsentativen Versammlung. Das ist einerseits eine Vorstellung politischer Physik, in der ein Körper in einem Spannungsfeld widerstrebender Kräfte sich in die Richtung bewegt, in die die stärkere Kraft wirkt, aber andererseits auch die Vorstellung, dass sich die Klarheit der Entscheidung aus der Neutralisierung sich widersprechender Stimmen ergibt, sodass allein die unwidersprochenen Stimmen den Willen des Kollektivs auszudrücken vermögen. Die Mehrzahl bringt die Minderheit durch Abzug zum Schweigen.
So auch Rousseaus Sicht: die Mehrheit ergibt sich als Rest, nachdem negative und positive Stimmen sich wechselseitig cancelliert, ausgestrichen haben.[10] Das Ausstreichen aber ist ein Vorgang, der Schriftlichkeit statt Mündlichkeit voraussetzt. In der politischen Versammlung muss – wenn es um Entscheidungen geht – die Stimme zu Schrift werden, es geht ums Überschreiben, nicht Überschreien, also um Aggregation, nicht Akklamation. Denn die Kräfteverhältnisse innerhalb einer Versammlung durch Lautstärke zu ermitteln, erweist sich als in mehrfacher Hinsicht problematisch – siehe Donald Trump und der Nominierungsparteitag der Republikaner. Die Schwierigkeit wird bereits evident, wenn Zustimmung und Ablehnung – wie bei Tacitus’ Germanen – auf unterschiedliche Weise geäußert werden: «Wenn die Befürworter eines Vorschlages mit Waffenlärm zustimmten, die Ablehnenden hingegen murrten, was galt dann? Selbstverständlich ist der Waffenlärm von wenigen lauter als das Gemurre von vielen. […] Gemurre konnte lediglich dann den Waffenlärm übertönen, wenn nur verhältnismäßig wenige die Waffen rührten. Das Verfahren privilegierte Zustimmung».[11] Und was, wenn eine Versammlung sich nicht für oder wider einen konkreten Vorschlag zu entscheiden hat, sondern aus einer Reihe von Vorschlägen auswählen soll? Als Maß relativer Zustimmung erweist sich der Zuruf als zu unpräzise: «Schon bei drei annähernd gleich starken Zurufen ist die Reihenfolge der Lautstärke kaum ermittelbar». Und falls «die unterschiedlichen Lautstärken nicht deutlich zu vernehmen sind, läßt sich eine solche Abstimmung nicht in gleicher Weise wiederholen. Der Zuruf strengt die Stimme an [… G]erade diejenigen, die am lautesten schreien, laufen Gefahr, daß ihnen die Stimme versagt, wenn die Abstimmung wiederholt wird. Dasselbe droht ihnen, wenn auf einer einzigen Tagung mehrere Entscheidungen per Abstimmung zu fällen sind. Ein generelles Manko beim Messen von Intensität zeigt sich: je mehr man diese ausdrückt, desto weniger ist die Wiederholung möglich».[12]
Uneindeutige Ergebnisse stellen aber schnell die Legitimität des Beschlusses in Frage, wecken Zweifel und geben den Unterlegenen Anlass, das Ergebnis anzufechten, umso mehr, als sie sich beim Verfahren nach lautestem Zuruf kaum selbst einen verlässlichen Überblick über die Verteilung von Zustimmung und Ablehnung verschaffen konnten. Wer laut ruft, hört sich in erster Linie selbst und kann daher die Lautstärke des Gegners nicht abschätzen – auch das nährt Misstrauen am Urteil. Wird nach Lautstärke entschieden, «zerstören» die Pro- nicht einfach die Kontra-Stimmen, sie «cancellieren» sich auch nicht einfach. Im Gegenteil – sie addieren sich eher: zu einem zunehmend ununterscheidbaren Lärm.
Dann also eher Dauer statt Lautstärke, Zustimmung statt Abstimmung und Beifall statt Zuruf. Auf dem Nominierungsparteitag der US-Demokraten tritt Bernie Sanders auf die Bühne: «Der Applaus nimmt kein Ende – und der Senator aus Vermont macht keine Anstalten, mit seiner Ansprache zu beginnen. Zigmal bedankt er sich. Am Donnerstag werden die Stoppuhren laufen, um zu messen, ob Clinton genauso lang bejubelt wird.»[13] Denn demokratischer, weil hinsichtlich des Lautstärkevermögens gleichmäßiger verteilt als die Stimme, ist die voix des mains, die Stimme der Hände, also der Applaus: Die «Demokratie der Hände» setzt sich gegen die «Aristokratie der Lungen» durch, denn dass die parlamentarischen Entscheidungen nach viva voce erfolgen, rief schon frühzeitig Bedenken gegen die potenzielle Verletzung des Gleichheitsprinzips hervor. Dann könne sich ja derjenige durchsetzen, der über die stärkere Stimme verfüge.[14] Heute aber misst man nicht mehr nach Händen, sondern zählt nach Köpfen – Aggregation statt Akklamation, denn – wie gesagt – der Applaus ist unzuverlässig, launisch und manchmal auch nur höflich, wird also trotz innerer Ablehnung quasi aus Höflichkeit gespendet. Applaus kostet nichts – so wie das «feine Schweigen». Nach Merkels Regierungserklärung zur Flüchtlingskrise im Oktober 2015 war im Bundestag der «Beifall aus den Reihen der Unionsfraktion … zwar ausreichend lang. Laut und kräftig aber war er nicht. Andreas Scheuer, der CSU-Generalsekretär, klatschte in solchen Abständen, als wolle er sich von Horst Seehofer nicht erwischen lassen.»[15]
Der stenographische Dienst des Bundestags hat ungeschriebene Regeln, um die feinen Abstufungen der Zustimmungsintensität, die sicherlich auch den Fraktionssprechern und Geschäftsführern nicht entgehen, im Protokoll festzuhalten: Beifall, lebhafter Beifall, starker Beifall, allgemeiner starker Beifall, stürmischer Beifall, langanhaltender Beifall, oder aber: Heiterkeit, Lachen, Unruhe usw.[16]
bunt
Lässt sich die Krise der Politik an der Krise der politischen Sprache ablesen?
Ist die «Krankheit der Politik vor allem die Krankheit der Wörter»?[1] Lässt sich die Krise der Politik an der Krise der politischen Sprache ablesen (→ Soundbites; → Kinsley gaffe)? Oder ist das nur eine dieser typischen Studienrat-a.-D.- und Die Zeit-Leserbriefschreiber-Obsessionen? Heutzutage werden im Dienste der politischen Sprachoptimierung Wörter an Fokusgruppen ausgetestet und dann den Politikern zur weiteren Verwendung angeboten.[2] Toleranz – für, Intoleranz – gegen. Was die Intoleranz anbetrifft, kann folglich nur gelten: Null Toleranz! Oder auch: Ungleichheit – schlecht, Diversität – gut. Aber viel zu verkopft. Dann lieber bunt. Was noch in den 1990er Jahren die «Bunn’zreplik» (Helmut Kohl) war, wird daher 2010 als «bunte Republik Deutschland» (Christian Wulff) ausgerufen. Auch Peter Tauber bekennt sich im Dreiklang zu «jünger, bunter, weiblicher». Bis es schließlich Alexander Gauland zu bunt wird.
Aber was wäre denn der Gegensatz von bunt? Grau. Und wer bitte soll das wollen, außer vielleicht der «mittelalte weiße Mann»,[3] eben die Gaulands des Landes? Das sind also die asymmetrischen Gegenbegriffe unseres politischen Alltags, Begriffe mit «suggestiver Eigenkraft», mit Polen, die auf ungleiche Weise konträr sind.[4] Es sind die Gegenbegriffe einer Zeit, die sich für endgültig frei von ihnen erklärt hat. Aber wehe, wenn der eine Begriff doch den anderen als seinen polaren Gegensatz aus sich heraustreibt. Dann sind wir ganz schnell bei: Braun.
Die politische Wortwahl will, dass wir gar keine Wahl mehr haben. Die politischen Wörter produzieren die Sehnsucht nach einer politischen Aussprache, die aber nie stattfindet. Am Ende gewinnt der mit den besten Wörtern: «I’m very highly educated. I know words, I have the best words» (Donald Trump).
Burg Wulffenstein («die Gaube des Grauens»)[1]
Klinker-Brutalismus à la Burgwedel, circa 2008.
Es entspricht der Ästhetik des Mittelmaßes, die unsere Demokratie dominiert (→ Flechtslipper), dass auch die Häuser unserer Politiker die elementaren Prinzipien architektonischer Spießigkeit berücksichtigen. Oggersheim, Burgwedel, Goslar, schon die Standorte sind Versprechen auf gediegene Provinzialität. Hannover, Zooviertel: Schröders Reihenhaus, nebenan die Edeka-Filiale und ein «Getränkemarkt, dessen Gebäude der Talstation einer Seilbahn ähnelt».[2] Und Sigmar Gabriel fährt zu Hause Aufsitzrasenmäher. Dass sich das Haus, für das Christian Wulff jenen Kredit aufnahm, dessen Bekanntwerden das Ende seiner Bundespräsidentschaft einleitete, als «x-beliebiges Herr-Mustermann-Haus im Burgwedeler Eigenheimbrei» qualifiziert, ist also nicht unbedingt einem persönlichen Stildefekt zuzurechnen – oder wenn doch, dann ist es ein politisch erfolgreicher, weil repräsentativer Defekt, ein Defekt, für den es in der Demokratie Prämien gibt.[3]
Was sehen wir? Einen «Klinkeralbtraum […] Chiffre niedersächsischer Neogotik […] Hinter dem Zaun mit zinnenartigen Postamenten erhebt sich ein eingeschossiger Gebäuderiegel mit bunkerhafter Anmutung und vier kleinen, auf retro getrimmten Fenstern. Eine Garage und eine Pergola rahmen das Ensemble ein.»[4] Die taz fragte: «Krüppelwalmdach, Sprossenfenster und Harzer Pfanne: Für dieses Haus lieh sich Bundespräsident Wulff eine halbe Million Euro. […] was sagt es uns über ihn?» Richtig hätte die Frage lauten müssen: Was sagt es über uns aus, über die Demokratie und ihre medialen Verwertungszwänge, über jene geschmacksprägende Kraft des Medianwählers mit seiner Ästhetik des Mittelmaßes? Im Vorwort von Zu Besuch bei Diktatoren, ein Band, der die Privathäuser der Despoten des 20. Jahrhunderts der Betrachtung unterzieht, wird notiert: «Man mag die Interieurs grässlich oder, insgeheim, eher inspirierend finden, eines ist sicher: die Farbe Beige taucht nirgends auf. Irgendwo darin steckt eine Lektion für uns alle».[5] Die Farben der Demokratie sind gedeckt, ihr Auftritt ist langweilig, tendenziell spießig, aber wir haben eigentlich keinen Grund zur Klage.
Aber Trump, what’s the matter with Trump?, könnte man jetzt berechtigterweise fragen. Wie passt sein Großkotz-Protz, seine unnachahmliche Mischung aus Macht, Neureichtum und schlechtem Geschmack in dieses Bild?[6] Nichts ist hier zurückgenommen, ganz bestimmt nicht sein 100-Millionen-Dollar-Penthouse im eigenen New Yorker Trump Tower: «Gold so weit das Auge reicht […] es funkelt, blitzt, glänzt und schillert überall.» Dazwischen cremefarbener Plüsch und rosa Marmor, Leder und falsches Holz, Wasserfälle über mehrere Etagen hinweg, viel Spiegelfläche und antike Möbel, die schrille Inszenierung des Überflusses, der Übertreibung, eine einzige Interieur-Rache an der dezenten Ostküsten-Ästhetik oder dem sachlich-kühlen, minimalistischen Design der globalen Elite. Trumps pompöser Stil der Maßlosigkeit, des demonstrativen too much, erinnert «verblüffend an Saddam Husseins Paläste» beziehungsweise an den «sogenannten Sankt-Moritz-Russengeschmack».[7] Oligarchen- oder eben Autokratenopulenz, wie sie auch im neuen türkischen Präsidentenpalast Gestalt gefunden hat, in Erdogans kitschiger Düznü-Wörld-Variante eines Sultanpalasts – pseudoosman, aber authentisch megaloman.
Trump stammt ganz offensichtlich aus Vulgärien und ist unübersehbar das komplette Antiprogramm zur demokratischen Zier der Bescheidenheit und der Unauffälligkeit: Könnte man sich Angela Merkel «in einem Mini-Neuschwanstein vorstellen»? Hinsichtlich seines Zweitwohnsitzes Mar-a-Lago in Palm Springs ergibt sich im Wesentlichen derselbe Befund: ein Zuckerbäckerpalast, in dessen Innern die reinste Kitschorgie – «Louis Quatorze auf Acid». Wieder Marmor, Gold, Gold, Spiegel, Gold, noch mehr Spiegel, Deckengemälde, Barockmöbel und sonstiger dekorativer Exzess: «Hauptsache von allem viel, geteilt wird nichts».[8]
Damit stellt sich die Frage, wie die schamlose Demonstration des teuren schlechten Geschmacks mehrheitsfähig werden konnte innerhalb einer sich abgehängt fühlenden unteren Mittelschicht, abgehängt von ebenjenem weitgehend regelfreien Kapitalismusmodell, für das ein Geschäftsrüpel wie Trump prototypisch zu stehen scheint? Zum einen findet man die Antwort wohl dort, wo man in seiner Person eine Mischung aus Aggression gegen und Über-Identifikation mit dem Establishment erkennt, und ein glaubhaftes Versprechen, jede Eliten-Nase, die sich da rümpft, auch gern noch persönlich platt zu hauen. Denn den Trump Tower wird man ja auch als einen dem Establishment unübersehbar entgegengestreckten «goldenen Mittelfinger» verstehen können, sein Penthouse als «die Rache des Typen, der immer als Bridge-and-Tunnel-Guy belächelt wurde», der eben nicht aus Manhattan, sondern nur aus Queens kam.[9] Was hier als Signal an die Wähler wichtig ist, ist Ambivalenz. Einerseits: «Ich bin einer von ihnen» – der äußerst erfolgreiche Geschäftsmann. Und andererseits: «Ich bin keiner von denen» – ich mische diesen Laden mal ganz gewaltig auf, und ich habe meinen Erfolg ja sowieso nur als Außenseiter gemacht, der sich an keine Regeln hält.
Zum anderen korreliert der exzentrischen Politik die exzentrische Erscheinungsweise: Geert Wilders, Gianni Varoufakis, der bei seinen Interviews ja auch am liebsten immer den Motorradhelm aufbehalten hätte (→ Locken im Wind), Boris Johnson, Pablo Iglesias … dass man weit außerhalb steht, soll sich im Zweifelsfall wohl auch in der Erscheinung widerspiegeln.
Chlorhühnchen
Ja, auch das Essen ist politisch codiert.
Gauche caviar, freedom fries, Chlorhühnchen – Carl Schmitt hatte recht: Das Politische ist substanzlos, es markiert nur eine Intensität (einer Assoziation oder Dissoziation). Alles kann urplötzlich in dieses Kraftfeld hineingezogen werden – auch das Essen. Oder das Trinken. Zum Kaviar-Linken gesellt sich dann der Champagne bzw. Chardonnay Socialist, oder der Bollinger Bolshevik (→ Hard work, Softdrink).[1]
Das Politische ist nicht besonders wählerisch, es holt sich seine Abgrenzungen dort, wo es sie gerade findet. Wenn nicht das Essen, dann vielleicht der Wohn- oder Urlaubsort? Was in England ein Hampstead Liberal ist, ist in Dänemark ein Kystbanesocialist, benannt nach einer exklusiven Wohngegend an der dänischen Ostseeküste. In Deutschland gehört man zur Toskana-Fraktion, was eine Aussage über den entsprechenden Konsum von Rotwein und Trüffelpasta gemeinhin einschließt. Früher, als der Salon noch nicht seinen über den Zwischenhalt des Friseursalons führenden Distinktionsniedergang angetreten hatte, war man Salonmarxist. In den USA dient bezeichnenderweise das Auto als politischer Marker doppelter Standards: limousine liberal. Aber auch in Deutschland manifestiert sich am Porsche des ehemaligen Linken-Vorsitzenden und WASG-Gründers Klaus Ernst zweifellos ein politisches Glaubwürdigkeitsproblem.[2]
Ein sozialdemokratischer Kanzlerkandidat schoss vor kurzem aus der Bahn, als er über seine Pinot-Grigio-Kaufgewohnheiten plauderte. Eine ganze Partei nahm sich aus dem Rennen, als sie den Deutschen einen wöchentlichen Veggie-Day zwangsverordnen wollte. Sahra Wagenknecht versuchte zu verhindern, dass Fotos von ihrem Hummeressen in einem Brüsseler Spitzenrestaurant an die Öffentlichkeit geraten (es hat nichts genutzt: «mit Hummer und Sichel» klebt nun als Etikett an ihrer Form des Edelmarxismus). Ohne Zweifel – das Essen ist eine politisch delikate Angelegenheit. Dabei scheint es in der Links-Rechts-Codierung asymmetrisch, denn wie könnte man die Ess-, Trink- oder Wohngewohnheiten eines Konservativen als heuchlerisch entlarven? Es ließ sich nicht so richtig skandalisieren, dass Nicolas Sarkozy seinen Wahlsieg 2007 mit Familie und Freunden im Sterne-Restaurant Fouquet auf den Champs-Élysées feierte, auch wenn dies ihm und seiner Entourage die bleibende Bezeichnung bande du Fouquet’s eintrug.[3]Droite saumon, Lachs-Rechte,[4] ist die müde und auch reichlich einfallslose Retourkutsche auf den Kaviar-Linken-Vorwurf, und sie scheint in der politischen Auseinandersetzung höchstens dann zu funktionieren, wenn sie auf die neue populistische Kleine-Leute-Rechte gemünzt ist.
Allenfalls kann es sich für einen Rechten als politisch verhängnisvoll erweisen, wenn ihm erfolgreich eine «dann lasst sie doch Kuchen essen»-Einstellung angehängt werden kann.[5] Doch der öffentliche Eindruck, den Kontakt zum «gemeinen Mann» bereits vollständig verloren zu haben, wäre für einen Politiker der Linken nicht weniger verheerend. Auf die Frage, ob er wisse, wie hoch die wöchentliche Lebensmittelrechnung eines durchschnittlichen britischen Haushalts ausfalle, half es dem britischen Labour-Oppositionsführer Ed Miliband nicht wirklich, als er antwortete: «Well, it depends how much you’re spending.»[6] Hier geht es sichtlich um etwas anderes als um die Frage, ob Politiker wirklich den aktuellen Preis von einem Paket Butter, einem Liter Milch oder von einem Schoko-Croissant[7] wissen müssen, um gute Politiker zu sein.
Es lässt sich am Essen ebenso wie an der Kleidung (→ Flechtslipper) unseres politischen Führungspersonals ablesen, dass tendenziell alle Verhaltensweisen, die in der Lage sind, sozial eine Unterscheidung zu markieren, in der voll demokratisierten Gesellschaft politisch unter Verdacht geraten können. In der Demokratie lässt sich keine Karriere auf Extravaganz gründen. Man tritt eher als MdB Solms denn als MdB Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich auf (→ Frau XY).[8] Es ist politisch vorteilhaft – zumindest bis knapp diesseits des öffentlichen Eindrucks vollständigen Mittelmaßes –, als ein Mann oder eine Frau ohne weitergehende soziale Eigenschaften zu erscheinen, weil jede soziale Distinktion ein potenzielles politisches Ausschließungskriterium ist, während der Repräsentationsanspruch in der Demokratie ja immer ein unbegrenzter sein muss. Soziologische Theorien des Elitendistinktionsverhaltens – von Simmel bis Bourdieu – wären daher politisch als Vermeidungskatalog zu lesen.
Bei den politischen Essgewohnheiten signalisiert folglich die erklärte Vorliebe für die einfache Küche Volksnähe und Bodenständigkeit. Politisch herrschen daher Landesküche und Hausmannskost vor, es geht vergleichsweise rustikal zu. Regionale Gerichte bieten die Gelegenheit, mit einem zusätzlichen Bekenntnis zur jeweiligen Herkunft zu punkten. Am deutschen Beispiel: dicke Bohnen (Konrad Adenauer), Pichelsteiner Eintopf (Ludwig Erhard), Saumagen (Helmut Kohl).[9] Schließlich mit leichtem Schlag ins Prollige: Currywurst (Gerhard Schröder). Sofort steht das Bild des SPD-Kanzlers als Politmalocher im Maschinenraum des deutschen Regierungssystems vor Augen: hier die Reformschraube ein wenig weiterdrehen, dort die Fraktionsdisziplin etwas nachfetten – und nach der Schicht dann zu Konnopke’s. Die Currywurst diente wohl auch dazu, Schröders vorheriges «Cohiba-Brioni-Image», nun ja, wohl nicht gerade «glattzubügeln», wie die Süddeutsche Zeitung schrieb (→ Flechtslipper), sondern eher schnell wieder vergessen zu machen.[10] Nach Schröder ging es dann wieder etwas dezenter, nämlich einfach und regional zu: Uckermärker Kartoffelsuppe mit Einlage. Im jährlichen Sommerurlaub auf Ischia hingegen die «gute traditionelle neapolitanische Küche», denn die Kanzlerin liebe ja schließlich, wie man wissen lässt, die einfachen Dinge (è amante delle cose semplici).[11]
Die typische politische Klischeespeise ist also im Inland wie im Ausland eine glatte, gediegene Sache, die sich gut in eine Zeichenordnung des Soliden, Bewährten und Bescheidenen einfügt und damit auch eine Sehnsucht nach Herkunft und Identität erfüllt, auf ein nostalgisches Bedürfnis antwortet: sie soll zur Assoziation jeden und zur Dissoziation keinen Anlass bieten.[12] Peter Altmaier twittert an einem heißen Sommertag ein einziges Wort: «Erdbeerkuchen». Das scheint eher unkontrovers zu sein. Politisch an der politischen Speise ist eben, dass sie Ausdruck einer Abwehr ist, die in der Regel den Konflikt niederhalten will und durch diesen Reflex das Politische naturalisiert. Eine Farce, über die keiner lacht, weil sich jeder an ihr beteiligt. Man mag das zunächst für einen Ausdruck pragmatischer Vernunft halten: Lasst uns das schnell abräumen, damit wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Aber dieser vorgebliche Pragmatismus ist doch nur Teil der mitlaufenden Zeichenordnung, denn das Wesentliche wird ja in der Demokratie meist nicht anders als das Nebensächliche behandelt, also beispielsweise als die äußere Erscheinung oder das tägliche Essen. Für beide gilt das Leitmotto der Demokratie gleichermaßen: pro bono, contra malum – Hass ist schlecht und Liebe gut, man ist für Toleranz und gegen Intoleranz (→ bunt), gegen Arbeitslosigkeit und für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und gegen Krieg, und ist dann im Zweifel auch für Wurstbrot und gegen Veuve Clicquot. In der Demokratie kleidet sich das Interesse immer in das Gewand von maximaler Zustimmungsfähigkeit, common sense und Normalität. Es ist ein gängiger Irrtum, anzunehmen, im Zentrum der Politik stehe der politische Streit. Im Zentrum der praktizierten Politik steht vielmehr der beständige Versuch seiner Vermeidung – die eigene Position soll als fraglos gelten.
So erklärt sich auch, wie die Bratwurst – laut Süddeutscher Zeitung – zum «kleinsten gemeinsamen kulinarischen Nenner der deutschen Politik» avancieren konnte. Auch wenn es eine besondere Herausforderung darstellt, sie in der Öffentlichkeit unfallfrei zu essen, geben ihre anderen Qualitäten politisch den Ausschlag: einfach, billig, ohne jeden Distinktionsanspruch, d.h. ohne jedes Konfliktpotenzial, dabei regional variantenreich. Schließlich spricht auch ihre ubiquitäre Verfügbarkeit gerade an denjenigen Orten für sie, die man als räumliches Komplement zur Bratwurst verstehen muss: die Fußgängerzone, der Parkplatz vor dem Baumarkt oder Möbelhaus, beim sonntäglichen Fußballspiel der Vereinskiosk leicht abseits des Spielfeldrands. Bratwurst im Brötchen eignet sich per se für das öffentliche Essen, weil man keine weiteren Hilfsmittel braucht. Man kann sie im Gehen (→ Walks, silly) und in Gruppen essen und dabei vielleicht sogar noch fortfahren, Hände zu schütteln.
Das Essen zeigt den politischen Menschen öffentlich privat, und die Bratwurst ist dabei das ideale kulinarische Darstellungsmittel.[13] Der schnelle Imbiss ist aus identischen Gründen auch anderenorts besonders demokratiekompatibel: «Barack Obama hat im US-Wahlkampf in nahezu jede Art von Fastfood mindestens einmal gebissen. Hot Dogs, Pizza, Burger […] Von Mitt Romney hingegen gibt es keine Bilder, wie er in einen Taco beißt», denn damit wäre automatisch das für die Republikaner heikle Thema der Einwanderung aus Lateinamerika aufgerufen.[14] Um die zurückgelegte Strecke in der Darstellung politischer Herrschaft abzumessen, reicht es zu fragen, ob Herrscherporträts der Vormoderne den Herrscher jemals essend gezeigt haben.
Auch Merkel auf Türkeireise weiß: «Bloß kein Bild mit Döner» – sonst mault die CSU wieder.[15] Das zeigt: Neben dem Wahlkampf ist der zweite hervorgehobene Anlass zum politischen Essen der Staatsbesuch (→ Gullydeckel). Auch dieses Essen, zumindest wenn es sich nicht um ein offizielles Staatsbankett, sondern um ein Arbeitsessen[16] handelt, steht unter dem Imperativ des Schlichten. Im Kanzleramt, so heißt es, geht es «wie immer unter Merkel bodenständig» zu. Etwa: Nordseekrabben, Roulade, Vanilleeis (Samaras, August 2012). Oder: Büsumer Krabben, Beelitzer Spargel mit Kalbsmedaillons, Früchtecrêpes (Obama, Juni 2013). Oder: Rinder-Consommé, Schweinefilet mit Spargel aus Beelitz und einer Erdbeer-Nachspeise, dazu Soft-Getränke und deutscher Wein (Hollande, Mai 2012). Das liest sich so bieder, wie es sich wohl auch lesen soll – eine Allerweltsküche von geradezu theatralischer Langeweile, ein fortgesetztes kulinarisches Understatement. Man muss/soll zu dem Schluss kommen, der Gang in die nächste Bahnhofsgaststätte sei aus rein pragmatischen Gründen verworfen worden. Aber hätte man wirklich lesen wollen, Merkel habe mit dem griechischen Ministerpräsidenten Samaras bei Sauté von Milchkalbsbries und Langostino, Chicorée und Grapefruit, gefolgt von gebratenem Seeteufel mit karamellisierten Endivien und Japanrettich und einem Jus von Blauem Spätburgunder mit Kalbsknochenmark über ein zweites Rettungspaket verhandelt?[17]
Geht es einerseits darum, keine Angriffsfläche für die in der repräsentativen Demokratie allgegenwärtigen «Ihr da oben, wir hier unten»-Vorwürfe zu bieten – keine Opulenz, kein Anschein der Dekadenz –, steht beim Staatsbesuch zusätzlich im Vordergrund, diplomatische Schnitzer des kulinarischen Fachs zu vermeiden.[18] Dazu gehört auch ein «internationales Küchenregime», das gewährleistet, dass trotz der erwünschten regionalen Einsprengsel keine Zumutungen wie Schafshoden, saure Kutteln, Blutpudding oder Milbenkäse aufgetischt werden.[19] Es war in einem doppelten Sinne keine gute Idee, Staatspräsident Hollande bei seinem Antrittsbesuch in Berlin Spargel mit Sauce hollandaise zu servieren. Zum einen hätte man im Vorfeld des Besuchs in Erfahrung bringen können, dass der französische Präsident keinen Spargel mag, zum anderen nährte der Menüplan die vor dem Hintergrund der zunehmenden ökonomischen Ungleichgewichte und der wachsenden Verstimmung zwischen den beiden Staaten ohnehin vorhandene Vorstellung, hier stünde eigentlich der eine auf dem Speiseplan des/der anderen. Den französischen Journalisten, besorgt um das deutsch-französische Verhältnis angesichts von Merkels Unterstützung für Nicolas Sarkozy im französischen Präsidentschaftswahlkampf und angesichts der antideutschen Wahlkampfäußerungen aus der Parti Socialiste, konnte man aus Kreisen des Kanzleramts zumindest versichern: «Sie werden sehen, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde».[20] Ob Merkel nach dem ersten Treffen wohl bestätigen konnte, was man Hollande zu Hause nachsagt, dass er nämlich den Charme eines feuchten Baguettes habe?
In Frankreich hat sich durch die Revolution historisch ohnehin eine völlig andere «politische Grammatik» des Essens entwickelt.[21] Die Republik verwirklicht den universalisierten Zugang zur kulinarischen Raffinesse des Adels, das feine Essen als Objekt adeliger Prestigekonkurrenz wird vom Bürgertum nachgeahmt, das Schleifen des Gildemonopols der französischen traiteurs und die Freisetzung von Köchen aus den Diensten ihrer adeligen Herren im Zuge der Französischen Revolution sorgen in Paris am Ende des 18. Jahrhunderts für die Geburt des modernen Restaurants.[22] Das Gleiche betrifft, nebenbei gesagt, auch die erotische Raffinesse, also die adelige Libertinage (→ Verlobungsringe), und im Vergleich mit den USA würden sich dann sowohl das US-amerikanische Unverständnis für die französische Libertinage wie auch die schlechte amerikanische Küche daraus erklären, dass in der Neuen Welt nie einer heimischen Aristokratie nachgeeifert werden musste. Man eiferte dort allenfalls französischen Republikanern nach, die dem französischen Adel nacheiferten. Thomas Jefferson verfügte über eine exklusive Sammlung französischer Weine.[23]
Was nun aber die politische Rolle der Küche nach der Französischen Revolution anbetrifft, so trafen die aus adligen Diensten entlassenen Köche auf der Nachfrageseite auf die aus der französischen Provinz nun zahlreich in die Hauptstadt strömenden revolutionären Abgeordneten, die – in Privatpensionen untergebracht – sich angewöhnten, zusammen in den zahlreichen neuen Restaurants in der Umgebung des Palais Royal und der Rue Richelieu zu speisen. Sie brachten auch die regionale Küche in die Hauptstadt, die nun ebenfalls eine entscheidende Verfeinerung erfuhr. Müssen wir den historischen Zusammenhang aus politischer Emanzipation und bürgerlicher Öffentlichkeit also anders erzählen? Wer hat in der «Verbindung zwischen parlamentarischem Leben […] und dem Leben der Kneipen und Caféhäuser» eigentlich für wen Modell gesessen?[24] Habermas’ Version dieser Geschichte, dass nämlich das Parlament dem Kaffeehaus nachfolgt und nicht umgekehrt, ist bereits öfter mit guten Gründen angezweifelt worden.[25]
Seit der Französischen Revolution gilt also: Auch Frankreichs politische Seele ist die Sauce.[26] Im Zuge der Revolution wurde die französische Haute nationalisiert zur Grande Cuisine, und diese nimmt bis heute weltweit kulinarische Hegemonie für sich in Anspruch. Im nationalen Selbstverständnis ist Frankreich die Wiege kulinarischer Kunst, ein Selbstbild, das sich durch den UNESCO-Kulturerbe-Status der cuisine française bestätigt sieht. An ausgewählten Momenten, etwa als Frankreich 1989 – zum 200-jährigen Revolutionsjubiläum! – G7-Gastgeber war, wird aufwendig inszeniert, dass es sich die Republik im Mobiliar der Monarchie mittlerweile recht gemütlich gemacht hat. Der Louvre oder das Schloss Versailles werden zu Orten üppiger republikanischer Schauessen, wie im März 2015, als allen in Frankreich akkreditierten Botschaftern, 650 an der Zahl, im Zuge einer «Gastronodiplomatie»-Initiative[27] des französischen Außenministeriums ein Menu aus Foie gras, Lachs-Tartar, Seebarschfilet, Milchlamm, schließlich Käsespezialitäten und einem «schwebenden» Schokoladendessert serviert wurde, begleitet von 18 Kilogramm Trüffeln und fünf Kilogramm Kaviar, dazu selbstverständlich französischer Wein und Champagner in ganz großem Stil (→ Hard work, Softdrink).
Es fällt nicht weiter schwer, sich das habituelle Protestspektrum vorzustellen, das ein solches Ereignis in Deutschland provoziert hätte: PETA – wegen Stopfleberpastete, Claudia Roth – wegen Milchlämmchen, die Linke – wegen Champagner. Daniel Cohn-Bendit, Wanderer zwischen den politischen Kulturen Frankreichs und Deutschlands, betont den Unterschied zwischen der deutschen «Nehmt den Reichen die Austern weg»-Linken und der französischen «Austern für alle»-Linken. Der Hedonismus der französischen Linken weist sie als wahre republikanische, antiklerikale Erben des katholischen ancien régime und seiner kulinarischen Überbietungskonkurrenz aus, während die protestantische Verkniffenheit der deutschen Linken geradewegs in das Bionade-Biedermeier der Grünen führt, in ihr Neo-Spießertum aus «Dinkel und Dünkel» (Peter Richter).
Das Essen ist immer politisch codiert, aber überall anders.
Delaberation[1]
Inkontinenzkompensationskompetenz: Zumindest beim Filibuster im US-Senat wird das zu einer wichtigen politischen Fähigkeit.
So, so – Parlament kommt also von parlare oder parler, und deswegen sei das Parlament vor allem und zuallererst Ort politischer Debatte: Als Etymologie getarnte Ideologie. Gegen sie spricht u.a., dass man ein Gesetz wohl ohne Aussprache, nicht aber ohne Abstimmung verabschieden kann.[2] Die parlamentarische Debatte dient der parlamentarischen Entscheidung, das Reden und Reden – der Filibuster[3] ist hingegen gerade ein Mittel politischer Sabotage, traditionsreiches Instrument parlamentarischer Obstruktion, antiparlamentarisches Mittel par excellence. Wer Carl Schmitt darin folgt, das «Wesentliche des Parlaments» im «öffentliche(n) Verhandeln von Argument und Gegenargument, (in) öffentliche(r) Debatte und öffentliche(r) Diskussion» zu sehen, wer gar mit ihm meint, die parlamentarische Demokratie gehe im Kern in «government by discussion» auf, wie etwa Jürgen Habermas, der sich ja Volkssouveränität nur noch als «diskursives Verfahren» vorstellen kann,[4] der hat gegenüber dem Schmitt’schen Antiliberalismus bereits verloren.
Natürlich musste Carl Schmitt als Theoretiker der Dezision in seiner Liberalismuskritik alles daran setzen, jedes Element der Entscheidung vom Parlament weit fernzuhalten, um es stattdessen in Diskreditierungsabsicht «mit der romantischen Vorstellung des ewigen Gesprächs» und der «endlosen Diskussionen» in Verbindung zu bringen.[5] Aber nichts könnte unparlamentarischer sein als ein ewiges Gespräch. Im Parlament manifestieren sich politische Mehrheiten, hier werden die in der Wahl ermittelten Mehrheiten in die eine, aktuelle politische Mehrheit übersetzt, was sich allein schon deswegen oft als nötig erweist, weil aufgrund des in den meisten westlichen Ländern vorherrschenden Verhältniswahlrechts aus der Wahl selber ja im Regelfall keine unmittelbaren Mehrheiten resultieren. Natürlich stehen politische Entscheidungen mit Allgemeinverbindlichkeit unter Rechtfertigungszwang und sollen und müssen öffentlich begründet und kritisiert werden, aber eben nur insoweit diese Rechtfertigung und Kritik auf die Entscheidung zuläuft und von ihr begrenzt wird, ist sie parlamentarisch.[6]
Im Parlament entscheidet sich, wer gewinnt und wer verliert, welches Interesse sich durchsetzt, wer herrscht und wer beherrscht wird.[7] Die Legitimation und Moderierung dieser Herrschaft resultiert wesentlich aus ihrer zeitlichen Begrenzung, nicht aus ihrer permanenten Begründung, die auf einen sich irgendwann womöglich einstellenden Konsens hoffen muss. Die parlamentarische Debatte ist einer Debattenordnung unterworfen, deren zentrales Merkmal die Regeln zu ihrer Beendigung sind,[8] damit man zu einer Entscheidung kommen kann, damit man zur Abstimmung schreiten kann. Und in dieser Abstimmung wird die Mehrheit über die Minderheit siegen. Dadurch ist jeder weitere Austausch von Argumenten beendet.
Das hat auch – ganz anders als der ohnehin illusionäre Konsens – eine befriedende Wirkung: Nicht die unablässige Behauptung, im Recht zu sein, führt zum Frieden, sondern die Entscheidung macht dem Streit ein Ende. Und dann lässt sich sehen, wer letztlich recht hatte. Unter anderem für diese retrospektive Kontrolle auf die Triftigkeit vorgebrachter statt nur vorgeschobener Argumente gibt es Wahlen. Und erst die Verbindung mit der Entscheidung und der Gelegenheit ihrer nachträglichen Überprüfung in Wahlen macht überhaupt die vorgängige politische Rede ernsthaft. Denn jetzt kann man nicht mehr alles behaupten, ohne befürchten zu müssen, im Nachhinein unglaubwürdig zu erscheinen.[9]
Das Wichtigste an den Diskursregeln sind deswegen jene zur Diskursbeendigung. Es muss gegen das romantische Demokratieverständnis, polemisch bei Schmitt, naiv bei Habermas, gelegentlich daran erinnert werden, dass es in der Politik nicht um Wahrheit geht, der man sich im zwanglosen Austausch der Argumente schrittweise nähern könnte,[10] sondern um Herrschaft,[11] und in der parlamentarischen Demokratie ist das Parlament der Ort, in dem sich diese politische Herrschaft manifestiert. Denn wie ewig muss man sich ein Gespräch vorstellen, bis auch Millionäre bzw. die von ihnen gewählten Repräsentanten finden, dass eine Millionärssteuer eigentlich eine ganz prima Idee sei? Und wer je das Vergnügen einer Diskussion mit Vertretern universitärer K-Gruppen hatte, dem dürfte auch die Formel vom «zwanglosen Zwang des Arguments» wenig, hingegen die Formel vom «Zwang des zwang- und deswegen endlosen Argumentierens» stark einleuchten. Bekanntlich reden die Leute viel, wenn der Tag lang ist – weswegen man den Tag kurz halten sollte, wenn man überhaupt irgendetwas erreichen will. Mit der unbegrenzten Rede lässt sich jedes noch so abstruse gesellschaftliche Interesse, jede ideologische Verstiegenheit auf ewig verteidigen. Die Spieltheorie prognostiziert, dass bei einer Verhandlung derjenige die höchste Auszahlung erhält, der die Zukunft am geringsten abdiskontiert – und Spinner haben vor allem eins: ganz viel Zeit.[12]
Das Parlament ist daher tatsächlich ein dezisionistischer Ort, wie es ihn in der Demokratie kein zweites Mal gibt.[13]