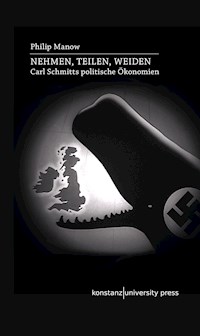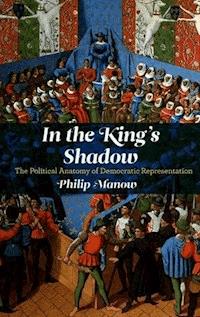15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Demokratie gegen Demokratie – illiberale gegen liberale, direkte gegen repräsentative Demokratie, vielleicht sogar »the people vs. democracy«? Es scheint, die Demokratie war noch nie so unumstritten wie heute, während zugleich noch nie so umstritten war, was aus ihr folgt. Jeder tritt in ihrem Namen an und beschuldigt den Gegner, ein Gegner der Demokratie zu sein.
Der Demokratie droht heute nur noch Gefahr von ihr selbst. Unsere Lage, so die These Philip Manows, ist von der gleichzeitigen Demokratisierung und (Ent-)Demokratisierung der Demokratie gekennzeichnet: Es ist die drastische Ausweitung von Partizipationschancen, die im Zentrum der Krise politischer Repräsentation steht. Diese Krise aber transformiert den Streit in der Demokratie zu einem Streit über die Demokratie – der ist jedoch demokratisch nicht zu führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Ähnliche
Philip Manow
(Ent-)Demokratisierung der Demokratie
Ein Essay
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Einleitung: Eine Politische Theorie des Populismus
I
. Die Demokratisierung der Demokratie
1. Pöbel und Volk
Volk und Pöbel
Repression by Representation
Repräsentative Demokratie als Oxymoron?
2. Das Ende repräsentativer Politik
Kontrollverlust: Politische Organisation
Die Demokratisierung der Parteiendemokratie
Corbyn
Die Auslese des politischen Führungspersonals
Trump
Parteien auf der Suche nach Charisma, Charisma auf der Suche nach Parteien
Macron
Kontrollverlust: Politische Kommunikation
II
. Die Entdemokratisierung der Demokratie
1. Demokratische Unsicherheit
Der Verdacht
Putsch?
Re-entry
Diskursanreize
2. Demokratie als Staatsform
The Constitutive Outside
Der universalistische Expansionismus der Werte und der Märkte
Schluss: Demokratie gegen Demokratie
Danksagung
Literatur
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Einleitung: Eine Politische Theorie des Populismus
Wir sind es überdrüssig zu hören, dass die Demokratie in der Krise ist.
C. B. Macpherson 1965, S. 21
Unsere Zeiten sind vielleicht nur darin neu, dass in ihnen immer etwas zu Ende geht, aber nichts Neues an seine Stelle tritt: das Zeitalter der großen Erzählungen oder das der Ideologien, die Geschichte, die Moderne, der Liberalismus, die Wahrheit usw. Nun also anscheinend auch die Demokratie. Unfähig zu sagen, was danach kommt, stellt man den Begriffen eine Silbe voran: Posthistoire, Postdemokratie, post-truth … Die Postmoderne, als eine Art Klammerbegriff, soll wiederum die kulturelle Ausdrucksform von etwas sein, das sich ebenfalls erschöpft hat, aber als maßgeblicher Verursachungsfaktor und als Begründungsressource kulturkritischer Diagnosen noch gebraucht und daher mit einem vorsichtigeren Zeitpräfix versehen wird: der Spätkapitalismus (Jameson 1991; Anderson 1998). Vorsicht scheint hier auch deshalb geboten, weil die These, die Geschichte sei zu Ende gegangen, ja insbesondere mit dem vollständigen Sieg begründet wurde, den der Kapitalismus über seine staatssozialistische Systemalternative davongetragen habe (Fukuyama 1989, 1992).2Die Konsequenz dieser zahlreichen End-Diagnosen ist eine zeitliche Verortung – post-irgendwas – in einem seltsam zeitlosen Raum: »[M]an kann das Konzept der Postmoderne verlässlich als einen Versuch begreifen, die Gegenwart historisch zu verorten, in einer Zeit, die historisch überhaupt zu denken verlernt hat.« (Jameson 1991, S. ix) Das wird aber nicht als Widerspruch wahrgenommen, sondern als Beleg der These selbst, sei die Postmoderne doch geprägt von dem paradoxen, ungleichzeitigen Nebeneinander und nicht mehr – wie die Moderne – von dem folgerichtigen, teleologischen Nacheinander.
Auch der aktuelle Populismusdiskurs zieht seine besondere Dringlichkeit im Wesentlichen aus einer solchen Endzeitperspektive, aus der drohenden Gefahr eines »end of democracy« oder aus der Diagnose, die entsprechende Schwelle sei bereits überschritten. Und auch für diese Entwicklung werden bisweilen der Kapitalismus und sein globaler Erfolg verantwortlich gemacht. Ein sich im Weltmaßstab durchsetzender Kapitalismus unterminiere die nationalstaatlichen Wachstums- und Wohlfahrtsstaatsmodelle, so die Einschätzung, und sei somit verantwortlich für ein weiteres Zu-Ende-Gehen, für das Ende des Nationalstaats, und das heißt eigentlich: für das Ende der Politik. Wir befinden uns, das wurde zumindest lange Zeit gern behauptet, in einer postnationalen Konstellation. Aber das »Ende der Nation« bedeute zugleich »den Tod der Politik« (Guéhenno 1998, S. 39).3 In diesem Fall jedoch meinen viele – wenigstens in Europa – zu wissen, was danach kommt oder doch kommen sollte: der Nachbau des nationalstaatlichen Modells in größerem Maßstab, auf suprastaatlicher Ebene. Für sie liegt der Ausweg aus den gegenwärtigen Schwierigkeiten und Konflikten darin, »die Reichweite von Demokratie, Regulierung und Sozialpolitik auf Ebenen oberhalb des Nationalstaats auszudehnen« (Crouch 2018, S. 4).
Weil es aber bis auf Weiteres keinen glaubwürdigen Entwurf dafür gibt, wie sich Demokratie und Wohlfahrtsstaat auf supranationaler Ebene verwirklichen lassen, und weil auch Europa einen solchen nicht bietet, scheint für Kritiker das im schlechten Sinne Utopische dieses Versprechens auf das handfeste Szenario einer doppelten, ökonomischen wie politischen Entmündigung hinauszulaufen. Die im Blick auf Staatshaushalte und politische Letztverantwortung ohnehin recht nachlässig begründete These von der postnationalen Konstellation legitimiert, so die Befürchtung, dann eine überhaupt erst zu vollziehende Absage an die Nation, so dass man mit ihr schließlich auch noch den Adressaten für jeglichen demokratischen Unmut über die schwindenden Räume politischer Selbstbestimmung zum Verschwinden bringen könnte – der ultimative Triumph liberaler »Postpolitik« (Chantal Mouffe). Das sieht dann aber gar nicht mehr nach einem »ungenierten Sieg des ökonomischen und des politischen Liberalismus« aus (Fukuyama 1989, S. 3, meine Hervorhebung), sondern viel eher nach einem Sieg der ökonomischen Freiheiten auf Kosten der politischen.
Was wir unter Populismus subsumieren, ließe sich aus dieser Perspektive als Protest gegen Globalisierung verstehen. Sowohl gegen die ökonomische als auch gegen die politische Globalisierung (Kriesi 2014; Kriesi/Pappas 2015; Rodrik 2018), im europäischen Fall insbesondere auch als Protest gegen die Dekonsolidierung des Nationalstaates durch die Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf die europäische Ebene (Hooghe/Marks 2017). Dahinter steht ein Versprechen auf die Rückerlangung politischer Souveränität. Man mag diesen Wunsch für nostalgisch, naiv, aus der Zeit gefallen und daher schon per se für demagogisch und verlogen halten. Sein demokratischer Kern und dessen Mobilisierungskraft mitsamt ihren verteilungspolitischen Implikationen lassen sich aber schlecht ignorieren – oder nur um den Preis des Nicht-Verstehens der gegenwärtig dominanten politischen Konfliktlinie. Das mündet schließlich in eine Debattenlage, in der die Diagnosen nicht gegensätzlicher und unversöhnlicher sein könnten: Populismus als Gefährdung der Demokratie etwa durch Nationalismus, oder Populismus als Reaktion auf die Gefährdung der Demokratie etwa durch Denationalisierung. So, wie sich diese wechselseitigen Einschätzungen öffentlich artikulieren, haben wir es dann aber schon mit einer entscheidenden Überschreitung vorheriger »Postdemokratie«-Befunde zu tun, stellten diese doch noch auf das formale Weitergelten, inhaltlich jedoch zunehmend entleerte Funktionieren demokratischer Prozesse ab, während sich heute die Lager wechselseitig zum Vorwurf machen, sich jeweils als offene Verächter beziehungsweise Gegner der Demokratie zu erweisen.
Indes provoziert auch die begründete Annahme, Populismus habe nicht zuletzt etwas mit Globalisierung zu tun (Manow 2018; Rodrik 2018)4, eine Reihe von Folgefragen. Zunächst: Wenn Populismus ein politischer Reflex auf die Dekonsolidierung des Nationalstaats ist, heißt das, dass von ihm keine Gefahr für die Demokratie ausgeht? Das heißt es meines Erachtens nicht, aber die Antwort fällt etwas komplizierter aus (siehe dazu unten Teil II). Und grundsätzlicher: Wie konnte das Globalisierungsprojekt, das ja kein irgendwie naturwüchsiges, sondern ein politisches Projekt war und ist, überhaupt so weit vorangetrieben werden, dass es erst jetzt und nun recht plötzlich einen so disruptiven, weil elektoral folgenreichen Protest hervorruft? Warum haben demokratische Korrekturmechanismen nicht schon viel früher gegriffen?
Es stellt sich also einerseits die »Warum dort?«-Frage der geografischen Varianz: Warum wird der Globalisierungsprotest einmal eher als Protest gegen die grenzüberschreitende Bewegung von Gütern und Kapital und einmal eher als Protest gegen die grenzüberschreitende Bewegung von Personen artikuliert? Warum tritt der Protest hier eher links und dort eher rechts auf (Manow 2018)? Oder sind das vielleicht ohnehin überholte Kategorien in einer Zeit, in der sich ein republikanischer US-Präsident zum Schutz der Arbeiterklasse vom Freihandel verabschiedet, ein italienischer Rechtspopulist gegen die durch die Maastricht-Kriterien auferlegte »Austerität« protestiert und ein französischer Linkspopulist die Migrationspolitik Angela Merkels kritisiert, weil diese auf die europaweite Schaffung einer lohndrückerischen Unterklasse abziele? Haben sich unsere Einordnungsmuster nicht vielleicht erübrigt in einer Zeit, in der viele populistische Parteien dem Wähler eine neuartige Kombination aus sozioökonomisch linken und soziokulturell rechten Positionen präsentieren? Immerhin handelt es sich dabei um eine ideologische Kombination, die in den ostmitteleuropäischen Ländern bereits seit 1990 als Erbschaft des Konflikts zwischen wirtschafts- wie gesellschaftspolitisch liberalen Reformparteien und den in beiden Dimensionen etatistisch-konservativen kommunistischen Nachfolgeparteien dominiert (Hooghe et al. 2002; Marks et al. 2006).
Es stellt sich aber zugleich die »Warum jetzt?«-Frage (vgl. Guiso et al. 2017): Warum haben sich in unserer Gegenwart simultan diverse populistische Bewegungen herausgebildet, die viele verschiedene Kontexte und Milieus erfassen? Bei allen Unterschieden in den Erscheinungsformen und konkreten Programmatiken des Populismus müsste eine politökonomische Erklärung des Phänomens ja auch angeben können, was sich im Verhältnis von Ökonomie und Demokratie so grundsätzlich geändert hat bzw. wie sich Ökonomie und Demokratie jeweils für sich derart verändert haben, dass uns ihr Verhältnis heute so krisenhaft und die Demokratie so gefährdet erscheint.
Solche Fragen zwingen dazu, noch einmal grundsätzlicher anzusetzen. Eine Politische Ökonomie des Populismus bedarf offenbar auch einer Politischen Theorie, und die muss historisch und theoretisch weiter ausgreifen. Das macht sich dieser Essay zur Aufgabe. Wenn der Anlass für populistischen Protest auch in jeweils recht konkreten ökonomischen Verwerfungen liegen mag, so verweist das Phänomen selber doch auch auf spezifische Dysfunktionalitäten der repräsentativen Demokratie. Hier setzt mein Argument ein. Seine zentrale These lautet, dass sich im Populismus zwei Prozesse bündeln. Der Populismus unserer Gegenwart konfrontiert uns mit der widersprüchlichen Gleichzeitigkeit, aber auch mit dem latenten Zusammenhang von zwei Entwicklungen, die ich Demokratisierung und Entdemokratisierung der Demokratie nennen möchte. Die erste These, die von der Demokratisierung der Demokratie, lautet, dass wir es zunächst eigentlich mit einer Krise der Repräsentation, nicht aber mit einer Krise der Demokratie zu tun haben. Ganz im Gegenteil: Die Krise der Repräsentation sollte als eine Konsequenz der massiven Ausweitung politischer Partizipationschancen verstanden werden, die wir momentan erleben. Die Demokratie ist also »demokratischer« geworden, sie hat sich demokratisiert (siehe dazu die Abschnitte I.1 und I.2).
Zugleich scheint sie auch als Legitimationsprinzip unumstrittener denn je. Ihre institutionelle Umsetzung ist heute in vielen Ländern umfassender gewährleistet als jemals zuvor. Die Unterdrückung der Opposition, die Einschränkung des aktiven wie passiven Wahlrechts nach Einkommen, Steuerbeitrag, Lesevermögen, Geschlecht, Hautfarbe, Beruf oder anderen Kriterien, indirekte und/oder nichtgeheime (Elster 2015; Przeworski 2015) oder sonst wie manipulierte Wahlen, nichtgewählte Zweite Kammern mit Vetomöglichkeiten gegenüber der Ersten, Monarchen oder Militärräte mit politischen Mitspracherechten etc.: Die zahlreichen praktischen und institutionellen Einschränkungen, gegen die das demokratische Gleichheitsprinzip seit mehr als 200 Jahren zu kämpfen hat, sind in vielen Ländern Schritt für Schritt abgebaut worden (Przeworski 2018, Kap. 3). Und selbst Autokratien – ob das Putins Russland ist, die iranische Theokratie oder Erdoğans Türkei – haben Schwierigkeiten, die Abhaltung von Wahlen zu vermeiden oder das Ergebnis von Wahlen zu ignorieren bzw. zu annullieren: »Die prinzipielle Ablehnung von Wahlen ist zur reinen Minderheitenposition geworden.« (Dunn 2006, S. 131) Einmal gewährt, entwickeln demokratische Freiheiten zudem ein extrem hohes Suchtpotenzial – wie sich aktuell etwa an der enormen Erbitterung zeigt, mit der Hongkongs Bürger ihre politischen Rechte gegen die ausgreifende Unterdrückungsmaschinerie Chinas verteidigen. Das alles spricht also nicht unbedingt für eine Krise der Demokratie – weder als grundlegendes Legitimationsprinzip noch als etablierte Praxis und institutionelles Arrangement gesellschaftlicher Ordnung. Die noch kürzlich allgemein getroffenen Einschätzungen, dass es nun weltweit keine legitime Alternative zur Demokratie als politischer Herrschaftsform mehr gäbe,5 haben sich ja nicht plötzlich, wie über Nacht, alle als falsch erwiesen.
Es ist aber andererseits nicht zu übersehen, dass sich Befunde eines backsliding und einer democratic recession häufen, uns in wachsender Zahl Berichte über die zunehmende Einschränkung demokratischer Freiheitsrechte und über den Rückfall in autoritäre Verhältnisse und politische Repression erreichen (Diamond 2015; siehe aber Levitsky/Way 2015): Polen, Ungarn, die Türkei, die Philippinen unter Duterte, Brasilien unter Bolsonaro, Venezuela unter Maduro, Indien unter Modi, die USA unter Trump etc. Es sind vor allem diese beunruhigenden Nachrichten, die sich zum generellen Eindruck einer aktuellen Gefährdung der Demokratie verdichtet haben. Der aktuelle Bericht der Nichtregierungsorganisation Freedom House konstatiert: »Die Demokratie ist auf dem Rückzug« (Freedom House 2019).6 Bei näherer Betrachtung steht aber im Zentrum dieser Entwicklungen ein paradoxer Befund, nämlich der, dass der Demokratie vor allem von der Demokratie Gefahr zu drohen scheint, weil sie immer häufiger »im Namen der Demokratie« angegriffen wird. Denn auch wenn die neuen populistischen Bewegungen und die neuen populistischen Führerfiguren vieles infrage stellen – die Demokratie nun meistens gerade nicht. Ganz im Gegenteil: Sie geben vor, in ihrem Namen anzutreten, und da genau das in einer breiten Öffentlichkeit als Gefährdung der Demokratie wahrgenommen wird, befinden wir uns in der paradoxen Lage, Krise und Nicht-Krise der Demokratie als gleichzeitige Ereignisse konstatieren zu müssen.7 Eine Lage, die es näher aufzuklären gilt.
Tatsächlich war es ja genau dieses demokratische Bekenntnis der Populisten, das den niederländischen Politikwissenschaftler Cas Mudde dazu bewog, die neuen rechtspopulistischen Parteien in einem einflussreichen Beitrag von den alten rechtsextremen, neofaschistischen Antisystemparteien abzugrenzen, die es natürlich immer gegeben hat und die es vermutlich immer geben wird (Mudde 2007, vgl. auch Mudde 2010). Dasselbe trifft für den Linkspopulismus zu, der ja auch – anders als die orthodoxe Linke früher – keine Diktatur des Proletariats mehr errichten will, sondern sich vielmehr die grundsätzliche Korrektur eines, aus seiner Sicht, plutokratisch verfälschten Systems zum Ziel genommen hat, der vielleicht die Abschaffung des Kapitalismus befürwortet, aber eben nicht die Abschaffung der Demokratie.8
Diese Referenz der Populisten auf eine angeblich »wahre« und momentan »vom politischen Establishment« verfälschte Demokratie ist also ein zentraler Teil der Definition dessen, um was es geht:
Es ist bemerkenswert, dass im frühen 20. Jahrhundert Nationalismus und Sozialismus Erscheinungsformen eines antidemokratischen Extremismus waren, während zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Populisten zumeist demokratisch, aber antiliberal sind. Daran zeigt sich zumindest, dass die Demokratie (Volkssouveränität und das Mehrheitsprinzip) nun hegemonial ist, während das für die liberale Demokratie – die Minderheitenschutz, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung hinzufügt – nicht gilt. (Mudde 2018)
Die neuen populistischen Parteien sind sicherlich antiinstitutionell, im Regelfall Gegner der repräsentativen Demokratie, sie sind aber eben nicht antidemokratisch (vgl. Moulin-Doos 2017; Przeworski 2019, S. 134f.) – beziehungsweise müssten diejenigen, die ein solches Urteil fällen, sehr viel präziser angeben, wo und wie genau der beständige Appell an die Volkssouveränität eigentlich ins Antidemokratische kippt. Nicht zuletzt wird man dem Umstand Rechnung tragen müssen, dass die Populisten gewählt und häufig sogar wiedergewählt werden. Dabei lässt sich kaum überzeugend argumentieren, hier handele es sich jeweils um demokratische Mehrheiten, die den Auftrag zur Abschaffung der Demokratie erteilt hätten – also um Selbstentmündigungsmehrheiten. In der letzten Welle des World Value Survey (2010-2014) gaben in den USA lediglich 1,1 Prozent der Befragten an, Demokratie sei »absolut unwichtig«, 60,6 Prozent halten sie dagegen für »sehr« oder »absolut wichtig«.9 Wie wollte man da die 46,1 Prozent der Stimmen, die Trump 2016 erhielt, als Mandat für die Zerstörung der Demokratie verstehen? Zugleich ist es sowohl methodisch wie demokratietheoretisch problematisch, eine ganz spezifische Wählerschaft für systematisch getäuscht, verführt, letztlich unzurechnungsfähig und/oder grundlegend moralisch defizient zu erklären.
Das Argument, eine »illiberale Demokratie« (Viktor Orbán) sei überhaupt keine Demokratie, ist sehr überzeugend (Müller 2019, S. 122-136). Aber das Argument, dass der Liberalismus in vielen seiner heutigen Ausprägungen undemokratisch geworden ist, ist es nicht weniger. Wir müssen beides betrachten, wenn wir von der Krise der Demokratie sprechen, sowohl »dass gewisse vermeintlich demokratische Kräfte die Rechtsstaatlichkeit untergraben« wie auch dass »gleichzeitig gewisse vermeintlich liberale Kräfte die Volkssouveränität aushöhlen« (Mor 2019, S. 69). Beide Entwicklungen müssen in den Blick genommen werden, nicht aus Gründen irgendeiner Ausgewogenheit, sondern weil sie offensichtlich unabhängig voneinander nicht zu verstehen sind. Denn es scheint plausibel, im Populismus »im Wesentlichen eine illiberale demokratische Antwort auf undemokratischen Liberalismus« zu sehen (Mudde/Kaltwasser 2019, S. 172; vgl. Mounk 2018). Es ist kein Relativismus, kein irregeleiteter bothsideism, wenn man konzediert, dass jeweils ein tatsächliches Demokratieproblem angesprochen ist. Die Lager zeigen – mit einer gewissen Berechtigung – auf die Fehlentwicklungen der Gegenseite, um ihre eigene Agenda zu legitimieren: »Demokratur« à la Orbán auf der einen versus postpolitische Juristokratie auf der anderen Seite.10 Dabei bezieht man sich dann auch, meist implizit, auf unterschiedliche Demokratiedefinitionen. Umso dringender erscheint der Bedarf nach einer Politischen Theorie des Populismus, einer Demokratietheorie des Populismus.
Aber selbst wenn der gegenwärtige Konflikt vor dem Hintergrund des bekannten Spannungsverhältnisses zwischen Liberalismus und Volkssouveränität interpretiert (vgl. Mouffe 2018 [2000]) und nicht einfach nur als Konflikt zwischen Demokraten und Antidemokraten simplifiziert wird, bliebe zu klären, wie dieses ja nun nicht neue Spannungsverhältnis sich zuletzt in einen so fundamentalen Konflikt verwandeln konnte. Hier setzt die Demokratisierungsthese an: Sie behauptet, dass die Krise der Repräsentation eine andere, instabilere Form von Demokratie freisetzt. Das ist eine Frage, die sich für die Demokratie seit 1789 immer wieder gestellt hat und die immer nur temporär beantwortet werden konnte: ob und wie die demokratische Revolution die von ihr ausgelöste politische Dynamik wieder einzufangen vermag. Repräsentation war eine solche Einhegung, sie selbst ist aber eine »labile Formel«, die mal eher »oligarchisch«, mal eher »populär« ausformuliert werden kann (Gauchet 1991, S. 24). Das Verhältnis von Volkssouveränität und Liberalismus ist daher abhängig von unterschiedlichen Beschleunigungsraten und Hitzegraden der Politik aufgrund des unterschiedlichen Ausmaßes ihrer institutionellen Zähmung.
Repräsentation als Prinzip bedarf einer Repräsentation als Praxis – und die ist offenkundig in der Krise. Einerseits scheint ein vehementer demokratischer Impuls gegen die zunehmende Substitution von Politik durch Recht aufzubegehren, dagegen, dass eine Rhetorik der Rechte bestimmte gesellschaftliche Interessen von den Unwägbarkeiten der Demokratie abzuschirmen sucht (Hirschl 2007). Diese zunehmende Substitution ist zugleich selber ein wichtiger Grund für die Entwertung kollektiver Organisationsformen des Politischen. Andererseits ist der Bedeutungsgewinn des Rechts wohl auch gerade als Versuch zur Eindämmung einer demokratischeren Demokratie zu verstehen. Ein Unterschied zu gängigen Deutungen der gegenwärtigen Lage würde darin liegen, dass der Liberalismus in dieser Lesart nicht nur als passives, selbst ganz bewegungsloses und weitgehend unschuldiges Opfer einer Bedrohung durch wundersam wiedererstarkte und dabei in ihrer Herkunft reichlich ominös bleibende »illiberale Kräfte« erscheinen würde. Es ist nicht nur so, dass ein neuer, roher demokratischer Impuls den Liberalismus bedroht (vgl. Jörke/Nachtwey 2017; Krastev/Holmes 2019; Müller 2019; Zielonka 2019), sondern dass zugleich ein expansiver Liberalismus die Demokratie substantiell beschränkt (vgl. Chamayou 2019; Slobodian 2019; Mounk 2018) oder gar »zerstört« (Brown 2015) und dass das eine Phänomen ohne das andere wohl nicht zu verstehen ist.
Das leitet über zur zweiten Diagnose, der einer Entdemokratisierung der Demokratie (siehe unten Teil II). Sie mündet in die These, dass der grundsätzliche Konflikt, der unsere Zeit zu charakterisieren scheint, auch als paradoxe Folge der alternativlosen Durchsetzung der Demokratie zu verstehen ist. Sie hat zum Wiedereintritt der Unterscheidung demokratisch/undemokratisch in die demokratische Auseinandersetzung selbst geführt. Was vorher das Außenverhältnis der Demokratie bestimmte – und sie dadurch stabilisierte –, nämlich die Abgrenzung zur Nicht-Demokratie, tritt in der Gegenwart in ihrem Binnenverhältnis wieder auf und destabilisiert sie, weil nun die Vorstellung um sich greift, die Antidemokraten seien nicht die anderen, sondern mitten unter uns. Vormalige Reibungswärme wird nun zu »innerer Hitze«. Die Krise der Repräsentation, also der Funktions- und Legitimationsverlust bewährter Artikulations- und Repräsentationsinstanzen (der politischen Parteien, der Parlamente, der Presse) hat diesen Re-entry befördert, der den politischen Streit zunehmend von einem Streit innerhalb der Demokratie zu einem über die Demokratie hat werden lassen. Ein solcher Streit ist aber demokratisch kaum zu führen, nicht zuletzt deswegen, weil sich beide Seiten gleichermaßen auf die Demokratie, wenn auch auf ganz unterschiedliche Konzeptionen von ihr, berufen. Unter diesen Voraussetzungen setzt der Streit über die Demokratie zwangsläufig Dynamiken der »Feindschaft« zulasten von historischen Errungenschaften der »Gegnerschaft« frei. Diese Dynamiken unterminieren den Gleichheitsanspruch der Demokratie als zentrale Prämisse des friedlichen politischen Konflikts. Damit aber führen die wechselseitigen Beschuldigungen, führt der gegenseitige argumentative Ausschluss zu einer wirklichen Krise der Demokratie. Das wirkt insbesondere deswegen so zerstörerisch, weil – und das ist der zweite Aspekt der Entdemokratisierungsdiagnose – der entscheidende Referenzrahmen, in Bezug auf den sich demokratische Gleichheit einfordern und begründen lässt, in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung verloren hat: der Staat und die Infrastruktur seiner Institutionen.
Das läuft also auf widersprüchliche Befunde hinaus: Nicht-Krise und Krise der Demokratie, Demokratisierung und zugleich Entdemokratisierung der Demokratie – eine Widersprüchlichkeit, die nicht nur auf unterschiedliche Verwendungsweisen des Demokratiebegriffs zurückzuführen ist, sondern vor allem auch auf die unterschiedlichen politischen Agenden, die hinter den Selbstverständlichkeiten der Begriffsverwendung stecken. Handelt es sich bei der Demokratie um ein grundlegendes Legitimationsprinzip (»Volkssouveränität«) oder um ein bestimmtes institutionelles Ensemble (»verantwortliche Regierung«; Tuck 2015, siehe unten Abschnitt I.1)? Geht es um einen umfassenden Wertekatalog oder nur um eine simple Entscheidungsregel (Dunn 2006)? Unsere paradoxe Situation sieht die Demokratie gegen die Demokratie antreten, die direkte gegen die repräsentative Demokratie, die »illiberale« gegen die liberale Demokratie, vielleicht auch: »the people vs. democracy«. So plausibel und einleuchtend es ist, den Konflikt mit diesen Begriffen zu beschreiben, so wenig sind wir doch in der Lage, seine Ursachen zu verstehen, solange wir uns nicht den Gründen zuwenden, warum und in welcher Hinsicht eigentlich die hergebrachten demokratischen Repräsentationsverfahren in die Krise geraten sind (siehe unten Abschnitt I.2).
Denn in der Demokratie ist der Erfolg des einen Lagers das Versagen des anderen. Das Erstarken der Ränder ist das Versagen der Mitte, der Erfolg der Antidemokraten das Versagen der Demokraten. Wie man es auch dreht und wendet, der Punkt bleibt derselbe – pointiert formuliert: Die Populisten sind nicht das Problem der repräsentativen Demokratie. Sie zeigen nur an, dass sie eines hat. »Don't shoot the messenger«, formulierte einst eine politische Weisheitslehre. Momentan scheinen sich jedoch alle auf den Überbringer der schlechten Nachricht einzuschießen. So richtig und wichtig das politisch auch sein mag, so sollte doch die Nachricht selber darüber nicht vergessen werden. Sie lautet: Die Demokratie, wie wir sie bislang kannten, funktioniert nicht mehr richtig – »andernfalls gäbe es keine populistische Gegenbewegung« (Runciman 2020, S. 72). Man wird die (repräsentative) Demokratie gegen ihre Herausforderer schlecht verteidigen können, wenn man ihre gegenwärtigen Schwächen nicht thematisiert, weil man sich darin eingerichtet hat, Ursache und Folge zu verwechseln.
Die Entdemokratisierung der Demokratie ist also nur eine andere Betrachtungsweise der Demokratisierung der Demokratie. Ich skizziere im Folgenden, was ich unter diesen beiden Prozessen verstehe, und beginne mit derjenigen Diagnose, die angesichts der zahlreichen Postdemokratie- oder »End of democracy«-Befunde, die in der letzten Zeit formuliert worden sind (Crouch 2008; Guéhenno 1998; Levitsky/Ziblatt 2018; Runciman 2020),11 überraschend klingen mag, nämlich mit der These, dass wir es gegenwärtig mit einer Demokratisierung der Demokratie zu tun haben. Entwickelt wird diese These im ersten Schritt anhand der Rekonstruktion der Debatte des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts über die – politische und ökonomische – Rolle des Pöbels (Abschnitt I.1). Diese Rekonstruktion soll veranschaulichen, dass Repräsentation zunächst insbesondere Exklusion bedeutete – und die gegenwärtige Krise der Repräsentation mithin den Zusammenbruch bisheriger Ausschlussmechanismen mit sich bringt. Anschließend schildere ich, wie die Krise einer zentralen Repräsentationsinstanz, die der politischen Partei, sich in eine Krise der repräsentativen Demokratie als solcher übersetzt (Abschnitt I.2). Man kann diesen ersten Teil unter die Überschrift »Aufstieg und Niedergang der politischen Repräsentation« stellen.
Um Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich gleich zu Beginn betonen, dass die Demokratisierungsthese ohne jede Wertung ist – eine »demokratischere« Demokratie wird hier nicht als per se als »bessere« Demokratie verstanden, schon gar nicht als eine besser funktionierende Demokratie. Der Begriff der Demokratisierung ist im Folgenden rein analytisch, nicht normativ gemeint. Er bezeichnet schlicht die Ausweitung von Partizipationschancen bzw. den Kollaps tradierter Exklusionsmechanismen.12
Was dann im daran anschließenden Teil den Prozess der Entdemokratisierung der Demokratie anbetrifft, so betone ich zunächst in Abschnitt II.1 die negativen Folgen, die sich ergeben, wenn die Unterscheidung demokratisch/undemokratisch in die demokratische Auseinandersetzung zurückgespeist wird – als paradoxe Folge des Sieges der Demokratie über alle alternativen Formen der Herrschaftslegitimation. Schließlich argumentiere ich in Abschnitt II.2, dass die Demokratie antiuniversalistisch ist und sein muss beziehungsweise dass der Universalismus antidemokratisch ist und sein muss. Und auch darin kann eine gegenwärtige Tendenz zur Selbstzerstörung der Demokratie gesehen werden, nämlich dass der demokratische Impuls die Politik andauernd über ihre staatliche Form hinaustreiben will.