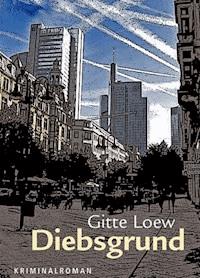
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die Handlung des Kriminalromans Diebsgrund beruht auf wahren Verbrechen. Der Russland-Deutsche Valentin reist mit vielen Hoffnungen in die BRD ein. Die anfängliche Freude trübt sich im Laufe der Zeit, da er nicht das erreichen kann, was er sich ursprünglich vorgeststellt hat. Er ist zu ungeduldig und nicht bereit, aus seinen Fehlern zu lernen. Im Gefängnis kommt er in Kontakt mit anderen Straftätern und Drogen, die er zuvor nicht kannte. Der Roman besteht aus realen Fakten und Fiktionen, um den Täter und seine Geschichte besser verstehen zu können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diebsgrund
Ein Kriminalroman nach einer wahren Begebenheit
von
Gitte Loew
1. Prolog
Die alte Lok fuhr in den Bahnhof von Barnaul ein. Die Wärme der Maschinen verwandelte die kalte Luft in Dunst, der langsam aufstieg. Auf dem Bahnsteig hatten sich zahlreiche Menschen versammelt. Ein lautes Stimmengewirr hing über der Menschenmenge. Frauen trugen ihre Säuglinge auf dem Arm, während ältere Kinder fröhlich zwischen den vielen Koffern und Kisten umhersprangen.
Valentin sah zu seiner Frau Greta hinüber. Sie hatte die Arme um den Hals ihrer Mutter geschlungen. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Der Schwiegervater stand mit undurchdringlicher Miene am Zug. Er hielt den kleinen Peter an der Hand. Valentin seufzte. Die Zeit drängte. Valentin ging auf die Mutter zu, zog sie wortlos von den Verwandten weg, die sich zum Abschied versammelt hatten. Er half ihr beim Einsteigen. Dann sprang er wieder ins Freie und begann die vielen Koffer ins Innere des Zuges zu tragen. Schon nach kurzer Zeit bildeten sich Schweißtropfen auf seiner Stirn, die er ärgerlich wegwischte. Sie hatten zu viel Gepäck.
Als er wieder auf dem Bahnsteig stand, riss er Greta vom Arm ihrer Mutter los. Sie schluchzte laut auf, aber Valentin schob sie energisch zwischen den Menschen hindurch zur Tür. Der Schwiegervater folgte ihm. Er hob den kleinen Peter über die Stufen hinweg in den Zug. Im Zugabteil versuchten Reisende die Fenster zu öffnen, aber sie waren eingerostet. Greta stand weinend am Fenster und winkte nach draußen.
Valentin sammelte derweilen die restlichen Gepäckstücke ein. Nachdem er mit der letzten Kiste ins Abteil zurückkehrte, ließ er sich erschöpft in seinen Sitz fallen. Er atmete schwer. Sie mussten noch dreimal mit all dem Gepäck umsteigen. Die Reise dauerte vier Tage. Zwischen Barnaul und Berlin liegen ungefähr 4500 Kilometer. Plötzlich ruckte der Waggon, der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Er sah aus dem Fenster. Menschen standen auf dem Bahnsteig und winkten zum Abschied. Die Lok beschleunigte ihre Fahrt. Die Landschaft flog immer schneller vorüber. Valentin fühlte sich müde und schloss die Augen.
2. Kapitel
Drei Jahre später
Valentin stand ungeduldig an der Tür. Als der Zug endlich anhielt, sprang er erleichtert ins Freie. Er brauchte dringend einen Druck, denn seine Hände flatterten bereits. Mit zittrigen Fingern zündete er sich eine Zigarette an. Die Fahrt mit dem Nachtzug von Berlin nach Frankfurt dauerte einfach zu lange. Es wurde von Zeit zu Zeit behauptet, dass man in Frankfurt günstiger als anderswo Stoff kaufen könnte. Vermutlich war das alles nur Gerede, aber jeder Junkie ist gierig auf solche Nachrichten und will es glauben.
Eine Menge Touristen und Rentner standen auf dem Bahnsteig herum und hielten Ausschau nach Angehörigen. Hinzu kamen viele Pendler, die vom Bahnhof aus über die Kaiserstraße zu ihren Arbeitsplätzen in der City hasteten. Valentin versuchte, in der dichten Menschenmenge voranzukommen. Er verschwand im Strom der Reisenden durch den Haupteingang des Bahnhofs.
Als er auf dem Bahnhofsvorplatz stand, hob er geblendet vom Licht die Hand vor die Augen. Im Dunst der aufgehenden Sonne spiegelten sich die silbrig glänzenden Hochhäuser des nahen Bankenviertels. Wer hier arbeitete, hatte vermutlich keine Geldprobleme. Gut gekleidete Menschen überholten ihn mit schnellen und energischen Schritten. Sie eilten mit hocherhobenen Köpfen ihren Geschäften entgegen.
Valentins Deals waren ganz anderer Art. Durch seine abgetragene und schmutzige Kleidung sah man ihm schon von Weitem an, was mit ihm los war. Er stolperte achtlos an jungen Frauen vorüber, die an Hauswände gelehnt ihre Körper zu Spottpreisen anboten. Dazwischen eilten Männer mit stierem Blick durch die Straßen. Bei seinem letzten Besuch in Frankfurt hatte er beobachtet, wie die Polizei das elende Volk am Bahnhof kontrollierte und in alle Winde zerstreute. So wie die Stadtreinigung das Unkraut am Straßenrand entfernen ließ. Derweilen amüsierten sich andere in einem der vielen Etablissements des Rotlichtviertels.
Valentin wischte sich mit der Hand über die feuchte Stirn. Er blieb einen Moment stehen und blickte ratlos den vorbeieilenden Gestalten nach. Er war momentan pleite und hielt Ausschau nach einem Mann, der ihm manchmal Geschäfte vermittelte. Zu Anfang seiner Drogenkarriere wollte er die Geschichten vom besseren Preis glauben. Mittlerweile war er schlauer geworden und wusste, dass nicht nur der Preis zählte, sondern die guten Verbindungen.
Angefangen hatte alles im Knast. Er brauchte damals das Dope, um dem Albtraum des Knasts für einige Zeit entkommen zu können. Zu Beginn schluckte er Pillen, später brauchte er harte Drogen, damit sein Kopf endlich Ruhe gab. Durch die Tabletten verschwand auch die Angst, die im Gefängnis überall lauerte. Er lernte schnell, dass zwischen den Gefangenen ein ungeschriebenes Gesetz existierte. Da er klein und schmächtig war, machte er schon nach kurzer Zeit die Bekanntschaft der Schläger. Die Kerle waren für ihn nichts Neues, denn die gab es überall. In Russland versuchte man ihnen aus dem Weg zu gehen, im Gefängnis war das unmöglich.
Seit seiner Entlassung aus der Haft pendelte Valentin zwischen den Großstädten ruhelos hin und her. Dabei spielte es keine Rolle, ob er sich im Süden oder Norden des Landes aufhielt, denn alle Orte blieben ihm gleich fremd. Als sie wieder einmal in Berlin davon quatschten, dass es in Frankfurt billigeren Stoff geben würde, hatte er sich auf den Weg gemacht. Vermutlich war alles nur Geschwätz, aber die Hoffnung starb bekanntlich zuletzt. Ein weiterer Grund, nach Frankfurt zu kommen, war eine frühere Freundin, die im Gallus-Viertel wohnte und ihn hin und wieder in ihrer Wohnung übernachten ließ.
Valentin hielt inne, denn er konnte Olli nirgendwo entdecken. Es würde besser sein, zuerst einmal zu Annemarie zu gehen. Er lief zurück in Richtung Poststraße. Überall versperrten Gitter und Bretterwände der Großbaustellen das Areal. An einer Straßenecke stand ein großes Schild, auf dem für ein neues Wohngebiet geworben wurde. Für ihn war das unwichtig, er konnte sich sowieso keine eigene Wohnung leisten.
In wenigen Minuten erreichte er das Haus in der Niddastraße. Die Fenster zu Annemaries Wohnung waren geschlossen. Das bedeute erst mal nicht viel. Sie konnte wegen des Lärms der ein- und ausfahrenden Züge die Fenster nur zum Lüften öffnen. Valentin klingelte, aber es rührte sich nichts. Er versuchte es noch einmal. Vergeblich. Verdammt, so früh am Morgen, wo konnte sie nur stecken? Nachdem auf sein drittes Läuten niemand öffnete, wandte er sich wütend ab und schlug den Weg zurück zum Bahnhof ein.
Er eilte durch die Eingangshalle, zwischen den Reisenden hindurch und nahm mit wenigen großen Schritten die Rolltreppe direkt ins Tiefgeschoss zur B-Ebene. Um diese Zeit war hier viel los. Menschen eilten zur Arbeit, und Touristen schleppten ihre Koffer von Bahnsteig zu Bahnsteig. Überall schlichen die Typen von der Bahnpolizei in Begleitung ihrer Schäferhunde herum. Als wäre das nicht schon genug, tauchten auch noch die Uniformierten vom Sicherheitsdienst auf. Diese Bande hatte es früher nicht gegeben. Valentin spuckte verächtlich auf den Boden und blickte sich unruhig um, konnte aber kein vertrautes Gesicht entdecken. Dann flitzte er die Rolltreppe zum Kaisersack hoch und hoffte, dort auf seinen früheren Kumpel zu treffen.
Die Kaiserstraße endet vor dem Bahnhof als jene Sackgasse, in der sich seit Jahren die Drogenszene in Frankfurt traf. Frauen, die alt aussahen, obwohl sie vermutlich noch jung waren und Männer, die mit starren Augen in die Ferne blickten. Zwischen all diesen Typen wankten Gestalten umher, bei deren Anblick jeder sah, dass sie es nicht mehr lange machen würden. Wenn es in Frankfurt einen Platz gab, wo der Tod zum Leben gehörte, dann war er hier im Kaisersack. Valentin wandte sich enttäuscht ab. Der Mann, den er suchte, war verdammt noch mal nirgends zu sehen.
Er spürte, dass seine Hände feucht wurden. Hastig fingerte er nach dem Rezept in seiner Hemdtasche und zog es heraus. Es war riskant das Rezept ausgerechnet in Frankfurt vorzulegen, wo falsche Verschreibungen zuhauf in Umlauf waren. Doch ihm brach allmählich der Schweiß aus und sein Hemd klebte am Rücken. Es gab für ihn keinen anderen Ausweg. Mit erhobenem Kopf steuerte er auf die Apotheke in der Kaiserstraße zu.
So früh am Morgen waren nur wenige Kunden im Laden. Er legte das Rezept mit einem erzwungenen Lächeln auf die Verkaufstheke. Die Angestellte sah ihn prüfend an, dann kamen aus ihrem Mund die gefürchteten Worte:
„Einen Moment bitte!“, sie nahm das Rezept und verschwand mit dem Papier in der Hand in die hinteren Räume der Apotheke.
Es dauerte eine Weile. Valentin trat nervös von einem Fuß auf den anderen. Das bedeutete nichts Gutes. Als die Frau in Begleitung eines älteren Mannes zurückkehrte, war ihm sofort alles klar. Er drehte sich blitzschnell um und rannte aus dem Geschäft. Sah zu, dass er wegkam und hetzte in eine der Nebenstraßen. Atemlos drückte er sich in den Eingang eines Nachtklubs und blieb einen Moment stehen, um Luft zu holen.
„Na Kleiner, hast du schon so früh am Morgen Lust?“, gurrte eine dunkle Stimme hinter ihm.
Valentin drehte sich um und sah in das stark geschminkte Gesicht einer Frau.
Als sie erkannte, wen sie vor sich hatte, zischte sie ihm aus verkniffenem Mund zu: „Hau ab, du Junkie, für Hungerleider haben wir keine Zeit!“, und schubste ihn unsanft auf die Straße.
Valentin war zu erschöpft, um sich zur Wehr setzen zu können und murmelte nur matt: „Alte Fregatte.“
Doch die Frau hatte das Schimpfwort gehört, hob blitzschnell den Fuß und trat ihm heftig vors Schienbein. Er schrie vor Schmerz auf, drehte sich entsetzt um und humpelte hastig davon. Keuchend stolperte er die Straße entlang und fand schließlich Zuflucht in einer der zahlreichen Kneipen des Viertels. Er steuerte, ohne sich weiter umzusehen, auf den Tresen zu und bestellte einen Doppelten. Der Alkohol brannte in seiner Kehle und verbreitete für einen kurzen Augenblick ein wärmendes Gefühl im Magen. Wann hatte er zuletzt etwas gegessen? Er konnte sich nicht erinnern. Zwei Betrunkene neben ihm stritten lauthals.
„Sie hat mich betrogen, das Luder, und dann habe ich ihr gezeigt, wer der Herr im Haus ist. War doch richtig?“, brüllte er in das voll besetzte Lokal.
Sein Saufkumpan antwortete nicht, sondern schüttelte den Kopf und grölte dabei: „Noch einen, Willi!“
Der Wirt sah die beiden an. Nicht mehr lange und die würden für Ärger sorgen. Kurz angebunden meinte er: „Ihr habt genug, sonst zeige ich euch, wer die Hosen anhat.“
Die Säufer erhoben sich von ihren Sitzen und protestierten lauthals. Als ein Stuhl mit Getöse umflog, warf Valentin das Geld auf den Tisch und verdrückte sich. Schwitzend irrte er durch die Straßen und stand plötzlich vor dem Café Fix, das er von einem früheren Besuch in Frankfurt kannte. Zwei Männer und eine Frau drückten sich vor dem Eingang herum.
„He, was geht ab?“, wollte Valentin wissen.
Die Frau hob den Kopf und blickte ihn aus rot entzündeten Augen an. Dann öffnete sie den Mund, in dem eine Kippe klebte und murmelte:
„Hier brauchst du einen Ausweis, sonst kriegst du nichts, bist wohl nicht von hier?“
„Ich weiß“, meinte Valentin ungeduldig, „aber ich brauch dringend was.“
„Hast du Kohle?“, wollte die Frau wissen.
„Nein, aber mir geht es echt scheiße!“
Die Frau warf ihm einen bösen Blick.
„Glaubst du mir geht’s besser?“, sie schüttelte den Kopf und murmelte mit leiser Stimme: „In der B-Ebene gibt‘s Pillen und die Stricher sind auch nicht weit!“
Nach diesen Worten drehte sie ihm wieder den Rücken zu. Valentin wimmerte leise und stolperte zum Hauptbahnhof zurück. Es war zu gefährlich, sich im Tiefgeschoss aufzuhalten. Die vom Sicherheitsdienst schossen wie Giftpilze aus allen Ecken des alten Gemäuers. Er schlich nass geschwitzt weiter in Richtung Kasseler Straße. Dort beobachtete er kurze Zeit das Treiben auf dem Parkplatz. Hier traf sich ein weiterer Teil der Szene. Ihm fielen zwei Afrikaner auf, die sich angeregt unterhielten. Sie lachten laut und klatschten ebenso geräuschvoll ihre Hände aufeinander. Valentin ging auf die beiden zu. Einer der Männer sah sich um, nickte kaum merklich und rannte davon. Der andere Kerl hatte Locken, die bis zu den Schultern reichten und trug einen buntgestreiften Pullover. Er erwiderte Valentins Blick und grinste ihn stumm an.
„Wie sieht’s aus?“, wollte Valentin wissen.
Der Mann zog die Stirn in Falten und betrachtete ihn jetzt misstrauisch und sagte: „Alter, ich bin der Weihnachtsmann!“
„Mach kein Theater! Hast du Stoff?“
Valentin war für solche Spielchen zu erschöpft.
„Hast du Kohle?“, kam prompt die Gegenfrage, und dabei tänzelte der Kerl von einem auf den anderen Fuß.
Valentin nickte verzweifelt. Er war kurz davor umzufallen.
Der Afrikaner flüsterte: „Crack oder Pillen?“
Valentin deutete auf das Päckchen und kaufte die billigeren Tabletten. Er hastete zum Bahnhof, besorgte sich einen Flachmann am Kiosk und spülte den Inhalt der Schachtel mit dem Schnaps hinunter. Endlich, er atmete erleichtert auf. Allein die Gewissheit, das Zeug geschluckt zu haben, beruhigte ihn schon. Er wusste allerdings aus Erfahrung, dass er sich nun schnellstens nach einem Platz zum Schlafen umsehen musste. Im Zug hatte er kaum ein Auge zugetan, und mittlerweile spürte er seine müden Glieder, die immer schwerer wurden. Vermutlich würde er sich nicht mehr lange auf den Beinen halten können. Die Mixtur aus Tabletten und Alkohol wirkte wie ein Brandbeschleuniger und brachte selbst den Stärksten zum Umfallen. Das Zeug zwang einen buchstäblich in die Knie.
Er humpelte hinter das Bahnhofsgelände und suchte am Rand der vielen Baustellen nach einem geeigneten Platz. Der größte Teil des Geländes war eingezäunt und mit Schlössern gesichert. In den wenigen freien Ecken lagen bereits andere Obdachlose.
Als er sich einer solchen Behausung näherte, schimpfte jemand laut: „Hau ab du Penner!“ Valentin stolperte schachmatt zum Bahnhof zurück und betrat das Gleisgelände. Es war verboten und man musste aufpassen, nicht von der Aufsicht erwischt zu werden. Vor lauter Hektik taumelte er über ein Kabelbündel und flog der Länge nach hin. Mühsam rappelte er sich wieder hoch und fand dann endlich einen alten Güterwagen, der mehr oder weniger ungenutzt herumstand. Bevor er einstieg, schaute er sich nochmals prüfend um. Mit letzter Kraft kroch er in das dunkle Loch. Versuchte in dem diffusen Licht zu erkennen, ob schon ein anderer hier lag, aber der Wagen schien leer zu sein. Erschöpft ließ er sich in eine Ecke fallen, legte seinen Rucksack unter den Kopf und sank sofort in einen tiefen Schlaf.
3. Kapitel
Das Piepsen der Mäuse weckte Valentin wieder auf. Er fühlte, wie die kleinen pelzigen Tiere an ihm vorbeihuschten. Es war jetzt dunkel draußen. Sein Kopf fühlte sich schwer wie Blei an, und seine Knochen waren durch die Kühle des Abends steif geworden. Schwerfällig richtete er sich auf und versuchte, auf die Füße zu kommen. Und dann sah er es. Wo waren seine Schuhe? Seine Schuhe waren verschwunden. Irgend so ein Tippelbruder hatte ihm im Schlaf die Schuhe geklaut. Es hatte wohl noch ein anderer Unbekannter im Waggon geschlafen. Wie fertig musste er gewesen sein, dass er nicht wach geworden war? Na warte, wenn er den Kerl zu fassen bekam. Valentin fluchte leise vor sich hin, denn auf Strümpfen würde er nicht weit laufen können.
Er kletterte aus dem Güterwagen, spürte die nasse Erde unter den Füßen und tappte vorsichtig zwischen Baustellenschutt und Schotter zum Bahnhof zurück. Als er im Licht der Bahnhofshalle stand, blickte er auf die Anzeige. Es war mittlerweile 22 Uhr. So konnte er nicht weiterlaufen. Es gab nur noch eine Möglichkeit, Annemarie musste ihm unbedingt helfen. Frierend und zitternd machte er sich an diesem Tag zum zweiten Mal auf den Weg zu ihrer Wohnung.
Bis er endlich an ihrer Haustür stand, schmerzten seine Fußsohlen von all den spitzen Steinen und seine Socken waren völlig durchnässt. Zum Glück brannte ein Licht hinter ihrem Fenster. Auf sein Klingeln ertönte der Türsummer und er fiel vor Erleichterung ins Treppenhaus. Langsam erklomm er die Stufen bis in den zweiten Stock. Als Annemarie ihn sah, hob sie die Hand vor den Mund und rief erschrocken:
„Ach nein, wo kommst du denn her? Mann, wie du aussiehst!" Sie wich unwillkürlich vor ihm zurück.
Valentin begann stotternd zu erzählen: „Sie haben mir im Schlaf die Schuhe geklaut. Ich kann nicht mehr.“
„Warum immer ich? Geh doch zur Bahnhofsmission", schimpfte sie und wandte sich angewidert ab.
Jetzt sank Valentin völlig in sich zusammen, fiel wie ein Häufchen Elend auf den Boden und wimmerte leise vor sich hin: „Ich kann nicht mehr, hilf mir, ich bin völlig fertig.“
Annemarie trat widerwillig zur Seite und flüsterte: „Komm herein, aber nur für eine Nacht.“
Valentin kroch ihr auf allen vieren nach und blieb vor Erschöpfung im Flur liegen. Schnell schloss sie die Wohnungstür hinter ihm, um die neugierigen Blicke der Nachbarn, die womöglich hinter den Türen lauerten, abzuwehren. Es war mucksmäuschenstill.
Sie drehte sich um und sah, dass Valentin noch immer auf dem Boden lag. Er schien wirklich am Ende zu sein. Kopfschüttelnd ging sie in die Küche, schenkte Schnaps in ein Wasserglas und reichte es ihm mit den Worten: „Hier, damit du wieder auf die Füße kommst.“
Valentin hob den Kopf, rappelte sich auf die Knie und stürzte die braune Flüssigkeit mit einem Schluck hinunter. Dann stand er unsicher auf und blickte zu Annemarie. Sie sah müde aus und hatte große Tränensäcke unter den Augen.
„Glotz mich nicht so an, ich hab dich nicht eingeladen“, schnauzte sie ihn wütend an.
Valentin hob beschwichtigend die Hände, erwiderte kein Wort und wankte ins Bad. Als er auf der Toilette saß, legte er den Kopf auf die Arme, und seine Augen wurden feucht. Er schnäuzte sich ins Toilettenpapier und erhob sich schwerfällig. Dann drehte er den Wasserhahn auf und griff nach der Seife, um den Dreck abzuwaschen. Dabei fiel sein Blick in den Spiegel. Entsetzt von seinem eigenen Anblick schloss er für einen Moment die Augen. Morgen früh musste er sich unbedingt rasieren, damit er auf der Straße nicht wie Rasputin herumlief. Müde schlurfte er zu Annemarie zurück, die in der Küche am Tisch saß.
„Ich mach keinen Ärger, will nur eine Nacht schlafen und mich morgen früh waschen können. Dann verschwinde ich wieder. Brauchst keine Angst zu haben.“
Sie blickte ihn spöttisch an.
„Seit wann habe ich Angst vor Gespenstern? Du siehst ziemlich kaputt aus. Damit das klar ist, wenn du hier etwas mitgehen lässt, kommst du nicht mehr in meine Wohnung, egal wie schlecht es dir geht.“
Sie zündete sich eine Zigarette an. Er schaute verlegen auf den Boden. Wenn sie so reagierte, musste es schlimm um ihn stehen. Valentin schüttelte den Kopf, als wolle er ihre Vorwürfe nicht hören. Dann zeigte er mit dem Finger nach unten.
„Hast du ein Paar Schuhe für mich? Die Schweine haben mir die Turnschuhe geklaut.“
Sie betrachtete seine nassen Socken und grinste breit.
„Da warst du ja in einem feinen Hotel. Die einzigen Schuhe, die ich dir anbieten könnte, wären ein paar alte Sandalen von mir. Deine Füße sind zu groß.“
Sie stand auf und verschwand in einem kleinen Abstellraum. Valentin kramte in der Zwischenzeit die restlichen Pillen aus seiner Tasche und schluckte sie mit dem Fusel hinunter, der auf dem Tisch stand. Sie kam mit einem Paar alter Latschen in der Hand zurück.
„Hier, die könnten dir passen.“
Valentin schlüpfte hinein und flüsterte: „Danke.“
Sie lachte kurz auf und blickte ihm mit einer Mischung aus Enttäuschung und Erschöpfung ins Gesicht. Dann begann sie leise zu reden:
„Was ist nur aus dir geworden? Hattest große Pläne als du kamst, und jetzt bist du am Ende. Es wäre besser gewesen, du wärst geblieben wo du warst.“
Valentins Gesichtsausdruck verwandelte sich in den eines getretenen Hundes. Er antwortete kaum hörbar:
„Dort, wo ich war, gab es keine Zukunft für mich. Ich war der deutsche Drecksack. Der Nazi, der abhauen sollte. Hier bin ich das Russenschwein, das verschwinden soll. Ich drehe mich im Kreis und bin nirgends richtig.“
„Ach, hör auf zu jammern. Wer sich nicht jeden Tag den Kopf vollballert und schaffen will, der findet im Westen Arbeit.“
Annemarie sah ihn verärgert an und verschränkte die Arme vor ihrer Brust wie ein Schutzschild.
Valentin erwiderte nichts, wischte sich verschämt das Wasser aus den Augen und starrte zu Boden. Es dauerte eine Weile, bis er auf ihre Vorwürfe antworten konnte.
„Was weißt du schon. Meine Eltern sind nach Sibirien verschleppt worden. Die Russen haben sie als Nazis zu Zwangsarbeit verurteilt. Der Vater musste im Bergwerk arbeiten, und meine Mutter verschwand in einem anderen Lager. Es gab weder anständige Unterkünfte noch genug zu essen. Die meisten sind krepiert. Nach vier Jahren Zwangsarbeit kamen sie frei. Aber sie durften das Land nicht verlassen, sondern wurden weiter in Russland festgehalten. Nichts weißt du. Erst als Gorbatschow entschied, dass die Deutschen gehen durften, konnten wir ausreisen.“
Annemarie hob die Hand wie ein Schutzmann auf der Kreuzung und schimpfte ärgerlich:
„Aber du bist doch in Sibirien geboren, bist eigentlich Russe. Du hättest doch mit deiner Frau und dem Kind bleiben können“.
Valentin schüttelte den Kopf und schimpfte sichtlich empört: „Sollte ich meine Eltern allein gehen lassen? Sie waren alt und krank. Wir sind Deutsche.“
„Wie kannst du dich als Deutscher fühlen? Du kannst ja noch nicht einmal richtig Deutsch reden!“, erwiderte sie mit müdem Gesichtsausdruck.
Valentin stierte mit trotzigem Gesichtsausdruck auf seine Hände. Ihm fiel nicht sofort etwas ein.
„In Russland darf man nicht Deutsch reden. Ich fühle mich als überhaupt nichts. In Barnaul war ich kein Russe, sondern ein Außenseiter. Wir mussten den Mund halten, die Partei hatte immer Recht. Ihr im Westen seid verwöhnt. Könnt gut reden und wisst nicht, wie es dort wirklich ist. Nach Sibirien fährt niemand in Urlaub, warum auch? Ihr wisst nichts über das Land.“
Er war bei seiner kleinen Rede in Rage geraten und schenkte sich schnell noch einen Schnaps zur Beruhigung ein.
Annemarie wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte und hielt den Mund.
Valentin redete weiter: „Meine Mutter konnte weder russisch lesen noch schreiben. Sie ging in eine Fabrik arbeiten, damit die Familie etwas zu essen hatte. Da blieb keine Zeit zum Lernen. Ich bin mit einem Kauderwelsch aus Deutsch und Russisch aufgewachsen. Wer in der Schule nicht Russisch sprach, wurde verprügelt. Man wurde ständig für etwas verprügelt. In der Schule und zu Hause natürlich auch. Keine Ahnung hast du.“
Annemarie verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
„Ach, hör auf. Wer hat damals nicht Prügel bekommen? Das war so. Mein Vater hat uns Kinder auch verhauen. Meine Mutter erzählte uns immer, dass er früher anders gewesen wäre, doch das war kein Trost für uns. Sie hätte uns helfen müssen, aber dazu war sie zu feige.“
Ohne darauf zu achten, was Annemarie gesagt hatte, erzählte Valentin seine Geschichte einfach weiter:
„Ich bin weggegangen, weil ich geglaubt habe, in Deutschland wäre es besser.“
Plötzlich hielt er inne und sah sie dabei böse an. Warum verstand sie ihn nicht?
„Ich wollte endlich frei sein und ein besseres Leben haben. Wir waren arm.“
Annemarie war zu müde und wollte nicht an frühere Zeiten erinnert werden. Die waren glücklicherweise vorbei. Doch Valentins Erinnerungen stiegen wie dumpfe Luft hoch, und er stammelte mit schwerer Zunge:
„Ich habe gehofft, hier würde es besser sein. Doch alles ging schief. Die Arbeit, das mit der Wohnung und dann der Ärger mit meiner Frau. Hier im Westen hast du nur Freunde, wenn du Geld hast. In Sibirien waren wir arme deutsche Schweine unter armen russischen Schweinen. Wir mussten zusammenarbeiten und miteinander auskommen. Aber die haben mich wenigstens verstanden. Im Westen versteht mich kein Mensch.“
Er spürte mittlerweile die Schwere des Alkohols, und die Tabletten zeigten ihre Wirkung. Sein Kopf neigte sich immer mehr nach vorn und sank nach einiger Zeit sachte auf den Tisch.
Annemarie stöhnte bei diesem Anblick auf, schenkte sich noch einen Schnaps ein und beobachtete den schlafenden Valentin. Er zog sie runter. Sein ganzes beschissenes Leben zog sie runter. Warum hatte sie die Tür aufgemacht? Sie wusste es selbst nicht. Wusste nur, dass sie manchmal auch so kaputt und am Ende war wie Valentin jetzt. Schwerfällig stand sie auf und versuchte ihn hochzuziehen. Doch der schlafende Mann war schwer wie ein Stein. Sie rüttelte an seiner Schulter, aber er bewegte sich nicht. Er konnte nicht aufstehen, sondern rutschte stattdessen vom Stuhl. Lag auf dem Fußboden wie hingeworfen. Ohne Kraft, die Arme und Beine verdreht, schutzlos, als hätte jemand auf ihn geschossen. Annemarie holte ein Kissen vom Sofa und schob es mit viel Anstrengung unter seinen Kopf. Dann legte sie eine alte Decke über den leblosen Körper, denn in der Nacht würde es kalt werden. Wer weiß, an was er gerade dachte, bestimmt an nichts Gutes. Sollte er schlafen und sich ausruhen, morgen früh würden sie weiterreden. Annemarie löschte das Licht und schlurfte ins Schlafzimmer.
Als sie im Bett lag, konnte sie trotz ihrer Müdigkeit nicht einschlafen. Was hatte sie sich da wieder aufgebürdet? Sie konnte nicht bei Verstand sein. Kam mit ihrem eigenen Leben nicht zurecht und ließ einen Verrückten in ihre Wohnung. Sie drehte sich von der linken auf die rechte Seite und fand keinen Schlaf. Müde kroch sie wieder aus dem Bett und schlurfte in die Küche zurück. Valentin lag noch immer so hilflos auf dem Boden. Annemarie stöhnte auf und schenkte sich nochmals Schnaps nach. Sie wusste, dass es falsch war, aber das Wüten in ihrem Kopf sollte aufhören. Sie schluchzte, und Tränen liefen über ihr Gesicht. Valentin sollte verschwinden und mit ihm all das Schreckliche, das er mit sich herumtrug. Von Sibirien nach Frankfurt und wer weiß wohin.
4. Kapitel
Karoline öffnete das Fenster und schaute in den sonnigen Morgen. Die Bäume standen in saftigem Grün. Der Frühling war für sie ein alljährliches Wunder, das ihr nach dem Tod ihres Mannes die Kraft zum Weiterleben gab. Sie ging zum Tisch zurück, trank den letzten Schluck Kaffee aus und räumte das Geschirr in die Spüle. Ihre Tasche stand fertig gepackt im Flur. Mit einem prüfenden Blick vergewisserte sie sich, dass alle elektrischen Geräte ausgeschaltet waren. Dann trat sie ins Treppenhaus und stieg die Stufen nach unten. Vor den Briefkästen blieb sie stehen und zog die Werbezettel heraus. In diesem Moment ging die Haustür auf, und die neue Mieterin aus dem ersten Stock stand vor ihr.
„Einen recht schönen guten Morgen“, grüßte Karoline freundlich und sah die Frau erwartungsvoll an.
Doch die lief in Eile an ihr vorbei und murmelte kurz: „Guten Morgen“, und war auch schon verschwunden.
Karoline blickte ihr nach und zuckte mit den Schultern. Dann eben nicht. Es war immer das Gleiche. Die neuen Mieter hatten keine Zeit. Sie rannten morgens zur Arbeit und kamen abends todmüde nach Hause. Die Mieten im Frankfurter Westend waren schon immer hoch gewesen, aber mittlerweile konnten sich nur noch wenige eine Wohnung in dieser Gegend leisten. Karoline hatte vor zwei Jahren die Hauswartarbeiten übernommen, um weiter hier wohnen zu können. Nach Friedrichs Tod war das Geld knapp geworden. Die Versicherung teilte ihr damals mit, dass sie die große Witwenrente erhalten würde. Mit dem, was man ihr tatsächlich überwies, konnte sie allerdings nur kleine Sprünge machen. Vierzig Jahre lebte sie nun in dieser Wohnung. Es war undenkbar für sie, auf ihre alten Tage noch einmal umzuziehen. Sie schüttelte traurig den Kopf. Ihr Garten und das Zuhause waren ihre Zuflucht, das einzig Vertraute in einer Welt, die ihr mehr und mehr fremd geworden war.
Sie überquerte in Gedanken versunken die Senckenberg-Anlage. Als sie um halb zehn durch die Leipziger Straße schlenderte, herrschte bereits viel Betrieb. Studenten hasteten an ihr vorbei und Rentner zogen ihre Einkaufswagen hinter sich her. Karoline ging gern hier einkaufen. Im Winter vermisste sie die langen Spaziergänge, besonders seit es Friedrich nicht mehr gab. In fünfzig Jahren Ehe gewöhnt man sich aneinander. Niemand fragte sie nun: „Wie geht’s?“ Stattdessen bekam sie zu hören: „Es geht immer weiter, man gewöhnt sich an das Alleinsein.“
Ihre Bekannte Henriette hatte sie zu Friedrichs Beerdigung begleitet und danach ziemlich nüchtern festgestellt: „Dein Friedrich war ein guter Mann.“
Nach der Trauerfeier tranken sie eine Tasse Kaffee zusammen, aber das war auch schon alles. Karoline fühlte sich in dieser Zeit, als ob alle Lichter ausgegangen wären. Sie würgte die aufsteigenden Tränen hinunter. Bloß nicht heulen, dann wurde es nur noch schlimmer. Die Leipziger Straße war ein Relikt aus glücklicheren Tagen. Die Häuser hatten vieles überdauert und erinnerten Karoline an das Frankfurt der fünfziger Jahre. In den Trümmern wuchsen die Hoffnungen schneller als das Unkraut auf dem Schutt. Jeder hatte Ideen und wollte etwas tun. Davongekommen zu sein machte alle glücklich.
Plötzlich schreckte sie aus ihren Tagträumen auf, da hatte doch jemand nach ihr gerufen?
„Karoline, warte doch, lauf nicht weg!“
Eine dicke Frau eilte atemlos auf sie zu. Als sie näher kam, erkannte Karoline eine frühere Arbeitskollegin. Oje, das würde wieder dauern. Laut sagte sie:
„Hallo, Margarete, was für ein Zufall, wie geht‘s?“





























