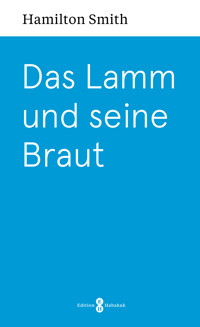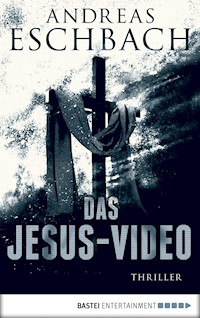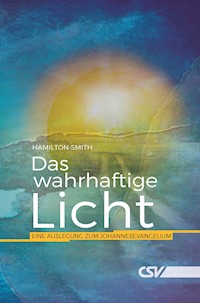
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Christliche Schriftenverbreitung
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Licht ist lebensnotwendig. Licht beeindruckt. Es vermittelt uns etwas von Gottes Größe und Kraft. Aber das physikalische Licht kann nicht Gottes Herz offenbaren und es kann auch nicht das Herz der Menschen offenlegen. Aber genau das tut das göttliche Licht in Jesus Christus: Es scheint in der geistlichen Dunkelheit der Menschheit. Das Johannesevangelium beschreibt die Vortrefflichkeiten des Sohnes Gottes. Im Unterschied zu den drei anderen Evangelisten geht es dabei weniger um das Wirken des Herrn Jesus, sondern mehr um seine Worte. In einer einfachen Sprache – deren Wortschatz nur ungefähr siebenhundert Wörter umfasst – stellt der Heilige Geist in diesem Evangelium die persönliche Herrlichkeit des Sohnes Gottes in den Vordergrund. Mit dieser klar strukturierten Vers-für-Vers-Auslegung ist es Hamilton Smith gelungen, die inhaltsreichen Verse des Johannesevangeliums gut verständlich zu erklären und dem Leser den Sohn Gottes groß zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kapitel 13–17 wurden mit freundlicher Genehmigung des Beröa- Verlages dem Buch „Abschiedsworte des Herrn Jesus“ (Zürich 2014) entnommen. Die restlichen Kapitel dieser Auslegung sind erstmals im Deutschen auf www.soundwords.de erschienen.1. Auflage 2018© by Christliche Schriftenverbreitung, HückeswagenUmschlaggestaltung: ideegrafik, Jürgen BennerSatz und Layout: Christliche SchriftenverbreitungE-Book: Verbreitung christlichen Glaubens e.V.ISBN: 978-3-89287-595-6www.csv-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Das Johannesevangelium ist das Evangelium, das vorrangig die Herrlichkeit des Sohnes Gottes offenbart. Die anderen drei Evangelien stellen andere Herrlichkeiten unseres Herrn vor:
Matthäus zeigt uns Ihn als Messias in seiner
amtlichen Herrlichkeit.
Markus beschreibt Ihn als Diener in der
Herrlichkeit seiner Erniedrigung.
Lukas stellt Ihn als Sohn des Menschen in seiner
moralischen Herrlichkeit
vor.
Johannes aber hat das große Vorrecht, Ihn als Sohn Gottes in seiner persönlichen Herrlichkeit zu beschreiben.
Christus wird uns als eine göttliche Person gezeigt, und das beinhaltet die Offenbarung aller Personen der Gottheit. Das Evangelium beginnt, indem es uns die Herrlichkeiten des Sohnes beschreibt; im weiteren Verlauf werden uns dann das Herz des Vaters (Kap. 1,18), die Hand des Vaters (Kap. 5,17) und das Haus des Vaters (Kap. 14,1–3) offenbart; daran anschließend finden wir eine umfassende Darstellung des Heiligen Geistes.
Außerdem stellt uns dieses Evangelium einen neuen Menschen nach einer völlig neuen Ordnung vor: Der Herr spricht von sich selbst als dem „Sohn des Menschen, der im Himmel ist“ (Kap. 3,13), dem Sohn des Menschen, „der aus dem Himmel herabkommt“ (Kap. 6,33.50) und dem Sohn des Menschen, der „dahin auffahren wird, wo er zuvor war“ (Kap. 6,62). Christus wird uns hier also von zwei Seiten gezeigt: Er ist der eingeborene Sohn, der den Vater offenbart – und als Sohn des Menschen stellt Er den Menschen einer neuen Ordnung vor: ein Mensch, der auf der Erde wandelt und im Himmel wohnt.
Um diese unterschiedlichen Herrlichkeiten Christi herauszustellen, verwendet Johannes verschiedene Bilder:
In Johannes 2 ist Christus
der Tempel,
in dem die Herrlichkeit Gottes wohnt;
in Johannes 6 ist Er
das wahre Brot,
das aus dem Himmel gegeben wird, um den Hunger der Menschen zu stillen;
in Johannes 8 und 9 ist Er
das Licht
der Welt, das die Menschen aus der Dunkelheit herausführt;
in Johannes 10 ist Er
der Hirte,
der seine Schafe aus dem alten jüdischen Schafhof herausbringt und in einer neuen (christlichen) Herde zusammenführt;
in Johannes 11 ist Er
die Auferstehung und das Leben,
um Menschen vom Tod zu erretten;
in Johannes 12 ist Er
das Weizenkorn,
das stirbt, damit eine Saat aufgehen kann, die Ihm gleich ist;
in Johannes 15 ist Er
der wahre Weinstock,
damit seine Jünger Frucht für den Vater hervorbringen.
Dieses Evangelium hat somit die großartige Absicht, uns die Herrlichkeit des Sohnes Gottes als eine göttliche Person vorzustellen. Damit ist klar, warum es in diesem Evangelium kein Geschlechtsregister gibt und weder die Geburt noch die frühen Jahre des Herrn beschrieben werden. Diese Einzelheiten, obwohl sie für den Glauben kostbar und wichtig sind, passen nicht in ein Evangelium, das die Herrlichkeit seiner Person als Sohn Gottes vorstellt. Als göttliche Person steht Er hier über jedem Geschlechtsregister; im Markusevangelium dagegen nimmt Er als Diener einen so niedrigen Platz ein, dass ein Geschlechtsregister dort ebenfalls nicht notwendig ist.
Wir erfahren im Johannesevangelium, dass das Wort Fleisch wurde – doch nicht mit dem Ziel, Christus mit dieser Erde oder dem Volk Israel in Verbindung zu bringen. Der Schreiber hat nicht die Absicht, zu zeigen, dass sich die Verheißungen des Alten Testaments erfüllen; es wird auch nicht vorausgesagt, dass in der Zukunft ein Königreich errichtet werden wird; noch belehrt es über die gegenwärtige Gestalt dieses Königreichs. Nichts davon! Diese Wahrheiten sind an ihrem Platz notwendig und wichtig – doch sie reichen bei weitem nicht an das großartige Thema von Johannes heran: Die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Der Sohn Gottes ist gekommen: Er hat die Personen der Gottheit, aber auch einen neuen Menschen offenbart – und so die alte jüdische
Ordnung beiseitegesetzt und das Christentum eingeführt. Dieses Evangelium zeigt uns deshalb von Anfang an, dass sowohl das Volk Israel als auch die Welt als Ganzes in ihrer Verantwortung gescheitert sind; sie stehen unter Gericht und werden beiseitegesetzt, damit das Christentum eingeführt werden kann. Darüber hinaus wird das Christentum hier nach den Gedanken Gottes beschrieben – und nicht nach dem Verfall, wie er zum Zeitpunkt der Abfassung bereits eingetreten war. Denn Johannes hat sein Evangelium wahrscheinlich erst geschrieben, als der von dem Apostel Paulus vorhergesagte Verfall bereits im christlichen Bekenntnis Einzug gehalten hatte. Dieses Evangelium erhebt uns also über die Welt und lenkt uns weg vom Judentum wie auch von der verderbten Christenheit. Hier sollen wir den Segen kennenlernen, den Gott mit dem Christentum verbindet und der sich allein auf die Person des Sohnes Gottes gründet.
Ein Christentum, das Christus als Grundlage hat, muss zwangsläufig auch das Wesen Christi haben, denn „wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen“ (1. Kor 15,48). Kapitel für Kapitel sehen wir deshalb, wie die alte Ordnung beiseitegesetzt und etwas völlig Neues eingeführt wird:
In Johannes 1 macht das mosaische Gesetz Platz für die „Gnade und Wahrheit“, die durch Jesus Christus geworden ist;
in Johannes 2 wird der Tempel in Jerusalem durch den Tempel seines Leibes ersetzt;
in Johannes 3 treten an die Stelle von „irdischen Dingen“ die „himmlischen Dinge“;
in Johannes 4 wird das natürliche Wasser aus dem Brunnen von der Quelle des Wassers des Lebens abgelöst;
in Johannes 5 werden der Teich und die heilende Bewegung des Wassers durch die machtvolle Stimme des Sohnes Gottes beiseitegesetzt;
in Johannes 6 macht das natürliche Brot Platz für das wahre Brot aus dem Himmel;
in Johannes 8 und 9 wird die Dunkelheit durch das Licht vertrieben;
in Johannes 10 wird der jüdische Schafhof durch die christliche Herde abgelöst und
in Johannes 11 wird der Tod durch das Leben überwunden.
So sehen wir, wie Stück für Stück Altes vergeht und alles neu wird. Die Ewigkeit löst die Zeit ab – und das Himmlische das Irdische. Wir werden gedanklich in eine Ewigkeit zurückgeführt, als es noch keine Zeit gab; zugleich werden wir mitgenommen, um schon jetzt außerhalb der irdischen Begrenzungen etwas von der Freude des Vaterhauses zu schmecken.
Was für ein Segen, dass wir uns in diesem Evangelium mit göttlichen Personen beschäftigen dürfen, bei denen es kein Versagen gibt, nachdem sich gezeigt hat, dass in den Händen der Menschen alles verloren ist. Wir sehen hier die Absichten Gottes, denen kein Verfall etwas anhaben kann, und wir werden zu Schauplätzen geführt, wo keine Spur menschlichen Versagens jemals zu finden ist.
Beim Lesen dieses Evangeliums kommen wir von Anfang an in Berührung mit ewigen Dingen und himmlischen Schauplätzen und befinden uns in unmittelbarer Gemeinschaft mit göttlichen Personen. Dennoch können wir uns ohne Furcht bewegen, weil diese herrliche Person, der ewige Sohn Gottes, uns so nahe gekommen ist, dass Er neben einer einsamen Sünderin an einem Brunnen Platz nahm und einen seiner Jünger in seinem Schoß ruhen ließ. Er wohnte so wahrhaftig unter uns Menschen, dass Er jemanden um einen Schluck Wasser bat, dass Er sich herabließ, anderen die Füße zu waschen, oder wiederum für andere ein wärmendes Feuer anzündete und sie zu einer Mahlzeit einlud, die Er zubereitet hatte.
Kapitel 1
Das ewige Wort
Johannes 1,1–18
Das große Thema der einleitenden Verse des Johannesevangeliums ist die Herrlichkeit der Person Christi als das ewige Wort. Zuerst werden unsere Gedanken zurück in die Ewigkeit gelenkt, um seine Herrlichkeit als göttliche Person kennenzulernen; wenn es dann um Raum und Zeit geht, wird uns seine Herrlichkeit als Schöpfer vorgestellt; schließlich heißt es, dass das Wort Fleisch wurde, und wir sehen seine Herrlichkeit als ewiger Sohn in Beziehung zu seinem Vater.
Verse 1.2: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott.
Das Evangelium beginnt mit der erhabenen Aussage: „Im Anfang war das Wort“. Ohne Einleitung werden unsere Gedanken direkt zurück in die Ewigkeit gelenkt, bevor die Zeit begann oder die Schöpfung existierte. Wir lernen, dass die herrliche Person, die hier „das Wort“ genannt wird, keinen Anfang hat. Bereits am Anfang von allem, was einen Anfang hat, war das Wort – nicht: begann das Wort. „Im Anfang war das Wort“ ist der Ausdruck dafür, dass das Wort keinen Anfang hat.
Als Erstes erfahren wir also, dass das Wort eine ewige Person ist. Das Wort, diese gepriesene Person, offenbart Gott. Diese Person der Gottheit ist in sich selbst, aber auch durch das, was sie tut und was sie geworden ist, der Ausdruck Gottes und seiner Gedanken.
Weiter heißt es, dass das Wort „bei Gott“ war. Das Wort ist also nicht nur eine ewige Person, sondern auch eine klar unterschiedene, eigenständige Person in der Gottheit. Das Wörtchen „bei“ drückt aber nicht nur Eigenständigkeit aus, sondern deutet auch einen Austausch unter den Personen der Gottheit an. Dann lesen wir: „Das Wort war Gott.“ Schon im ersten Satz erfahren wir, dass das Wort eine ewige Person ist. Das schließt ein, dass es auch eine göttliche Person sein muss. Doch wenn es um die Herrlichkeit dieser Person geht, sind uns keinerlei Schlussfolgerungen überlassen, und seien sie noch so richtig. Deshalb heißt es hier ausdrücklich: „Das Wort war Gott“ – eine göttliche Person.
Schließlich lesen wir: „Dieses war im Anfang bei Gott.“ Das ist keine bloße Wiederholung der bereits erwähnten Tatsache, dass das Wort eine eigenständige Person bei Gott ist. Hier erfahren wir eine weitere Wahrheit: Das Wort war von Ewigkeit her eine Person in der Gottheit. Der Geist Gottes wacht sorgfältig über die Herrlichkeit dieser Person gegenüber solchen, die wohl zugeben würden, dass das Wort eine eigenständige Person ist, zugleich aber behaupten, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem Er eine eigenständige Person geworden ist. Nein, Er war es schon immer!
Wenn der Herr vom Beginn seines Dienstes spricht, verwendet Er den Ausdruck „von Anfang an“ (Kap. 6,64; 15,27), genauso wie Johannes, wenn er vom Beginn des Christentums redet. Doch hier, wo die Rede von dem ist, der keinen Anfang hat, finden wir zweimal den Ausdruck „im Anfang“. Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass es hier heißt: „Das Wort war bei Gott“ – nicht: bei dem Vater. Wort und Gott stehen in einer Beziehung zueinander – wie auch Sohn und Vater. Die Bezeichnung Gott umfasst nicht nur den Vater, sondern auch den Heiligen Geist und den Sohn. Wort und Gott sagen also etwas über das Wesen göttlicher Personen aus – während Vater und Sohn von der Beziehung zwischen göttlichen Personen sprechen. Das große Ziel dieser Verse ist, die Herrlichkeit Christi festzuschreiben: Er ist dem Wesen nach eine göttliche Person.
So beschreibt der Geist Gottes bereits in diesen Anfangsversen in wenigen und zugleich sehr einfachen Worten die Herrlichkeit der Gottheit unseres Herrn. Das Wort ist also: eine ewige Person, eine klar unterschiedene, eigenständige Person in der Gottheit, eine göttliche Person und eine von Ewigkeit her eigenständige Person in der Gottheit.
In diesem Evangelium stehen wunderbare „himmlische Dinge“ vor uns, und sie alle beruhen auf der Grundlage der Herrlichkeit der Person Christi. Die Gottheit des Sohnes infrage zu stellen, untergräbt das Fundament, worauf jeder menschliche Segen beruht. Was auch immer für ausgeklügelte, religiöse Systeme Menschen errichten mögen oder wie sehr sie sich auch zur Ehre des Namens Christi bekennen mögen: Wenn sie nicht auf diesem Fundament bauen, wird ihr Werk keinen Bestand haben.
Vers 3: Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist.
In den ersten beiden Versen wurde die Herrlichkeit des Wortes als eine göttliche Person festgestellt. Nun treten wir aus der Ewigkeit in die Zeit, um die zwei wunderbaren Wege kennenzulernen, in denen Gott durch das Wort kundgemacht wird: durch die Schöpfung (V. 3) und indem das Wort Fleisch wurde (V. 14). Hier heißt es nun: „Alles wurde durch dasselbe“ – durch das Wort. Diese positive Aussage wird durch die folgende Verneinung noch verstärkt: „Ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist“. Alles, was geworden ist, ob groß oder klein, belebt oder unbelebt, geistig oder materiell, ist durch das Wort geworden. Die Personen der Gottheit selbst werden hier automatisch durch die gewählte Formulierung ausgeschlossen: Sie waren – niemals wurden sie! Die Schöpfung zeigt aber nicht nur, dass es einen Schöpfer gibt, sondern auch, wie groß dieser Schöpfer ist. „Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag berichtet es dem anderen, und eine Nacht meldet der anderen die Kunde“ (Ps 19,1.2; vgl. Röm 1,20).
Vers 4: In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.
Vers 3 spricht von dem, was durch das Wort geworden ist; Vers 4 dagegen zeigt uns, was in dem Wort ist: „In ihm war Leben.“ Die erste Aussage spricht von der Beziehung des Wortes zum gesamten geschaffenen Universum, die zweite von der Beziehung zu uns Menschen. Bei dem „Leben“, von dem hier die Rede ist, kann es sich somit nicht um das natürliche Leben in der Schöpfung handeln. Das Wort als der Schöpfer ist zweifellos die Quelle des natürlichen Lebens, durch das Pflanzen und Tiere leben und sich fortpflanzen. Hier aber ist mit „Leben“ göttliches Leben gemeint. Dieses Leben wird das Licht von Menschen, die bereits natürliches Leben haben. Das „Leben“ wird anderen mitgeteilt, doch es wurde niemals dem Wort mitgeteilt, denn „in ihm war Leben“.
Dieses Leben war das Licht der Menschen. Deshalb kann der Herr sagen: „Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben“ (Kap. 8,12). Das natürliche Licht kann den Menschen das Herz Gottes nicht offenbaren, doch das Leben, das in dem Wort ist, offenbart den unsichtbaren Gott in vollkommener Weise.
Auch das Licht des Verstandes kann Gott nicht finden. Nur das Licht des Lebens in dem Wort, das Fleisch wurde, kann Gott kundmachen.
Vers 5: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Doch der Mensch ist gefallen. Wenn das Licht also scheint, dann scheint es hinein in die Finsternis und in die Unkenntnis über Gott. Weiter lesen wir: „Die Finsternis hat es nicht erfasst.“ Geistliche Finsternis bedeutet also nicht nur Unkenntnis oder Abwesenheit von Licht, sondern Widerstand gegen das Licht. Natürliches Licht würde die natürliche Dunkelheit vertreiben, doch solange der Mensch sich selbst überlassen ist, kann das geistliche Licht seine geistliche Finsternis nicht vertreiben. Das Licht des Lebens, das von dem ewigen Wort ausgeht, macht die moralische Unfähigkeit des Menschen deutlich – so wie später die Liebe, die der Herr in seinem Leben gezeigt hat, den Hass der Menschen noch deutlicher zutage treten ließ.
Verse 6–9: Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeugte, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern damit er von dem Lichte zeugte. Das war das wahrhaftige Licht, das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet.
Die Anfangsverse haben uns die Herrlichkeit des Wortes gezeigt: zunächst in Bezug auf Gott, dann in Bezug auf die Schöpfung und zuletzt in Bezug auf den Menschen. Die folgenden Verse zeigen uns nun, wie Gott den Menschen das Licht in dieser Welt vorstellte. Denn Gott gab nicht nur das Licht, sondern Er sandte auch einen Vorläufer, um die Menschen auf das Licht aufmerksam zu machen: Johannes den Täufer. Wir erfahren nichts über Johannes' Beziehung zu den Juden oder zu irdischen Dingen – er ist „von Gott gesandt“ und zeugt von dem, was völlig neu ist: von dem Licht. In den anderen Evangelien bezeugt er dem bußfertigen Volk Israel den König und sein Königreich; hier im Johannesevangelium bezeugt er allen Menschen das Licht.
Doch wenn Gott einen Vorläufer sandte, wachte Er gleichzeitig sorgfältig über die Herrlichkeit Christi. So groß Johannes auch gewesen sein mag – es gab nur einen, der das Licht ist. Johannes war nur eine „brennende und scheinende Lampe“ (Kap. 5,35), doch das Wort ist das Licht, das in die Welt kam, um jeden Menschen zu erleuchten. Dabei leuchtete es in zwei Richtungen: Es stellte den Menschen bloß – und es offenbarte Gott. Der Herr ging „wohltuend und heilend“ umher (Apg 10,38), doch sein eigentlicher Beweggrund war, Gott bekannt zu machen. So machte Er nicht nur blinde Augen wieder sehend, um die Blindheit zu heilen, sondern um die Liebe Gottes zu zeigen, die den Nöten der Menschen begegnet. Licht ist die Offenbarung Gottes in Liebe gemäß der vollen Wahrheit über den Zustand des Menschen und der Heiligkeit Gottes.
Verse 10.11: Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an.
Dann erfahren wir, wie das Licht auf den sich selbst überlassenen Menschen wirkt: „Die Welt kannte ihn nicht“ und „die Seinen (die Juden) nahmen ihn nicht an“. Das Licht offenbart, dass der Mensch nicht nur absolut unempfänglich ist für das, was gut und vollkommen ist, sondern dass er sich sogar dem Einen widersetzt, in dem sich alles Gute kundtut. Auf sich selbst gestellt ist der Mensch in einem hoffnungslosen Zustand.
Verse 12.13: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.
Doch in seiner souveränen Gnade überlässt Gott die Menschen nicht völlig sich selbst. Er wirkt in ihnen und so nehmen einige Christus auf – solche, „die an seinen Namen glauben“. Ihnen gibt Er „das Recht, Kinder Gottes zu werden“. Sie bilden ein neues Geschlecht, allerdings nicht durch natürliche Geburt („aus Geblüt“) oder durch eigene Anstrengungen („aus dem Willen des Fleisches“) oder durch den Willen eines anderen („aus dem Willen des Mannes“), sondern durch das neue Leben, das sie von Gott empfangen.
Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns (und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater) voller Gnade und Wahrheit.
Die ersten dreizehn Verse zeigen uns die Herrlichkeiten der Person Christi: Er ist das Wort; Er ist eine ewige, eigenständige und göttliche Person innerhalb der Gottheit; Er ist der Schöpfer aller Dinge; Er ist der, in dem das Leben ist; Er ist das Licht der Menschen.
In den nächsten Versen erfahren wir nun, wie diese wunderbare Person in diese Welt kam, um den Menschen das Licht des Lebens zu bringen. Der, der „im Anfang“ das Wort war, wurde Fleisch. Wir haben gesehen, wer Er ist und wer Er in der Ewigkeit war. Jetzt wird uns gesagt, was Er in der Zeit wurde. Er wurde nicht das Wort, als er Mensch wurde, nein, Er war es bereits, denn es heißt: „Das Wort wurde Fleisch“.
Dieses gewaltige Ereignis – dass das ewige Wort Mensch wurde – lässt uns wunderbare und gesegnete Folgen erwarten. Drei herausragende Auswirkungen seiner Menschwerdung werden uns in den nächsten Versen vorgestellt:
die Offenbarung der ewigen Beziehungen zwischen den göttlichen Personen (V. 14)
die Haltung Gottes gegenüber dem Menschen (V. 14)
Gott wird in seiner ganzen Fülle bekannt gemacht (V. 18)
Die ewigen Beziehungen zwischen den göttlichen Personen
Nachdem das Wort Fleisch wurde kann der Apostel Johannes sagen: „Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater“. Die Herrlichkeit, die sie anschauten, entsprang nicht der Menschheit, die Er angenommen hatte, sondern seiner Beziehung innerhalb der Gottheit. Seine Herrlichkeit war einzigartig, es war die Herrlichkeit als eingeborener Sohn, einer Beziehung, die Er in Gemeinschaft mit Gott als seinem Vater genoss. Johannes beschreibt und bekräftigt seine Menschheit – und wacht doch gleichzeitig über die Herrlichkeit seiner Person.
Die Haltung Gottes gegenüber dem Menschen
Nachdem wir gelesen haben, dass das Wort Fleisch wurde, erfahren wir sogleich, was Gott im Blick auf den Menschen am Herzen liegt. Der, der Fleisch wurde, wohnte unter uns „voller Gnade und Wahrheit“. So wie Er kam, so brauchten wir Ihn. Er kam nicht, um etwas von uns zu fordern, wie das Gesetz es tat; Er kam als Geber und wollte denen, die unwürdig waren, in Gnade Segen bringen. Außerdem kam mit Christus die volle Wahrheit. Das, was Mose und die Propheten gesagt hatten, war die Wahrheit – aber es umfasste eben nicht die gesamte Wahrheit. Denn das Gesetz sagt mir, was ich sein soll, aber es sagt mir nicht, was ich bin. Christus dagegen zeigte nicht, wie etwas sein sollte, sondern wie etwas war.... Christus sagt mir die Wahrheit über alles, egal, ob es gut oder böse ist.
Vers 15: Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte: Der nach mir Kommende hat den Vorrang vor mir; denn er war vor mir.
Noch einmal wird das Zeugnis Johannes des Täufers über diese herrliche Person, die im Fleisch kam, erwähnt. Der Eine, der voll Gnade und Wahrheit ist, nimmt in der Zeit einen weitaus höheren Platz ein als Johannes, da Er bereits vor ihm war, nämlich von Ewigkeit her.
Verse 16.17: Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben; die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.
Doch die Fülle der Gnade, die in Christus war, zeigte sich nicht nur, als das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte, sondern wir haben auch „aus seiner Fülle alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade“. Christus war nicht nur auf der Erde, um Gnade in sich selbst darzustellen, sondern auch um Gnade an andere weiterzugeben, und das überreichlich, nämlich: „Gnade um Gnade“. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben: Es forderte vom Menschen, was er sein sollte – gegenüber Gott und gegenüber dem Nächsten. Die Gnade, die durch Jesus Christus gekommen ist, bringt dem Menschen dagegen Segen, und zwar so, wie er es nötig hat. Dabei hält sie die Wahrheit über das, was Gott in seiner unendlichen Heiligkeit ist, vollkommen aufrecht.
Vers 18: Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.
Gott wird in seiner ganzen Fülle bekannt gemacht
„Das Wort wurde Fleisch“ – damit wurde Gott vollständig offenbart. Zur Zeit des Alten Testaments hatte Gott sich nur teilweise kundgemacht: in seinen Kennzeichen als der Allmächtige oder als der Unveränderliche. Doch sein Herz konnte Gott erst offenbaren, als der Sohn kam. Kein Mensch war groß genug, um Gott kundzumachen. Niemand, außer einer göttlichen Person, konnte Ihn als göttliche Person offenbaren, denn „niemand hat Gott jemals gesehen.“ Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat den Vater kundgemacht – so wie Er Ihn kennt. Jemand hat einmal gesagt: „Hier wird nicht nur seine Herrlichkeit auf Erden beschrieben, sondern das, was Er im Schoß des Vaters in der Gottheit war, ist und immer sein wird. So hat Er uns Gott kundgemacht.“
Das dreifache Zeugnis Johannes des Täufers
Johannes 1,19–37
Nach den einleitenden Versen gibt uns das Evangelium jetzt ein bemerkenswertes Zeugnis über Christus: Zunächst an drei aufeinanderfolgenden Tagen durch Johannes den Täufer und dann durch den Herrn selbst, ebenfalls wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen.
Das Zeugnis des ersten Tages, das Johannes erwähnt, ist Inhalt der Verse 19–28. Das Zeugnis des zweiten Tages finden wir in den Versen 29–34, es beginnt mit den Worten: „Am folgenden Tag sieht er“. Das Zeugnis des letzten Tages steht in den Versen 35–37 und wird durch die Worte eingeleitet: „Am folgenden Tag stand Johannes wieder da“.
Das Zeugnis Johannes des Täufers, wie es uns im Johannesevangelium gezeigt wird, steht in einem bemerkenswerten Gegensatz zu seinem Zeugnis in den Berichten von Matthäus und Lukas. In diesen beiden Evangelien legt Johannes sein Zeugnis ab in der Gegenwart von Sündern, im Johannesevangelium dagegen in der Gegenwart des Sohnes Gottes. Bei Matthäus und Lukas spricht er als Prophet zu der Volksmenge, um ihr Gewissen zu erreichen und Menschen von ihren Sünden zu überführen; hier aber, in der Gegenwart einer göttlichen Person, spricht er als Anbeter. Bescheiden und mit einfachen Worten redet er von dem, dessen Sandalenriemen er nicht würdig ist, zu lösen. Bei Matthäus und Lukas bedrückt ihn die Schuld des Volkes; hier aber ist er von der Herrlichkeit Christi erfüllt. Christus ist für Johannes alles in allem; er selbst ist nur eine Stimme, die schon bald wieder verstummen wird.
Am ersten Tag ist das Ziel seines Dienstes, sich selbst zu verbergen und Christus groß zu machen. Das Thema des zweiten Tages ist die Herrlichkeit der Person Christi und die Größe seines Werkes, das der Not der Welt begegnet. Am letzten Tag seines Dienstes stellt er die Person Christi vor, wie sie das Herz eines Gläubigen erfüllt.
Der erste Tag des Zeugnisses durch Johannes den Täufer
Johannes 1,19–28
An diesem ersten Tag tritt Johannes in den Hintergrund. Er möchte Christus als den neuen Sammelpunkt seines Volkes vorstellen. Er will das Volk um Christus versammeln und so tauft er, um die Gläubigen von dem verderbten religiösen System jener Tage zu trennen. Schließlich wird deutlich, dass Christus von der religiösen Welt abgelehnt wird.
Verse 19–21: Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, damit sie ihn fragen sollten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und siefragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sagt: Ich bin es nicht. -Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein.
Alle diese Wahrheiten kommen in dem Gespräch zwischen Johannes und den Vertretern der Juden ans Licht. Die Priester und Leviten, die von Jerusalem gesandt sind, stellen ihm die Frage: „Wer bist du?“ Erfüllt von Christus entgegnet er: „Ich bin nicht der Christus.“ Das ist eine bemerkenswerte Antwort, denn in der Frage ging es ja gar nicht um Christus. Es ist, als ob Johannes sagt: „Ihr seid zwar zu mir gekommen, aber ich bin nicht der, den ihr braucht. Ich bin nicht der Christus.“ Als treuer Zeuge weist er auf Christus hin und tritt selbst zurück. Je mehr er gezwungen wird, über sich selbst zu sprechen, desto kürzer werden seine Antworten. Sie fragen ihn: „Bist du Elia?“, er antwortet: „Ich bin es nicht“; sie fragen: „Bist du der Prophet?“, er antwortet mit einem einzigen Wort: „Nein“. Johannes tritt zurück, damit Christus hervortreten kann.
Verse 22.23: Sie sprachen nun zu ihm: Wer bist du? – damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach: Ich bin die „Stimme eines Rufenden in der Wüste: Macht gerade den Weg des Herrn“, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat.
Auf die Frage: „Wer bist du?“ entgegnet er, dass er nur eine „Stimme“ sei. Er ist nicht Elia, den Maleachi erwähnt; er ist auch nicht der Prophet, den Mose verheißt; er ist nur die Stimme, von der Jesaja gesprochen hat. Johannes lehnt es ab, den Platz als Sammelpunkt für das Volk Gottes einzunehmen, und er lehnt es ab, einen Namen anzunehmen, um sich selbst groß zu machen. Er will einfach nur eine Stimme sein, die dem Wort Gottes gehorsam ist und die von Jesus spricht. Und wo wird seine Stimme gehört? In einer Welt, in der es für Gott nichts gibt, und inmitten eines Volkes, das ohne Gottesfurcht ist.
Verse 24.25: Und sie waren abgesandt von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist noch Elia noch der Prophet?
Johannes will keinesfalls Menschen um sich scharen. Doch warum tauft er dann? Die Pharisäer wissen genau, dass die Taufe von Tod und somit von Trennung spricht, und nichts trennt so wie der Tod. Johannes tauft und will auf diese Weise Menschen von dem alten System trennen, damit sie dann an etwas völlig Neuem teilhaben können. Als die Pharisäer erkennen, dass Johannes es ablehnt, selbst Anführer oder Sammelpunkt zu werden, wollen sie wissen, wer das neue „Zentrum“ sein könnte.
Verse 26–28: Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser; mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir Kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.
Johannes antwortet: „Ich taufe mit Wasser“, das heißt: Wer sich um Christus versammeln will, muss sich von dem verderbten religiösen System dieser Zeit trennen. Dabei wird deutlich, dass diese Absonderung zwingend notwendig ist. Doch die religiösen Juden wissen Christus nicht zu würdigen: Er steht mitten unter ihnen – und ist ihnen doch unbekannt. Er ist nicht nur der Welt unbekannt, sondern auch den Priestern und Leviten aus Jerusalem. Doch dieser Unbekannte ist so groß, dass Johannes sagen kann, dass er nicht würdig sei, „ihm den Riemen seiner Sandale zu lösen“. Aber Christus ist nicht nur unbekannt, sondern Er befindet sich auch an einem Platz außerhalb, nämlich „jenseits des Jordan“. So wird in diesem Evangelium Christus von Anfang an als der vorgestellt, der vom Volk verworfen ist und der sich außerhalb an einem Ort der Schmach aufhält.
Daran hat sich bis heute nichts geändert: So wie Christus von der religiösen Masse des Volkes in den letzten Tagen des Judentums behandelt wurde, so wird Er auch heute von den religiösen Bekennern in den letzten Tagen der Christenheit behandelt. Einzelnen ist Er kostbar – doch den laxen religiösen Bekennern ist Er noch immer unbekannt. Noch immer steht Er außerhalb der verderbten religiösen Systeme, und noch immer ist Er der Verworfene. Das ist traurig, keine Frage, aber es braucht uns nicht zu überraschen, denn wir sind vorgewarnt: In der letzten Phase der Christenheit wird Christus draußen stehen, vor der Tür eines laxen christlichen Bekenntnisses (Off 3,20).
Der zweite Tag des Zeugnisses durch Johannes den Täufer
Johannes 1,29–34
Am ersten Tag bereitet Johannes also den Weg für den Herrn, indem Er sich selbst verbirgt, damit die Menschen sich allein auf Christus konzentrieren. Am zweiten Tag nun legt er ein noch schöneres Zeugnis ab von der Herrlichkeit der Person und des Werkes Christi: Christus ist das Lamm Gottes und der Sohn Gottes. Als das Lamm Gottes nimmt Er die Sünde der Welt weg und als Sohn Gottes tauft Er mit Heiligem Geist.
Vers 29: Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!
Johannes beginnt sein Zeugnis an diesem Tag mit den Worten: „Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!“ Das stellt uns zwei Seiten des Werkes Christi vor: Erstens ist Er als das Lamm Gottes das Opfer für die Sünde geworden, indem Er am Kreuz zur Sünde gemacht wurde; zweitens wird Er zu einem zukünftigen Zeitpunkt die Sünde aus der Welt wegnehmen.
Das Lamm steht in Verbindung mit dem Opfer am Kreuz; „Lamm Gottes“ spricht dabei von einem Opfer, das Gott gibt – im Gegensatz zu den von Menschen dargebrachten Opfern im Alten Testament. Das Ergebnis dieses großen Opfers wird sein, dass jegliche Spur von Sünde aus der Welt beseitigt wird. Die Worte „das die Sünde der Welt wegnimmt“ sprechen davon, was der Herr Jesus in der Zukunft tun wird als Resultat seines Werkes, das Er als Lamm Gottes in der Vergangenheit am Kreuz vollbracht hat.
Sünde ist Gesetzlosigkeit, das heißt, der Mensch handelt nach seinem eigenen Willen, ohne an Gott zu denken oder Ihn zu fürchten. Das ganze Elend der Welt hat seinen Ursprung in dem eigenwilligen Handeln des Menschen in einer Welt voller Sünde. Einmal wird der Herr jede Spur von Sünde wegnehmen, indem Er Gott alles unterwerfen wird. Aber auch schon heute wird ein Gläubiger von der Macht der Sünde erlöst, wenn er sich Gott unterwirft. Unser alter Mensch ist ja mit Christus gekreuzigt, deshalb halten wir uns der Sünde für tot, „Gott aber lebend in Christus Jesus“ (Römer 6,11). Der von der Sünde beherrschte Mensch denkt nicht an Gott – der Gläubige dagegen hat Gott vor Augen. Er möchte nach dem Willen und Wohlgefallen Gottes leben, und wenn er es tut, herrscht die Sünde nicht mehr über ihn. Das gilt heute für jeden Gläubigen, der sich selbst der Sünde für tot hält, „Gott aber lebend in Christus Jesus“. Im Tausendjährigen Reich wird es in einem gewissen Maß für die Welt gelten, wenn die Menschen sich Gott und seiner Herrschaft in Gerechtigkeit unterwerfen. Doch im absoluten Sinn wird es im neuen Himmel und auf der neuen Erde sein, in denen Gerechtigkeit wohnen wird. Dann wird Gott bei den Menschen wohnen – und sein Wille wird in allem und von jedem ausgeführt werden. Keine Spur von Sünde wird diesen Ort trüben. Gott wird alles in allem sein. Das wird die Antwort Gottes auf das Gebet des Herrn sein: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde“ (Mt 6,10).
Vers 30: Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der den Vorrang vor mir hat, denn er war vor mir.
Johannes zeugt nun von der Größe des Einen, der als das Lamm Gottes dieses Werk vollbringen wird. In der Zeit kam Christus nach Johannes – doch Er steht weit über ihm, denn Er existierte bereits vor Johannes in der Ewigkeit.
Vers 31: Und ich kannte ihn nicht; aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser taufend.
Johannes ist darauf bedacht, zu zeigen, woher seine Kenntnis über die Herrlichkeit der Person Christi kommt: nämlich nicht aus natürlichen Wissensquellen. Das, was er weiß, hat er nicht auf natürlichem Weg aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen erfahren. Zweimal sagt er deshalb: „Ich kannte ihn nicht.“ Dann beantwortet er die von den Pharisäern gestellte Frage: „Warum taufst du?“ Er erklärt, dass er die alte Ordnung durch die Taufe zu Ende bringt, damit Christus für Israel als der große Mittelpunkt einer neuen Ordnung sichtbar wird. Sich selbst will Johannes nicht zeigen. Er tritt zurück, damit Christus offenbar wird.
Vers 32: Und Johannes zeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederfahren, und er blieb auf ihm.
Johannes gibt Christus einen einzigartigen Platz: Er berichtet, wie der Geist wie eine Taube auf Ihn herniederstieg und auf Ihm blieb. Für den Heiligen Geist war es nichts Neues, zu einem bestimmten Zweck auf einen Menschen herabzukommen. Gänzlich neu war jedoch, dass Er dort blieb. Jesus empfängt den Heiligen Geist als Mensch aufgrund seiner Vollkommenheit – und als Sohn aufgrund seiner Beziehung zum Vater. Wir dagegen sind versiegelt, weil wir Söhne sind durch den Glauben an Ihn durch die Erlösung, die Er vollbracht hat.
Verse 33.34: Und ich kannte ihn nicht; aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihm bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist.
Der Geist stieg „wie eine Taube“ auf Christus herab – und nicht wie die Zungen aus Feuer am Pfingsttag. Feuer bedeutet Erprobung und beinhaltet Selbstgericht. Wenn der Geist auf uns kommt, prüft er alles, was aus dem Fleisch ist und verurteilt es. Johannes kommt nun auf den zweiten Teil des Werkes Christi zu sprechen: „der mit Heiligem Geist tauft.“ Christus wirkt nicht nur die Erlösung als das Lamm Gottes - als Sohn Gottes gibt Er auch den Heiligen Geist, damit die Erlösten als Söhne in den Segen eingeführt werden. Johannes bezeugt also, dass der, der den Heiligen Geist gibt, der Sohn Gottes ist. Wer, außer einer göttlichen Person selbst, kann eine göttliche Person senden? Was Johannes hier über den Herrn sagt, geht weit über das hinaus, was Christus in Bezug auf Israel ist. Als das Lamm Gottes vollbringt Er ein Werk, das für die ganze Welt ist und das eine weltweite Auswirkung hat; als das Lamm ist Er im Buch der Offenbarung auch der Mittelpunkt aller Erlösten. Dann aber kann sich auch die Taufe mit dem Geist nicht allein auf Israel beschränken, denn es heißt: „Es wird geschehen ... spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch“ (Apg 2,17). Als Sohn Gottes hat Christus auch Gewalt über alle Nationen (Ps 2).
Der dritte Tag des Zeugnisses durch Johannes den Täufer
Johannes 1,35–37
Verse 35–37: Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern, und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes! Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach.
Am ersten Tag seines Dienstes tritt Johannes, der größte unter den „von Frauen Geborenen“ (Mt 11,11), in der Gegenwart Jesu in den Hintergrund. Am zweiten Tag zeugt er von der Herrlichkeit der Person Christi und der Größe seines Werkes. Am letzten Tag schließlich spricht er weder von dem Werk Christi (V. 29) noch von seiner Gabe (V. 33), sondern einzig und allein von der Person Christi. Er sieht Ihn und ruft aus: „Siehe, das Lamm Gottes!“ Vielleicht ist dieser Ausruf nicht so sehr ein Zeugnis für andere, sondern mehr die Bewunderung eines Herzens, das von der Schönheit Christi erfüllt ist. Johannes hat an diesem Tag Jesus betrachtet – und da kommt dieser wunderbare Ausspruch über seine Lippen. Nicht, weil er von Ihm in den Propheten gelesen oder weil er es von anderen gehört hat, nein, wir lesen: „Hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes!“
Auch uns täte es gut, in der Hetze und Eile des täglichen Lebens einmal eine Weile still zu stehen und auf Jesus zu sehen, „der da wandelte“. Wir würden gestärkt werden durch die Gnade und Würde, die Güte, Freundlichkeit, Schönheit, Milde, Heiligkeit und Liebe, die jeden Schritt seines Lebens in einer dunklen Welt voll Sünde und Kummer kennzeichnete. Dann wären unsere Herzen voll und wir würden auch andere auf die Schönheit der Person aufmerksam machen, an der alles lieblich ist. Wir würden, wie damals Johannes, ausrufen: „Siehe, das Lamm Gottes!“
Ein solcher Dienst, ein solcher Ausruf zeigt Wirkung. Man sieht es hier an den zwei Jüngern, die Johannes reden hören, dann aber Jesus nachfolgen. Offensichtlich hatten sie schon an den beiden Tagen vorher Johannes zugehört, doch ohne Reaktion. Am dritten Tag ist Johannes so von Christus erfüllt, dass sein Dienst Herzen erreicht, die Christus nötig haben.
Was ist die Folge, wenn wir betrachten, wie Jesus hier umherging? Wir werden erkennen, dass Er uns liebt. Seine Liebe wird unsere Liebe wecken und uns zu Ihm ziehen: Wir werden Ihm nachfolgen. Doch sind wir nicht oft damit zufrieden, durch das Werk Christi errettet und mit dem Geist versiegelt zu sein – ohne dass wir Christus entschieden nachfolgen? Ihm nachzufolgen bedeutet mehr als an Ihn zu glauben! Glauben gehört dazu, denn wer nachfolgt, muss glauben. Doch nicht jeder, der glaubt, folgt auch nach! Nachfolgen heißt, dass Christus groß vor unserem Herzen steht – dass Er der Eine ist, der unser Leben leitet und lenkt. Oft fehlt uns in der Nachfolge die Entschiedenheit. Ist das nicht die geheime Ursache für die geringen Fortschritte, die wir in unserem geistlichen Leben machen? Macht das nicht den Unterschied aus zwischen echter Hingabe und Halbherzigkeit?
Der dreifache Dienst Christi
Johannes 1,38–2,11
Christus ist das Thema jedes wahren Dienstes. Das Ziel eines Dienstes ist erreicht, wenn die Zuhörer dem Herrn entschieden nachfolgen. Wenn hier also die beiden Jünger in einer solchen Liebe zu Christus hingezogen werden, dass es sie drängt, Ihm nachzufolgen, dann ist das Ziel des Dienstes von Johannes erreicht.
Indem Johannes sein Zeugnis beendet, beginnt Christus seinen Dienst. Diese historische Reihenfolge von damals ist heute die geistliche Reihenfolge im Leben eines Gläubigen. Zunächst wird er durch einen Diener des Herrn zu Christus hingezogen – und dann wird er Ihn selbst und seinen wunderbaren Dienst der Liebe erfahren.
Wie bei Johannes so wird uns auch der Dienst des Herrn an drei aufeinanderfolgenden Tagen vorgestellt: Den Dienst des ersten Tages finden wir in den Versen 38–42; der Dienst des zweiten Tages beginnt in Vers 43 mit den Worten „Am folgenden Tag“ und geht bis zum Ende des Kapitels; den Dienst des dritten Tages finden wir in den ersten 11 Versen von Kapitel 2, die mit den Worten beginnen: „Und am dritten Tag“.
Der erste Tag des Dienstes Christi
Johannes 1,38–42
Der Dienst am ersten Tag zeigt uns auf wunderbare Weise bildhaft, wie Christus während des christlichen Zeitalters sein Volk um sich schart. Dass eine lebende Person der Mittelpunkt des Zusammenkommens für das Volk Gottes sein sollte, war etwas völlig Neues. Um diesen Dienst der Liebe richtig zu verstehen, müssen wir uns bewusst machen, dass diese herrliche Person, die die Zuneigung der beiden Jünger hervorgerufen hat, sodass sie Christus folgen, draußen steht: Die Welt kennt Ihn nicht und das religiöse Fleisch verwirft Ihn (V. 10.11.26.28). Bis dahin war Jerusalem mit seinem Tempel das Zentrum der religiösen Aktivitäten des bekennenden Volkes Gottes gewesen. Im Judentum war der Sammelpunkt ein geografischer Ort – im Christentum dagegen ist es eine Person. Und diese Person ist ein Verworfener an einem Ort der Schmach! Wenn wir uns also um Ihn versammeln wollen, müssen wir wie die beiden Jünger bereit sein, zu Ihm hinauszugehen, „außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend“ (Heb 13,13).
Doch leider ist die bekennende Christenheit größtenteils zum jüdischen System zurückgekehrt und hat prächtige Gebäude ins Zentrum ihres religiösen Lebens gerückt. Weil man nicht erkennt, dass Christus von der Welt verworfen worden ist, bemüht man sich, Christus zur Welt zurückzubringen – anstatt zu Christus hinauszugehen. Menschen haben ihre eigene Ehre gesucht und haben seinen heiligen Namen für ihre Organisationen, Systeme und Länder missbraucht, doch Christus befindet sich außerhalb aller weltlichen Systeme und Religionen. Wer sich dagegen in Liebe zu Ihm hingezogen fühlt, muss den Platz der Schmach „außerhalb des Lagers“ akzeptieren. Nur dort ist Christus zu finden – die Quelle, die für alles genügt.
So ist diese Szene „jenseits des Jordan“ ein schönes Bild davon, was Christentum nach den Gedanken Gottes ist: eine Gemeinschaft von Gläubigen, die sowohl aus dem Judentum als auch aus der sozialen, politischen und religiösen Welt herausgenommen wurden und die sich nun um eine Person versammeln, die ihnen alles bedeutet. Doch diese Leute kommen nicht nur zusammen, weil sie ein gemeinsames Interesse an seinem Werk haben – sie versammeln sich um eine Person, die lebt und die eine Anziehungskraft auf ihre Herzen ausübt. Wenn wir also die Wirksamkeit des Werkes Christi persönlich erfahren haben, den Heiligen Geist besitzen und unsere Zukunft somit sicher ist – dann könnten wir zu Recht fragen: Wie können wir auf unserem Weg zum Himmel, der durch diese Welt mit all ihren Versuchungen führt, bewahrt bleiben? Darauf gibt es nur eine Antwort: Wir bleiben nur bewahrt, wenn wir uns zu einer lebendigen Person hin versammeln, die ein Herz voll Liebe und alle Macht in ihrer Hand hat und die alle Weisheit für die Seinen bereithält. Der lebende Christus ist die Lösung für alle unsere Schwierigkeiten! Wir werden unseren Weg durch das Dunkel der Welt nur finden, wenn wir Ihm folgen und nahe bei Ihm bleiben, denn ohne Ihn können wir nichts tun. So lesen wir von diesen zwei Jüngern, dass sie Jesus nachfolgen und bei Ihm bleiben (V. 37–39). Später gibt der Herr diesen Worten eine geistliche Bedeutung, wenn Er zu seinen Jüngern sagt: „Bleibt in mir“, und: „Folge du mir nach“ (Kap. 15,4; 21,22).
Verse 38.39: Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi (was übersetzt heißt: Lehrer), wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht! Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde.
Sie haben von Christus gehört, haben auf den gesehen, der da wandelt, werden zu Ihm hingezogen und folgen Ihm nach. Nun sehen wir das große Interesse, das der Herr an diesen Jüngern hat. Wir lesen: „Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen“. Wie damals nimmt Er auch heute Notiz von denen, die Ihm nachfolgen.
Der Herr prüft diese zwei Jünger, indem er fragt: „Was sucht ihr?“ Wenn wir heute, wie die Jünger damals, den Platz außerhalb der weltlichen Religionssysteme aufsuchen, dann erleben wir, dass unsere Beweggründe in ähnlicher Weise herausgefordert und geprüft werden. Lässt der Herr nicht oft Schwierigkeiten unter uns zu, damit wir uns einmal fragen: Warum sind wir da, wo wir sind? Haben wir diesen Platz vielleicht nur aufgesucht, um dem Bösen der religiösen Systeme zu entfliehen? Oder suchen wir mehr „Licht“ und eine bessere Belehrung? Oder sind wir nur an diesem Ort, weil unsere Eltern vielleicht auch schon diesen Weg gegangen sind? Wenn das der Fall ist, sollten wir unsere Motive überprüfen! Denn wenn wir aus falschen oder gemischten Beweggründen gehandelt haben, besteht die Gefahr, dass wir auf unserem Weg ermüden und den Platz der Schmach aufgeben.
In dem Fall der beiden Jünger bringt die „Testfrage“ des Herrn ihre Gegenfrage und damit ihre wahren Beweggründe hervor: „Rabbi, wo hältst du dich auf?“ Sie haben den Platz „draußen“ nicht nur aufgesucht, um der Verderbtheit des Judentums zu entfliehen oder für sich selbst einen Vorteil daraus zu ziehen. Sie wollen nur bei dem sein, der ihre Zuneigung hat und zu dem sie sich hingezogen fühlen. Der Grund liegt also nicht bei ihnen, sondern bei Ihm! Sie wollen den kennenlernen, zu dem sie hingezogen worden sind. Deshalb fragen sie: „Wo hältst du dich auf?“ Auch heute kann man Menschen nicht wirklich kennenlernen, wenn man sie nur gelegentlich trifft oder sich hin und wieder mit ihnen austauscht. Um sie kennenzulernen, muss man sie zu Hause besuchen. Wenn wir also Christus näherkommen möchten, müssen wir uns bemühen, Ihn dort zu erleben, wo Er zu Hause ist, wo auch der Vater ist. Darum heißt es: „Sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes“ (Kol 3,1). Und wo können wir einen tieferen Einblick in himmlische Dinge bekommen als dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind mit Ihm selbst in der Mitte? – Ein solches Verlangen zu stillen, freut den Herrn. Es ist so, wie jemand einmal gesagt hat: „Wir können so viel von Christus haben, wie wir wollen.“
Der Herr antwortet den Jüngern und sagt: „Kommt und seht!“, und wir lesen: „Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt.“ In dieser Welt gibt es nichts, was von Christus spricht. Egal, was sich in unseren Häusern auch finden mag – wir können sicher sein, dass dort, wo Er sich aufhält, uns nichts von Ihm ablenkt. Die beiden Jünger sehen, wo Er sich aufhält, sie lernen Ihn dort kennen, wo Er zu Hause ist, und so freuen sie sich, diesen Tag bei Ihm zu bleiben. Die Person, die die Jünger an diesen Ort „draußen“ gezogen hat, ist dieselbe, die sie auch dort hält.
Verse 40–42: Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden (was übersetzt ist: Christus). Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn Jonas; du wirst Kephas heißen (was übersetzt wird: Stein).
Bei Christus zu bleiben hat Folgen: Andere werden für Christus gewonnen. Wir lesen, dass einer der Jünger diesen gesegneten Ort verlässt, um seinen leiblichen Bruder Simon zu suchen. Und als er ihn gefunden hat, „führt er ihn zu Jesus“. Er bringt ihn nicht nur an einen abgelegenen Ort, er bringt ihn auch nicht zu den anderen an diesem Ort – er bringt ihn zu einer Person: „zu Jesus“. Und wie wunderbar wird Simon dort empfangen! Er kommt in die Gegenwart dessen, der seinen Namen und den Namen seines Vaters kennt und der ihm jetzt einen neuen Namen gibt. Dadurch lässt der Herr Simon zum einen wissen, dass er es mit jemandem zu tun hat, der sein Leben von Geburt an kennt. Zum anderen macht Er Simon deutlich, dass Er ihn ganz für sich beansprucht, denn nur ein Eigentümer hat die Autorität und damit das Recht, Namen zu ändern. So lernt Petrus direkt zu Beginn seines geistlichen Werdegangs, dass der Herr sein ganzes sündiges Leben kennt und ihn dennoch für immer als Eigentum besitzen will.
Wie schön und lehrreich ist die Laufbahn dieser Jünger in Verbindung mit Christus am ersten Tag seines Dienstes: Sie
blicken hin auf Jesus, der da wandelt,
hören zu, wenn von Ihm die Rede ist,
folgen Ihm an jenen Ort außerhalb,
sehen, wo Er sich aufhält,
bleiben bei Ihm,
finden andere für Jesus und
bringen sie zu Ihm.
Der zweite Tag des Dienstes Christi
Johannes 1,43–51
Bisher haben wir Christus als Mittel- und Sammelpunkt seiner himmlischen Heiligen (seiner Versammlung) gesehen. Mit dem nächsten Abschnitt wechselt das Bild: Nun ist Christus der Mittelpunkt der irdischen Heiligen (jüdischer Überrest), die sich um ihn scharen.
Verse 43–45: Am folgenden Tag wollte er aufbrechen nach Galiläa, und er findet Philippus; und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach! Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten, Jesus, den Sohn des Joseph, den von Nazareth.
An diesem Tag erfahren wir nichts über den Aufenthaltsort Christi, der – wie wir gesehen haben – das Teil der himmlischen Gläubigen ist. Am Tag vorher verließen zwei Jünger sozusagen die Welt, um sich um Christus zu versammeln, dort wo Er „zu Hause“ ist. An diesem Tag aber geht Christus aus in die Welt und zieht zwei Gläubige zu sich, damit sie mit Ihm in seinem zukünftigen Reich regieren. Das stimmt mit Mose und den Propheten überein: Sie haben nicht über seine himmlischen Herrlichkeiten, sondern sehr häufig über sein irdisches Reich gesprochen. So zeugt Philippus hier von Ihm als dem zukünftigen König, weil Er nach dem Gesetz der Sohn Josephs und somit der rechtmäßige Thronfolger ist.
Verse 46–48: Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh! Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.
Zu Beginn zeigt Nathanael etwas von dem Unglauben, der die Juden damals charakterisierte: „Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?“, fragt er. Darüber hinaus ist Nathanael ein Vertreter des gottesfürchtigen jüdischen Überrestes. Dieser wird nach der Entrückung der Versammlung aus dem ungläubigen Volk gerufen und Buße darüber tun, dass die Juden als Nation Christus verworfen haben. Der Herr sieht in Nathanael jemand, der frei von Trug ist. Er wusste genau, womit Nathanael sich beschäftigte, als er unter dem Feigenbaum saß. Sicherlich hat Nathanael dort vor Gott seine Sünden bekannt, denn nur so wird man frei von Trug.
Vers 49: Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels.
Als Folge davon bekommt Nathanael einen klaren Blick und bezeugt, dass Christus der Sohn Gottes und der König Israels ist. Das sind die beiden Titel, unter denen das jüdische Volk Christus verworfen hat (vgl. Ps 2). Im Hof des Hohenpriesters leugnet das Volk, dass Christus der Sohn Gottes ist und bei Pilatus weist es den Anspruch Christi zurück, der König Israels zu sein.
Verse 50.51: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte: Ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dieses sehen. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.
Der Herr würdigt den Glauben Nathanaels, der letztlich durch die Worte des Herrn hervorgerufen wurde. Nachdem Nathanael Christus im Sinn von Psalm 2 bezeugt hat, verkündet der Herr ihm seine Herrlichkeit als Sohn des Menschen im Sinn von Psalm 8. Als Sohn des Menschen wird Er über alle Werke der Hände Gottes gesetzt werden, und alle Dinge werden Ihm unterworfen sein. Wenn Ihm dann die Erde unterworfen ist, wird sich der Himmel über Ihm öffnen. Dann werden die Engel, die den herrlichen Gegenstand ihres Dienstes in Christus auf der Erde finden, eine Verbindung zwischen Himmel und Erde herstellen.
Der dritte Tag des Dienstes Christi
Johannes 2,1–11
Durch die einleitenden Worte wird die Hochzeit zu Kana eindeutig mit dem vorherigen Kapitel verknüpft. Die Hochzeit findet am „dritten Tag“ statt. Wenn der erste Tag im Vorbild die Zeit der Versammlung darstellt, wenn die Gläubigen sich um den Herrn scharen, und der zweite Tag das Zusammenkommen des gottesfürchtigen jüdischen Überrestes zum Herrn beschreibt, nachdem die Versammlung in den Himmel entrückt worden ist, dann liegt es nahe, dass der dritte Tag von der Wiederherstellung Israels im Tausendjährigen Reich spricht. Die ganze Begebenheit wird ja ein „Zeichen“ genannt (V. 11). Ein Zeichen ist ein natürlicher oder materieller Sachverhalt mit einer geistlichen Bedeutung. Die vorbildliche Bedeutung dieser Hochzeit ist, dass die Beziehungen zwischen dem Herrn und Israel erneuert werden. Hosea schreibt davon, was der Herr einmal von Israel sagen wird: „Ich will dich mir verloben in Ewigkeit, und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit, und ich will dich mir verloben in Treue“ (Hos 2,21.22).
Bezeichnenderweise fügt Hosea hinzu: „Er wird uns nach zwei Tagen wiederbeleben, am dritten Tag uns aufrichten“ (Hos 6,2). Das spricht von der Buße des Volkes, die zu Israels Wiederherstellung in Gerechtigkeit führt. Diese
Wiederherstellung wird das Ergebnis einer moralischen Reinigung sein, die durch die Buße hervorgerufen wird. Ein Bild davon haben wir in den leeren Wasserkrügen, die für die Reinigung vorgesehen waren und nun gefüllt werden. Wenn der Heiligkeit Gottes entsprochen worden ist, kann der Wein der Freude für Israel hervorströmen.
Kapitel 2
Einleitung
Wenn wir das Johannesevangelium lesen, müssen wir uns bewusst machen, dass hier die jüdische und irdische Segensordnung beiseitegesetzt wird. Etwas völlig Neues wird eingeführt, etwas, das himmlisch und ewig ist. In dieser neuen Segensordnung, dem Christentum, werden uns die Personen der Gottheit offenbart. Doch das Neue konnte nicht kommen, bevor nicht das Wort Fleisch geworden war. Denn nur eine göttliche Person war in der Lage, die Personen der Gottheit zu offenbaren und uns mit den Gedanken Gottes bekannt zu machen.
Im Christentum gründet sich alles auf die Person des Sohnes Gottes. Deshalb beginnt dieses Evangelium auch damit, uns die Herrlichkeit dieser Person zu zeigen. Er, der Sohn, ist die Grundlage für jeden bleibenden Segen, den der Mensch erfährt – aber auch dafür, dass Gott verherrlicht wird. Bevor wir jedoch aus der Offenbarung himmlischer Dinge Nutzen ziehen können, muss uns erst einmal bewusst werden, dass der gefallene Mensch in einem hoffnungslosen Zustand und völlig verdorben ist.
Das zweite Kapitel deckt auf, wer und wie der Mensch ist, und zwar unter vier Gesichtspunkten:
Der Wein geht zur Neige – der Mensch kann sein eigenes Glück in natürlichen und rechtmäßigen Dingen nicht festhalten (V. 1–11).
Der Tempel ist verdorben – der Mensch ist nicht in der Lage, den Gottesdienst, den Gott auf der Erde zum Segen angeordnet hat, richtig auszuüben (V. 13–17).
Christus wird verworfen – der Mensch kann auch die Güte Gottes nicht wertschätzen, obwohl Gott selbst auf die Erde hinabsteigt, um voller Gnade und Wahrheit unter den Menschen zu wohnen (V. 18–22).
Die rein menschliche Vernunft weiß Christus nicht angemessen wertzuschätzen. Selbst wenn der Mensch in Bezug auf Ihn die richtigen Rückschlüsse zieht, bleibt er doch fern von Gott. Es gibt in dem gefallenen Menschen nichts, woran Gott anknüpfen kann (V. 23–25).
Das Kapitel zeigt uns also die Verdorbenheit des Menschen – aber es entfaltet uns auch die Herrlichkeit Christi. Christus bringt wahres Glück, beschäftigt sich mit dem Bösen, überwindet die Macht des Todes und zieht die Menschen zu sich hin.
Das Hochzeitsfest
Johannes 2,1–11
Verse 1–11: